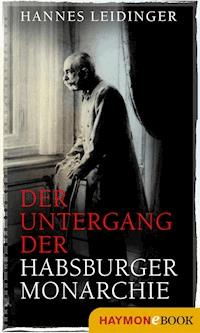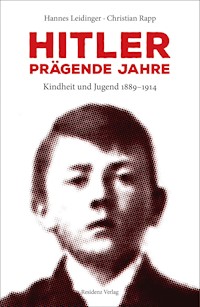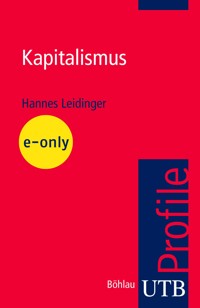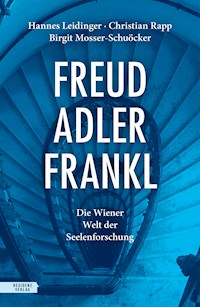Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Was ist heute von der Habsburger-Monarchie, die 1918 endete, noch übrig? "Lang lebe der Kaiser!" – ein Imperium zerfällt, die Erinnerung bleibt Als im November 1918 der Erste Weltkrieg endet, beginnt der schleichende Tod einer der mächtigsten Dynastien Europas. Obwohl das Reich der Habsburger zerbricht, Grenzen neu gezogen werden und die Republik in Österreich ausgerufen wird, lebt die Monarchie weiter in den Herzen derer, die sich ihr zugehörig fühlten. Zentraler Ort für die Beantwortung dieser Fragen ist die "Kaiserstadt" Bad Ischl im Salzkammergut. Sie ist nicht nur Zentrum des k.u.k.-Mythos und der romantisierenden Verklärung, sondern erinnert an fatale Entscheidungen; entschied sich doch Franz Joseph I. ebenda für den Griff zu den Waffen und damit für den Beginn des Ersten Weltkriegs. Wie ging die Geschichte des k.u.k.-Doppelstaates und den Entwicklungen nach 1918, die im Grunde bis heute andauern, weiter? Wie betrachten wir das habsburgische Erbe? Wie steht es um seine Relevanz, nicht nur für Österreich, sondern für ganz Europa? Die totgeglaubten Habsburger erwachen in Text und Bild zu neuem Leben Der österreichische Historiker Hannes Leidinger, ein Experte auf diesem Forschungsgebiet, beschäftigt sich unter anderem mit der Beantwortung dieser Fragen. Diese Auseinandersetzung, angereichert durch Beiträge hochkarätiger Wissenschaftler*innen und ergänzt durch ausdrucksstarke Illustrationen von Lenz Mosbacher, beschäftigt sich mit der Suche nach Hinweisen, mit dem Dechiffrieren einzelner Indizien, die beweisen: Die Monarchie ist Geschichte, doch ihre Macht hallt nach – bis heute. Die Publikation dient als Portal, als Eintritt in die Welt der Habsburger lange nach dem Einläuten der Republik. Gleichzeitig ist sie Ausstellung to go, als Verlängerung der in Bad Ischl, der damaligen "Kaiserstadt" des k.u.k.-Doppelstaates, 2024 stattfindenden Ausstellung "k(ritisch) und k(ontrovers)".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 279
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Dämmerstimmung
Hannes Leidinger/Lenz Mosbacher
Theatralischer könnte es nicht sein. In den nebeligen Regentagen des Novembers entschwindet mit der absterbenden Natur die alte politische Ordnung. Zuerst ist es der betagte Monarch, der im spätherbstlichen Schönbrunn für immer die Augen schließt. Dann, gerade einmal zwei Jahre später, verlässt sein Nachfolger die barocke Schlossanlage. Das Dunkel der Nacht umhüllt den letzten Kaiser und die kleine Schar seiner Getreuen. Im Dämmerzustand der Hoffnung auf Wiederkehr treten sie aus der Herrschaftsgeschichte Europas aus.
Der Moment stellt eine tiefgreifende Zäsur dar: durch das Ende des Ersten Weltkrieges und durch das plötzliche Verschwinden bislang scheinbar ewig bestehender Imperien. Der Bruch ist für den alten Kontinent so groß wie für Österreich, das für sich selbst eine neue Definition sucht.
Dabei konnten die Untertanen des verblichenen k.u.k. Doppelstaates nicht völlig überrascht sein von den einschneidenden Veränderungen. Das untergegangene Reich stand immer wieder vor dem Aus, erlebte regelmäßig existenzielle Krisen, empfand sein Weiterbestehen nur zu oft als Provisorium und Prekariat.
Zugleich schien der „Alte Mann an der Donau“ Siechtum und Zähigkeit gleichermaßen zu verkörpern. Das fragile und vielgestaltige Gemeinwesen verfügte trotz aller Widrigkeiten über beachtliche Kräfte des Zusammenhalts. Sie relativierten die scharfe Zeitgrenze von 1918. Der Doppeladler hatte sich Lebensenergien bewahrt, das Reich lebte weiter: in den Köpfen und Herzen, in den Empfindungen und Vorlieben, in den Sitten und Normen seiner ehemaligen Bewohner.
Der Abschied verzögerte sich. Im Grunde dauert er bis heute an. Habsburgs schleichender Tod vollzog sich in Etappen, mit Anbindung an die Gegenwart.
Die folgenden Seiten erzählen davon, in Texten und Illustrationen. Begleitet wird die Zeitreise von Manfried Rauchensteiner, der einleitend den entscheidenden Moment, den Ersten Weltkrieg und die Auflösung Österreich-Ungarns, zwischen Kritik und Verklärung ansiedelt.
Abschließend betrachten Verena Moritz, Elisabeth Schweeger und Nadia Rapp-Wimberger das habsburgische Erbe aus heutiger Sicht. Die kritische Annäherung an historische Langzeitwirkungen und unterschiedliche Formen des Gedenkens endet in der Gegenwart, fragt nach der Relevanz – nicht nur für Österreich, sondern für Europa.
Die Kulturhauptstadt Salzkammergut mit der „Kaiserstadt“ Bad Ischl gerät in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Der idyllische Ort ist Zentrum des k.u.k. Mythos, der romantisierenden Verklärung, erinnert aber auch an fatale Entscheidungen. In Bad Ischl entschloss sich Franz Joseph I. im Sommer 1914 für den Waffengang. Er wurde zum „Weltbrand“ und zur „Urkatastrophe“ des 20. Jahrhunderts.
Die Kulturhauptstadt Europas widmet sich dem schwierigen Vermächtnis. Unter anderem vermitteln Informations-Stelen mit Ton- und Bilddokumenten sowie Erzähltexten und Zeichnungen das vielschichtige Geschehen vor und nach 1918. Das Buch bewahrt diese Intervention im öffentlichen Raum: Ein Portal führt in eine virtuelle Ausstellung1 …
Ein Hauch von Joseph Roth
Das Ende der Habsburgermonarchie zwischen Kritik und Verklärung
Manfried Rauchensteiner
„Ich habe es geliebt, dieses Vaterland, das mir erlaubte, ein Patriot und ein Weltbürger zugleich zu sein, ein Österreicher und ein Deutscher unter allen österreichischen Völkern.
Ein grausamer Wille der Geschichte hat mein altes Vaterland, die österreichisch-ungarische Monarchie, zertrümmert.“ So schilderte der aus Brody in Galizien, einem Teil der heutigen Ukraine, stammende Schriftsteller Joseph Roth in einem Begleittext zu seinem Roman „Radetzkymarsch“ seine Gefühlslage bei der Abfassung seines Textes. Es war ein berührender Nachruf auf die Habsburgermonarchie. Nicht der einzige, den Roth geschrieben hat und dabei bemüht war, Stärken und Schwächen eines entschwundenen Reichs sichtbar werden zu lassen. In einem aber irrte er ganz offensichtlich: Es war kein „grausamer Wille der Geschichte“, der den Zerfall der Donaumonarchie herbeigeführt hat, sondern Mutwille, Fehleinschätzungen, Massenpsychose, Siegeszuversicht, militärisches Unvermögen und schließlich der Triumph der Sieger. Ab dem November 1918 gehörte Österreich-Ungarn der Geschichte an. Für den Weg dahin scheint das alte Begriffspaar Triumph und Tragödie zu passen.
Schon lange vor dem Ersten Weltkrieg war die Habsburgermonarchie ein zerbrechliches Gebilde und stellte eine Existenz auf Abruf dar. Der seit 1848 regierende Kaiser Franz Joseph bezeichnete gegenüber dem Schweizer Diplomaten Carl Jacob Burckhardt sein Reich sehr zutreffend als „Anomalie“. Durch ein Bündnis mit dem Deutschen Reich 1879 und vier Jahre später mit Italien hatte es scheinbar an Stabilität gewonnen. Doch es blieb ein Staatswesen, dessen Zeit abgelaufen war. Der endliche Zerfall hatte aber nicht nur seine äußeren und bündnispolitischen Gründe. Der „Wurm“ fraß das Reich von innen auf.
1867 hatte man noch glauben können, dass der sogenannte „Ausgleich“ mit Ungarn die Spannungen zwischen den beiden größten Volksgruppen der Monarchie, den deutschen Österreichern und den Magyaren, dauerhaft beseitigt hätte. Doch der ungarische Wunsch nach Unabhängigkeit konnte nicht beseitigt werden. Außerdem lebten in der Habsburgermonarchie elf Nationalitäten, die rechtlich zwar gleichgestellt waren, aber keinen gleichen Anteil an den staatlichen Einrichtungen hatten und daher von einer selbstbestimmten Zukunft träumten.
Seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert war keine große Reichsreform mehr zu erwarten gewesen. Kaiser Franz Joseph war mit der „Anomalie“ zufrieden. Daher konzentrierten sich Interessen und Hoffnungen mehr und mehr auf den österreichisch-ungarischen Thronfolger, Erzherzog Franz Ferdinand. Der hatte zwar auch nur recht vage Vorstellungen, wie man die Habsburgermonarchie zukunftsfähig machen könnte. Doch so viel war klar: Er war trotz seines martialischen Auftretens kein Kriegstreiber. Vielmehr beabsichtigte er, dem fragilen Reich dadurch Stabilität zu geben, dass er zusammen mit Deutschland und Russland das Dreikaiserbündnis des 19. Jahrhunderts reaktivieren und dann mit der entsprechenden außenpolitischen Absicherung an die Reichsreform gehen, den Dualismus beseitigen und eine Neustrukturierung der Habsburgermonarchie versuchen wollte. Das wäre nicht ohne schwere Konflikte und möglicherweise einen Bürgerkrieg abgegangen. Doch wenn sich Russland gewinnen ließ, konnte der Neubeginn – theoretisch – gelingen. Es sollte anders kommen.
Was dann am 28. Juni 1914 geschah, ist hinlänglich bekannt. Der Doppelmord von Sarajevo änderte alles und wurde in Wien als eine Art Kriegserklärung Serbiens aufgefasst. Nicht zuletzt Kaiser Franz Joseph sah nur mehr die Niederwerfung Serbiens als Lösung der anstehenden innen- wie außenpolitischen Probleme. Am 29. Juli fielen an der Donau die ersten Schüsse. Und wie bei einer Kettenreaktion folgte eine Kriegserklärung der anderen und es traten außer Serbien und Montenegro auch Russland, Großbritannien und Frankreich gegen Österreich-Ungarn und Deutschland in den Krieg ein. Andere Staaten taten es ihnen gleich. Statt wie von den Pazifisten gefordert den Krieg zu bestreiken, sprach man gelegentlich von „Erlösung“ durch den Krieg, denn jetzt musste man nicht mehr verhandeln und um Kompromisse ringen; jetzt ging es um einen Siegfrieden, den Österreich-Ungarn genauso wie seine Verbündeten und Gegner mit Millionenheeren zu erringen suchte.
Anfangs zogen die Soldaten aller kriegführenden Länder mit „grausamer Entschiedenheit“ (Joseph Roth) an die Fronten im Süden, Westen und Osten. Schon wenige Monate später mochte den Staatsführern wohl die Erkenntnis gedämmert haben, dass sich der gedachte mit dem tatsächlichen Krieg nicht vergleichen ließ. Aber niemand wollte den entscheidenden Schritt zurück machen. Am ehesten wäre das vielleicht von Österreich-Ungarn zu erwarten gewesen, denn die k.u.k. Armee war schon nach wenigen Wochen nicht mehr kriegsfähig. Drei Offensiven gegen Serbien waren gescheitert, und den Russen gelang es, die Truppen der Donaumonarchie bis an die Karpaten zurückzudrängen. Die Reaktion darauf bestand aber nicht darin, dass die Suche nach einem Waffenstillstand begonnen hätte, sondern darin, dass in großen Teilen der Habsburgermonarchie das Kriegsrecht ausgeweitet wurde. Vor allem in den nördlichen und östlichen Kronländern zeichnete sich eine Militärdiktatur ab.
An der russischen Front ergaben sich ganze Truppenkörper, doch die Leidensfähigkeit der österreichisch-ungarischen Soldaten, aber auch der Zivilisten im Hinterland überdeckte zunächst noch jegliches Krisensymptom. Der Krieg ging weiter. Die Soldaten schafften es, schwere Rückschläge hinzunehmen. Sie zeigten ebenso Durchhaltevermögen wie die rund 50 Millionen Menschen in der Heimat, die das Ihre dazu beitrugen, die militärische Maschinerie am Laufen zu erhalten. Sie kurbelten die Produktion an Rüstungsgütern so an, dass man mit gutem Grund sagen konnte, Österreich-Ungarn habe seine Gegner zeitweilig niedergerüstet. Mittels Kriegsanleihen wurden die finanziellen Mittel aufgebracht, um die Liquidität zu erhalten. Und wenn es an den Fronten oder im Hinterland kriselte, bat das k.u.k Armeeoberkommando das verbündete Deutschland um Hilfe. Und bekam sie. Im Übrigen hielt die Vision, das Reich könnte nach einem verlorenen Krieg zerfallen, die Völker des Reichs entgegen manchen Erwartungen doch noch zusammen. Es war aber auch der alte Kaiser, der als Symbol einer mehr als sechshundertjährigen Gemeinsamkeit die emotionalen Bindungen festigte.
Als sich im Mai 1915 auch das bis dahin mit Österreich-Ungarn und Deutschland verbündete Italien auf die Seite der Gegner schlug, wurde der Zusammenhalt sogar noch einmal gestärkt. Wie schon vorher Serben und Russen verbanden die Italiener mit der Teilnahme ihres Königreichs am Krieg das Ziel, sich nennenswerte Teile der Donaumonarchie anzueignen. Das sollte mit aller Macht verhindert werden. Doch auch eine neuerliche emotionale Aufwallung hielt nur kurz an, denn der Krieg war schon längst im Inneren der Monarchie angekommen. Ausnahmegesetze schränkten das Leben jedes Einzelnen massiv ein. Die Zensur verhinderte jegliche freie Meinungsäußerung. Drakonische Strafen trafen alle jene, die oft nichts anderes getan hatten, als nicht rechtzeitig zu fliehen. Den Einschränkungen folgte der Hunger.
Eine Million Menschen floh aus dem Osten und Süden der Monarchie ins Innere. Plötzlich waren in der Nähe von kleinen Ortschaften mit 2000 bis 3000 Einwohnern Lager für 40000 Menschen geschaffen worden, die anders aussahen als die Bodenständigen, eine andere Religion hatten, Sprachen verwendeten, die man nicht verstand, denen man zutiefst misstraute, die versorgt werden mussten, die Krankheiten mitbrachten und ihrerseits Opfer von Lagerseuchen wurden. Wann immer sich die Möglichkeit bot, die Geflohenen zurückzuschicken, wurden sie repatriiert. Und wie selbstverständlich wurde immer drängender die Frage gestellt, wieso das Elend noch immer kein Ende hatte.
Das Wort vom Verteidigungskrieg, das gerne gebraucht wurde, hatte sich abgenützt. Und 1916 war Österreich-Ungarn nach einer schweren Niederlage in Russland abermals nicht mehr kriegsfähig. Dazu kam der Kriegseintritt Rumäniens, das sich so wie seinerzeit im Mai 1915 Italien auf die Seite der Alliierten schlug. In dieser kritischen Situation reagierte der mittlerweile 86-jährige österreichische Kaiser in der Weise, dass er in die Bildung einer „Gemeinsamen Obersten Kriegsleitung“ einwilligte und sich, sein Reich sowie seine Land- und Seestreitkräfte der deutschen Führung unterwarf. Damit wurde zwar die Stabilisierung der Front in Russland und die Niederwerfung Rumäniens erreicht, ließen sich auch die Rüstungsanstrengungen noch einmal steigern, doch immer öfter machte das Wort vom „deutschen Krieg“ die Runde und wurde von den Nord- wie Südslawen der Monarchie mit der Frage verknüpft, warum man denn nur mehr für Deutschland Krieg führen und alle Opfer auf sich nehmen sollte. Es gab viele Fragen, auf die sich keine Antworten mehr fanden.
Am 21. November 1916 starb Kaiser Franz Joseph. Sein Nachfolger, Kaiser Karl I., trat die Regierung mit der Vorstellung an, es müsste doch bei einigem guten Willen gelingen, in Friedensgespräche mit den Alliierten einzutreten. Und ein Zweites: Kaiser Karl wollte die deutsche Dominanz abschütteln und die Gemeinsame Oberste Kriegsleitung einschränken. Beide Ziele ließen sich nicht erreichen.
Nach längerem Zögern war der österreichische Kaiser zu einem Verzichtfrieden bereit.
Die Möglichkeit, einen Sonderfrieden zu schließen, wäre aber nur um den Preis eines Bruchs mit Deutschland zu erreichen gewesen. Und diesen Schritt wollte Kaiser Karl nicht tun. Er ließ sich Ende 1917 abermals durch Siege, die mit deutscher Hilfe in Oberitalien errungen wurden, täuschen und hoffte darauf, dass die zentrifugalen Kräfte, die mehr und mehr zu spüren waren und die Völker seines Reichs auseinanderdriften ließen, nicht überhandnehmen würden.
Die innere Loslösung wurde durch eine Note des amerikanischen Präsidenten Wilson weiter angeheizt. Die USA hatten sich am 7. Dezember 1917 den Kriegsgegnern des Habsburgerreichs hinzugesellt. Daher sah sich Wilson berechtigt, in einer 14 Punkte umfassenden Auflistung der amerikanischen Kriegsziele den Nationalitäten der Donaumonarchie die Loslösung aus dem Reichsverband in Aussicht zu stellen. Unter Punkt 10 hieß es: „Den Völkern Österreich-Ungarns, deren Platz unter den Nationen wir geschützt und gesichert zu sehen wünschen, sollte die freieste Gelegenheit zu autonomer Entwicklung zugestanden werden.“ Damit hatten die Amerikaner wie ihre Alliierten deutlich gemacht, welches Kriegsziel ihnen nun vorschwebte: Mitteleuropa sollte sein Zentrum verlieren.
In der Habsburgermonarchie konnte man seit dem Frühjahr 1918 nicht mehr von geordneten Verhältnissen sprechen. Nach zwei gescheiterten Offensiven im Frühjahr 1918 ging es in Österreich wie in Deutschland nur mehr um das Eingeständnis der Niederlage.
Anfang Oktober 1918 begann die Auflösung. Eines der drei einigenden Bande des Reichs, die Armee, war dem Krieg zum Opfer gefallen. Abseits der Front und der militärischen Einrichtungen kam es zu Zusammenrottungen und Tumulten Sonderzahl. Der Hunger beherrschte den Alltag. Die Desertionen stiegen sprunghaft an. Im Frühjahr waren schon rund 30000 Armeeangehörige als sogenannte „grüne Kader“ hinter den Fronten in einer Art Niemandsland untergetaucht. Bald darauf stieg ihre Zahl auf mehrere Hunderttausend. Angesichts dieser Tristesse und der ungeheuren Not rang sich Kaiser Karl zu einem vorletzten entscheidenden Schritt durch. Er erließ ein sogenanntes „Völkermanifest“, mit dem er den Völkern seines Reichs die Gestaltung ihrer Zukunft freistellte. Ungarn erreichte es freilich, dass an dem schon fertiggestellten Manifest noch Änderungen vorgenommen wurden. Alles, was da geschrieben stand, sollte „unbeschadet der Rechte der ungarischen Krone“ geschehen. Der Kaiser nahm’s hin.
Seit das Völkermanifest verkündet worden war, lief eigentlich alles nur mehr auf die Liquidierung der Habsburgermonarchie hinaus. Mitten in die beginnende Auflösung hinein fiel ein letzter alliierter Angriff in Italien, dem eine sich nach 48 Stunden auflösende k.u.k. Armee nichts mehr entgegenzusetzen hatte. Am 1. November überschritt eine österreichische Waffenstillstandsdelegation die Frontlinie südlich von Trient. Zwei Tage später willigte Kaiser Karl in den Abschluss eines Waffenstillstands ein. Doch das Reich, für das er gelten sollte, gab es nicht mehr.
Der Zerfall hätte vielleicht nicht sein müssen, doch das Zusammenwirken von jenen, die in der Unabhängigkeit auch eine Art Reinwaschung von der Schuld am Nichtfunktionieren des Staates und am Krieg sehen wollten, traf sich mit der Absicht der gegnerischen Mächte, die Donaumonarchie zu zertrümmern und sie für etwas zu bestrafen, das ihr wohl nur teilweise anzulasten war.
In den Staaten, die auf dem Boden der österreichisch-ungarischen Monarchie entstanden, gab es die unterschiedlichsten Gefühlslagen. Nord- und Südslawen, aber auch Ungarn hatten ihre Unabhängigkeit erreicht. Die Italiener feierten die Arrondierung ihres Königreichs. Deutsch-Österreich aber, dem von den Siegermächten gemeinsam mit Deutschland die uneingeschränkte Kriegsschuld angelastet wurde, kam mit seiner neuen Existenz letztlich nicht klar und war wie das zugrunde gegangene Reich ein fragiles Gebilde – eine Existenz auf Abruf.
14 Jahre nach dem Krieg schloss Joseph Roth das Vorwort seines Romanes „Radetzkymarsch“ mit einem sehr persönlichen Bekenntnis: „Ich habe die Tugenden und die Vorzüge dieses Vaterlands geliebt, und ich liebe heute, da es verstorben und verloren ist, auch noch seine Fehler und Schwächen. Deren hatte es viele. Es hat sie durch seinen Tod gebüßt.“ Dem war eigentlich nichts hinzuzufügen, doch es schreit geradezu nach einer Begründung.
Stationen des Niedergangs, der Auflösung und der Erinnerung
Beständigkeit auf tönernen Füßen
Ein Flickenteppich im internationalen Vergleich
Der greise Kaiser Franz Joseph stirbt 1916 und hinterlässt ein labiles Reich, das im aussichtslosen Krieg gegen die alliierten Großmächte zerschellt. Zurück bleiben zerstrittene Völker – so oder ähnlich wird der Untergang der Habsburgermonarchie erzählt. Verabsäumte Reformen bis 1914 und gravierende Fehlentscheidungen im Ersten Weltkrieg werden meist als Gründe genannt. Und dennoch liegen die Mechanismen des Niedergangs tiefer in der Geschichte Europas begraben.
Im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit spannte sich ein komplexes Netz an feudalen Machtbereichen und Sonderrechten über den Kontinent. Allmählich schufen die Hausmachtpolitik und der Ausbau von Hof- und Staatsverwaltungen aber eine Grundlage für einheitlichere Gemeinwesen. In vielen Regionen Europas festigte sich zunächst das Königtum oder die Position der Landesfürsten. England und Schottland vereinigten sich Anfang des 18. Jahrhunderts zu einer Realunion mit einem gemeinsamen Parlament. Frankreich empfand sich seit der Aufklärung und der Revolution zunehmend als geeinte „Grande Nation“. Die Gesellschaften der Kerngebiete entwickelten sich zu Aktionsgemeinschaften. Von ihnen gingen wirkmächtige Initiativen zur Entstehung von überseeischen Kolonialreichen aus.
Der moskowitische Herrschaftsbereich zwischen Charkow und dem Ural stellte schon früher einen Zentralraum dar, von dem aus östlich und südlich gelegene Erschließungsgebiete erobert wurden. Über die Revolution von 1917, den Sturz des Zaren und die Gründung der Sowjetunion hinaus bestand damit ein Imperium, um dessen Aufrechterhaltung oder Wiedererrichtung bis heute gekämpft wird. Der Anteil der Russen war dabei maßgebend, vor allem auch deshalb, weil sich etwa viele Ukrainer noch lange mit ihnen verbunden fühlten. Nichtslawische Ethnien hatten im Unterschied dazu klar das Nachsehen.2
Russlands benachbarter Langzeitrivale, das Osmanische Reich, verfügte wiederum über ein Stammgebiet, das „turkmenisch-türkisch“ geprägt war: Schon vor den Gebietsverlusten während der Balkankriege 1912/13 bildeten türkische Mandatare in der Deputiertenkammer von Istanbul die unangefochtene Majorität. Nach 1913 stieg die Zahl der türkischen Abgeordneten weiter, zum Nachteil der übrigen Ethnien.3
Während Italien und Deutschland den Aufbau weitgehend homogener Staaten anstrebten, sah es in der Habsburgermonarchie ganz anders aus. Dort war keines der Völker des Reiches zahlenmäßig begünstigt: Insgesamt stellten die Deutschsprachigen rund ein Viertel der Bevölkerung, die Ungarn knapp 20, die Tschechen 12,5 und die Polen knapp 10 Prozent. In der westlichen Hälfte gehörten zu den „Deutschen“ etwas mehr als 35 Prozent, gefolgt von Tschechen und Polen mit 23 und 16 Prozent.4
Die Erweiterung des Männerwahlrechts machte die ethnische Zusammensetzung sichtbar. Im Wiener Reichsrat genügte es auch für die Deutschsprachigen als stärkste Nationalität nicht für eine Hegemonie. Aus österreichischer Perspektive meinte daher 1908 Maximilian Wladimir Freiherr von Beck in seiner Funktion als k.k. Ministerpräsident: „Uns hat die Vorsehung ein Problem auf den Weg gegeben, wie keinem anderen Staate Europas. 8 Nationalitäten, 17 Länder, 20 parlamentarische Körperschaften, 27 parlamentarische Parteien, […] verschiedene Weltanschauungen, ein kompliziertes Verhältnis zu Ungarn, die durch beiläufig achteinhalb Breiten- und etwa ebenso viele Längengrade gegebenen Kulturdistanzen – alles das auf einen Punkt zu vereinigen, aus alldem eine Resultierende zu ziehen, das ist notwendig, um in Österreich zu regieren!“5
Den zentraleuropäischen Raum mit seinen begrenzten imperialen Expansionsmöglichkeiten kennzeichneten überdies weit zurückreichende, hochmittelalterliche Staatstraditionen. Königtum und adelige Ständevertretung waren in Polen, Böhmen und den „Nebenländern des heiligen Wenzel“ ebenso wie in Ungarn, Kroatien und Serbien prägende Elemente der Herrschafts- und Landesidentität. Sie standen den absolutistischen, gegenreformatorischen und zentralistischen Ambitionen des „allerhöchsten Erzhauses“ im Wege.
Widerstand und Konflikte im Donauraum waren somit nicht allein auf die Demokratisierung und den Nationalismus vor 1914 zurückzuführen. Die beobachtbaren Gegensätze rührten vielmehr seit Langem von einer fragilen Allianz zwischen den unterschiedlichen, auf Eigenständigkeit achtenden habsburgischen Ländern her. Es ging um diese Brüchigkeit des Reichsgefüges in seinem innersten Wesen, und nicht – wie etwa vielfach im Fall Russlands, Englands und Frankreichs – um meist weit entfernte und noch erschließbare Außen- oder Erweiterungszonen. Die habsburgische „Union von verschiedenen (Stände-)Staaten“ blieb bei allen Bemühungen um eine einheitliche Monarchia Austriaca ein heterogenes Machtkonglomerat ohne festen Reichskern.
Existenzgefährdung
Ein latenter Überlebenskampf kennzeichnete die weitere Entwicklung der lose verknüpften Ländersammlung. Die Gewissheit, dass das habsburgische Erzhaus in der männlichen Linie erlöschen würde, stellte Anfang des 18. Jahrhunderts eine harte Bewährungsprobe dar. Überschattet vom Verlust der spanischen Machtsphäre, der Monarchia Hispanica, drohte nun auch der Zerfall der Monarchia Austriaca. Sie konnte mit der weiblichen Nachfolge und damit längerfristig mit der Regentschaft Maria Theresias gesichert werden. Basis dieser Entwicklung war das 1713 festgelegte und später Pragmatische Sanktion genannte Staats- und Hausgesetz. Bezeichnenderweise musste es allerdings zwischen 1720 und 1723 von den österreichischen Ländern, Ungarn und Siebenbürgen gesondert akzeptiert werden. Umso nachdrücklicher pochte der Wiener Hof auf die „Unteilbarkeit und Untrennbarkeit“ des Besitzkomplexes.6
Prinz Eugen, der wichtigste Berater und Feldherr von Maria Theresias Vater Karl VI., gab sich dennoch keinen Illusionen hin. Für ihn lag ein „Stück Pergament ohne Wert“ vor. Kurz vor seinem Tod prophezeite der Prinz: „Hunderttausend Mann und ein gefüllter Schatz sind die besten Garantien der Pragmatischen Sanktion.“7
Tatsächlich ließen sich die gewünschten Ziele nur mit Waffengewalt erreichen. Vor allem Preußen wurde im nachfolgenden „Österreichischen Erbfolgekrieg“ zum Hauptfeind. Die k.k. Schutz- und Trutzgemeinschaft zentraleuropäischer Länder blieb äußerlich bestehen. Dahinter verschwanden vorläufig die Bruchlinien. Maria Theresia und ihr Mann Franz Stephan von Lothringen konnten jedoch die Sonderinteressen der vermeintlich untrennbaren Reichsteile nicht überwinden – trotz Reformen zur Stärkung und Vereinheitlichung des Gesamtstaates. Jede stärkere Machtkonzentration in Wien stellte eine existenzielle Gefahr dar. Dabei priorisierte das Herrscherhaus die Einheit des Donauraumes und erkaufte sich beispielsweise Englands Segen für die Pragmatische Sanktion mit dem Verzicht auf koloniale Einflusssphären. Die richtungsweisende Entscheidung gegen weit entfernte Besitzungen und für die Konsolidierung sowie den Zusammenhalt der Stammländer milderte allerdings Joseph II. mit seinem Erneuerungseifer: Bemühungen um den Erwerb von Kolonien stellten dabei noch das geringste Problem dar. Schwerer wogen die Homogenisierungsmaßnahmen in den verschiedenen Erz-, Erb- und Kronländern.8
Neuerliche Krisen machten sich vorrangig in Ungarn bemerkbar. Dort betrachteten alle maßgeblichen Gruppierungen die Dekrete Josephs als Verfassungsbruch. Sein Bruder und Nachfolger Leopold II. befand sich in einer schwierigen Situation. Radikalere Kräfte wandten sich bereits vom bisherigen Herrschergeschlecht ab. Das ging auch dem kompromissbereiten Leopold zu weit. Eine drohende soziale Revolution und der Konflikt mit dem revolutionären Frankreich erleichterten schließlich eine neue, für das Erzhaus günstige Übereinkunft mit dem ungarischen Adel. Vorläufig beruhigte sich die Lage.9
Unkontrollierbar war jedoch das Vordringen der Franzosen. Die Revolutions- und Koalitionskriege verwandelten sich in Kämpfe um imperiale Einflusssphären. Dabei blieb kaum ein Stein auf dem anderen. Das tausendjährige Heilige Römische Reich, an dessen Spitze die Habsburger seit Jahrhunderten standen, wankte angesichts der Wucht des Neu- und Umgestaltungsfurors.10
Franz II., der Leopold als Regent gefolgt war, sah sich zur Gegenaktion gezwungen. Wieder erwies sich der uneinheitliche Länderbesitz des Erzhauses als Problem. Wie, lautete die Frage, sollte man mit jenen Teilen umgehen, die zum lädierten Heiligen Römischen Reich gehörten? Wiens Diplomaten überlegten, die übrigen Gebiete, Ungarn und das im Zuge der Polnischen Teilungen 1772 gewonnene Galizien, unter einer eigenen Krone zusammenzufassen. Der Zerfall der Donaumonarchie wäre damit besiegelt gewesen. Nach reiflicher Abwägung entschied Franz anders: Das 1804 proklamierte Kaisertum brachte ihm nun einen neuen Herrschertitel; die „unabhängigen Staaten“ behielten ihre bisherigen Verfassungen und Vorrechte aber ungeschmälert bei.11
Das betraf den landesfürstlichen Herrschaftskomplex in Zentraleuropa. Das Heilige Römische Reich wurde unterdessen vollends zur leeren Hülle. Die mit Napoleon verbündeten deutschen Fürsten sagten sich von ihm los.12 Wien kapitulierte und verkündete 1806 die Reichsauflösung, ein juristisch durchaus anfechtbarer Entschluss. Schließlich konnte der Kaiser nur abdanken, nicht aber das ganze traditionelle Herrschaftsgefüge „nullifizieren“. Franz und seine Ratgeber sahen darüber jedoch hinweg, für ihren Schritt hatten sie andere Gründe. Vor allem wollten sie verhindern, dass die Reichskrone in fremde Hände gelangte. Der Blick richtete sich auf Bonaparte, der sich zum Kaiser der Franzosen erhoben hatte.13
Das Verschwinden des alten Reiches stellte einen der massivsten Brüche der deutschen Geschichte dar. Aus unzähligen Reaktionen sprach eine tiefe Erschütterung, begleitet von einer romantischen Idealisierung des Mittelalters.14
Frankreichs „Empereur“ schritt darüber unbewegt hinweg. Die politische Landkarte wurde mit Waffengewalt neu gezeichnet. Kaiser Franz fürchtete nun auch um das Weiterbestehen der Donaumonarchie. Nach der Niederlage bei Austerlitz Ende 1805 hatte er bereits empfindliche Gebietsverluste an der Adria und im Westen hinnehmen müssen. Der Versuch, Napoleon in die Schranken zu weisen, endete 1809 mit der Reduzierung der k.k. Herrschaft auf eine mittlere Macht ohne Zugang zum Meer. Der auch wirtschaftlich vor dem Bankrott stehende „Binnenstaat“, in dem zugleich wichtige staatliche Reformvorhaben scheiterten, vermochte nur noch auf der Grundlage einer Allianz zwischen Wien und Paris zu überleben. Sichtbares Band war die Ehe des korsischen Welteroberers mit der Habsburgerin Marie Louise.15
Balance als Rettungsanker
Der erfahrene Diplomat und mehrmalige Außenminister Frankreichs, Charles Maurice de Talleyrand-Périgord, fasste die Lage des Erzhauses pointiert zusammen. „Eure Majestät“, schrieb er Napoleon, „können nun die österreichische Monarchie zerbrechen oder erheben. Einmal zerbrochen, stünde es selbst nicht in der Macht eurer Majestät, die zerstreuten Reste zu sammeln und wieder zu einem einheitlichen Ganzen zusammenzufügen. Nun aber ist die Existenz dieses Ganzen notwendig; sie ist unerläßlich für das zukünftige Heil der zivilisierten Nationen.“ Zwar sei Österreich – im Gegensatz zur französischen „masse homogène“ – ein „composé mal assorti“ verschiedener Staaten, Sprachen, Sitten und Religionen. Aber, gab Talleyrand zu bedenken: „Wenn Österreich im Westen zu schwer geschwächt werde, könnte es die Ungarn nicht mehr unter seinem Szepter halten. Ungarn aber sei zu schwach, um einen eigenen Staat zu bilden, es würde sich Rußland ausliefern. Auch andere Trümmer des Reiches würden sich, wenn man das bereits so schwache Band noch mehr lockerte, das die heterogenen Teile seines Bestandes zusammenhielt, eher an Rußland anschließen.“16
Österreich, wie er sich ausdrückte, in „einer für Europa nützlichen Weise“ zu erhalten, erwies sich als eine zukunftsweisende Sicht, die nicht bloß den Geist des Wiener Kongresses 1814/15, sondern die internationalen Beziehungen der folgenden Dekaden prägte.17
Auf dieser diplomatischen Klaviatur spielte Klemens Wenzel Nepomuk Lothar von Metternich als Außenminister und nachmaliger Haus-, Hof- und Staatskanzler des Habsburgerreiches. Nur zu sehr war ihm bewusst, dass vielleicht London, Paris, Sankt Petersburg und in gewisser Weise auch schon Berlin über größere Aktionsradien verfügten. Wien aber vermochte den eigenen Status nur in Absprache mit anderen, größeren Mächten zu sichern. Angesichts dessen galt die vom Erzhaus mehr schlecht als recht kontrollierte Ländermasse vor allem als „anlehnungsbedürftig“. Das zeigte sich nicht zuletzt im besonderen Bemühen Metternichs um Bündnissysteme, vertragliche Vereinbarungen und feste Prinzipien.18
Das Gleichgewicht der Mächte wurde solcherart zur fixen Idee, obwohl die damit angedeutete Äquivalenz vielfach als Trugbild erachtet wurde.19 Gerade das an Einfluss verlierende Österreich betonte daher, dass es bei diesem System nicht um gleich mächtige Staaten gehe, sondern darum, schwächere durch einflussreichere Mächte zu stützen.20
Diese Überzeugungen enthielten jedoch einige Risiken. Das Verhalten jener, welche die Oberhand gewannen, blieb unberechenbar. Für den Augenblick aber siegte die Pragmatik der Balance nach mehreren kriegerischen Dekaden.21 So konnte sich der Habsburgerstaat unter den maßgeblichen Mächten der Epoche halten. Sein schwerer Reputationsverlust ließ sich nach dem Ende des Heiligen Römischen Reiches nicht mehr kompensieren. Der im Juni 1815 geschaffene Deutsche Bund, der eine Mischform aus Staatenbund und Bundesstaat darstellte, war kein gleichwertiger Ersatz. Als Völkerrechtssubjekt fasste er in Summe 39 souveräne, rechtlich gleichgestellte Fürsten und urbane Magistrate zusammen. Die in Frankfurt residierende Bundesversammlung tagte als ständige Gesandtenkonferenz unter österreichischem Vorsitz. Mehr als eine Geste war das aber nicht.22
Revolution
Politische, soziale und ökonomische Krisen offenbarten die Schwäche der diplomatischen Kompromisse und bedrohten gleichzeitig die innere Ordnung vieler Länder. Im Habsburgerreich mündeten die Spannungen in einen neuen Kampf um die Existenz des Gesamtstaates. Im Frühjahr 1848 richteten sich Aufstände in Norditalien gegen das Erzhaus. Auch anderswo brodelte es. Die Regierung sah sich mit der Frage konfrontiert, wie die Länder der Stephanskrone mit dem österreichischen Kaisertum verbunden bleiben sollten. Die Stellung Kroatiens und Siebenbürgens – beide hatten schon früher in einer autonomen Beziehung zum Rest Ungarns gestanden – war ebenfalls von dieser Problematik betroffen.23
Schlagartig schienen sich die Hoffnungen der bisherigen Oppositionellen sowohl international als auch in der Donaumonarchie zu erfüllen. Die verbliebenen Elemente der Feudalstrukturen verschwanden. Dazu gehörten Grundherrschaft und Patrimonialgerichtsbarkeit, Relikte von Hörigkeit und bisherige Abgaben- und Arbeitspflicht. Die Aufhebung des Untertanenverhältnisses und die Grundentlastung bildeten den Kern der liberalen Wirtschaftsforderungen in einer immer noch weitgehend agrarisch geprägten Gesellschaft. Das soziale Gefüge erfuhr durch politische und rechtliche Zugeständnisse eine Neugestaltung. Mit der Pressefreiheit brach eine Sturzflut an Zeitungen, Zeitschriften und Flugblättern los. In den Druckschriften ging es vorrangig um die Gesamtkonstruktion des zukünftigen Staatsgebäudes – um die von den Fürstenhäusern zugesagten Konstitutionen.24
Auch Deutschland sollte nun ein starkes Fundament anstelle des lockeren Bundes bekommen. Schwarz, Rot und Gold wurden zu Modefarben der Saison. Einst Erkennungsmerkmal antinapoleonischer Freikorps wurden sie von nationalen Turnern und Burschenschaftern in Ehren gehalten. Von Metternich zuvor in die Schranken gewiesen, zogen sie nun mit der deutschen Trikolore durch die Städte. Am Turm des Wiener Stephansdoms wehte sie ebenso wie an den Fenstern der Hofburg. Das habsburgische Kaiserpaar legte selbst Hand an, um „den Dreifarb“ zu befestigen. Die österreichische Regierung folgte dem Trend angesichts der nationalen Unabhängigkeitsbewegungen in Italien und Ungarn sowie der tschechischen Absage an das „teutonische Einigungswerk“. Böhmen hatte zum alten Heiligen Römischen Reich gehört. Seine slawische Bevölkerung kehrte unter ihren Wortführern nun „Germania“ den Rücken zu. Schon vor 1918 war in Wien vom Anschluss an Deutschland die Rede. Auch 1848 wollte sich ein verbleibender Rest der vom Zerfall bedrohten Donaumonarchie mit dem „großen Bruder“ vereinigen.25
In dieser Atmosphäre fanden allgemeine Wahlen statt. Die Mehrheit der männlichen Bevölkerung war aufgerufen, durch Wahlmänner das zukünftige gesamtdeutsche Parlament zu bestimmen. Um die „Nationalversammlung der Deutschen“, die schließlich ab dem 18. Mai 1848 in der Frankfurter Paulskirche tagte, stand es jedoch von Anfang an schlecht. Die Abgeordneten vertraten unterschiedliche Programme. Weder über das Regierungssystem noch über das Territorium des Staates herrschte Einigkeit. Zwar wählte man einen Habsburger, Erzherzog Johann, zum Reichsverweser. Die Ehrenstellung und der Vorrang der Casa de Austria besaßen jedoch in Wirklichkeit nicht einmal mehr Symbolkraft.
Die Herrscherdynastie, an deren Spitze Ende 1848 Franz Joseph I. trat, überwältigte mit Hilfe des Militärs die Reformer und Separatisten. Vom anschlusswilligen Überbleibsel einer untergehenden Donaumonarchie konnte nicht mehr die Rede sein. Die Bewahrung des kaiserlichen Gesamtstaates hatte in den Wiener Ministerien schon bald wieder Priorität.26
Nachdem k.k. Truppen die letzten Aufstände unter anderem in Wien niedergeschlagen hatten, wurde schließlich Ungarn zum Hauptkampfgebiet. Angeführt von dem aus dem Kleinadel stammenden Rechtsanwalt Ludwig Kossuth setzte man hier im April 1849 das Haus Habsburg ab. Die magyarische Elite verfügte jedoch nur über begrenzten Einfluss. Sie pochte auf ihre Privilegien und vertrat kaum das Gros der lokalen Bevölkerung. Noch schwieriger gestaltete sich ihre Beziehung zu den ethnischen Minderheiten. Die Herrscherdynastie profitierte davon. Abgesehen von der immer noch weitverbreiteten Loyalität gegenüber der Krone begünstigten die Uneinigkeiten zwischen den Nationalitäten und den verschiedenen sozialen Gruppen das Erzhaus. Die bestehende internationale Monarchen-Solidarität tat ihr Übriges. Das Zarenreich stellte sich den bedrängten Habsburgern zur Seite – im August 1849 kapitulierten die Reste der magyarischen Truppen.27
Als der Wiener Hof wieder fester im Sattel saß, übten die k.k. Sicherheitskräfte Vergeltung an den „Rebellen“. Der Racheakt vollzog sich im Namen der Restauration, der Wiederherstellung der früheren Ordnung. Gänzlich inakzeptabel fand man daher auch den Vorschlag der Paulskirche, deutsche und tschechische Gebiete der Habsburger in das zu gründende Deutsche Reich aufzunehmen, ihre anderen Länder aber zu einer davon unabhängigen konstitutionellen Einheit zu vereinen. Eine nur noch durch den Monarchen in Personalunion zusammengehaltene Ländermasse widersprach völlig den Vorstellungen des Erzhauses. Der junge Franz Joseph und sein neuer Ministerpräsident, Fürst Felix zu Schwarzenberg, verstanden die Monarchia Austriaca als festen Block und Garant althergebrachter Fürstenherrschaft.28
Gebietsverluste
Die internationale Entwicklung hingegen deutete bald in eine andere Richtung. Wien verschlechterte seine Position auf dem diplomatischen Parkett. Auslöser war der Krimkrieg, in dessen Verlauf zwischen 1853 und 1856 das expandierende Zarenreich auf das Osmanische Reich, Frankreich und Großbritannien prallte. Die k.k. Regierung hielt dabei die Westmächte auf Distanz, drohte aber Russland sogar mit Krieg. Ohne neue Allianzen zu schmieden, stieß sie bisherige Verbündete vor den Kopf. In Sankt Petersburg sprach man mit Blick auf die Waffenhilfe in den Jahren 1848/49 vom Undank Österreichs.29
Dennoch gab es nach wie vor keine unüberbrückbare Kluft zwischen den Imperien der Habsburger und der Romanows. Russland beklagte allerdings die mangelnde Bereitschaft Franz Josephs, Konflikte durch internationale Vermittlung zu lösen. Der Vorwurf bezog sich insbesondere auf die Auseinandersetzungen in Italien, wo die österreichische Hegemonie 1859 zusammenbrach. Die k.k. Heeresverbände verloren bei Magenta und Solferino gegen vereinte französisch-piemontesische Streitkräfte die Lombardei.30
Bald darauf beschritt Preußen unter seinem Premier Otto von Bismarck den Weg zur Bildung des Deutschen Reiches. Habsburgische Ansprüche standen ihm dabei im Weg. Ausgangspunkt der Zwistigkeiten war nun primär der Streit mit Kopenhagen um den Status und die Zukunft Schleswig-Holsteins. Nach einem kurzen Feldzug von Truppen der Habsburger und der Hohenzollern gegen die unterlegene dänische Armee legte Bismarck Österreich die sprichwörtliche „preußische Schlinge“ um den Hals. Berlin wandte sich von Wien ab, suchte eine Verständigung mit Sankt Petersburg, ließ sich von Paris zumindest Neutralität zusichern und knüpfte ein militärisches Bündnis mit dem jungen italienischen Nationalstaat. Kaiser Franz Joseph geriet in einen Zweifrontenkrieg, nachdem er attraktive Kaufangebote abgelehnt hatte: Sowohl das Apenninenkönigreich als auch Preußen boten gutes Geld für den Erwerb Venetiens, „Welschtirols“ und des gerade besetzten Holstein. Bald musste Österreich die Gebiete zu einem wesentlich höheren Preis abtreten. Denn die Kontrahenten gingen nun auf Kriegskurs.31
Den preußischen Einheiten sowie den kleineren Kontingenten aus mittel- und norddeutschen Ländern stellte sich in dem folgenden, knapp sieben Wochen dauernden Waffengang eine zahlenmäßig überlegene Koalition entgegen. Zum Habsburgerreich hielten neben kleineren Bundesmitgliedern Bayern, Württemberg, Baden, Sachsen, Hannover, Kurhessen und Hessen-Darmstadt. Das klang imposant, erwies sich in der Praxis jedoch als ineffektiv. Die Koordination war vollkommen desolat: Truppen der Wittelsbacher wollten keinen gemeinsamen Operationsplan akzeptieren. Sie blieben eher defensiv, ebenso die Württemberger. Andere Verbündete des Habsburgerreiches schaltete der Gegner währenddessen rasch aus. Wilhelms Truppen, dirigiert von Generalstabschef Helmuth von Moltke, konnten sich hauptsächlich auf die k.k. Streitmacht und einige sächsische Einheiten konzentrieren.32
Am regnerischen Morgen des 3. Juli 1866 begann schließlich eine über 17 Stunden dauernde Entscheidungsschlacht. Zwischen der Festung Königgrätz an der Elbe und dem böhmischen Dorf Sadowa bekämpften sich nahezu gleich starke Armeen erbittert mit jeweils rund 250000 Mann. Etwa 50000 Tote, Verwundete und Gefangene, davon mehr als 40000 aus den Reihen der k.k. Streitkräfte, waren schließlich zu beklagen. An der vollständigen Niederlage der Österreicher bestand kein Zweifel.33
Im Gegensatz zu preußischen Hof- und Militärkreisen wollte Otto von Bismarck allerdings nun das unterlegene Österreich nicht durch allzu harte Forderungen weiter demütigen. Sein Ziel war die vollständige Annexion von Schleswig-Holstein, Hannover, Kurhessen, Nassau und Frankfurt. Vor allem aber zwang er die Donaumonarchie, der Auflösung des Deutschen Bundes und der Schaffung eines Norddeutschen Bundes zuzustimmen. Ihm sollten alle deutschen Gebiete nördlich des Mains angehören.