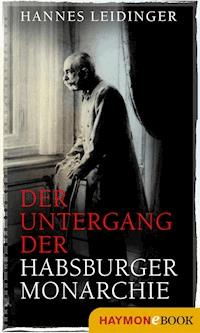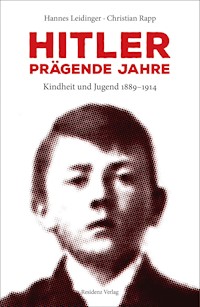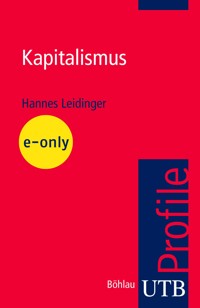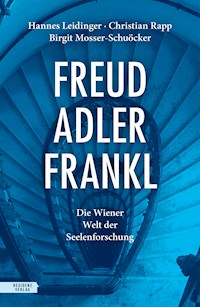Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Residenz
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Verbrechen - Grausamkeiten - Pflichtverletzungen: Die schonungslose Bilanz zur k.u.k. Kriegsführung im Ersten Weltkrieg Neue Erkenntnisse über die düstersten Kapitel des Ersten Weltkriegs: Die Autoren untersuchen die Beschlüsse und Kalkulationen der habsburgischen Entscheidungsträger. Sie zeigen, wie ohne Rücksicht auf die Konsequenzen der Krieg entfesselt wurde. Ihre Arbeit wirft zudem ein erschreckendes Schlaglicht auf Befehlsketten, Feindbilder und die eskalierende Gewalt gegenüber Verdächtigen, Wehrlosen und "verwalteten Massen".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 525
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hannes Leidinger | Verena MoritzKarin Moser | Wolfram Dornik
HABSBURGSSCHMUTZIGER KRIEG
Ermittlungen zur österreichisch-ungarischenKriegsführung 1914–1918
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek:Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in derDeutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografischeDaten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
www.residenzverlag.at
© 2014 Residenz Verlag
im Niederösterreichischen Pressehaus
Druck- und Verlagsgesellschaft mbH
St. Pölten – Salzburg – Wien
Alle Urheber- und Leistungsschutzrechte vorbehalten.
Keine unerlaubte Vervielfältigung!
ISBN eBook:
978-3-7017-4488-6
ISBN Printausgabe:
978-3-7017-3200-5
Den Opfern, die in Vergessenheit geraten sind …
INHALT
Vorbemerkungen (Hannes Leidinger)
Die »Kriegsschuld« (Hannes Leidinger)
Eskalation der Gewalt (Hannes Leidinger)
Gefangenschaft (Verena Moritz)
Ordnung schaffen (Hannes Leidinger)
Besatzungswirklichkeit(en) (Wolfram Dornik)
Welches Recht? (Hannes Leidinger)
Verzerrung und Ausblendung (Hannes Leidinger)
»Visuelles Erinnern« – Der Erste Weltkrieg im österreichischen Film- und Fernsehschaffen (Karin Moser)
Anmerkungen
Quellen- und Literaturverzeichnis
Personenregister
VORBEMERKUNGEN
HISTORISCHES GEDÄCHTNIS IM WANDEL
Seit den 1980er-Jahren hat sich die Erinnerungskultur Österreichs erheblich verändert. Eher am Rande und durch die Fokussierung auf die Verbrechen des Nationalsozialismus beinahe unbemerkt, stellte sich dabei auch die Frage, wie mit weiter zurückliegenden Epochen umzugehen sei. Erste Arbeiten dazu ließen erahnen, dass es sich um eine »erbarmungslose Abrechnung« mit der eigenen Geschichte handeln könnte. Diese sei, wurde angemerkt, wesentlich von zerstörerischen Kräften, von Feindbildern und Gewaltbereitschaft, geprägt.1
Speziell die Donaumonarchie, die oft milde beurteilt und einer breiteren Öffentlichkeit lediglich in Form karikierender Verharmlosungen oder nostalgischer Verkitschungen präsentiert worden war, geriet nun in das Fadenkreuz der Kritiker. Ausländische Beobachter registrieren seither mit mehr oder minder guter Kenntnis der kollektiven Befindlichkeiten in der Alpenrepublik eine Art Wetteifern mit den Deutschen, wenn es darum geht, historische »Schuld« auf sich zu nehmen. Ob dem tatsächlich so ist, sei dahingestellt. Dass eine selbstkritische Auseinandersetzung mit der eigenen Historie, speziell in Bezug auf die Terrorherrschaft des »Dritten Reiches«, auf die »Verbrechen der Wehrmacht« und auf den Holocaust, jedenfalls mehr als notwendig und angebracht war beziehungsweise immer noch ist, gilt heute weitgehend als Konsens, teilweise sogar unter jenen, die mit dieser Art von »Vergangenheitsbewältigung« lange ihre Probleme hatten.2
Darüber hinaus wird jedoch mit dem Hinweis auf langfristige Entwicklungen mindestens seit dem 19. Jahrhundert eine Tendenz erkennbar, wenigstens den »Tod des Doppeladlers« in den Jahren 1914 bis 1918 unter dem Gesichtspunkt einer neuen historischen Schwerpunktsetzung zu betrachten: Hatte man nach dem »braunen Albdruck« und den Gewaltexzessen von 1938 bis 1945 die wiedererstandene Alpenrepublik und ihre Bewohner zu Opfern fremder Aggression stilisiert, so wird vor allem unter jenen, die sich mit zeitgeschichtlichen Fragestellungen näher befassen, ein gegenteiliges Phänomen ausgemacht: der Trend zu einer Selbstbeschreibung, welche zunächst vorrangig in Bezug auf die österreichische Geschichte im 20. Jahrhundert von der Betonung der »Opfergesellschaft« zur Hervorhebung der »Tätergesellschaft« übergeht.3
Die Frage führt zur Gestaltung der »Gedächtnisräume«.4 Auch Wissenschaftler, denen gewiss keine Affinität zu monarchistischen Überzeugungen oder gar zu NS-Positionen vorgeworfen werden kann, geben etwa zu bedenken, dass man mit einer Beseitigung von »verdächtigen« Denkmälern und Straßennamen im Sinne einer »Überschreibung« des Geschehenen Geschichte mitunter eher auslöscht als bewusst macht. Behutsamkeit wird eingefordert: Einzelfälle sind zu prüfen, einer reflexartigen »Umbenennungswut« ist mit detaillierten Untersuchungen und ausgewogenen Erläuterungen zu begegnen.5
GEFAHREN DER VEREINFACHUNG UND POLARISIERUNG
Speziell im Hinblick auf das Habsburgerreich ist in diesem Zusammenhang Sensibilität gefordert – umso mehr, als diesbezüglich mit Recht ein simples Gleichsetzen von Gräueltaten und Rechtsbrüchen im Ersten und Zweiten Weltkrieg, in totalitären Diktaturen und in den militarisierten Gesellschaften der »alten« Monarchien, fraglos unangebracht ist und in der ernst zu nehmenden Fachliteratur auch entsprechend zurückgewiesen wird.6
Freilich geht für manche Kommentatoren aber schon diese vorsichtigere Herangehensweise zu weit. Es handelt sich um nicht mehr und nicht weniger »als um die Dämonisierung und den Versuch, unsere alte k.u.k. Armee mehrheitlich als Kriegstreiber und Kriegsverbrecher zu brandmarken«, heißt es etwa in der vom österreichischen Bundesministerium für Landesverteidigung herausgegebenen Zeitschrift »Truppendienst«. Und weiter: »Beispiele für diese verschiedentlich unglaublichen Taten gibt es genug. Dem ehemaligen Generalstabschef der Monarchie, Conrad von Hötzendorf, wurde sein Ehrengrab auf dem Hietzinger Friedhof aberkannt. Der Vorwurf: mögliche Kriegsverbrechen seiner Soldaten in Serbien und Planung eines Angriffskrieges. In Salzburg wird diskutiert, eine Straße, benannt nach dem ehemaligen Feldmarschall der k.u.k. Armee, Freiherr von Böhm-Ermolli, umzubenennen. Der Vorwurf: seine Rolle als Besatzungschef in der Ukraine. Der ehemalige Direktor der Wiener Staatsoper erhebt die Forderung, am Schluss des weltbekannten Neujahrskonzertes das traditionelle Spielen des Radetzky-Marsches zu unterlassen. Seine Argumente: Radetzky war für Kriegsverbrechen der Österreicher 1848 in Italien verantwortlich! Seit Langem wird darüber diskutiert, die unzähligen Kriegsgräber in den Gemeinden des Landes aufzulassen oder zumindest zu verändern, weil sie der ›Kriegsverherrlichung‹ dienen. Stichwort: Kameradschaftsbünde.«7
Der Auflistung sind noch weitere »Fälle« hinzuzufügen. Liegenschaften in unmittelbarer Verwaltung des Verteidigungsministeriums sollen nicht länger der »Verehrung« von zweifelhaften k.u.k. Feldherren dienen. Das Nachrichtenmagazin »profil« notierte diesbezüglich im Jänner 2014: »In Graz hat sich jetzt« eine »Initiative zur Umbenennung der Conrad-von-Hötzendorf-Straße gebildet. Deren Namensgeber, k.u.k. Generalstabschef Franz Conrad, hatte schon vor dem Sarajevo-Attentat auf einen Präventivschlag gegen Serbien gedrängt«. Nach Kriegsbeginn, heißt es im »profil« weiter, ließ Conrad »in Thalerhof im Süden der Stadt ein Internierungslager für ›russenfreundliche‹ Ruthenen (Ukrainer) und russische Kriegsgefangene anlegen, in dem entsetzliche sanitäre Zustände herrschten«.8
Wenige Wochen später ist auf der Titelseite der »Presse am Sonntag« vom »Wiener Kriegstreiber« Hötzendorf die Rede.9 Durchaus seriöse Darstellungen kratzen indes nicht nur am Image hoher Militärs, die beträchtliche Mitverantwortung des »guten alten Kaisers« an der »Entfesselung eines Weltbrandes« ist zu konstatieren.10 Vor dem Hintergrund einer Debatte, die speziell nach 1918 auch die Auslösung einer bewaffneten Auseinandersetzung kriegs- beziehungsweise völkerrechtlich anzuprangern versucht, drängt sich bisweilen ein hartes Urteil auf: Franz Joseph – ein Kriegsverbrecher. Journalisten und Künstler verfestigen das Bild der k.u.k. Tätergesellschaft: Schwankend zwischen historisch Belegbarem und »kreativen« Erzählungen werden – beispielsweise in dem von Regisseur Andreas Prochaska gedrehten Fernsehfilm »Das Attentat – Sarajevo 1914« – Interpretationsfreiräume geschaffen, um zu zeigen, wie es (auch) gewesen sein könnte. Hinter dem Anschlag auf das österreichisch-ungarische Thronfolgerpaar tauchen solcherart dunkle Gestalten aus den Imperien der Hohenzollern und der Habsburger auf, die den Mord am Kronprinzen Franz Ferdinand nicht mehr nur für »ihren« Schlag gegen Serbien nutzen wollen, sondern den Boden für das Gelingen des Attentates bereiten und als eigentliche Drahtzieher hinter dem Anschlag vom 28. Juni 1914 erscheinen. Kann der historisch weniger informierte Zuseher hier noch zwischen Fiktion, Verschwörungstheorie und wissenschaftlicher Erkenntnis unterscheiden? Vor allem dann, wenn er zugleich in TV-Dokumentationen und Bildbänden mit Fotografien von Hinrichtungen konfrontiert wird, die emotionalisieren, aber auch »verführen«, das Umfeld ausblenden und vor allem bis 1918 mitunter als »Feindpropaganda« Verwendung fanden?11
Qualitativ wie quantitativ besteht gegenüber den Darstellungen und vorgelegten Fakten jedenfalls ein beträchtliches Maß an Skepsis. Einzelne Begebenheiten werden immer wieder genannt, aber selten im Kontext analysiert. Arbeiten über verschiedene Fragestellungen oder Überblicksdarstellungen zur Donaumonarchie im Ersten Weltkrieg befassen sich lediglich unter anderem oder nur am Rande mit der Thematik. Eine gründliche Analyse der betreffenden Archivmaterialien fehlt fast vollständig, umfangreichere Spezialliteratur lässt sich kaum finden. In Bezug auf vermeintliche oder tatsächliche Grausamkeiten beziehungsweise Kriegsverbrechen der Habsburgerarmee im Ersten Weltkrieg existiert bislang nur eine überschaubare Zahl an Veröffentlichungen. Meist sind es zweifellos verdienstvolle Beiträge in Fachzeitschriften und Aufsätze in Sammelbänden, deren Autoren gelegentlich an den bisherigen Befunden einiger weniger interessierter Forscher zweifeln.12 Bis dato werden darüber hinaus diesbezüglich relevante Forschungsfragen vielfach eher gestellt als erschöpfend beantwortet.
NEUE UND ALTE PERSPEKTIVEN
Einen wichtigen Stellenwert bei der Beschäftigung mit der Thematik nehmen Werke ein, die hauptsächlich in der letzten Dekade zur Dynamik und Eskalation von Gewaltformen allgemein und speziell im 20. Jahrhundert, zur Ethnisierung bewaffneter Konflikte, zur Untersuchung von Genoziden generell, zum Völkermord an den Armeniern beziehungsweise zu Gräueltaten während des Ersten Weltkrieges insbesondere in Belgien und auch an der Ostfront Stellung genommen haben.13
An diesen Studien hat sich gleichfalls das vorliegende Buch orientiert, um darauf aufbauend eine quellennahe Darstellung und Analyse bestimmter Fragestellungen zur k.u.k. Kriegsführung zu wagen und mit ihrer Hilfe weder simplifizierenden »Verteufelungen« des »Kriegs der (Ur-)Großväter« noch einer lange Zeit vorherrschenden Verharmlosung oder sogar Glorifizierung insbesondere der »altösterreichischen Wehrmacht« Vorschub zu leisten.14
Dieser Zugang verlangt von den Autorinnen und Autoren freilich auch, die »Verhandlung« zwischen Geschichte und Gegenwart, die von Forschern wiederholt als eigentliche »raison d’être« der Historiographie angesehen wurde und wird, im Auge zu behalten und seinen eigenen Beobachtungsstandort sowie den Blickwinkel seiner Zeitgenossen mitzuberücksichtigen. Demgemäß mag unter Verweis auf den Kommentar in der Zeitschrift »Truppendienst« auch die Frage erlaubt sein, ob speziell jüngere Generationen Österreichs, die – glücklicherweise – lange nach dem »Katastrophenzeitalter« in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in völlig andere gesellschaftliche und politische Verhältnisse geboren wurden, immer noch von »unserer« alten k.u.k. Armee sprechen sollten. Und nicht nur in Österreich, sondern auch im Ausland generell und insbesondere in den Nachbarstaaten, deren Territorien einst teilweise oder zur Gänze zum Habsburgerreich gehörten, darf man wenigstens in bestimmten Kreisen und wohl nicht zuletzt unter jüngeren Wissenschaftlern mit Irritationen rechnen, wenn man etwa auf die Aufforderung stößt, der in »Mode gekommenen« Diskreditierung der »Führung der Monarchie« und dem Bestreben, »heute Stück für Stück« Österreichs Besinnung auf die Geschichte der k.u.k. Armee abzubauen und zu »verleugnen«, »energisch entgegenzutreten«.15
Der Ansatz, »kritische Habsburggeschichte« nicht zum Minenfeld von Polemiken, Vermutungen und übertriebenen Anklagen verkommen zu lassen, schließt freilich gleichermaßen mit ein, gängige Deutungsmuster, Urteile und Erwartungshorizonte zwar nicht rundweg und vor allem unbegründet abzulehnen, aber eben auch zu hinterfragen, vor allem wenn ernsthafte nationale und internationale Forschungsarbeit zum Umdenken rät. Verantwortliche Kreise des österreichischen Bundesheeres – dessen sind sich die Verfasserinnen und Verfasser dieses Buches sicher16 – stehen einer entsprechend kritischen Reflexion der »Traditionspflege« keinesfalls im Wege: Schließlich kann der »Waffenträger« der Republik nicht darauf ausgerichtet sein, einer untergegangenen Welt mit ihren gekrönten Häuptern, Herrscherdynastien, Geburtsrechten, epochenspezifischen Werthaltungen und Entscheidungen sowie mehr oder weniger vorhandenen Standesdünkeln und Prestigevorstellungen »Ehre« zu erweisen. Der fraglos einzufordernde respektvolle Umgang mit der Vergangenheit hat gerade hier – im Bereich von Regierungszuständigkeiten – auf Reibungsflächen mit der Verfassungswirklichkeit und den relevanten gesellschaftlichen Strömungen der Gegenwart sensibel zu reagieren. Zudem sind die Eliten von einst und jetzt an ihren eigenen Maßstäben zu messen. Immerhin trachteten und trachten sie nach Vorrechten, Privilegien, Besitz, Positionen und den damit verbundenen Handlungsspielräumen. Ihr erweiterter Aktionsradius wies und weist sie nach eigenem Verständnis und Auftreten als Entscheidungsträger und Verantwortliche aus. Die Beurteilungskriterien des Historikers sollten nicht zuletzt auch darauf ausgerichtet werden – einmal abgesehen von der demokratiepolitischen Notwendigkeit, Macht zu kontrollieren, Mitsprache zu sichern und demgemäß nach Möglichkeit zu verhindern, dass eine kleine Gruppe von Eingeweihten und »Staatslenkern« über das Schicksal, ja sogar über das Leben und den Tod von Millionen bestimmt.
ZUGÄNGE
Im Wissen um augenblickliche Krisen und blutige Konfrontationen, den Streit in Bezug auf die (globale) Verteilung von Einfluss und Vermögen sowie die Diskussionen über das Eintreten in ein »postdemokratisches« Zeitalter stellt eine entsprechende herrschaftskritische Historiographie anlässlich des hundertjährigen Gedenkens an den Ausbruch des Ersten Weltkrieges folglich ein weiteres Beispiel für die Intervention geschichtswissenschaftlicher Tätigkeiten im »öffentlichen Raum« dar. Das scheint gleichfalls eine »raison d’être« der Historiographie zu sein, ungeachtet ihrer Eigengesetzlichkeiten als autonomer »Denkraum« und Teil wissenschaftlicher Institutionalisierung.17
Hier, ebenso wie in den Debatten über die Zukunft demokratischparlamentarischer Gemeinwesen, macht sich dabei ein sozusagen »systemimmanenter Wertrelativismus« breit, der Ausdruck von begrüßenswerten Liberalisierungstrends ist, aber zudem das Gefühl der Orientierungslosigkeit schafft. Die Geschichtsforschung ist mit ihrer aktuellen Multiperspektivität, mit ihrer Analyse von Identitäts- und Vergangenheitskonstruktionen, mit ihrem Prozess der permanenten Überarbeitungen von Wissens- und Deutungshorizonten und immer wiederkehrenden Auseinandersetzungen mit verschiedenen »turns« hierfür ein gutes Beispiel. Das Unbehagen angesichts ständiger Transformationen, Neuorientierungen und -formulierungen, vornehmlich aber der Glaube an Wahrheit(en) beziehungsweise letztgültige Erkenntnisse oder auch nur ein übermäßiger Optimismus gegenüber »Objektivierungsbemühungen« stellen sich in diesem Zusammenhang jedoch als unbefriedigende und problematische »Antworten« dar.18 Gleichfalls wird nicht immer und ohne Weiteres zu eruieren sein, was gerade unter Historikern als Rück- oder Fortschritt im Forschungsdiskurs gelten darf. Tendenzen sind freilich erkennbar – zum Beispiel in Bezug auf eine wenigstens unterschwellige Abwertung von Nationalhistoriographien gerade in Verbindung mit dem Ersten Weltkrieg. Sie erscheinen mitunter als vermeintlich rückschrittliche Relikte einer sich ebenso vermeintlich gegenüber größeren Zusammenhängen verweigernden Forschung, die sich der Untersuchung von Entwicklungen in einzelnen Ländern zuwendet. Anders formuliert: Wer sich beispielsweise auf die Geschichte Russlands, Deutschlands oder Österreich-Ungarns in den Jahren 1914 bis 1918 konzentriert, muss nicht zwangsläufig einen europäischen oder aber globalen Kontext ausblenden.19 Der eingeforderte »multilaterale Blick«, der sich einer nationalstaatlichen »Nabelschau« entschlägt, ist nicht unbedingt ein Vorzug allein »weltgeschichtlicher Betrachtungsweisen«, die sich im Übrigen der Bausteine unterschiedlicher Nationalhistoriographien bedienen. Gerade in den Diskussionen über die aktuelle Geschichtsschreibung des »Großen Krieges« wird bisweilen postuliert oder aber hervorgehoben, was mehrheitlich ohnehin üblich ist oder sein sollte.20
Die Autorinnen und Autoren dieses Buches, ebenso wie dessen Leserinnen und Leser, sind gefordert, solchen Überlegungen Rechnung zu tragen, umso mehr, als die Forschungsarbeit von Zersplitterungs-, Fragmentierungs- beziehungsweise Spezialisierungstendenzen geprägt ist, bei gleichzeitigen Bemühungen, Untersuchungsfelder zu entgrenzen, Zwischenräume und »Hybriditäten« zu entdecken sowie Verknüpfungen und Wechselwirkungen nicht zuletzt aus transnationaler Perspektive zu begreifen. Für die Untersuchung der Verhaltensweisen österreichischungarischer Truppen im Ersten Weltkrieg sind daher immer wieder allgemeine, »grenzüberschreitende« Trends, Entwicklungsprozesse oder Gesellschaftsmechanismen zu beachten und Vergleiche zu anderen Regionen und Staaten anzustellen. Gleichzeitig setzt sich der Diskurs um unterschiedliche »Realitätsvorstellungen« fort, der sich gegen einen hemdsärmeligen Pragmatismus des Sammelns, Darstellens, Deutens oder Erzählens wendet, aber auch danach fragt, in welchem Ausmaß historische Ereignisse und Kausalitäten nicht erst von den Geschichtsschreibern geschaffen worden sind, sondern bereits unabhängig von Narration und Fiktion existieren.21
Solche Überlegungen sind gerade dann kein akademisches Denkspiel in angeblich weiter Distanz zu den gesellschaftlichen Alltagserfordernissen und -erfahrungen, wenn es um Verantwortungen für Fehlentwicklungen, Normübertretungen beziehungsweise Rechtsbrüche oder gar Verbrechen gegen die Menschlichkeit geht. Hinsichtlich dessen darf auch auf ältere theoretische Erwägungen hingewiesen werden, wie etwa auf die Ausführungen des französischen Historikers Georges Duby, der gerne eingestand, dass das, was er schrieb, »seine« Geschichte war, gewissermaßen als Ausfluss seiner Subjektivität, eines »Traumes«, so Duby weiter, »der allerdings nicht vollkommen frei zusammengestellt« sei, »sondern auf Spuren« beruhe, »materiellen Gegenständen«, Aussagen beziehungsweise Schriften der Zeitzeugen, »Worten, aneinander gereihten Zeichen, Sätzen«.22
EINGRENZUNGEN UND THEMENSCHWERPUNKTE
Geschichtliche Konstruktion ist demgemäß vor allem dann nicht »Erfindung«, wenn sie trotz einer gerade vor beziehungsweise während und ab dem Ersten Weltkrieg verstärkten Infragestellung von Rationalität und Empirie möglichst quellennahe argumentiert und die Forschungsfelder speziell bei der Vielzahl von Dokumenten zu den Geschehnissen von 1914 bis 1918 einschränkt beziehungsweise durch Schwerpunktsetzungen und Fragestellungen entsprechend präzisiert. Die hier präsentierten Dokumente, belegbaren Äußerungen und daraus gezogenen Rückschlüsse sollen dementsprechend – bei fortgesetzter und vertiefter Skepsis – Bewertungsmöglichkeiten schaffen, die anstelle beliebiger Wertungen zumindest Grundlagen für die Revidierung bezogener Standpunkte anbieten. Aufgrund des gewählten Themas und der damit verknüpften Problematik von »Schuld und Verantwortung« scheint dies – es sei noch einmal ausdrücklich betont – umso notwendiger und dringlicher. Die »Beweismittel«, die gesammelt wurden, beziehen sich dabei auf Untersuchungsfelder, die von den Autoren seit längerer Zeit vor allem auch anhand einer Vielzahl von Archivalien behandelt wurden.23
Zugleich bilden Titel und Untertitel ein untrennbares Ganzes. Gemeinsam verweisen sie auf das Bestreben, vorliegende Ermittlungsergebnisse zur genannten Thematik anzubieten und Resultate von Forschungen zu präsentieren, die keineswegs als abgeschlossen zu betrachten sind, sondern weitergeführt werden – von den beteiligten Autorinnen und Autoren, aber auch von vielen anderen Forschern. Nicht die Kriegsführung der Donaumonarchie in ihrer Gesamtheit und unter Einbeziehung aller militärischen und zivilen Maßnahmen wird behandelt, ebenso wenig die Perspektive der Feldherren oder eine Militärgeschichte im »klassischen« Sinn, beispielsweise anhand der Misserfolge österreichisch-ungarischer Truppenverbände seit dem Kriegsausbruch 1914. Dabei könnte die Weltkriegsforschung hierzu viel Anschauungsmaterial liefern: Nicht erst aktuelle Studien heben die Niederlagen und die exorbitanten Verluste der Habsburgerarmee, speziell bei den Anfangsoffensiven und Feldzügen 1914/15, hervor. Hinzu kommen unter anderem kritische Kommentare der Experten in Bezug auf die Zerwürfnisse zwischen den verschiedenen Führungsinstanzen des Habsburgerreiches, auf den schwindenden Einfluss Österreich-Ungarns gegenüber den verbündeten Deutschen sowie auf die letztlich sinnlosen Siege und Eroberungen der Mittelmächte ab 1915 vor dem Hintergrund einer zunehmenden, sich zur Versorgungskatastrophe steigernden Ressourcenknappheit.24
Lediglich am Rande finden Regelverstöße wie die Verwendung verbotener Waffen beziehungsweise Kampfstoffe Erwähnung. Fokussiert werden vielmehr das Verschwimmen der Grenzen zwischen dem Operationsradius der Streitkräfte und den Lebensbereichen der Zivilbevölkerung und somit die Konsequenzen einer nahezu alle Nichtkombattanten miteinbeziehenden Totalisierung und teilweisen Ethnisierung der bewaffneten Auseinandersetzungen. Angesichts dessen geht es um Themen wie die Verstärkung von Feindbildern und die Dynamik von Gewalteskalationen bis hin zu Massenexekutionen, Zwangsdeportationen und -internierungen, um Klein- und Guerillakriege sowie allgemein um die Vorgehensweise der k.u.k. Streitkräfte und diverser Verwaltungsinstanzen Österreich-Ungarns insbesondere am Balkan und an der Ostfront. In den Mittelpunkt der Betrachtungen rücken dabei speziell Serbien, Galizien und die angrenzenden ukrainischen Gebiete beziehungsweise die von der Habsburgerarmee okkupierten Territorien. Aufgrund der Bedeutung des Misstrauens gegenüber vielen eigenen Staatsbürgern, das deren Verhaftung und Unterbringung in diversen Lagern zur Folge hatte, werden außerdem – in Form skizzenhafter Überblickstexte – vergleichbare Entwicklungen im Flüchtlings- und Kriegsgefangenenwesen behandelt.25
Das Verschmelzen von zivilen und militärischen Sphären, das Ineinandergreifen von regulären und irregulären Formen der Gefechte, vom Kräftemessen an der Front und von Aufständen beziehungsweise blutigen Konfrontationen in okkupierten Landstrichen, im Etappenraum oder im Hinterland lassen es schließlich auch angebracht erscheinen, bei der Begriffswahl gewaltgeschichtlicher, kriegs- beziehungsweise völkerrechtlicher Analysen Anleihe zu nehmen. Demgemäß ist von einem »schmutzigen«, die einzelnen Aktionsfelder kaum mehr trennenden und dabei zahlreiche Richtlinien des »Ius in Bello« verletzenden Krieg zu sprechen. Die Bezeichnung »Schmutziger« oder »Dreckiger Krieg« verwies zwar zunächst vor allem auf Menschenrechtsverletzungen staatlicher Organe vornehmlich autoritärer Regime gegenüber vermeintlichen und tatsächlichen inneren Gegnern während des Ost-West-Gegensatzes, speziell in sogenannten »Stellvertreterkonflikten« und »Guerillakämpfen«, bei »Antiterrormaßnahmen« und »verdeckten Operationen« bis zu den 1980er-Jahren. Die Tatsache, dass sich solche Geschehnisse keineswegs allein etwa mit dem Vorgehen von Diktaturen im Kalten Krieg, mit der Existenz massiver illegaler Repressalien in nicht klar definierten Waffengängen oft ungleicher Kontrahenten oder mit »Kampfbegriffen« in journalistischen Veröffentlichungen und Darlegungen von Menschenrechtsverletzungen gleichsetzen lassen, ist dabei aber ebenso zu berücksichtigen. Anwendung findet nämlich der Ausdruck »Schmutziger Krieg« speziell in der Geschichtswissenschaft des angelsächsischen Raumes gleichfalls bei Fehlverhalten liberalerer Herrschaftssysteme und sogar demokratischer Staaten, bei konventionellen militärischen Auseinandersetzungen beziehungsweise generell bei Brutalitäten gegenüber der Zivilbevölkerung zumindest seitens einer der Streitparteien.26
Solche Forschungsperspektiven müssen letztlich im Hinblick auf die Analyse des Ersten Weltkrieges gleichermaßen Beachtung finden wie eine Erweiterung des Untersuchungsfeldes betreffend die Missachtung des Völker- beziehungsweise Kriegsrechtes. In diesem Sinne meint etwa der Schweizer Historiker Daniel Marc Segesser: »Selbst wenn innerhalb der Rechtswissenschaft der Begriff Kriegsverbrechen einheitlich nur für Verstösse gegen das bis dahin kodifizierte oder gewohnheitsrechtlich anerkannte Ius in Bello verwendet würde, so darf sich der Historiker oder die Historikerin nicht durch eine solche Definition einschränken lassen, denn Kriegsverbrechen im engeren wie im weiteren Sinn waren und sind unabhängig von völkerrechtlichen Normen Teil der historischpolitischen Wirklichkeit.«27
ERGÄNZENDE FRAGESTELLUNGEN
Zu beachten sind dabei sowohl unsere heutigen Vorstellungen als auch die Debatten über Regelverstöße, Grausamkeiten und Inhumanität vor dem Ausbruch, während und nach dem Ende des Ersten Weltkrieges – eine Herangehensweise, die es uns überdies ermöglicht, durchaus »modern« anmutende Auseinandersetzungen und Urteile über »Verbrechen gegen die Menschlichkeit« unter anderem schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts ausfindig zu machen. Parallel dazu legt eine solche Perspektive nahe, die Veränderungen der relevanten Diskussionen in Fachkreisen und in einer breiteren Öffentlichkeit mitzuverfolgen.28 So wird etwa hauptsächlich ab 1918 die Auslösung von bewaffneten Konfrontationen gleichfalls als kriegsvölkerrechtliches Vergehen behandelt, weshalb es sich auch in dieser Studie empfahl, speziell am Beispiel der Entscheidungsträger in der Donaumonarchie noch einmal auf die »Kriegsschulddebatte« – trotz ihrer kontraproduktiven Wirkung und der daraus entstehenden nationalistischen, Konflikt fördernden Diskurse speziell in der Zwischenkriegszeit – näher einzugehen, um aus geschichtswissenschaftlicher Sicht bestimmte Schwerpunktsetzungen in den entsprechenden Interpretationen zu prüfen und gegebenenfalls zu revidieren.29
Bei alldem gilt es, »Schuldfragen« in ihrem Kontext zu analysieren und etwa unangebrachte Gleichsetzungen mit den Verbrechen während des Zweiten Weltkrieges beziehungsweise der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft entschieden zurückzuweisen und auch Unterschiede zu Massenverfolgungen beziehungsweise Massentötungen zwischen 1914 und 1918 in anderen Krieg führenden Ländern zu beachten. Ebenso unumgehbar ist es aber, die nachfolgenden Schilderungen über das Verhalten insbesondere der k.u.k. Armee sowohl aus der zeitgenössischen Perspektive als auch aus der Sicht der Nachgeborenen beziehungsweise der Gegenwart als Grausamkeiten, Gräueltaten oder Kriegsverbrechen zu kennzeichnen und vor allem auch den irritierenden Verharmlosungen oder sogar Idealisierungen Österreich-Ungarns zum Teil bis in die letzten Dekaden entgegenzutreten. Dieses Missverhältnis zwischen den oft traumatischen Erlebnissen bis 1918 und vorhandenen Geschichtsklitterungen in den folgenden Epochen veranlasste das Autorenteam auch dazu, in abschließenden Kapiteln zum historischen Gedächtnis der Alpenrepublik Stellung zu nehmen.30
ENTWICKLUNGSPROZESSE, ERKLÄRUNGSMODELLE, BEWERTUNGSKRITERIEN
Statt Übergriffe der Habsburgerarmee, bestimmte Missstände und entsprechende Verantwortlichkeiten der Behörden und Regierungsspitzen in der Donaumonarchie allein mittels mehr oder minder starrer synchroner und diachroner, generalisierender oder kontrastiver Vergleichsanalysen ähnlichen Geschehnissen in anderen Ländern und Zeitaltern gegenüberzustellen, orientieren sich die vorliegenden Ausführungen außerdem eher an Transformationsphänomenen mit jeweils unterschiedlicher Dauer. Aus einer solchen Perspektive scheint es mit Blick auf die neuzeitliche Geschichte und speziell auf den Terror totalitärer Regime, das Zerstörungspotenzial des Zweiten Weltkrieges und Genozide bis in die Gegenwart ratsam, gerade auch die Geschehnisse zu Beginn des Ersten Weltkrieges in den nord- und südöstlichen Rand-, Front- bzw. Besatzungsgebieten Österreich-Ungarns als »Entwicklungsstufe« oder »Durchgangsstadium« hin zu einer weiteren, wenngleich nicht geradlinigen und kausalen Radikalisierung im 20. Jahrhundert zu verstehen.31
Brutalisierungstendenzen, die Verstärkung von Feindbildern beziehungsweise Ressentiments und die zunehmende Bereitschaft, bewaffnete Auseinandersetzungen zu befürworten oder eine gewisse Hemmschwelle zu überwinden, um Repressalien und Massentötungen zuzulassen, fordern wiederum dazu auf, die graduelle Steigerung der Eskalationsprozesse genauer im Auge zu behalten, die dahinterliegenden Motive aufzudecken und die nicht selten wahrnehmbare Dynamik von Gewaltspiralen zu rekonstruieren. In diesem Zusammenhang stellt sich allerdings auch die Frage, was wir unter Gewalt oder verschiedenen Formen der Gewalt verstehen und wie wir sie bewerten wollen. Eine recht breit gehaltene Definition bieten zum Beispiel jüngere Studien zur Problematik der Kriegsgefangenen an, in denen auch hervorgehoben wird, dass die Betroffenen gedemütigt, beschimpft, angebrüllt und bespuckt wurden.32 Ganze ohne Zweifel ist es wichtig, solche Demütigungen nicht etwa mit physischen Attacken gleichzusetzen, wie Benjamin Ziemann betont, der schreibt: »Spucke lässt sich […] von der Wange abwischen. Eine Kugel im Bauch ist jedoch zumeist tödlich, oder sie hinterlässt zumindest eine bleibende Wunde.«33 Ziemann, der den »totalen« und »industrialisierten« Waffengang von 1914 bis 1918 allgemein als Erfahrungsraum und Laboratorium der Gewalt analysiert, legt dabei vor allem auch darauf Wert, den Krieg als Besonderheit zu präsentieren, als Konfliktfeld, in dem »jene Grundbedingung moderner Gesellschaften systematisch außer Kraft gesetzt« wird, »nach der drastische Sanktionen riskiert, wer andere Menschen gezielt verletzt oder tötet«.34
Die leicht verständliche Differenzierung ist wichtig, um verschiedene Stufen mit ihrem jeweiligen Aggressionspotenzial voneinander unterscheiden zu können und nach den Ursachen für eine etwaige Zunahme oder Steigerung der Gewaltbereitschaft zu fragen. Verfeinerte Bewertungskriterien müssen jedoch gleichfalls Passivität und »Unterlassungssünden« in Betracht ziehen, wenn es etwa um das Elend der Deportierten, Internierten, Flüchtlinge und gefangenen »Feindsoldaten« geht. Neben den organisatorischen Mängeln verwandelt sich in diesem Fall Nichthandeln in eine physische »Attacke«, die sogar zum womöglich in Kauf genommenen Tod führen kann, wenn zum Beispiel hungernden oder kranken Arrestanten und Lagerinsassen mögliche Hilfe verweigert wird. Die diesbezüglichen Darstellungen im vorliegenden Buch orientieren sich an den Maßstäben einer quellenkritischen Interpretation, die Zweifel zulassen muss, wo keine eindeutigen Schlüsse zu ziehen sind, aber Tendenzen aufzeigt oder zumindest problematisiert, wo sie sich abzuzeichnen scheinen.
Das Schwanken zwischen diversen Erklärungen, die einerseits strukturelle Mängel und andererseits persönliches Versagen beziehungsweise Fehlverhalten bezeichnen, ist gerade in Bezug auf das Interesse an der Verantwortung für den Kriegsausbruch und die daran anschließenden Gräueltaten in das Zentrum der Betrachtungen zu rücken. Einige gewaltgeschichtliche Studien verweisen etwa schon vorweg auf entsprechende strukturelle Voraussetzungen in bestimmten Regionen. Mit dem Balkan und den nordöstlichen Grenzgebieten des Habsburgerreiches durchaus vergleichbar, heißt es etwa beim Berliner Osteuropahistoriker Felix Schnell bezüglich der Ukraine: »Es ist kein Zufall, dass die südwestliche Peripherie des Russischen Kaiserreiches seit der Jahrhundertwende immer wieder zum Schauplatz von Gewalt wurde.« Die Gegend war »im Gegensatz zu den zentralrussischen Gebieten ethnisch viel differenzierter und sozioökonomisch heterogener. […] Mit anderen Worten: Es war in der Ukraine sehr leicht, ›Andere‹, ›Anderes‹ und ›Fremdes‹ zu finden und zu erfahren – vor allem, wenn man es darauf anlegte. Für die Entstehung von Feindbildern herrschten insofern günstige Bedingungen.«35
Einen vergleichbaren Blickwinkel nimmt hinsichtlich des Kriegsbeginns 1914 der österreichische Politikwissenschaftler Helmut Kramer ein, wenn er sich über Neuerscheinungen zu diesem Thema äußert und die Tendenz, einzelne Persönlichkeiten in ereignisgeschichtlichem Kontext zu präsentieren, folgendermaßen kommentiert: »Die Grundintention und das Erkenntnisinteresse in den Arbeiten, in denen die Sichtweisen und Positionen der beteiligten Akteure im Mittelpunkt stehen, zielt […] nicht auf eine Beurteilung, sondern vielmehr auf ein respektvolles Verstehenwollen.« Gerade diesbezüglich seien jedoch Defizite zu konstatieren. Die »mit dem ereignishistorischen Ansatz verbundene Ausklammerung der gesellschaftlichen Struktur- und Krisenfaktoren, also Militarismus, Rüstungswettlauf und imperialistische Konkurrenz«, so Kramer weiter, »birgt die Gefahr, dass die gesellschaftlichen Faktoren und Tendenzen, die zum Krieg geführt haben, ihrer normativ-moralischen Bedeutung entkleidet und verharmlost werden«.36
Gerade Hintergründe, Grundlagen und Voraussetzungen, mittel- und langfristige Veränderungen, kollektive Wahrnehmungen, Erfahrungen und Werthaltungen in Verbindung mit ethischen Fragen zu bringen, drängt sich auf, nachdem das nach 1918 und vornehmlich nach 1945 erkennbare Interesse an strukturalistischen Erklärungsmodellen tendenziell auf die Einschränkung individueller Aktionsradien abzielte und demnach eine Verlockung bei der Relativierung persönlicher Schuld verkörperte.37 Es stellt sich demzufolge auch die Frage, ob der zweifellos begrüßenswerte Verzicht auf ein plumpes »blame game«38, wie er in Bewertungen eines Teils der aktuellen Literatur zum Kriegsausbruch festgestellt wird, solche Überlegungen ausreichend beachtet. Und es ist zu hinterfragen, ob die im Gedenkjahr 2014 auf große gesellschaftliche Resonanz stoßende Verständigung auf eine »geteilte Schuld« aller an der Gewalteskalation im Sommer 1914 beteiligten Mächte nicht zumindest dahingehend problematisch sein könnte, als sich daraus eine grundsätzliche Entkoppelung von Handlungen und diesbezüglicher Verantwortung ableiten lässt. Dass bei alldem überdies nicht allein »nationale Befindlichkeiten« und eingeübte Betrachtungsweisen eine Rolle spielen, sondern gleichfalls ein offenbar innerhalb der Historikerzunft ausgetragener »Streit um die Deutungshoheit« konstatiert werden kann, stellt in Summe reichlich Stoff für eine in Bewegung gekommene Debatte zum Gedenken an den Ersten Weltkrieg dar.39
Geschichtswissenschaftliches Arbeiten hat – gerade im Rahmen der Erforschung von Gewalt und Gewalterfahrung, von Verantwortlichkeiten, Rechtsbrüchen und inhumanem Verhalten – über die eigengesetzlichen Regeln wissenschaftlicher Analyse hinaus im gesamtgesellschaftlichen Diskurs eine »normativ-moralische Bedeutung« der sozialen Rahmenbedingungen und Entwicklungen zu berücksichtigen. Handlungen des Einzelnen beziehungsweise Ereignisse als offene Entscheidungssituationen mit mehreren Alternativen sind daraufhin zu befragen und auch zu bewerten. Schließlich muss dabei aber auch festgehalten werden: »Strukturen und Bedingungen allein erklären nichts, denn sie handeln nicht. Es bedarf immer der Akteure, die Chancen und Möglichkeiten nutzen.«40
DIE »KRIEGSSCHULD«
»UNEINDEUTIGKEITEN«
Der Weg der Geschichte gleiche dem eines »durch die Gassen Streichenden«, der an »eine Stelle gerät, die er weder gekannt hat noch erreichen wollte«, schrieb Robert Musil in seinem Roman »Der Mann ohne Eigenschaften«. Musils Worte passten zur Epoche um 1900, in eine Ära von Widersprüchen und Zweideutigkeiten, die sich nicht zuletzt auf unterschiedliche Modernisierungsphänomene zurückführen ließen. Technisierung, Industrialisierung und Urbanisierung, Individualisierung und Demokratisierung schufen gleichermaßen Grundlagen für eine Fortschrittseuphorie wie für eine Krisenstimmung, eine grüblerische, mitunter sogar suizidale Melancholie. Sahen die einen die »Morgenröte« einer besseren Zukunft, kritisierten andere die Unwirtlichkeit der Städte oder die Zerstörung und Künstlichkeit sozialer Beziehungen. Ein »nervöses Zeitalter« stimulierte Aufbruchsfantasien ebenso wie kulturpessimistische Ängste der »Degeneration«. Debatten über die Gestaltungsräume verschiedener Gesellschaftsschichten oder über die Beziehungen zwischen den Geschlechtern verunsicherten die bisherigen, vorwiegend männlichen Eliten.1
Zeitgleich standen wissenschaftliche Gewissheiten zur Disposition: Kausalitäts- und Rationalitätsvorstellungen wurden beispielsweise infolge der Quanten- und Relativitätstheorie infrage gestellt, ebenso das »vernünftige Individuum« als Schlüsselfigur der Aufklärung, das bei Sigmund Freud oder auch beim Philosophen und Physiker Ernst Mach in »Auflösung« begriffen war. Das »willensstarke Ich« und die Vorgaben des »Über-Ichs« befanden sich nun in einem steten Kampf mit den Bedürfnissen des »Unbewussten« und Triebhaften. Der Mensch war sozusagen nicht mehr Herr im eigenen Haus, vielmehr ein Konstrukt, bestehend aus einer »Vielzahl nur zufällig miteinander verbundener Empfindungselemente«.2
Unterminierte die intellektuelle Avantgarde auf solche Weise Grundfesten regelrechter Progressivitätsdoktrinen, machten sich für eine wesentlich breitere Bevölkerungsschicht politisch-weltanschauliche Reibungsflächen unmittelbar bemerkbar. Wahlrecht und Wehrpflicht verwiesen auf die stärkere Einbindung des Einzelnen in das Staatswesen und die beschleunigten Kollektivierungsprozesse. Im Gegenzug wurden »Andere« und »Fremde« noch entschiedener ausgeschlossen, speziell vor dem Hintergrund sozialrevolutionärer Rhetorik, zunehmender ethnischer Spannungen, rassistisch-antisemitischer Ressentiments und einer radikalisierten, von eugenisch-sozialdarwinistischen Einflüssen geprägten Stigmatisierung des »Schädlichen« und »Schwachen«.3 In den »Volks-, Klassen- und Ständegemeinschaften« grassierte die Angst vor dem äußeren und inneren Feind, verstärkt durch wirtschaftliche Konkurrenz zwischen antiliberalem Protektionismus und »globalem Handel«, vor allem aber durch den Kampf der Nationen, Staaten und Imperien um Territorien, Reputation, Macht- und Einflusssphären.4
Der Gegensätzlichkeit des »Fin de Siècle« entsprach auch der Umgang mit der Gefahr bewaffneter Auseinandersetzungen. Romane entwarfen ein Schreckensszenario kommender Kriege. Zivilisten und Soldaten, Regierungsmitglieder und Oppositionelle diverser ideologischer Couleurs warnten vor dem Grauen zukünftiger Volkskriege und systemverändernder Konfrontationen. Während in einigen Schriften die neue Waffentechnik ins Visier genommen und angesichts des kontinentalen Wettrüstens darüber spekuliert wurde, »Superwaffen« könnten letztlich überhaupt jedem weiteren gewaltsamen Kräftemessen ein Ende bereiten, schickten sich grenzübergreifende Initiativen an, in Kundgebungen, Konferenzen und Organisationen dem Pazifismus das Wort zu reden. Liberal-bürgerliche Kreise taten sich diesbezüglich speziell in Westeuropa hervor. Auf dem ganzen Kontinent war es zudem die Arbeiterbewegung, die noch 1914 bei Großveranstaltungen den Eindruck vermittelte, dass die »Linke« sich entschieden gegen jede militärische Lösung der unzähligen Konflikte stellen werde.5
Tatsächlich standen dann vor dem Hintergrund eines ebenso wirkmächtigen Militarismus aber überall »patriotische« Überlegungen und Regungen höher im Kurs. Auch wenn sich die zweifellos vorhandene Kriegsbegeisterung nicht uneingeschränkt breitmachte, so gehorchten die Menschen den Mobilisierungsplänen für gewöhnlich ohne größere Unmutsäußerungen.6 Das Ausmaß der Mitsprache, der Grad der Demokratisierung fiel aus gesamteuropäischer Perspektive in diesem Kontext nicht ins Gewicht.7
Tonangebend blieben zunächst ein paar Dutzend Politiker, Monarchen, Diplomaten und Generäle, deren Aktivitäten jedoch gleichfalls auf Ambivalenzen verwiesen. Die Großmächte und ihre Führungen zeigten sich bei kolonialen Fragen kompromissbereit und sahen sich gemeinsam kleineren Staaten gegenüber, die, wie am Balkan, nur mehr bedingt ihren Vorgaben folgten.8 Die »Zweiklassengesellschaft« in der Völkergemeinschaft wurde infrage gestellt, während die Entscheidungsträger der größeren Länder bei Meinungsverschiedenheiten untereinander und bei einigermaßen unklaren Interessenlagen immer öfter über den richtigen Zeitpunkt eines »militärischen Erstschlags« nachdachten. Ein regelrechter »Offensivkult« wurde begleitet vom Bemühen, potenzielle Partner nicht zu vergraulen. Dies galt umso mehr, als in der ersten Dekade des 20. Jahrhunderts weder die Entente zwischen Paris, London und St. Petersburg noch der Dreibund zwischen Deutschland, Österreich-Ungarn und Italien besonders enge Allianzen darstellten.9
Verschärfte Rivalitäten, allen voran in Südosteuropa, fielen daher genau in jene Phase der internationalen Beziehungen, die von »uneindeutigen Strukturen« geprägt waren. Noch gab es keine Institution wie die »Vereinten Nationen« oder ständige Verhandlungsplattformen zur Regelung von Differenzen. Die Haager Konferenzen und Landkriegsordnungen standen zwar am Anfang einer zukunftsweisenden völkerrechtlichen Entwicklung, doch die Regelwerke fanden nicht ungeteilten Zuspruch, waren unterschiedlich interpretierbar und erwiesen sich als durchaus lückenhaft. Da keine fest gefügten Blöcke existierten, wie später etwa die NATO oder der Warschauer Pakt, zugleich aber auch das »Konzert der Großmächte« im Sinne der Richtlinien des 19. Jahrhunderts von immer mehr Misstönen gestört wurde, kam es auf Einzelstaaten an, die mit Blick auf ihre möglichen Verbündeten jedoch auch nicht frei handeln konnten: Anders als in der Epoche des deutschen Reichskanzlers Otto von Bismarck bis 1890 verfügten die Regierenden daher nicht mehr über die Flexibilität, »jederzeit mit jedem gegen jeden zusammenzugehen«.10
Angesichts solcher und anderer »Uneindeutigkeiten« und »Widersprüchlichkeiten« erscheint es nicht angebracht, »die internationale Geschichte« des 19. und frühen 20. Jahrhunderts »teleologisch auf den Kriegsausbruch« im Sommer 1914 »zulaufen zu lassen«.11 Es passt vielmehr ins Bild, dass unmittelbar vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges an den Herrscherhöfen, in den Ministerien und Botschaften eine äußerst heterogene Stimmungslage anzutreffen war: »grenzenlose Friedensliebe ebenso wie martialisches Gehabe und die Bereitschaft, eine diplomatische Lösung um jeden Preis anzustreben, sowie die resignative Feststellung, dass nichts mehr zu machen war.«12
TENDENZEN
Ausschlaggebend aber blieben zwei Faktoren: Einerseits wurde vermehrt auf die Bündnislogik geachtet und andererseits zeigten die Schlüsselfiguren keinen energischen Willen, den »Waffengang« zu verhindern.13 In den Hauptstädten Europas setzte sich die Überzeugung durch, dass, »wenn nicht anders möglich«, keineswegs nur ein lokaler Konflikt, sondern der »große Krieg« durchaus auch als »schreckliche Katastrophe« zu akzeptieren sei.14 Diese mentalen Voraussetzungen bilden den geistigen Horizont, vor dem jene Geschehnisse zu beurteilen sind, die sich zwischen dem Attentat auf den österreichisch-ungarischen Thronfolger Franz Ferdinand und seine Gemahlin in Sarajewo am 28. Juni 1914 einerseits und dem Beginn der Kampfhandlungen rund vier Wochen später andererseits ereigneten. Und diese Befindlichkeiten sind es auch, die erklären, wie der »Große Krieg« ausbrechen konnte, den die Verantwortlichen in Wien und Belgrad allein niemals auszulösen imstande gewesen wären. Während der dazwischen liegenden »Julikrise« zeigte sich nämlich vor allem, dass die mehr oder minder lockeren politischen und militärischen Allianzen nun fast augenblicklich an Festigkeit gewannen. Während des Staatsbesuchs des französischen Präsidenten Raymond Poincaré im Zarenreich in der zweiten Julihälfte wurden die guten französisch-russischen Beziehungen noch einmal explizit hervorgehoben.15 Gleichzeitig signalisierte St. Petersburg, den »serbischen Schützlingen« zur Seite stehen zu wollen.16 Selbst Großbritannien, wo man die Begebenheiten am Kontinent und speziell in den entfernten Balkangebieten distanzierter beobachtete, sah sich schließlich enger an die Freunde in der Entente gebunden, als in Berlin, Wien und sogar innerhalb der Westmächte angenommen worden war.17
Die gegenteiligen Spekulationen Deutschlands, einen österreichischserbischen Konflikt gänzlich lokalisieren zu können, beruhten indes unter anderem auf der Hoffnung, speziell der Zar werde sich nicht auf die Seite der »Mörder von Franz Ferdinand«, eines zukünftigen Kaisers und Repräsentanten der monarchischen Ordnung, stellen. Gerade auch an diesem Beispiel wurde deutlich, wie sehr sich hauptsächlich die Mittelmächte, das Hohenzollern- und das Habsburgerreich, von Fehlkalkulationen leiten ließen. Der Schulterschluss zwischen Wilhelm II. und Franz Joseph basierte zudem auf der Vorstellung, noch rechtzeitig den Kampf suchen zu müssen, bevor das gegnerische Lager sich weiter verstärken könne und schließlich eine unbesiegbare Übermacht darstelle. Die Tendenz, so bald wie möglich loszuschlagen, begünstigte in Wien und Berlin eine ausgesprochene Paranoia, von einem überlegenen Gegenbündnis eingekreist zu werden. Diese Grundhaltung, die durch das Misstrauen gegenüber Italien nur noch vergrößert wurde, führte zu einer gefährlich alternativlosen Gewaltbereitschaft und einem noch engeren Zusammenrücken zwischen Deutschland und Österreich-Ungarn. Im Gefühl weitgehender außenpolitischer Isolation sagte man sich gegenseitige Hilfe nach besten Kräften zu. Ein enger Mitarbeiter des k.u.k. Außenministers Leopold Graf Berchtold, Alexander Graf Hoyos, war mit einem deshalb mehr erwarteten als erhofften Resultat schon in den ersten Julitagen aus Berlin zurückgekommen: Man würde sich zwar gerade jetzt, nach den Todesschüssen von Sarajewo, nicht in die Politik Wiens gegenüber Serbien einmischen, stünde aber bedingungslos hinter dem Bündnispartner, bemerkten Wilhelm und seine Berater.18
Das Hohenzollernreich billigte die aggressive Marschrichtung der Donaumonarchie. Einige seiner Repräsentanten feuerten die österreichisch-ungarischen Entscheidungsträger sogar noch an, bei einer »harten Gangart« zu bleiben. Verhängnisvoller als das bedingungslose Mitgehen und die martialischen Zuflüsterungen waren aber die operativen Planungen der Deutschen, die sie bis zu einem gewissen Grad zwangen, wenigstens ein kontinentales Kräftemessen auszulösen.19 Allerdings war aus Berliner Sicht gerade der angenommene Zweifrontenkrieg und der Plan, zunächst Frankreich schnell zu besiegen und dann erst mit voller Wucht gegen Russland vorzugehen, ein Mitgrund für eine gewisse Zurückhaltung bei der Vorbereitung militärischer Aktionen. »Preußischerseits« war man sich der Schwierigkeit, in diesem Fall den gesamteuropäischen Waffengang noch zu verhindern, durchaus bewusst. Gegen Ende Juli 1914 waren es demgegenüber gerade die französischen Unterstützungserklärungen für Russland und dessen Mobilmachungsaktivitäten, die eine Vermeidung des gewaltsamen Konfliktes erschwerten.20
EINE KLARE LINIE
Die Kriegsschulddebatte, welche die Feindschaft zwischen den Staaten des »alten Kontinents« vergrößerte und nach 1918 einen gefährlichen Revanchismus am Leben erhielt, scheint daher auf folgende Conclusio hinauszulaufen: Jede Streitpartei leistete im entscheidenden Moment Beiträge zur Eskalation, so wie andererseits in zahlreichen Regierungskanzleien und Botschaftsgebäuden mitunter Vorschläge zur friedlichen Beilegung der Krise ausgearbeitet wurden. Diese derzeit oft favorisierte Betrachtungsweise stellt gewissermaßen eine gesamteuropäische Proporzlösung der geteilten Schuld in den Dienst eines noblen Versöhnungswerkes.21
Dennoch darf die Frage erlaubt sein, ob ein derartiger Befund ohne Einschränkungen zulässig ist. Die Problematik eines angemessenen Urteils ist freilich nicht neu. Entsprechende Diskussionen kreisten bis vor Kurzem um die lange vorherrschende Tendenz, speziell den verantwortlichen Kreisen in Berlin den Beginn des »vierjährigen Massenschlachtens« anzulasten. Ausgeblendet blieb dabei vielfach der wichtigste Bündnispartner der Deutschen. Die Gründe schienen, wenigstens oberflächlich betrachtet, auf der Hand zu liegen: Als insbesondere ab 1918 die Diskussionen über den Ausbruch des Ersten Weltkrieges zum gefährlichen Konfliktpotenzial für künftige Kontroversen und Kriegshandlungen wurden, war mit der Donaumonarchie ein Hauptakteur des Jahres 1914 bereits »verstorben«. Dessen Handlungen im Gefolge des Attentates von Sarajewo aber lassen wenig Spielraum für Zweideutigkeiten. Nicht umsonst ist in der Historiographie von einer »Entfesselung« des Weltkriegs in Wien die Rede gewesen, wurde der Fokus auf die Voraussetzungen für die Dynamik der Eskalation im Sommer 1914 gerichtet.22 Dabei wird deutlich: Österreich-Ungarn legte sich vergleichsweise konsequent auf eine militärische Konfrontation, zunächst und vorrangig mit Serbien, fest. Die Fixierung auf den südöstlichen Nachbarstaat hatte seit einigen Jahren geradezu obsessive Züge angenommen. Das galt nicht zuletzt aufgrund der Geschehnisse im Jahr 1908, als die Habsburgermonarchie Bosnien-Herzegowina angliederte, das es im Einvernehmen mit dem Berliner Kongress 1878 besetzt hatte, das formal aber Teil des Osmanischen Reiches geblieben war. Die Belgrader Regierung, die das Gebiet wenigstens teilweise gleichfalls für sich reklamierte, fand nun im Zuge der »Annexionskrise« wohl grundsätzlich Rückendeckung im Zarenreich. Nach seiner Niederlage gegen Japan 1904/05 und ohne Beistand des französischen Alliierten wollte das Imperium der Romanows aber keine bewaffnete Auseinandersetzung riskieren. Was blieb, war eine tiefe Verstimmung und ein russisch-österreichischer Gegensatz in einer der gefährlichsten Krisenregionen der damaligen Welt. Die Gefahren, die vom Balkan ausgingen, zeigten sich dann auch 1912/13: Bulgarien, Serbien, Griechenland und Montenegro griffen den »kranken Mann am Bosporus« an, brachten das verbliebene europäische Territorium der »Hohen Pforte« zum größten Teil unter ihre Kontrolle und gerieten danach miteinander unter Einschluss Rumäniens und der Türkei über die »Beute«, also die eroberten Gebiete, in Streit. Österreich-Ungarn sah sich dabei noch mehr als bisher von serbischen Expansionszielen herausgefordert. Die Zwistigkeiten der ungleichen Nachbarn nahmen endgültig den Charakter einer »Todfeindschaft« an.23
Spannungszustände, ultimative Drohungen und Mobilmachungen größerer Truppenverbände ließen speziell den k.u.k. Generalstabschef Franz Conrad von Hötzendorf zu einem energischen Verfechter eines Waffenganges werden. Das »Lager der Falken« innerhalb des Habsburgerreiches vergrößerte sich, und es überrascht nicht, dass es kurz nach dem Attentat in Sarajewo Oberhand gewann. »Wir haben den Krieg schon ganz früh beschlossen, das war schon ganz am Anfang«, erinnerte sich später Leon Ritter von Biliński, der als k.u.k. Finanzminister auch für Bosnien-Herzegowina zuständig war.24 Aus dieser Perspektive folgten, ungeachtet aller Details, auch alle weiteren Schritte einer klaren Linie. Die Mission Hoyos’ und die Rückversicherung beim deutschen Bündnispartner passten ebenso zur Kriegsvorbereitung wie der Wunsch, mit Hilfe einer Démarche beziehungsweise eines Ultimatums25 möglichst harte Forderungen an Serbien zu stellen.26 Das Bemühen, nicht einfach über den Gegner herzufallen und ihm zumindest offiziell die Verantwortung für alle weiteren Entwicklungen aufzubürden, war in Wien, ebenso wie in den übrigen europäischen Hauptstädten, unverkennbar.27 Allerdings oblag es der Donaumonarchie, die Lawine loszutreten, im festen Entschluss, eine »radikale Lösung« anzubahnen. Neben den Offizieren um Conrad war es nun das k.u.k. Außenministerium unter der Leitung von Leopold Graf Berchtold, das unmissverständliche Worte fand. Dem Gesandten des Habsburgerreiches in Belgrad, Wladimir Freiherr von Giesl, gab Berchtold bündige Weisungen mit auf den Weg: »Wie immer die Serben reagieren – Sie müssen die Beziehungen abbrechen und abreisen; es muss zum Krieg kommen.«28
Der »gemeinsame Ministerrat« der seit 1867 dualistisch strukturierten Monarchie, in der unter dem »Zepter Habsburgs« die zwei weitgehend selbstständigen Reichsteile Österreich und Ungarn vereint waren, hatte sich festgelegt. Nicht mehr nur die Militärs um Stabschef Conrad und die Diplomaten um Graf Berchtold machten Druck, auch der österreichische Ministerpräsident Karl Graf Stürgkh glaubte, das Band zwischen den Slawen inner- und außerhalb der Monarchie nur mehr durch Waffengewalt zerschneiden zu können. Selbst der vorsichtigere ungarische Ministerpräsident István Graf Tisza brachte gewisse Vorbehalte keinesfalls aus prinzipiell pazifistischen Überlegungen vor. Vielmehr ging es für ihn um Kriegsziele, Bündnisfragen und das weitere Prozedere bei der Behandlung der »serbischen Frage«. Als Tisza in einem Gespräch mit Außenminister Berchtold am 1. Juli 1914 erfuhr, dass »man die Morde in Sarajewo zum Anlass für eine Abrechnung mit Serbien nehmen würde«, wandte er sich an den Kaiser persönlich, der den eingeschlagenen Kurs ebenfalls billigte.29
Gerade Franz Joseph hatte sich bald, wahrscheinlich bei einer der Audienzen des Grafen Berchtold, etwa am 30. Juni, entschlossen, Serbien militärisch in die Schranken zu weisen. Der Herrscher, ohnehin kein Freund von Konferenzen und Unterredungen mit mehreren Anwesenden, bestimmte in routinemäßigen Zweiergesprächen die Richtung und war danach wohl überzeugt, alles Wichtige gesagt zu haben. Die betreffenden Maßnahmen überließ er, wie schon bei früheren Gelegenheiten, seinen Beratern. Franz Josephs weiteres Verhalten entsprach dann seinen Charaktereigenschaften und einer lang geübten Praxis: Er blieb passiv, ließ sich informieren, versah Dokumente mit seiner Unterschrift. Statt viele Worte zu machen und Initiativgeist zu zeigen, verwandelte er die Entfesselung des Krieges in einen »einfachen Verwaltungsakt«.30
DER KURS WIRD GEHALTEN
Der feste Entschluss, die Waffen sprechen zu lassen, ging bei der österreichisch-ungarischen Führung mit dem Ansinnen einher, das Ausland über ihre wahren Absichten zu täuschen. Graf Berchtold und Conrad von Hötzendorf kamen überein, die Öffentlichkeit »einzulullen«, wie es der deutsche Militärattaché in Wien ausdrückte. Der Presse gegenüber wollten die »maßgeblichen Stellen« eine betont »ruhige, besonnene Haltung« einnehmen. Wichtige Repräsentanten insbesondere der Armee traten ihren Urlaub an und vermittelten den Eindruck, dass die Krise keine schlimmeren Konsequenzen nach sich ziehen werde.31
Parallel zu derartigen Ablenkungsmanövern setzten Hofkreise und Diplomaten sehr zur Zufriedenheit der Hardliner in der Generalität alles daran, den Spielraum für friedenserhaltende Verhandlungen nach Kräften einzuengen. Auch in dieser Hinsicht wird deutlich, wie früh sich die österreichisch-ungarische Führung auf einen Kriegskurs festlegte. Das Begräbnis des Thronfolgerpaares etwa hätte zur Begegnung vieler bedeutender Staatsoberhäupter und Regierungschefs führen können. Eine Annäherung der Eliten Europas wäre bei diesem Anlass möglich gewesen, wenigstens vor dem Hintergrund des Mordanschlags und der Überzeugung, dass das Schicksal Franz Ferdinands und seiner Gemahlin jeden treffen konnte, der die Macht verkörperte. Aber selbst der deutsche Kaiser Wilhelm erhielt keine entsprechenden Signale aus der Donaumonarchie. Hier wollte man von einer Fürstenversammlung, von einem »Gipfel« der Entscheidungsträger, von internationalen Tagungen oder diplomatischen Unterredungen, wie etwa während der Balkankriege in den vorangegangenen Jahren, nichts wissen. Noch während die Leichname der Opfer von Sarajewo nach Wien überführt wurden, formierten sich die Kräfte innerhalb Österreich-Ungarns, die sich einer gewaltfreien Lösung der Krise widersetzten.32
Sir Maurice de Bunsen, britischer Botschafter im Habsburgerreich, erhielt in dieser Hinsicht eine interessante Auskunft von Außenminister Berchtold, der sich einigermaßen abfällig über die »Botschafterkonferenzen in London während der Balkankrise« 1912/13 äußerte. Eigentlich habe er, so Berchtold, niemals an die Dauerhaftigkeit der dortigen Absprachen geglaubt. Schließlich seien die Verhandlungsergebnisse insofern dürftig gewesen, als sie die fundamental voneinander abweichenden Standpunkte der Streitparteien eher »künstlich« in Übereinstimmung zu bringen versucht hätten.33 Der Gesandte des Vereinigten Königreiches musste erkennen, dass für etwaige Vermittlungen kaum Voraussetzungen existierten. Zwar bestand kein Zweifel, dass die Donaumonarchie »etwas vorbereitet« und dass die österreichische Presse durchgehend eine antiserbische, kriegsbereite Haltung eingenommen habe. Aber, notierte Sir Maurice de Bunsen Anfang September 1914, weder er noch seine Kollegen aus anderen Ländern seien über Details informiert gewesen. Mit Ausnahme des deutschen Botschafters, ergänzte er, konnte niemand hinter den Vorhang blicken und im Zusammenhang mit dem Ultimatum an Serbien substanzielle Gespräche führen.34
Sicherlich waren die beteiligten Auslandsrepräsentanten, ebenso wie alle anderen wichtigeren Entscheidungsträger, noch im Verlauf der »Julikrise« und erst recht in der Zeit danach bemüht, die eigene Position möglichst günstig darzustellen, und bisweilen hatte es den Anschein, als feilten die Akteure bei dieser Gelegenheit schon an vorteilhaften Formulierungen für später zu veröffentlichende Propagandaschriften, Memoiren und Dokumentenbände. Dennoch zeigt der Bericht von Maurice de Bunsen, dass nahezu jedes Angebot zur Deeskalation der Lage von den Verantwortlichen in der Donaumonarchie zurückgewiesen wurde. Gewiss konnte zum Beispiel gegen die speziell von Großbritannien, dann zudem von Frankreich und teilweise auch von Vertretern des Hohenzollernreiches ventilierte Idee, Österreich-Ungarn möge sich durch seine Streitkräfte in den Besitz von Belgrad oder wenigstens nur von einem kleinen Gebiet Serbiens bringen und dann mithilfe dieses »Faustpfandes« in Verhandlungen eintreten, einiges eingewendet werden. Schließlich war nicht klar, ob Europa und vor allem Russland – trotz gegenteiliger Aussagen des zarischen Gesandten in Wien – bei diesem »kurzen, harten Schlag« nur zusehen würde, abgesehen von Mobilmachungs- und Aufmarschplänen der k.u.k. Militärs, die mit einem solchen Szenario kaum in Einklang zu bringen waren. Dennoch sind derlei Überlegungen unzweifelhaft von wichtigeren Einflussfaktoren überlagert worden, allen voran von der österreichischen Überzeugung, den einmal eingeschlagenen Weg nicht verlassen zu dürfen. Berlin bestärkte seinen Bündnispartner dabei auch noch, indem es – ähnlich wie Frankreich und Russland – in den letzten Julitagen auf späte Vermittlungsangebote der britischen Regierung, der Donaumonarchie im Rahmen von Verhandlungen beziehungsweise Botschafterkonferenzen Genugtuung zu verschaffen, distanziert reagierte und darauf bestand, »Österreich in seinem Serbenhandel« nicht »vor ein europäisches Gericht zu ziehen«.35
Dass aber weder die Haltung der mit England verbündeten Ententestaaten noch der Standpunkt des Hohenzollernreiches von der Verantwortung der k.u.k. Regierung ablenken kann, beweisen die Wortmeldungen von Außenminister Berchtold: Eindeutig hatte er sich in Anwesenheit von Sir Maurice de Bunsen von einer Fortsetzung der früheren Balkanpolitik und neuerlichen diplomatischen Gesprächen losgesagt.36 Die Übergabe des »Ultimatums« an Serbien, ohne zuvor mit den potenziellen Feinden insbesondere unter den Großmächten Gespräche zu führen, hatte die Krise schon bis zur fast völligen Ausweglosigkeit verschärft und schließlich die Kriegserklärung Österreichs an Serbien am 28. Juli 1914 zur Folge. Eine neuerliche Erinnerung Großbritanniens an die Möglichkeit einer Konferenz, dieses Mal schon mit der Warnung verbunden, andernfalls nicht abseits stehen und eventuell als Gegner der Mittelmächte in bewaffnete Auseinandersetzungen verwickelt werden zu können, alarmierte sogar den deutschen Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg, der Wien bislang »unablässig zum Losschlagen gegen Serbien« ermuntert und »entscheidend zur Heraufbeschwörung« eines gewaltsamen Konfliktes beigetragen hatte.37 Zutiefst besorgt über den Anschluss des »Empires« an die feindliche Allianz, riet er der k.u.k. Monarchie jetzt zum Meinungsaustausch mit dem Zarenreich, denn, so Bethmann Hollweg: »Wir sind zwar bereit, unsere Bündnispflicht zu erfüllen, müssen es aber ablehnen, uns von Wien leichtfertig und ohne Beachtung der Ratschläge in einen Weltbrand hineinziehen zu lassen.«38
Obwohl in dieser Situation nun wiederum Kaiser Wilhelm II. gegen seinen Kanzler Stellung bezog und damit einmal mehr deutsche Entscheidungen – überdies unter beträchtlicher Einflussnahme der Generalität39 – eine verhängnisvolle Wirkung entfalteten, kann dennoch eines nicht übersehen werden: Eine Geste des Entgegenkommens war vom Habsburgerreich zu setzen, dessen Aktivitäten am Beginn der Ereigniskette standen und von dessen Kompromissbereitschaft noch in der schwierigen Lage der letzten Juliwoche einiges abhängen konnte. Der britische Außenminister Edward Grey äußerte sich in diesem Sinn gegenüber dem österreichischen Botschafter in London, Albert Graf Mensdorff: »Wenn die Mächte nur in Russland raten sollen, dass es passiv bleibe, so ist es gleichbedeutend, Ihnen freie Hand zu geben, was Russland nicht annehmen wird«, bemerkte Grey, um geradezu flehentlich hinzuzufügen: »Irgend etwas müssten Sie uns zum mindesten geben, das[s] wir in Petersburg verwerten können«.40 Graf Mensdorff kam nicht umhin, der englischen Regierung das »eifrigste Bemühen« zu attestieren, den »Frieden zu erhalten und jedem Versuch dahin vollste Unterstützung angedeihen zu lassen«.41 Dennoch blieb er gegenüber den Äußerungen Greys vorsichtig, da dessen Anregungen, so Mensdorff, »vielleicht jetzt nicht erwünscht wären«.42 Die Wiener Führung wich von ihrer Linie nicht ab: »Ungeachtet seiner Freundlichkeit während der Unterredung«, hielt Maurice de Bunsen demgemäß fest, ließ Graf Berchtold »keine Zweifel darüber aufkommen, dass die österreichisch-ungarische Regierung mit Entschlossenheit die Invasion Serbiens fortsetzen wird«. Parallel dazu hatte sich Berchtold gegenüber dem russischen Botschafter in der k.k. Haupt- und Residenzstadt, Nikolaj Šebeko, gleichermaßen unnachgiebig gezeigt. Šebekos Vorschlag, auf Direktgespräche zwischen Russland und Österreich zu setzen, lehnte er laut Bunsen am 28. Juli ab.43 Der Außenminister des Zarenimperiums, Sergej Sazonov, beklagte sich dann auch bei der Wiener Regierung über »die glatte Ablehnung seiner Proposition bezüglich Aussprache« mit dem Gesandten der Donaumonarchie in Sankt Petersburg, Frigyes Graf Szápáry. Einem Gedankenaustausch mit den russischen Diplomaten und namentlich mit Šebeko habe er sich niemals verweigert, antwortete darauf Berchtold am 30. Juli, bestätigte aber indirekt Sazonovs Eindruck durch die Unnachgiebigkeit seines Standpunktes. »Gewünschte Erläuterungen«, schärfte er Graf Szápáry ein, könnten sich »allerdings nur im Rahmen nachträglicher Aufklärungen bewegen, da es niemals in unserer Absicht gelegen war, von den Punkten der Note [gegenüber Serbien] etwas abhandeln zu lassen«.44
OHNE RÜCKSICHT AUF VERLUSTE
London warnte angesichts dessen noch einmal explizit, dass sich der Kampf der habsburgischen Streitkräfte gegen Serbien nicht lokalisieren lasse.45 Aus englischer Sicht beruhte die österreichische Vorgangsweise auf einer gefährlichen Einengung des Wahrnehmungshorizontes. Und selbst in deutschen Generalstabskreisen mokierte man sich über die »blinde Serbenwut, die den Blick in Wien trübt«.46 Die Verantwortlichen in der Donaumonarchie glichen »Igeln, die über eine Landstraße huschen, ohne auf den Verkehr zu achten«, heißt es demgemäß in einer aktuellen historischen Analyse.47 Dabei bedurfte es nicht einmal der regelmäßigen Einflüsterungen und Warnungen der Großmächte und ihrer Auslandsvertreter.48 Unmittelbar nach dem Attentat in Sarajewo wies der k.u.k. Außenminister auf die Möglichkeit eines allgemeinen oder sogar globalen Konfliktes hin. Bei der Sitzung des gemeinsamen Ministerrates am 7. Juli 1914 war zumindest Russlands Kriegseintritt bereits ein Thema, wenngleich ausgerechnet der »Falke« Conrad von Hötzendorf in diesem Augenblick einen gleichzeitigen Kampf gegen Serbien und das Zarenreich für »ungünstig« hielt. Nichtsdestoweniger zeigen die Beratungen vom 7. Juli, ebenso wie die Gespräche unter Einbindung von Kaiser Franz Joseph, dass die Staatsspitze »einen allgemeinen Krieg riskieren« wollte, »um einen lokalen Krieg gegen Serbien zu führen«.49
Schon bei der Eröffnung der Sitzung am 7. Juli ging es Berchtold darum, »durch eine Kraftäußerung« das benachbarte kleine Königreich im Südosten »für immer unschädlich zu machen«. Dabei sei unbedingt Deutschlands Hilfe nötig, wobei »ein Krieg mit Russland« möglich sei. Während der ungarische Ministerpräsident Tisza auch einen diplomatischen Erfolg mittels weitreichender Forderungen und die Behebung der »Krise in Bosnien« durch eine energische Verwaltungsreform für möglich, andererseits aber eine »kriegerische Aktion für näher gerückt« hielt, plädierte der österreichische Ministerpräsident Stürgkh unter Berufung auf Berichte des Landeschefs für Bosnien und Herzegowina, Oskar Potiorek, »für einen kräftigen Schlag gegen Serbien«. Was darunter zu verstehen war, machte der »gemeinsame Finanzminister« Biliński mit der Bemerkung klar: »Der Serbe ist nur der Gewalt zugänglich.« Ein »diplomatischer Erfolg hat keinen Wert«, assistierte Alexander von Krobatin, seines Zeichens k.u.k. Kriegsminister. Noch bevor die Unterredung unterbrochen wurde, gelangten daher – abgesehen von bestimmten Einwänden Tiszas – »alle Anwesenden« zur »Ansicht, dass ein rein diplomatischer Erfolg, wenn er auch mit einer eklatanten Demütigung Serbiens enden würde, wertlos wäre und dass daher solche weitgehende Forderungen an Serbien gestellt werden müssten, die eine Ablehnung voraussehen liessen, damit eine radikale Lösung im Wege militärischen Eingreifens angebahnt würde«.50 Bemerkenswert kurz gaben dann die Militärs ihre Stellungnahmen während der Nachmittagssitzung ab. Aus Geheimhaltungsgründen wurden die nachfolgenden Erläuterungen auf Ersuchen des Generalstabschefs Conrad von Hötzendorf nicht in das Protokoll des »Gemeinsamen Ministerrates« aufgenommen. So viel ist aber klar: Es ging um einen Waffengang – »auch gegen Russland« –, und es gab »eine längere Debatte über die Kräfteverhältnisse und den wahrscheinlichen Verlauf eines europäischen Krieges«. Dann verließ Hötzendorf vorzeitig die Sitzung, deren Teilnehmer sich schließlich auch mit Tiszas Einwilligung ganz auf den »Schlag« gegen Serbien konzentrierten, wie die neuerlichen Gespräche des »Gemeinsamen Ministerrates« am 19. Juli 1914 beweisen.51
Noch kurz vor Überreichung der österreichischen Démarche in Belgrad war dann die österreichische Vorgehensweise soweit bekannt, dass der britische Außenminister Grey gegenüber Graf Mensdorff die mahnenden Worte fand: »Wenn vier große Staaten, Österreich-Ungarn, Deutschland, Russland und Frankreich, in einen Krieg verwickelt werden, so folge ein Zustand, der einem wirtschaftlichen Bankerott Europas gleichkomme. Keine Kredite seien mehr zu erlangen, die industriellen Zentren in Aufruhr, so dass in den meisten Ländern, gleichgültig, ob Sieger oder besiegt, ›so manche bestehende Institution weggefegt‹ werden würde.« Vom österreichisch-ungarischen Außenministerium gedeckt, erwiderte darauf Mensdorff: »Meiner Ansicht nach müssten wir in diesem Falle trotz unserer bekannten Friedensliebe Serbien gegenüber ›sehr fest‹ bleiben. […] Ich fürchte, er [Grey] wird den Charakter eines Ultimatums unserer Démarche und die kurze Frist kritisieren.«52 Parallel dazu ließ Graf Berchtold in einem geheimen Zusatz zu einem Telegramm an die k.u.k. Botschafter in Madrid, Washington, Tokio und beim »Päpstlichen Stuhle« vermerken, dass »die weitere Entwicklung der Dinge« nicht bloß zu einem bewaffneten Konflikt mit Serbien, sondern zumindest auch zum Krieg mit Russland führen könne.53 Graf Szapáry gegenüber ging Berchtold zwei Tage später, am 25. Juli 1914, in einem geheimen Schreiben noch weiter, indem er betonte, dass »wir zur Durchsetzung unserer Forderungen bis zum Äußersten gehen und auch vor der Möglichkeit europäischer Verwicklungen nicht zurückschrecken würden«.54
Unter solchen Gesichtspunkten ist auch der Meinung des kritischen Journalisten Heinrich Kanner beizupflichten, der 1922 rückblickend zugespitzt formulierte: »An seinem Ursprung, in Wien, ging der Kriegswille nur auf die Vernichtung Serbiens. Dies aber um jeden Preis, ohne Rücksicht auf den europäischen Frieden.«55 Und auch heute noch muss die Geschichtswissenschaft einigermaßen irritiert feststellen, dass man in Wien reichlich »solipsistisch« auf eine bewaffnete Konfrontation abzielte. Eine bemerkenswert eingeschränkte Sichtweise der geopolitischen Situation Europas verknüpfte sich mit dem festen Glauben an die Richtigkeit des eigenen Handelns. Dabei ersetzte zum Teil das Vertrauen auf den mächtigen deutschen Nachbarn ein behutsames Abwägen der Alternativen und der Chancen, in einem Kräftemessen mit den Kontrahenten bestehen zu können.56
Vor diesem Hintergrund ist verständlich, dass selbst Kaiser Franz Joseph zumindest im Nachhinein, ein halbes Jahr später, Zweifel an der Richtigkeit der Entscheidungen im Juli 1914 äußerte.57 Gewiss standen diese Erörterungen schon unter dem Eindruck der keineswegs glanzvoll verlaufenden Eröffnungsfeldzüge der k.u.k. Armee und der Probleme, die im Zuge einer langen Ressourcenschlacht auf die Donaumonarchie zukamen. Aber auch Mitarbeiter des österreichisch-ungarischen Außenministeriums fanden klare Worte zum Kriegsausbruch. »Wir haben den Krieg angefangen, nicht die Deutschen und noch weniger die Entente«, konstatierte etwa Leopold von Andrian-Werburg, der allerdings trotz des Wissens um die weiteren Entwicklungen immer noch meinte, dass man nach den Schüssen von Sarajewo richtig gehandelt habe.58 Zerknirschter und selbstkritischer klangen vergleichbare Darlegungen jedoch bei Alexander Graf Hoyos. Seine Unterredungen in Berlin bezeichnete er in seinen Erinnerungen als »unermessliches Unglück«. Und obwohl er nach 1918 Rechtfertigungen für die Wiener Politik im Juli 1914 suchte, befielen ihn Schuldgefühle.59 Sogar mit dem Gedanken des Freitodes soll er gerungen haben, nachdem er während des Ersten Weltkrieges, im Winter 1916, gegenüber Freunden vom »niederdrückenden Gefühl« gesprochen hatte, »doch der eigentliche Urheber des Krieges gewesen zu sein«.60
Zwar bedurfte es einer größeren Zahl von überdies wichtigeren Entscheidungsträgern, um ein »vierjähriges Massenschlachten« auszulösen, aber die Bedenkenlosigkeit, mit der unter anderem Hoyos seinen Beitrag zur Entfesselung eines »großen Völkerringens« leistete, musste mit einem gewissen zeitlichen Abstand auch ihn erschrecken: »Wenn der Weltkrieg daraus entsteht, so kann uns das gleich bleiben«, hatte er vor Beginn der »Urkatastrophe Europas« mit Blick auf den serbischen Erzfeind behauptet.61 Fast zeitgleich, genauer gesagt kurz nach der Rückkehr von Hoyos aus der deutschen Hauptstadt, war indes sein Chef bei Conrad von Hötzendorf vorstellig geworden, um nachzufragen, was geschehen solle, wenn die Belgrader Regierung wider Erwarten das Ultimatum akzeptiere. Conrad darauf trocken und ohne Bezug auf etwaige russische Gegenmaßnahmen: »Trotzdem einmarschieren und so lange bleiben«, bis Serbien unter anderem die »Kriegs- und Besatzungskosten abbezahlt hat«.62
SERBISCHE REAKTIONEN
Unter solchen Umständen kann es auch nicht überraschen, dass sich die maßgeblichen Regierungsvertreter Österreich-Ungarns bei der weiteren Behandlung des Konfliktfalles kaum Selbstbeschränkungen auferlegten. Die Forderungen an Belgrad, falls ihnen angesichts des Kriegswillens der verantwortlichen Kräfte in Wien überhaupt noch eine zentrale Bedeutung zukam, sollten – wie erwähnt – nach Wunsch der beteiligten Diplomaten gar nicht annehmbar sein oder zumindest trotz ihrer Schärfe vorbehaltlos angenommen werden. Die Gegenseite wiederum war gewiss von nationalistischen Begehrlichkeiten geleitet. Gewaltexzesse während der Balkankriege und in den eroberten Gebieten hatte nicht zuletzt auch Serbien zu verantworten, dessen maßgebliche Kräfte sich eines antiösterreichischen Tones bedienten, die Südslawen aus dem »habsburgischen Völkerkerker« befreien wollten oder überhaupt auf die Zerschlagung der Donaumonarchie hinarbeiteten. Dass die k.u.k. Führung ein lokales Kräftemessen um den Preis eines schwer kalkulierbaren europäischen Krieges ohne internationale Verhandlungen provozierte, beruhte vor diesem Hintergrund auf der Annahme, Serbien insgesamt für die Schüsse in Sarajewo verantwortlich machen zu können. Gerade diese Sichtweise erschien jedoch fragwürdig: Reichten nämlich einerseits zu diesem Zeitpunkt die Erhebungen der österreichisch-ungarischen Untersuchungsbehörden noch nicht aus, um das Attentat in Sarajewo zweifelsfrei mit Machenschaften Belgrads in Verbindung zu bringen, so verweisen Informationen, die erst einige Jahre später zur Verfügung standen, andererseits vor allem auf die Tatsache, dass in Serbien unter anderem durch ein Geflecht von radikalen Netzwerken sowie die Aktivitäten des Nachrichtendienstchefs Dragutin Dimitrijević schwerwiegende innenpolitische Zerwürfnisse heraufbeschworen worden waren.63
Ministerpräsident Nikola Pašić und seine große Gefolgschaft sahen sich von schlagkräftigen Gegenströmungen herausgefordert, zu denen Offiziere wie Dimitrijević und berüchtigte Geheimgesellschaften wie die »Schwarze Hand« zählten. Ihre Mitverantwortung am Attentat64 stand in deutlichem Gegensatz zu den Überlegungen im Umfeld von Pašić. Obwohl selbst alles andere als »austrophil«, sah er speziell nach den beiden Balkankriegen die Notwendigkeit einer Ruhepause für sein Land. Belgrad versuchte daher zu besänftigen.65 Aufmerksame Leser konnten sich davon sogar in österreichischen Zeitungen überzeugen, wenn sie sich die Mühe machten, klein gedruckte Kurznotizen zu beachten. Unter anderem brachte die »Arbeiter-Zeitung« ein Communiqué des »serbischen Preßbureaus« vom 29. Juni 1914 mit folgendem Inhalt: »Unter dem Eindruck des tragischen Ereignisses, dessen Schauplatz gestern Sarajewo war, haben wir nicht genug Worte, um das schreckliche Attentat zu brandmarken, dem der Thronfolger unserer Nachbarmonarchie Erzherzog Franz Ferdinand und dessen Gemahlin zum Opfer gefallen sind.«66 Feierlichkeiten zum »Vidovdan«, in Erinnerung an die serbische Niederlage gegen die Osmanen auf dem Amselfeld 1389 und die Ermordung des Sultans Murad I. durch Miloš Obilić, wurden unterbunden.67 Dazu die »Arbeiter-Zeitung«: »Trotz des Nationalfestes, das in Stadt und Land begangen wurde und zu dem unzählige Gäste aus dem Ausland eingelangt waren, wurden auf Anordnung der Regierung sämtliche öffentliche Lokale, selbst die Kaffeehäuser, um 10 Uhr abends geschlossen. Das Regierungsorgan ›Samouprawa‹«, setzte das Blatt fort, »veröffentlicht einen Artikel, worin über das tragische Ereignis das Bedauern ausgesprochen und der greise Kaiser sowie die Völker der Nachbarmonarchie inniger Teilnahme versichert werden. Der größte Teil der Presse verurteilt das Attentat.«68
Dort, wo gegenteilige und »unpassende« Äußerungen zu vernehmen waren, schritt das offizielle Serbien, so gut es ging, ein. Selbst die eindeutig gegen Belgrad eingestellte Wiener Presse musste am 9. Juli 1914 konzedieren, dass im »Auftrag des Ministerpräsidenten Pašić die Redakteure sämtlicher serbischer Blätter« aufgefordert worden seien, »sich in der Politik über das Sarajevoer Attentat jedweder Ausfälle gegen Österreich-Ungarn zu enthalten«.69 Berichtet wurde hingegen über weitere Beileidsbekundungen gegenüber der Donaumonarchie. »Der Präsident der Skupschtina«, des serbischen Parlaments, vermerkte wiederum die »Arbeiter-Zeitung«, »richtete an die Präsidenten der Parlamente in Wien und in Budapest Kondolenztelegramme, in denen die Anteilnahme und die Abscheu« angesichts des Attentates »in Sarajewo ausgesprochen werden. Der Stellvertreter des von Belgrad abwesenden Ministerpräsidenten Paschitsch, Finanzminister Patschu, richtete an den Grafen Berchtold im Namen der serbischen Regierung ein Telegramm, in welchem dieselben Gefühle der Teilnahme und des Abscheues ausgedrückt werden. Ferner […] kondolierten König Peter und Kronprinz-Regent Alexander dem Kaiser Franz Josef. Justizminister Dr. Gjuritschitsch begab sich in Begleitung des Sektionschefs des Ministeriums des Äußern Gruitsch zum österreichisch-ungarischen Geschäftsträger, um ihm im Namen des Kabinetts die Teilnahme auszusprechen.«70 Es folgten die Anordnung einer mehrtägigen Staatstrauer durch den serbischen Innenminister sowie Ankündigungen, etwaigen Spuren des Mordanschlages auf serbischem Territorium nachzugehen und antiösterreichische Manifestationen beziehungsweise Demonstrationen zu unterbinden.71
Neben Gesten und Versprechen waren im Übrigen Hinweise auf Interessen und Zielsetzungen der Belgrader Entscheidungsträger einigermaßen aussagekräftig. In der »Reichspost« vom 4. Juli 1914 wurde ein ehemaliger serbischer Minister mit den Worten zitiert: »Von dem Tode des Erzherzogs Franz Ferdinand hat Serbien keinen Nutzen.«72 Die »Arbeiter-Zeitung« berief sich auf das jungradikale Parteiorgan »Odjek«, das am 29. Juni zwar von der »schweren Lage« des serbischen Volkes im »armen Bosnien« und in der »wurmstichigen Monarchie« sprach, andererseits aber keinen »unüberwindlichen Ausbruch der Leidenschaften« und der »Unbesonnenheit« wünschte, sondern »in allen Gebieten Frieden und in den Beziehungen mit der Nachbarmonarchie eine möglichst lange Periode der Ruhe und des Vertrauens«.73 Auch alle Gesandtschaften und Konsulate Serbiens wurden unter solchen Umständen angewiesen, das »verabscheuungswürdige Verbrechen in Sarajewo« auf »das schärfste« zu verurteilen, wenngleich man sich in diesem Zusammenhang dagegen verwehrte, durch verschiedentlich erhobene Verdächtigungen »ein ganzes Volk« für die »Tat eines unreifen jungen Menschen« verantwortlich zu machen.74