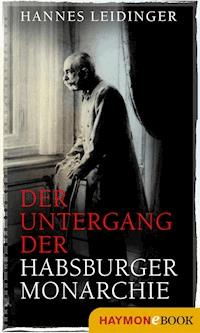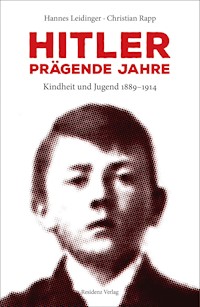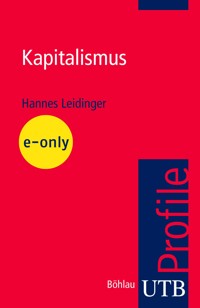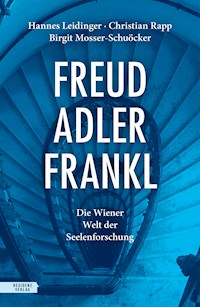Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
EINE REPUBIK AUF DER SUCHE NACH SICH SELBST: DIE GESCHICHTE ÖSTERREICHS NEU ERZÄHLT. BLITZLICHTER, WENDEPUNKTE, KONSTANTEN Was haben das Jahr 1945 und unsere gegenwärtige DEMOKRATIEKRISE gemeinsam? Welche Parallelen gibt es in der GENESE VON FEINDBILDERN zwischen gestern und heute? WAS BEWEGT ÖSTERREICH im Jahr 2018 - im Zeitalter der Globalisierung und Transnationalität - immer noch so sehr wie zu Beginn der NATIONSFINDUNG 1918? Geschickt stellen Hannes Leidinger und Verena Moritz bildgewaltige Brüche Kontinuitäten gegenüber und erzählen FUNDIERT, ANSCHAULICH UND MITREIßEND VON ÖSTERREICHS WEG IN DIE GEGENWART. ÖSTERREICH 1918-2018: EINE REPUBLIK IN BEWEGUNG Im Jubiläumsjahr 2018 feiert die Republik Österreich ihren 100. Geburtstag. EIN JAHRHUNDERT VOLLER TURBULENTER POLITISCHER, WIRTSCHAFTLICHER UND GESELLSCHAFTLICHER ENTWICKLUNGEN ist seit 1918 vergangen: der Übergang von der MONARCHIE zur REPUBLIK, unterbrochen von Jahren des FASCHISMUS, über das Jahr 1968 mit seinen tiefen Einschnitten auf allen Ebenen des Lebens bis hin zum Eintritt in die EUROPÄISCHE UNION und dem Österreich von heute. Ausgehend von den GROßEN MOMENTEN DER ÖSTERREICHISCHEN GESCHICHTE eröffnen die renommierten HistorikerInnen Hannes Leidinger und Verena Moritz ein WEITES GESCHICHTSPANORAMA, DAS MEHR IST ALS EINE REINE CHRONOLOGIE.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 407
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hannes Leidinger, Verena Moritz
Umstritten, verspielt, gefeiert
Die Republik Österreich 1918/2018
Das Konzept – Eine kurze Einleitung
1918 – 1938 – 1968 – 2018. Das historische Gedächtnis lebt von der Wiederkehr. Es hält sich an Ereignissen fest, benötigt sie, um den Fluss permanenter Veränderung zu strukturieren. Daraus entstehen Konstrukte, die Gefühl und Sinn verknüpfen, die gefestigt, bejubelt, hinterfragt oder gewissermaßen „verabschiedet“ werden können.
Die „Nation“ ist in dieser Hinsicht ein Schlüsselbegriff. Sie beruft sich auf weit zurückreichende Traditionen, stellt sich bei näherer Betrachtung aber vor allem als Resultat von Entwicklungen seit der Französischen Revolution dar. Der Begriff „Österreich“ macht das deutlich. Von der Bezeichnung einer Herrscherdynastie und eines Kaiserreiches führt er im 20. Jahrhundert zu höchst unterschiedlich wahrgenommenen Republiken, einer Ersten, „gescheiterten“, und einer Zweiten, „erfolgreichen“. Das Ende der Letztgenannten haben allerdings einige Kommentatoren des Zeitgeschehens mittlerweile, wenn nicht bereits ausgerufen, dann immerhin zum Thema gemacht.
Periodisierungen verweisen auf mehr oder weniger tiefgreifende Umwälzungen und plötzliche Wendungen. Konstanten und zaghafte Veränderungen treten demgegenüber eher in den Hintergrund – trotz der Tatsache, dass etwa die Zeitspanne von 1934 bis 1945 vorherige und nachfolgende Perioden erklärt und überschattet. Die Republik „verstehen“ heißt demnach auch, jene dunklen Kapitel zu beachten, in denen sie nicht existierte. Obwohl sich keine direkte Linie von 1918 bis 2018 ziehen lässt und ein Schrägstrich, der die beiden Jahreszahlen im Untertitel des Buches trennt, das komplizierte Verhältnis zwischen Bruch und Kontinuität andeutet, kommt auf solche Weise besonders ein epochenübergreifendes Wesensmerkmal der jüngeren Geschichte Österreichs zum Vorschein: Speziell im Zeichen von ideologischen Gegensätzen und nationalen Vorurteilen, von Rassismus und Antisemitismus, zwei Diktaturen und Weltkriegen geht es immer wieder um die verhängnisvolle Suche nach der eigenen, lange „umstrittenen“ nationalen Identität. Letztlich mündet sie in ein Bekenntnis zum vormals „verspielten“ Kleinstaat, das dann im Rahmen des europäischen Integrationsprozesses unterschiedliche Modifikationen erfuhr – ein Prozess, der nicht abgeschlossen ist und in Anbetracht augenscheinlicher Renationalisierungstendenzen innerhalb der Europäischen Union Schwierigkeiten mit der eigenen Positionierung nach sich zieht.
Indessen stellt sich die Frage, ob das Ende des Habsburgerimperiums oder die Folgen der „68er“-Studentenbewegung in gewisser Weise Grund zur Freude sind. Darf, sollte oder muss angesichts von konstatierten Demokratisierungs- und möglicherweise auch Liberalisierungsschüben, in Anbetracht der Einführung des Frauenwahlrechtes, des Kampfes gegen ungerechte Einkommensverhältnisse und verkrustete Hierarchien, gegen Militarismus und Fremdenfeindlichkeit, nicht auch – wie im Titel gleichfalls ausgedrückt – „gefeiert“ werden?
Als Mahnung und Jubiläum gleichermaßen scheinen die „Achterjahre“ besonders geeignet zu sein, um längerfristige und widersprüchliche Entwicklungen ins Auge zu fassen. „Umstritten“, „verspielt“ – mit beabsichtigter Tendenz zur Doppeldeutigkeit – und „gefeiert“: Die vorangestellten Begriffe entsprechen der Vielschichtigkeit der Annäherung. Zudem erweisen sich „100 Jahre Republik“ per se als nahezu zwingender Anlass für eine Rückschau auf verschiedenen Ebenen. Unzählige Konferenzen, Fachpublikationen und Ausstellungen, Titelgeschichten, Serien und Dokumentationen in Tageszeitungen, Wochenmagazinen und elektronischen Medien widmen sich den einzelnen Forschungsfeldern. Donaumonarchie, Erste Republik, „Ständestaat“, Nationalsozialismus, Zweite Republik legen Epochengrenzen fest, die wiederum das Bedürfnis nach der Ereignisgeschichte befriedigen. Die „Eckdaten“ stehen im Mittelpunkt. Sozial- und wirtschaftsgeschichtliche Zugänge verweisen indessen schon durch ihre Methodik eher auf Prozesse und Konjunkturen.
Das vorliegende Buch versucht beiden Ansätzen – Geschehnissen von kurzer und Entwicklungen von längerer Dauer – gerecht zu werden. Es besteht daher aus zwei Ebenen. Auf der einen folgt es bestimmten „Verlaufskurven“. In bisweilen essayistischer Form wollten wir ausloten, wie die Österreicherinnen und Österreicher mit ihrer Vergangenheit umgingen, welche Eigendefinitionen und Feindbilder sie pflegten oder welches Verhältnis sie zu „Demokratie“ und „Liberalismus“ entwickelten. Schließlich ging es uns auch um die Vermögensverteilung im 19. und 20. Jahrhundert sowie um die Position des Landes innerhalb internationaler Trends und Kräfteverhältnisse.
Alle diese von Hannes Leidinger verfassten „Längsschnitte“ – hier „Wege durch die Zeiten“ genannt – stellen außerdem Verbindungen zur Gegenwart her. Sie bilden dadurch Rahmen und Anknüpfungspunkte für die zweite Ebene der „Momentaufnahmen“, der „Augenblicke“, denen sich Verena Moritz über die Erinnerungskultur nähert. Zunächst wird deshalb auf zeitgenössische Filmaufnahmen Bezug genommen, zum Teil auf geschichtsmächtige (Lauf-)Bilder, die im sogenannten, nicht unumstrittenen „kollektiven Bewusstsein“ als Weichenstellungen und Zäsuren gespeichert sind beziehungsweise als gespeichert gelten. Das „visuelle Gedächtnis“ ist dann Ausgangsbasis eines Rekonstruktionsversuches, mit dessen Hilfe Vorbedingungen, Verlauf und Folgewirkungen einzelner „Wendepunkte“ erfasst werden.
Ein solches Konzept entzieht sich einer rein chronologischen Narration. Es empfiehlt sich vielmehr, bestimmte Ereignisse und Prozesse mitunter wieder zu thematisieren und aufzugreifen, um sie aus unterschiedlichen Perspektiven und entlang spezifischer Entwicklungslinien mehrmals zu betrachten. Gefragt wird dabei nach Grundzügen der mentalen, kulturellen und ideologischen, sozialen, ökonomischen und politischen Verfasstheit eines Landes, das sich zugleich nicht in den Grenzen einer nationalen Geschichte allein, sondern auch durch lokale und regionale, kontinentale und globale Zusammenhänge erschließt.
Der Schwerpunkt der Texte liegt im Übrigen bei den „Momentaufnahmen“ auf der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Hier ist ungeachtet verschiedener Interpretationen und weltanschaulicher Einfärbungen eine Art Kanonisierung der herausragenden Momente eingetreten. Demgegenüber erscheint die Periode nach 1955 weniger von Zäsuren als von längerfristigen Entwicklungen gekennzeichnet, die wiederum in „Wege durch die Zeiten“ zusammengefasst wurden. Bei Weitem nicht alle Aspekte, die beachtenswert sind, konnten dabei (gleichrangig) berücksichtigt werden. Intendiert waren vielmehr Texte, die als Orientierung zu verstehen sind. Die einzelnen Kapitel sind nicht deshalb eine „short-read“-Lektüre, weil das Gegenteil davon angeblich mehrheitlich als abschreckend wahrgenommen wird, sondern weil eine möglichst kompakte Gesamtdarstellung beabsichtigt war. Fußnoten wurden, den Vorgaben entsprechend, äußerst sparsam gesetzt, weiterführende Literatur findet sich im betreffenden Verzeichnis.
Das Buch folgt rein formal dem Aufbau der von uns 2008 vorgelegten Publikation „Die Republik Österreich 1918/2008 – Überblick, Zwischenbilanz, Neubewertung“. Wohlgemerkt gilt das für die grundlegende Struktur, die Gliederung beziehungsweise den Aufbau des aktuellen Buches, nur partiell aber für die Inhalte. Zehn Jahre später hat eine Unzahl mittlerweile erschienener zusätzlicher Arbeiten und Analysen die gründliche Überarbeitung aller Kapitel nötig gemacht. Hinzu kamen rasante gesellschaftliche Veränderungen: Ein ergänzender Epilog zu den Geschehnissen in der jüngsten Vergangenheit und zur Situation in der Gegenwart wurde ebenso notwendig wie die zum Teil tiefgreifende Modifikation der bisherigen Darstellungen. Ein anderes Buch entstand, das folgerichtig auch einen anderen Titel trägt.
Momentaufnahme:November 1918
Die Szenerie
Der 12. November 1918 ist ein regnerischer Dienstag. Viele sind mit Schirm unterwegs. Langsam bewegt sich die Menge entlang der Ringstraße in Richtung Parlament, wo der Festakt anlässlich der Ausrufung der Republik stattfinden soll. Der Kameramann, der die Szenerie im Auftrag des deutschösterreichischen Staatsrates festhält, scheint fasziniert von den schier unüberschaubaren Menschenmassen. Er zeigt sie uns als ein Meer stecknadelgroßer Köpfe, als eine mit schwarzen Punkten übersäte Fläche, die er in ein Bild zwingen möchte. In anderen Einstellungen sind Gesichter erkennbar. Arbeiter, Uniformierte, Männer mit Spazierstöcken, Frauen mit Hüten und Kopftüchern blicken ernst und in Erwartung dessen, was oben auf der Parlamentsrampe passieren wird. Zigarettenrauch steigt auf. Solche „Nebelschwaden“ sind auszumachen, soweit das Auge reicht. Die Bilder, die eingefangen werden, transportieren eine Stimmung voll Ungewissheit und Spannung. Sie verstärkt sich durch die starren Kamerapositionen. Der Masse wird schließlich ein Einzelner gegenübergestellt. Auf der Skulptur der „Rossebändiger“ ist eine Gestalt auszumachen. Fokussiert wird ein Mann, womöglich ein kommunistischer Agitator, der sich an die Anwesenden zu richten scheint. Sein auf Film gebannter Auftritt verweist auf das Kalkül der „Verführbarkeit“ der Massen und gleichzeitig auf die unterschiedlichen Erwartungshaltungen, die damit verbunden waren.1
Revolution?
Tatsächlich konnte die damalige Stimmung weiter Teile der Bevölkerung als „revolutionär“ wahrgenommen werden. Vor allem in der Hauptstadt. Dennoch verlief die „österreichische Revolution“ alles in allem ruhig. Die „Umwälzung“ vollzog sich im Wesentlichen ohne größeres Blutvergießen.
Die Geschichtsschreibung hat es der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei (SDAP) als Verdienst angerechnet, die Gefahr einer politischen Radikalisierung abgewendet zu haben. Die „Russische Revolution“ hatte sich keineswegs als nachahmenswert erwiesen.2 In diesem Sinne entsprach auch die Eingliederung der „Roten Garde“ in das neue Heer, die Volkswehr, dem Versuch, das revolutionäre Potenzial zu domestizieren. Nichtsdestoweniger erwies sich diese spontan gebildete Gruppe, mit der nicht zuletzt der Name des Journalisten und Autors Egon Erwin Kisch verbunden wird, auch weiterhin als schwer kontrollierbarer und unberechenbarer Faktor. Die „Revolutionäre“, „Schrecken aller Haus-, Auto- und sonstigen Besitzenden“, hatten seit Anfang des Monats für zahlreiche Zwischenfälle gesorgt.3 Aufmerksamkeit erregten die „roten Soldaten“ freilich nicht nur aufgrund von Requirierungen. Eine Abordnung der Garde hatte bereits am 1. November vor dem Parlament eine rote Fahne hochgezogen und die Staatsratsmitglieder bedrängt, für Waffen zu sorgen sowie beispielsweise der freien Wahl von Offizieren zuzustimmen. Eine Aktion der Gardisten, die nach dem Vorbild der Russischen Revolution auf einen gewaltsamen Umsturz abzielte, konnte nicht ausgeschlossen werden. Die allseits wirren Verhältnisse schienen einer derartigen Entwicklung zuzustreben. Ein Volkswehrsoldat, Heimkehrer aus der Gefangenschaft, der in Russland Zeuge der Revolution gewesen war, erzählte nach dem 12. November in einem Bericht der Arbeiter-Zeitung von der Suggestivkraft, die an diesem Tag von den versammelten Menschenmassen auszugehen und Taten zu fordern schien. So als hätten die vor dem Parlament Aufstellung genommenen, verunsichert wirkenden Menschen auf ein Ereignis gedrängt, das konkretere Anhaltspunkte liefern sollte als die Ausrufung einer Republik, von der man nur eine vage Vorstellung hatte.
Die noch nicht einmal zwei Wochen alte Kommunistische Partei Deutschösterreichs (KPDÖ) hatte indes bereits durchaus klare Zielsetzungen vorzubringen. Gefordert wurde die Bildung einer Arbeiter- und Bauernregierung, eine diesbezügliche Proklamation sollte vor dem Parlament am 12. November verlesen werden. Die sozialdemokratische Führung hingegen hatte ihre Anhängerschaft davon überzeugen können, dass schon die Errichtung einer demokratischen Republik als revolutionärer Akt zu begreifen sei. In der Arbeiter-Zeitung bezeichnete man die Einsetzung einer rein sozialistischen Regierung „im gegenwärtigen Augenblick“ als „gefährliches Experiment“. Die ungestümen Arbeiter wurden daran erinnert, dass unter solchen Bedingungen die Industriegebiete von den Bauern „ausgehungert“ würden. Außerdem vertröstete man die Befürworter einer sofort auszurufenden sozialistischen Republik auf die für Februar 1919 angekündigten Wahlen. Spätestens dann werde sich entscheiden, „ob die deutschösterreichische Republik bürgerlich oder sozialistisch werden soll“.4 Dennoch ließen sich revolutionäre Bestrebungen nicht ganz unterdrücken. Gleich zu Beginn des eingangs beschriebenen kurzen Films über die Ausrufung der Republik Deutschösterreich ist ein Transparent zu sehen, das den Schriftzug „Hoch lebe die sozialistische Republik“ trägt und das Zentrum einer Aufnahme von der Parlamentsrampe bildet. Wenige Tage zuvor, am 9. November 1918, hatte der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann in Berlin die „Deutsche Republik“ ausgerufen. Noch am selben Tag proklamierte der spätere Kommunist Karl Liebknecht die „freie sozialistische Republik“. Was sich dann am 12. November in Wien abspielte, zeigt recht deutliche Parallelen zu den Ereignissen im Nachbarland. Der Film, der die Ausrufung der deutschösterreichischen Republik dokumentieren sollte, lieferte Bilder von der Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Vorstellungen über die Zukunft des Landes. Am Ende wird der Fahnenmast vor dem Parlamentsgebäude gezeigt. Ein Windstoß erfasst einen fetzenähnlich verknoteten Stoffstreifen, der anstelle der Staatsflagge befestigt wurde. Diese rote Fahne, die linksradikale Aktivisten hochgezogen hatten, nachdem der weiße Mittelstreifen der rot-weiß-roten Flagge entfernt worden war, verwies auf den überaus brüchigen politischen Konsens, welcher der Republikgründung vorausgegangen war.
Die Monarchie zerfällt
Die Menschen waren über die Zeitungen dazu aufgerufen worden, dem Festakt vor dem Parlament anlässlich der Proklamation der Republik am 12. November 1918 beizuwohnen. Dieses Gebäude hatte bisher die Abgeordneten des österreichischen Reichsrates beherbergt. Noch am 27. Oktober war eine neue kaiserlich-österreichische Regierung gebildet worden. Sie betrachtete sich allerdings nur mehr als eine Art Liquidierungsorgan. Die Ereignisse überstürzten sich. Es schien kaum noch möglich, all die Entwicklungen im In- und Ausland zu überblicken. Schon im September 1918 hatte Thomas Masaryk in Paris einen selbstständigen tschechoslowakischen Staat proklamiert. Kurze Zeit später konstituierten Slowenen, Kroaten und Serben einen Nationalrat. Die Monarchie zerbröckelte, und der Krieg, der auch das Hinterland mit Not und Elend überzogen hatte, ging seinem Ende zu. Darüber aber, wie der Frieden aussehen sollte und welche Gestalt die europäische Landkarte nun annehmen würde, ließ sich nur spekulieren. Manche schienen jedoch die Zeichen der Zeit nicht erkennen zu wollen beziehungsweise interpretierten sie auf ihre Weise.
Dem jungen Kaiser Karl legten seine Berater in Anbetracht der dramatischen Entwicklungen im Herbst 1918 nahe, rasch zu handeln, bevor andere das Heft in die Hand nehmen würden. Der Rat kam viel zu spät. Während der Monarch Mitte Oktober 1918 in einem Manifest „seinen Völkern“ das vage formulierte Angebot einer Umgestaltung Österreichs in einen Bundesstaat machte und damit den aktuellen Entwicklungen hoffnungslos hinterherhinkte, versetzte die Offensive der Alliierten in Italien den k. u. k. Streitkräften den Todesstoß. Die Fronten lösten sich auf. Massen von Soldaten unterschiedlichster Nationalität überfluteten Österreich auf ihrem Weg in die Heimat. Die Kriegsgefangenen – vor allem Italiener und Russen – verließen ihre Lager. Das Land drohte, im Chaos zu versinken. Noch dazu rückten Anfang November deutsche Truppen in Salzburg und Tirol ein. Wenn dieser „Einmarsch“ auch ein kurzes Intermezzo blieb, so zeugt er doch von einer insgesamt unübersichtlichen Situation. Vor diesem Hintergrund lässt sich begreifen, warum von den Gesichtern der Menschen, die am 12. November zum Parlament strömten, nicht zuletzt Skepsis abzulesen ist.
Die Republik entsteht
Mit den neuen Machtverhältnissen waren die meisten wohl nur oberflächlich vertraut. Erst in den letzten Oktobertagen hatte sich die provisorische Nationalversammlung Deutschösterreichs gebildet. An deren Spitze standen der Sozialdemokrat Karl Seitz, der Christlichsoziale Jodok Fink und der Deutschnationale Franz Dinghofer. Etwa eine Woche später konstituierte sich schließlich ein provisorischer Staatsrat, und eine erste deutschösterreichische Regierung, die von Karl Renner angeführt wurde, nahm ihre Tätigkeit auf. Am 3. November 1918 war der Waffenstillstand zwischen der österreichisch-ungarischen Monarchie und den Alliierten abgeschlossen worden. Am 9. November dankte der deutsche Kaiser Wilhelm angesichts der revolutionären Entwicklung im eigenen Land ab, und zwei Tage später unterzeichnete Kaiser Karl eine Erklärung, der zufolge er auf die Teilnahme an den Staatsgeschäften verzichtete. Überdies erklärte er, „im Voraus“ die Entscheidung anzuerkennen, „die Deutschösterreich über seine künftige Staatsform trifft“. Mit diesem Schriftstück, in dem das Wort „Abdankung“ sorgsam vermieden worden war, sah der Staatsrat alle Hindernisse für die Ausrufung der Republik beseitigt. Kaiser Karl verließ das Land allerdings erst Ende März 1919.
Im Gesetz vom 12. November 1918 über die Staats- und Regierungsform heißt es unter Artikel 2: „Deutschösterreich ist ein Bestandteil der Deutschen Republik.“5 In einem der Entwürfe für die provisorische Verfassung war im Übrigen die Bezeichnung „Südostdeutschland“ vorgesehen gewesen, das in Gestalt eines Freistaates beziehungsweise eines „Sonderbundesstaates“ dem Nachbarland angehören sollte. Die genauen Rahmenbedingungen für die Eingliederung in die Deutsche Republik sollten jedenfalls noch gesondert geregelt werden. Doch entsprach es keineswegs den Interessen der Siegermächte, das niedergerungene Deutsche Reich gleichsam mit einem Gebietszuwachs zu belohnen. Frankreich, der alte „Erzfeind“ Deutschlands, hatte an so einer Lösung am allerwenigsten Interesse. Im September 1919 wurden die Weichen für eine eigenständige Existenz der deutschösterreichischen Republik gestellt. Die im Friedensvertrag von Saint-Germain enthaltenen Bestimmungen verlangten dem jungen Staat einen Verzicht auf die Vereinigung mit Deutschland ab. Hinzu kam die Enttäuschung über die territorialen Bestimmungen des Vertrags. Man musste sich mit dem Verlust Südtirols, Deutschböhmens, der deutsch besiedelten Teile Südmährens und des Sudetenlandes abfinden. In Anbetracht des verwehrten Anschlusses und der zurückgewiesenen Ansprüche auf die erwähnten Gebiete stellte sich auch die Frage des Namens für das kleine Land neu. Bevor die Entscheidung für „Österreich“ fiel, erwog Karl Renner unter anderem die Bezeichnung „Norische Republik“.
Der Anschluss
Der per Gesetz zum Ausdruck gebrachte Anschlusswille machte den 12. November 1918 und damit die Ausrufung der Republik rückblickend zu einem belasteten Datum.
Die Absicht, sich Deutschland einzugliedern, lag im November 1918 hauptsächlich im Zweifel an der Existenzfähigkeit des Kleinstaates begründet. Immerhin musste der Zerfall des Habsburgerreiches auch als Verlust eines großen Wirtschaftsraumes begriffen werden, den es zu kompensieren galt. Das Bekenntnis zum Anschluss ist ohne diesen Hintergrund nicht zu verstehen. Der Staatsrat trug also auf der einen Seite ökonomischen Erwägungen Rechnung und agierte andererseits im Trend einer an nationaler Selbstbestimmung orientierten Neuordnung Europas. In Deutschland reagierte man jedoch auf die Absichten der eben erst gegründeten deutschösterreichischen Republik nicht zuletzt in Hinblick auf die eigene schwierige Position bei den Friedensverhandlungen mit den Siegerstaaten zurückhaltend. Im anschlussbereiten Österreich machte sich Verunsicherung breit. Ende November 1918 kündigte Karl Renner im Rahmen einer Staatsratssitzung an, sich nochmals an das deutsche Außenamt zu wenden, da bis dato keine Reaktion aus Berlin eingetroffen sei.
Politisch motivierte Überlegungen, die vor allem in Verbindung mit dem Anschlusswillen der Sozialdemokraten diskutiert wurden, können nicht ausgeblendet werden. Von der Vorstellung eines Zusammenwirkens mit der mächtigen deutschen „Bruderpartei“ ging eine in der Ersten Republik immer wieder debattierte Anziehungskraft auf die „Genossen“ in Österreich aus. Andererseits stand die Sozialdemokratie im Herbst 1918 nicht geschlossen hinter der Entscheidung, die Anbindung an Deutschland zu vollziehen. Dessen ungeachtet gab der für die außenpolitischen Belange der jungen Republik zuständige Sozialdemokrat Otto Bauer dem deutschen Nachbarn zu verstehen, dass das Land wünsche, „sich mit den anderen deutschen Stämmen, von denen es vor 52 Jahren gewaltsam getrennt wurde, wieder zu vereinigen“.6 Bauer erinnerte damit an das Jahr 1866, als sich Preußen im Kampf gegen Österreich durchsetzte und auf die Schaffung des Deutschen Kaiserreiches zusteuerte.
Ebenso wie die Sozialdemokraten beriefen sich auch die Christlichsozialen auf das Selbstbestimmungsrecht. Im Parteiprogramm aus dem Jahr 1926 verlangten sie auf dieser Grundlage „die Ausgestaltung des Verhältnisses zum Deutschen Reiche“.7
1918 ersehnte Otto Bauer die „Wiedervereinigung“. Sie, meinte er, werde „uns […] den Weg zum Sozialismus“ bahnen.8 Im März 1919 hieß es dann in der Schrift „Rätediktatur oder Demokratie?“, die in ein Plädoyer für demokratische Verhältnisse mündete, ohne allerdings eine Rätediktatur „für alle Zeiten“ auszuschließen: „Wenn wir uns einerseits dem großen roten Deutschland eingliedern und andererseits in Gemeinden und Kreisen starke Burgen roter Herrschaft schaffen, führen wir das Proletariat auf sicherem Wege zur Macht.“9 14 Jahre später und als Reaktion auf Hitlers Machtübernahme in Deutschland hat man den Anschlussparagrafen aus dem sozialdemokratischen Parteiprogramm gestrichen. Karl Renner selbst trug jedoch mit seiner befürwortenden Stellungnahme zum „Anschluss“ 1938 wesentlich zum Vorwurf bei, dass großdeutsche Aspirationen der SDAP auch nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten fortgewirkt hätten. Untermauert wurden solche Anschauungen unter anderem mit dem Verweis auf die Zertrümmerung der Sozialdemokratie durch das Regime von Kanzler Engelbert Dollfuß und die daraus abgeleitete Neuorientierung eines Teiles der Arbeiterschaft in Richtung NS-Ideologie. Die seit dem Februar 1934 illegalen Sozialdemokraten appellierten noch im selben Monat an die Arbeiter, sich „nicht aus Haß“ gegen Dollfuß „von den Nazis einfangen“ zu lassen. „Eine Naziherrschaft in Österreich“, warnte man damals, „könne dauerhafter, innerlich fester und darum gefährlicher sein als die Diktatur des blutigen Palawatsch des Austrofaschismus.“10
Die Geschichtswissenschaft hat auf die Notwendigkeit, sich mit der lange Zeit tabuisierten Frage des Verhältnisses zwischen Sozialdemokratie und Nationalsozialismus auseinanderzusetzen, reagiert. Demgegenüber war offenkundig der Patriotismus des „austrofaschistischen“ Regimes betont worden, das umso überzeugter vor allem als Bollwerk gegen Hitler beschrieben werden konnte. Die mit dem Jahr 1933 einsetzende autoritäre Politik sowie die daraus resultierenden Folgen für das innenpolitische Klima wurden vor diesem Hintergrund gewissermaßen als hinzunehmende „Kollateralschäden“ dargestellt. Der Wille, die Souveränität des Landes zu erhalten, und der Widerstand gegen eine völlige Vereinnahmung durch Hitler-Deutschland wurden zu Anhaltspunkten für eine generelle oder zumindest weitestgehende Pardonierung des Regimes. Darüber hinaus erwiesen sich bestimmte Verhaltensweisen seitens der Sozialdemokraten als denkbar untauglich, um solchen Interpretationen entgegenzuwirken. Karl Renner distanzierte sich zwar später von seinen Aussagen pro „Anschluss“, die er 1938 getroffen hatte, blieb aber eine prinzipielle und unmissverständliche Korrektur des Gesagten schuldig. Der problematische Umgang mit den „Ehemaligen“ etwa von Langzeitkanzler Bruno Kreisky in den 1970er-Jahren verwies dann einigermaßen deutlich auf Lücken im Zusammenhang mit der Aufarbeitung der Vergangenheit. Den „braunen Flecken“ der Sozialdemokratie, die sich nach 1945 in Form einer unhinterfragten Integration ehemaliger NS-Mitglieder zeigten, widmete man sich innerhalb der Partei lange Zeit nur zögerlich. Dem „Willen zum aufrechten Gang“ – so der Titel einer 2005 publizierten „Offenlegung der Rolle des BSA [heute: Bund sozialdemokratischer AkademikerInnen] bei der gesellschaftlichen Reintegration ehemaliger Nationalsozialisten“ – folgten allerdings nur wenige darüber hinausreichende Initiativen eines kritischen Rückblicks. Die Frage, ob das Thema „braune Flecken“ im Hinblick etwa auf andere Parteien erschöpfend behandelt wurde, stand bald ebenfalls zur Diskussion. Im Frühjahr 2018 wurde eine Studie „Zur Repräsentanz von Politikern und Mandataren mit NS-Vergangenheit in der Österreichischen Volkspartei 1945–1980“ publiziert.11 Eine Historikerkommission soll indessen der FPÖ zu einem neuen Umgang mit ihrer Geschichte verhelfen.
Panik vor dem Parlament
Belastet wirkt der 12. November 1918 aber nicht bloß im Zusammenhang mit der Anschlussproblematik. Im Zuge der Feierlichkeiten anlässlich der Ausrufung der Republik kam es zu Tumulten. Schon der erste Zwischenfall, das Hochziehen der roten anstatt der rot-weiß-roten Fahne, begleitet von empörten Pfuirufen ebenso wie von stürmischem Beifall, hatte Unruhe in den Ablauf des Festaktes gebracht. Nur mit Mühe konnte sich Staatskanzler Renner, der sich an die versammelten Menschen wandte, Gehör verschaffen. Nicht anders erging es den übrigen Rednern. Nachdem Karl Seitz gesprochen hatte, machten sich auf der Rampe immer mehr Rotgardisten bemerkbar. Als sich schließlich die Abgeordneten in das Parlamentsgebäude zurückziehen wollten, wurden sie von mehreren Männern attackiert, die erregt Einlass forderten. Der Kommunist Karl Steinhardt war in Begleitung von Rotgardisten erschienen, um den Staatsrat mit der Forderung nach Bildung einer Arbeiter- und Bauernregierung zu konfrontieren. Die Gardisten konnten nur kurzfristig zurückgedrängt werden. Dann wurden Fenster mit Gewehrkolben eingeschlagen und die hohe Glastür, die in die Säulenhalle des Parlaments führte, zertrümmert. Plötzlich hieß es, ein Schuss sei abgegeben worden. Aus den Presseberichten der kommenden Tage ging hervor, dass die Rotgardisten vermeinten, es sei aus dem Parlament gefeuert worden. Angeblich war beim Herablassen eines Rollbalkens ein Geräusch entstanden, das mit dem Krachen eines Schusses verwechselt wurde. Außerdem hatten Teilnehmer der Kundgebung das Gerücht verbreitet, auf dem Dach des Parlaments seien Maschinengewehre in Stellung gebracht worden. Vermutlich hatte man das Stativ eines Kameramannes, der die Feierlichkeiten filmte, irrtümlich für eine Gewehrvorrichtung gehalten. Daraufhin eröffneten mehrere Gardisten das Feuer. „Das Schießen“, hieß es später in den Zeitungen, dauerte mehrere Minuten. Karl Seitz konnte schließlich eine Abordnung der Volkswehr davon überzeugen, dass sich im Parlament keineswegs bewaffnete „reaktionäre Putschisten“ verschanzt hatten. Tatsächlich wollten wohl einige an einen monarchistischen Gewaltakt glauben, der die Aktion der Rotgardisten als Verteidigungsmaßnahme erscheinen ließ. Umgekehrt ergab sich das Bild, dass man am 12. November Zeuge eines geplanten kommunistischen Putschversuches geworden war. In der Folge wurden mehrere Kommunisten verhaftet.
Die Schüsse hatten die Anwesenden in Panik versetzt. „In wilder Flucht“, berichtete die Arbeiter-Zeitung am nächsten Tag, drängten die Menschen Richtung Burgtheater und Bellaria. Hilferufe von Frauen und Kindern wurden laut, viele der Fliehenden wurden zu Boden gerissen. In den Krankenhäusern mussten Dutzende Verletzte versorgt werden. Für zwei, einen Knaben und einen etwa 40-jährigen Mann, kam jede Hilfe zu spät. Man hatte sie förmlich zu Tode getrampelt.
Arthur Schnitzler notierte anlässlich der Ereignisse vom 12. November 1918 in sein Tagebuch: „Ein welthistorischer Tag ist vorbei. In der Nähe sieht er nicht sehr großartig aus.“12
Konfliktzonen
Viele betrachteten die Republik als ein „Kind der Schande“. Die Christlichsozialen hatten sich überdies nur zaghaft von ihrem ursprünglichen Wunsch gelöst, die Monarchie beizubehalten. In der Reichspost fielen jedoch deutliche Worte: „Mit dem alten System, das das ungeheure Weltgeschehen nicht zu überleben vermochte, muß auch die Fäulnis verschwinden, die es durchfressen hatte und seinen Zusammenbruch verschuldete.“13
Nichtsdestoweniger führten die Ereignisse am 12. November vor Augen, dass die Einigung auf die Formel „Republik“ keineswegs eine Überwindung unterschiedlicher politischer Bestrebungen und Zielsetzungen nach sich gezogen hatte. Noch dazu wurde deutlich, dass die Entscheidung für die Republik als reversibel angesehen wurde. So schlug die Reichspost bereits am 15. November vor, „das Volk“ möge in einem „Referendum“ darüber abstimmen, ob es nicht doch lieber in einer Monarchie leben wolle. Zunächst aber müsse sich, hieß es damals, in den Wahlen zur Nationalversammlung entscheiden, ob Deutschösterreich ein „nach christlich-germanischen Kultur- und Gesellschaftsidealen geordneter Rechtsstaat“ werden solle oder aber ein „Gemeinwesen, in dem Kommunismus, Bolschewismus, freimaurerische Altarstürmerei und deutschwidriges jüdisches Assimilantentum sich austoben“ werden.14 Das „Gespenst der Revolution“ geisterte durch den gesamten Wahlkampf 1919. Als bestimmendes Element erwies sich auch der Antisemitismus. Konkret bezog er sich auf zwei spezifische Feindbilder: auf sozialistische beziehungsweise kommunistische „Umstürzler“ und „Unruhestifter“ ebenso wie auf die Repräsentanten des „jüdischen Großkapitals“. Letzteren galten auch die Angriffe der Sozialdemokraten, und zwar vor allem in Zusammenhang mit deren Kritik an den „Kriegsgewinnlern“. Darüber hinaus polarisierten die höchst unterschiedlichen Anschauungen der beiden „Großparteien“ in Hinblick auf die Bedeutung der Religion. Hier boten nicht zuletzt die Bestrebungen der Sozialdemokraten bezüglich einer Eherechtsreform und der damit verbundenen Änderung gültiger Regelungen bei Scheidungen Anhaltspunkte für eine emotionell aufgeladene Gegenpropaganda. Da Volkswehrtrupps und Abordnungen der „Roten Garde“ in den Wochen vor dem Urnengang immer wieder Gottesdienste störten oder aber auf andere Weise gegen die katholische Kirche protestierten, schienen sich die Befürchtungen der Christlichsozialen, die im Falle eines sozialdemokratischen Wahlsieges vor der Zertrümmerung der katholischen „Sittenlehre“ warnten, zu bestätigen.
Was folgte, war eine Koalition zwischen Sozialdemokraten und Christlichsozialen, die bis zur Jahresmitte 1920 hielt. Trotz des Wahlerfolgs der SDAP hatte sich die „Stimmzettelrevolution“ als Illusion erwiesen. Die Partei tat sich schwer, der eigenen Anhängerschaft die Koalition mit dem „Klassenfeind“ zu erklären. Auf der anderen Seite wollte man gegenüber den Christlichsozialen einen glaubwürdigen Verhandlungspartner abgeben. „Man entschied sich schließlich für einen Weg revolutionärer Phrasen und der Inangriffnahme sozialpolitischer Probleme.“15
Bereits in den ersten Monaten des Bestehens der Regierung zeigte sich jedoch deutlich, dass revolutionäre Bestrebungen noch lange nicht abgeflaut waren. Im April und im Juni 1919 erschütterten blutige Unruhen, sogenannte „Kommunistenkrawalle“, die Hauptstadt. Die Anziehungskraft der Kommunistischen Partei ging erst ab der zweiten Jahreshälfte zurück, um dann allerdings völlig zu schwinden. Die KP versank in der Bedeutungslosigkeit. Währenddessen trat eine ganze Reihe bahnbrechender Sozialgesetze in Kraft, die den revolutionären Druck zusätzlich eindämmten.
Ein Referendum über die Frage, ob Republik oder Monarchie, so wie es von der Reichspost vorgeschlagen worden war, fand nicht statt. Im Gesetz vom 21. Oktober 1919 über die Staatsform wurde das Bekenntnis zu einer „demokratischen Republik“ noch einmal abgelegt.16
Erinnerung und Gedenken
Die Geburtsstunde der Republik wurde von den geschilderten dramatischen Vorfällen – Schießerei und anschließende Massenpanik – überschattet. Die Ereignisse des 12. November schienen auf eine Zwangsläufigkeit der kommenden, von Parteienzwist und Gewalt dominierten Entwicklung Österreichs hinzuweisen.
In der Ersten Republik waren es vor allem die Sozialdemokraten, welche die Erinnerung an den 12. November aufrechterhielten. Bezeichnenderweise besteht das Republikdenkmal, das 1928 neben dem Parlament errichtet wurde, aus einem Ensemble von Büsten dreier sozialdemokratischer Politiker. 1933 ließ die Regierung unter Engelbert Dollfuß Aufmärsche und Kundgebungen anlässlich des Jahrestages der Republikgründung verbieten. Im Jahr darauf wurde das erwähnte Denkmal verhüllt. Die Erinnerung an den 12. November, der im Frühjahr 1919 gemeinsam mit dem 1. Mai per Gesetz zu einem „Ruhe- und Festtag“ erklärt worden war, hatte im „Ständestaat“ keinen Platz mehr.
Als dann in der Zweiten Republik nach einem Datum für den Staatsfeiertag gesucht wurde, stand schließlich auch der 12. November zur Debatte. Doch die Republikgründung 1918 galt nach wie vor als belastet. Als Symbol für einen gedeihlichen Neuanfang eignete sich der 12. November offenbar nicht, wobei er auch „wegen der ungünstigen Wetterlage, die um diese Zeit gewöhnlich herrscht“, abgelehnt wurde. Der November, hieß es, sei für „festliche Veranstaltungen“ eher problematisch. 20 Jahre später entschied man sich dennoch für einen Tag im Herbst: 1965 wurde der 26. Oktober als Nationalfeiertag eingeführt – und mit diesem Datum, mit dem man der Erklärung der „immerwährenden Neutralität“ im Jahr 1955 gedachte, der Rückgriff auf die Erste Republik vermieden.17
2008 widmete sich unter anderem eine Ausstellung im Parlament 90 Jahren Republik. Zehn Jahre später sind es nicht zuletzt die beiden „Häuser der Geschichte“ in St. Pölten und Wien, die 100 Jahre zurückblicken – auf die Geschichte eines „Landes mit Eigenschaften“.18
Momentaufnahme:Juli 1927
Das Auge der Kamera
Dunkle, mächtige Rauchsäulen steigen auf. Der Justizpalast brennt. Menschen drängen in das Gebäude hinein, andere verlassen es hastig. Aktenbündel und Bücher werden aus dem Fenster geworfen. Durch die Luft wirbeln Papiere. Einige fallen in kompakten weißen Schwärmen zu Boden, andere schweben einzeln langsam abwärts. Der Rauch wird dichter. Aus den Fenstern des Justizpalastes züngeln grelle Flammen. Ein dünner Wasserstrahl schießt in die Höhe. Die Löschversuche der Feuerwehr wirken hilflos. Die Kamera zeigt uns das lodernde Flammenmeer, das vom Dachstuhl Besitz ergriffen hat. Stunden sind vergangen. Das Gebäude ist nicht mehr zu retten. Noch immer sind Kameraleute vor Ort, um mitzuverfolgen, wie die zerstörerische Gewalt des Feuers wütet. Umrahmt werden die Bilder des brennenden Justizpalastes vom Schwarz der Nacht, die inzwischen angebrochen ist. Das in Flammen stehende Gebäude erscheint inmitten der Finsternis wie ein flackerndes Mahnmal.
Das vorhandene Filmmaterial vermittelt aber auch Eindrücke von den Geschehnissen des Tages. So wird etwa die Menschenmenge am Platz vor dem Justizpalast in verschiedenen Bildern fassbar. Der Kameramann Rudi Mayer hat seine Apparatur im Dachatelier einer Filmfirma, unweit des Justizpalastes, in Position gebracht. Noch ein weiterer Kameramann filmt die Vorgänge am Schmerlingplatz unter anderem von einem Dach aus. Beide sind nahe genug, um die Ereignisse mitzuverfolgen, aber auch zu weit vom Schauplatz entfernt, um Einzelheiten festhalten zu können.
Die anwesende Masse gebärdet sich, so scheint es aus der Distanz, nicht aggressiv, eher neugierig, nervös abwartend, vielleicht unberechenbar, zum Teil aber auch völlig unbeeindruckt von dem, was sich vor ihren Augen abspielt. Einige wirken wie zufällig in den Trubel geraten und würdigen den in Brand gesetzten Justizpalast nur eines kurzen, fast desinteressierten Blickes. Ein junger Mann mit Fahrrad jedoch scheint „extra“ gekommen zu sein, um das Spektakel aus der Nähe zu sehen oder um womöglich ebenfalls in den Justizpalast einzudringen und sich am Zerstörungswerk zu beteiligen. Dann rücken die Polizeieinheiten näher. Als Schüsse fallen, fliehen die Menschen in alle Richtungen. Manche sind unentschlossen, wohin sie laufen sollen. Andere wiederum bleiben einfach stehen. Die ganze Tragweite des Geschehens wird wohl erst begriffen, als die Ersten zu Boden sinken, Tote und Verwundete liegen bleiben. Doch dann formiert sich die Menge wieder, um vorzudringen, kurz danach zurückzuweichen und am Ende erneut die Flucht zu ergreifen. Der „Wiederholungszwang“ der Masse, von dem später der Schriftsteller Elias Canetti als prominenter Augenzeuge berichtet, scheint durch die Filmaufnahmen bestätigt zu werden. Es entsteht der Eindruck von der Unbeugsamkeit einer quasi unbelehrbaren Menge. Andererseits wird selbst bei oberflächlicher Analyse des erhalten gebliebenen Filmmaterials deutlich, dass immer wieder dieselben Szenen am Schneidetisch aneinandergefügt wurden. Noch im Sommer 1927 sind diese Aufnahmen im Kino zu sehen. Verstärkt durch die gewählten Zwischentitel verdichtet sich die solcherart präsentierte filmische Dokumentation der Ereignisse tendenziell zur Botschaft vom geschehenen Unglück. In Anbetracht der Gefahr, das Kinopublikum mit krassen Gewaltszenen womöglich zu verstören oder die Menschen aufs Neue in Erregung zu versetzen, ist anzunehmen, dass man nicht alles zeigte, was gefilmt wurde. In den Augen der Sozialdemokraten belegten die Aufnahmen die unverhältnismäßige Gewalt der Exekutive. Für die Regierung hingegen galt das Filmmaterial gleichsam als Beweis für die Tobsucht eines brandschatzenden Mobs, dem nur durch hartes Eingreifen beizukommen war.1
Schattendorf
Die sogenannten „Schreckenstage“ des 15. und 16. Juli 1927 in Wien fordern 89 Todesopfer und zahllose Verletzte. Geschäfte, Zeitungsredaktionen und Polizeiwachstuben sind verwüstet. In der Presse ist vom „Schlachtfeld des Bürgerkriegs“ die Rede.2 Der Schock sitzt tief. Der christlichsoziale Bundeskanzler Prälat Ignaz Seipel wird kurze Zeit später im Rahmen einer Sondersitzung des Nationalrates von der „verwundeten Republik“ sprechen und gleichzeitig betonen, dass die Polizei ihre Pflicht erfüllt hat. Und er sagt: „Verlangen Sie nichts vom Parlament und von der Regierung, das den Opfern und Schuldigen an den Unglückstagen milde erscheint.“ Diese Milde könnte, erklärt Seipel, von jenen, die sich den Demonstranten angeschlossen hatten, um zu plündern und Häuser in Brand zu stecken, als Schwäche missverstanden werden.3 Für die Sozialdemokraten ist er von nun an der „Prälat ohne Milde“ und Polizeipräsident Johann Schober ein „Arbeitermörder“. An die 600 mit Bundesheerkarabinern ausgerüstete Polizisten hatte Schober gegen die Demonstrierenden aufmarschieren lassen. Unerfahrene Schulmannschaften waren es, die in die Menge feuerten. Die verwendete Scheibenschussmunition verursachte bei den Opfern ähnlich schwere Verletzungen wie die berüchtigten Dumdumgeschosse. 85 der insgesamt 89 Todesopfer, welche die blutigen Ereignisse des Juli 1927 gefordert hatten, sind Zivilisten gewesen.
Während Seipel das Vorgehen der Polizei mit dem Verweis auf eine außer Kontrolle geratene Meute rechtfertigt, bezeichnet die Arbeiter-Zeitung die „Säuberungsmaßnahmen“ der Exekutive als „grausame Jagd auf Wehrlose“. Arbeiter und Arbeiterinnen seien von den bewaffneten Polizisten „wie die Hasen abgeschossen worden“.
Schüsse waren es auch, die gleichsam am Beginn der furchtbaren Exzesse des 15. und 16. Juli 1927 standen. Am 30. Jänner desselben Jahres kam es im kleinen burgenländischen Ort Schattendorf zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen dem Republikanischen Schutzbund, dem bewaffneten Arm der Sozialdemokratie, und Mitgliedern der Frontkämpfervereinigung. Dabei wurden ein achtjähriger Knabe und ein kriegsinvalider Arbeiter getötet. Laut Obduktionsbericht hatten die abgefeuerten Schrotkugeln den Körper des Kindes regelrecht durchsiebt. Auch das andere Opfer war mehrmals getroffen worden. Am „rechten Teil des Hinterhauptes“, so der zuständige Gerichtsmediziner, hatte er „dreiundzwanzig Einschußöffnungen“ feststellen können, wobei ein Projektil „die Kopfschwarte durchdrungen“ und zum Tode geführt hatte.4
Zusammenstöße von paramilitärischen Verbänden waren längst keine Seltenheit mehr. Immer wieder prallten Angehörige der Heimwehr, der bedeutendsten antimarxistischen Wehrorganisation, sowie Vertreter anderer rechtsorientierter Milizverbände auf der einen und Schutzbundabteilungen auf der anderen Seite aufeinander. Die zahlreichen Waffen, die der Aufrüstung der „Privatarmeen“ dienten, gehörten ebenso zum verhängnisvollen Nachlass des Ersten Weltkrieges wie mentale Folgewirkungen. Besorgte Zeitgenossen beklagten die „Verrohung“ der Menschen als Ergebnis des jahrelangen Blutvergießens. Hinzu traten die zahlreichen wirtschaftlichen Probleme der Republik. Not, Arbeitslosigkeit und fehlende Perspektiven begünstigten radikale Tendenzen. Begleitet wurde die fortschreitende Militarisierung der Gesellschaft von einer Sprache der Gewalt, die den Weg zu einer Versöhnung der politischen Lager unmöglich machte und ideologische Gegensätze in den Vordergrund rückte. Die Berichterstattung über die Schattendorfer Ereignisse und den nachfolgenden Prozess gegen drei Frontkämpfer, die als Todesschützen auf der Anklagebank saßen, geriet geradezu folgerichtig zu einem Krieg der Worte.
Eine erklärt antimarxistische Presse lastete die Schattendorfer Tragödie den Schutzbündlern an. Sie hätten die Frontkämpfer, indem sie deren Aufmarsch im Ort verhindern beziehungsweise stören wollten, provoziert und damit auch die tragischen Folgen verschuldet. Die Reichspost beschrieb den sozialdemokratischen Wehrverband als geradezu notorischen Unruhestifter. Wenige Tage vor Ende des Prozesses am Wiener Landesgericht berichtete die Zeitung ausführlich über so bezeichnete „Schutzbündlertumulte in Klosterneuburg“. Sie wurden als jüngstes Beispiel für die Gefährlichkeit und die mangelnde Disziplin der „rotfaschistischen Truppe“ angeführt.5 Die Arbeiter-Zeitung verwehrte sich entschieden gegen derlei „niederträchtige“ Angriffe und empörte sich über die „entstellende“ Einseitigkeit des gesamten Verfahrens. Man wies darauf hin, dass die Schattendorfer Frontkämpfer das Feuer eröffnet hatten, als die Schutzbundeinheiten, begleitet von zivilen Sympathisanten, bereits den Abzug begonnen hatten. Im Übrigen waren durch den Umstand, dass der nationalsozialistische Rechtsanwalt Walter Riehl die Angeklagten vertrat, weitere Polarisierungen vorprogrammiert. Im Zuge des Schattendorfer Prozesses äußerte Riehl noch dazu die Vermutung, dass jenes Projektil, das den Tod des kriegsinvaliden Arbeiters herbeigeführt hatte, womöglich aus der Waffe eines Schutzbündlers stammte. Seine Verteidigungsstrategie zielte darauf ab, den Sachverhalt als schwer rekonstruierbar darzustellen. Riehl berief sich auf den „Wirbel“ und die allgemeine „Aufregung“, die im Zuge der Konfrontation zwischen Schutzbund und Frontkämpferverband entstanden seien. Eine eindeutige Feststellbarkeit der Schuld seiner Klienten hielt er daher von vornherein für unmöglich. Der Plan des Verteidigers ging auf und trug sicherlich nicht unwesentlich zum Zustandekommen des Urteils bei: Alle drei Angeklagten wurden freigesprochen. Die Geschworenen wollten nicht einmal den Tatbestand der Notwehrüberschreitung erkannt haben.
Der Ausgang des Schattendorfer Prozesses fügte sich in eine Reihe ähnlicher Beispiele ein. In den vorangegangenen Jahren waren ausgerechnet im Zusammenhang mit Tötungsdelikten immer wieder umstrittene Urteile gefällt worden. Dabei fiel auf, dass gewalttätige Sozialdemokraten tendenziell härtere Strafen ausfassten als Täter mit anderem politischen Hintergrund. Die Geschworenengerichte, für deren Wiedereinführung im Jänner 1919 sich gerade die Sozialdemokraten stark gemacht hatten, weil sie darin eine „Demokratisierung“ des Gerichtsverfahrens erblickten, erschienen der Linken zunehmend als „Exekutoren der Klassenjustiz“.
„… schweres Unheil …“
Der Urteilsspruch im Schattendorfer Prozess empörte nicht nur Anhänger der Sozialdemokratie. So stellte die Neue Freie Presse am 15. Juli, einen Tag, nachdem die angeklagten Frontkämpfer den Gerichtssaal als freie Männer verlassen hatten, folgende Frage: „Ist niemand da, der darüber erschrickt, dass zwei Leute, ein armer Knabe, ein bedauernswerter Kriegsinvalider, tot gemacht wurden in Schattendorf und dass auch nicht eine geringe Strafe über die verhängt wurde, deren Schüsse sie getötet haben?“6
Noch am selben Tag füllten Tausende die Straßen, um gegen das Urteil zu protestieren. In der Morgenausgabe der Arbeiter-Zeitung hatte Chefredakteur Friedrich Austerlitz von der Grenze der Rechtlosigkeit gesprochen, die nun überschritten worden war. Die „namenlose Schandtat“ sei „ungesühnt“ geblieben, der Glaube an die Gerechtigkeit nachhaltig erschüttert. Es sei zu fragen, ob die „aufreizende Freisprechung von Menschen, die Arbeiter getötet haben“, nicht schon der Bürgerkrieg sei, vor dem „immerzu“ gewarnt werde. Das Urteil des 14. Juli, hieß es, schände „die ganze Rechtsprechung“. Aus „einer Aussaat von Unrecht, wie es gestern geschehen ist“, erklärte Austerlitz abschließend, „kann nur schweres Unheil entstehen“.7 Es nahm seinen Lauf, kaum dass diese Zeilen gedruckt worden waren.
Noch in der vorangegangenen Nacht hatte sich die Belegschaft der städtischen Elektrizitätswerke zum Streik entschlossen. Am Morgen standen die Straßenbahnen still. Gewaltige Demonstrationszüge von Arbeiterinnen und Arbeitern bewegten sich in Richtung Zentrum. „Protest gegen das Schandurteil“ oder „Wir greifen zur Selbsthilfe“ war auf den mitgebrachten Transparenten zu lesen. Der erste größere Zwischenfall ereignete sich bei der Universität. Noch bevor es den aufgebrachten Demonstranten gelang, das Gebäude zu stürmen, konnten die Tore geschlossen werden. Rufe wie „Nieder mit den Arbeitermördern!“ und „Stürmt die Hakenkreuzlerburg!“ wurden laut. Beim Parlament sprengten berittene Polizisten mittels Säbelattacken den Zug der Protestierenden. Augenzeugen berichteten später vom rücksichtslosen Vorgehen auch gegen harmlose Passanten, Frauen und Kinder. Schließlich wurden die ersten Schüsse abgegeben. Immer mehr Demonstranten begannen sich mit verschiedenen Gegenständen zu bewaffnen und schleuderten Pflastersteine, wenn irgendwo eine Polizeiuniform zu sehen war. Das harte Eingreifen der Exekutive wirkte als Provokation. Der Protest gegen das Schattendorfer Urteil schlug um in einen offenen Aufruhr gegen die Staatsgewalt. Als Wachleute Demonstranten verhafteten, kam es zu Handgreiflichkeiten. Eine Polizeistation wurde geplündert und dann in Brand gesetzt, der Feuerwehr der Weg versperrt. Die Gewalt eskalierte. Polizisten wurden misshandelt, Zivilisten niedergeritten und von Pistolenschüssen getroffen. Augenzeugen gaben später an, dass Angehörige der Exekutive auch einen am Boden liegenden Verletzten mit gezielten Kopfschüssen töteten.
Auf den Straßen rund um das Rathaus konnte man Blutspuren ausmachen. Noch bevor Demonstranten in den Justizpalast, Symbol des Unrechts und der Willkür, eindrangen, waren die ersten Todesopfer zu beklagen. Schutzbündler, die ordnend und kalmierend eingreifen sollten, standen auf verlorenem Posten. Immerhin gelang es ihnen, die im Justizpalast eingeschlossenen Zivilisten und Polizisten rechtzeitig zu evakuieren. Indes waren weder der Wiener Bürgermeister Karl Seitz noch Julius Deutsch, Leiter des Schutzbundes, in der Lage, die wütende Menge dazu zu bewegen, die Löscharbeiten anlaufen zu lassen. Einige Demonstranten zerschnitten die Schläuche. Im Palais Epstein, wo der Stadtschulrat untergebracht war, und im Hof des Parlaments sammelten sich mittlerweile zahllose Verletzte. Neben ihnen lagen bereits mehrere, zum Teil verstümmelte Leichen. Auch Sanitäter gehörten zu den Opfern.
Eine Kommission des Wiener Gemeinderates, die später eingesetzt wurde, um die Juliereignisse zu untersuchen, brachte eine Vielzahl einzelner Zwischenfälle zutage, anhand derer das geschilderte Horrorszenario noch drastischer zu zeichnen wäre. In seiner Fackel ließ auch Karl Kraus, der angesichts der Brutalität der Einsatzkräfte den Rücktritt des Polizeipräsidenten Schober gefordert hatte, verschiedene Augenzeugen zu Wort kommen. Sie beschrieben schockierende Details des Massakers. Währenddessen konzentrierte sich die Berichterstattung der Regierungsblätter darauf, die Geschehnisse als Ergebnis vornehmlich krimineller Energien darzustellen. Die Reichspost, deren Redaktionsgebäude im Zuge der Unruhen völlig devastiert worden war, kolportierte das Bild von der „gerechten Notwehr“ einer „heldenmütigen Polizei“. Der Blick verengte sich solcherart auf den „Terror“ des „Abschaums“. Auch die Neue Freie Presse sah „Rowdies“ und „Vandalen“ am Werk, die „Bestie Mensch“, die ihre grausame Fratze gezeigt hatte. Dass sich unter die Demonstranten, die sich als Zeichen des Protestes gegen das Schattendorfer Urteil formierten, auch „zwielichtige Gestalten“, „Lumpen“ und „Gesindel“ gemischt hatten, konnte man allerdings selbst in der Arbeiter-Zeitung nachlesen. Führende Sozialdemokraten sprachen von „Elementen der Tiefe“ und „Taten übler Instinkte“.8
Den Angaben der Polizei entsprechend war mehr als ein Drittel der getöteten Demonstranten vorbestraft gewesen. Solche Informationen bestärkten jene, die sich vorbehaltlos hinter die Maßnahmen der Exekutive stellten. Auf der anderen Seite wurden Letztere hingegen als verbrecherisch und menschenverachtend gebrandmarkt. Anders, hieß es in der Arbeiter-Zeitung, könne „vom blindwütigen Rasen einer tollgewordenen Polizei“ gar nicht gesprochen werden. Theodor Körner, der die Aktion des Schutzbundes zur Rettung des Personals aus dem brennenden Justizpalast geleitet hatte, verwies indessen darauf, dass er unter den Zerstörungswütigen viele „verhungerte Gesichter“ gesehen hatte, Menschen, die offenbar glaubten, nichts mehr zu verlieren zu haben. Doch konnte man 200.000 Menschen, die sich an den Demonstrationen beteiligt hatten, nicht pauschal zu blutrünstigen Aufrührern stempeln. Darüber hinaus galt es aber, sich mit den tiefer liegenden Ursachen für die Gewaltbereitschaft spezifischer Gruppen auseinanderzusetzen. Tatsächlich ereignete sich parallel beziehungsweise überschneidend mit der spontanen Protestaktion der Massen am 15. Juli die Revolte eines sozial verelendeten vorstädtischen Proletariats, die auch am darauffolgenden Tag mit Schießereien, Plünderungen und Verwüstungen einherging. Nicht zu übersehen war außerdem, dass bei alldem den jugendlichen Demonstranten, Burschen ebenso wie Mädchen, eine herausragende Rolle zufiel. Die Juliereignisse lassen sich demzufolge nicht zuletzt als Aufbegehren der Jugend beschreiben.
Ausblick
Den Rücktrittsaufforderungen der Sozialdemokraten, denen mit der Ausrufung eines eintägigen Generalstreiks und eines unbefristeten Verkehrsstreiks Nachdruck verliehen wurde, kam Bundeskanzler Seipel nicht nach. Unterstützung erhielt er von den Heimwehren, welche die Juliereignisse als Manifestation „marxistischer Revolutionsgelüste“ betrachteten. Die Gräben zwischen den politischen Lagern vertieften sich. Das Einlenken der Sozialdemokratie, die von der Dynamik der Julitage überrascht worden war, interpretierten die antimarxistischen Kräfte nicht zuletzt als Schwäche. Tatsächlich offenbarte der Umstand, dass die Parteizentrale der SDAP beziehungsweise die Arbeiter-Zeitung Emotionen geschürt hatten, ohne auf die Konsequenzen vorbereitet zu sein, die Neigung zu prinzipiellen Fehldiagnosen in der Einschätzung der eigenen Anhängerschaft.
Die Heimwehren mit ihrer antiparlamentarischen und antidemokratisch-faschistischen Stoßrichtung erlebten in weiterer Folge einen Aufschwung. Gleichzeitig stand auch die Sozialdemokratie schon lange vor den Juliereignissen unter Verdacht, die „Herrschaft“ des Volkes zugunsten einer „Diktatur des Proletariats“ kippen zu wollen. Im Sommer 1927 lehnte man nichtsdestoweniger eine „Fortsetzung des Blutvergießens“ ab und verwies auf die fatalen Konsequenzen eines Bürgerkrieges. Der Kampf gegen das „mörderische Regime der Bourgeoisie“ müsse vielmehr mit einer noch intensiveren „Hingabe an die Arbeiterbewegung“ verknüpft werden.9 Die Argumente, die angeführt wurden, um die Arbeiterschaft zu beruhigen, glichen zum Teil jenen, die man im November 1918 vorgebracht hatte, um die „Räterepublik“ abzuwehren. Jetzt benannte man allerdings die „Faschisierung“ des Landes nach dem Beispiel Italiens als eine der größten Gefahren. In der Folge geriet die Sozialdemokratie immer mehr in die Defensive und erlag gleichzeitig einer verhängnisvollen Selbsttäuschung, indem sie, die Bedeutung der Machtverhältnisse im Roten Wien überschätzend, ihren Handlungsspielraum falsch beurteilte. Der Juli 1927 gilt in diesem Zusammenhang als wesentlicher Faktor für die nachfolgende Orientierung der Partei. Der damalige Verzicht auf weitere, gegen die Regierung gerichtete Maßnahmen leitete den schleichenden Verlust ihrer Glaubwürdigkeit gegenüber der Arbeiterschaft ein. In Erwartung einer „besseren Zukunft“ bediente man sich der Rhetorik eines unbefriedigenden Attentismus und ersetzte konkrete Aktionen durch scheinrevolutionäres Pathos. Der „Sieg des Sozialismus“, den die Partei versprach, stellte sich allmählich als allzu ferne Zukunft dar.
Was bleibt vom Juli 1927?
Schriftsteller wie Heimito von Doderer oder Elias Canetti verarbeiteten die Juliereignisse literarisch. Historiker haben sich in Hinblick auf ihre herausragende Bedeutung für die weitere Entwicklung der Ersten Republik intensiv mit den Geschehnissen beschäftigt. Dennoch scheint die Bedeutung der „Wiener Schreckenstage“ im Bewusstsein einer breiteren Öffentlichkeit eher schwach verankert. Der sieben Jahre später stattfindende Bürgerkrieg warf seine Schatten voraus. Sie legten sich im Nachhinein auf jene Ereignisse, die ihn gleichsam eingeläutet hatten, und tauchten die Julitage 1927 in ein Dunkel, das nur hie und da bei runden Jahrestagen ein wenig aufgehellt wird. 2017 nahm sich das Innenministerium in einer Ausstellung des Themas an. Eine ausgewogene und zugleich detaillierte Darstellung der damaligen Ereignisse stand hierbei für das veritable Bemühen, demokratiepolitische Fehlentwicklungen zu benennen und einer größeren Öffentlichkeit sowie explizit der Exekutive die fatalen Folgen einer auf die Straße getragenen Politik der Konfrontation vor Augen zu führen.10
Wege durch die Zeiten:„Altlasten“ oder: Die Schatten der Vergangenheit
Die Toten von Lambach
Die spätere Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek war aufgebracht. „Ich bin“, sagte sie, „im Grunde ständig tobsüchtig über die Verharmlosung“ der Vergangenheit.1 Als unmittelbarer Anlass für die Verärgerung erwies sich der Arbeitsbeginn an einem in Oberösterreich, in der „Lambacher Au“, geplanten Wasserkraftwerk während der Wintermonate 1995/96. Hatten sich die Projektbefürworter bislang mit Umweltschützern herumschlagen müssen, so schien nun auch die Geschichte Schwierigkeiten zu machen. Skelette waren zum Vorschein gekommen. „Solche ‚Knochen‘ würde ja fast jeder ‚Häuslbauer‘ finden“, bemerkte dazu der damalige oberösterreichische Landeshauptmann Josef Pühringer, der, wie das Nachrichtenmagazin profil befand, „von Pietät offenbar nicht angekränkelt“ war, als es galt, Forderungen nach einer Bauverzögerung vom Tisch zu wischen.2
Längst aber geriet die ganze Causa außer Kontrolle. Experten trafen ein. Ihrem Kompetenzbereich entsprechend gelangten sie zu unterschiedlichen Ergebnissen. Der vom Innenministerium beauftragte „Umbetter von Kriegsgräbern“ reklamierte die sterblichen Überreste gewissermaßen für sich: „Es sind Angehörige der deutschen Wehrmacht, die 1945 im amerikanischen Auffanglager verstorben sind“, hieß es in den Oberösterreichischen Nachrichten am 2. Februar 1996. Nur drei Tage früher ließ der Sachverständige der Israelitischen Kultusgemeinde verlautbaren, dass es sich bei dem Fundort um ein Massengrab jüdischer KZ-Häftlinge handeln dürfte. „Da war vielleicht ein KZ, denn es gab dort überall KZs und Außenstellen von KZs“, mutmaßte auch Jelinek und fügte hinzu: „Da wurden ungarische Juden durchgetrieben und von den Einwohnern erschlagen, auch noch nach dem Friedensschluß. Es gab eine ungeheure Brutalität der Landbevölkerung gegenüber diesen ausgemergelten und schon fast verhungerten Menschen.“3
Die Presse stürzte sich auf das Thema, während Prähistoriker des Linzer Landesmuseums das Kraftwerksareal systematischer zu untersuchen begannen. Die ersten Grabschächte, erkannten sie, hatte man „ordentlich“ in einer Reihe angelegt und „sorgfältig“ in den Flussschotter eingetieft. Im rechten Winkel dazu aber wurden Gruben gefunden, die „randvoll“ mit „sorglos“, ja „brutal hingeworfenen“ Leichen gefüllt waren. Anthropologische Analysen der Gebeine sowie die Bestimmung der Kleinfunde erbrachten ein eindeutiges Resultat. Die „Toten“ lagen seit mehr als 300 Jahren in der „Au“. Schriftquellen räumten letzte Zweifel aus. Aufständische Bauern hatten im Oktober 1626 Lambach belagert. Gefallene waren von ihnen anfangs noch selbst bestattet worden, daher die „Sorgfalt“ bei der ersten Grabanlage. Dann aber hatten sich die kaiserlichen Truppen durchgesetzt. Es sei „hart hergegangen“, heißt es in den überlieferten Dokumenten, „600 Rebellen“ sollen umgebracht worden, die Auheide ganz „schwarz“ vor Toten gewesen sein. Die Leichen waren von Ortsbewohnern und „Kaiserlichen“ in der Folge gründlich beraubt und in Gruben geworfen worden. Unbrauchbares Gerümpel des „bäuerlichen Lagers“ war über den Bestatteten gestapelt und angezündet worden. Deshalb entdeckten die Linzer Archäologen auf den Massengräbern eine „Brand-Asche-Schicht“. Am 18. März 1996 vermerkte das Magazin profil: „Plötzlich interessieren die Lambacher Skelette keinen mehr, seit sie 370 Jahre alt“ sind.4
Zeitstau
Die oberösterreichischen Prähistoriker fühlten sich angesichts der allgemeinen Gleichgültigkeit zu einigen persönlichen Nachbetrachtungen berufen. In einer alles andere als „knochentrockenen“ Sprache fügten sie ihrem Grabungsbericht folgende Schlussbemerkungen hinzu: Bei Lambach liegen die „bleichen Knochen einer blühenden Jugend, die bereit war, für einen winzigen Bruchteil jener Freiheit auszubluten, wie sie jeder Angehörige unseres Staates inzwischen längst in gedankenloser Selbstverständlichkeit genießen darf […]. Gab es innerhalb des Millenniums nicht auch so manch Unbewältigtes, das man nur allzugerne beiseiteschob und zugunsten bequemer wohlstandsgesättigter Friedhaftigkeit einfach vergaß?“5
Die Forscher spielten auf die Tausendjahrfeiern an, für die sich Österreich gerade rüstete. Eine groß angelegte Schau war geplant. Bei dieser Gelegenheit wurde allerdings festgehalten, dass die beurkundete Schenkung von Otto III. an den Freisinger Bischof, in der es um ein Gebiet ging, das im Volksmund „Ostarrichi“ hieß, im Grunde wenig jubiläumsverdächtig sei. Als man im November 1946 dennoch auf die damals 950 Jahre alte Urkunde zurückgriff, war dieses Gedenken allerdings ein weiterer Gründungsakt der Zweiten Republik gewesen. Sie wollte sich damit zur Kleinstaatlichkeit bekennen und den habsburgischen und reichsdeutschen Großmachtphantasien abschwören.6
Der Rückgriff auf die Babenberger, mit dem schon vor 1938 das kleinere Österreich bejaht werden sollte, bedeutete gleichzeitig eine Hinwendung zu einem eher unproblematischen Mittelalter, gemessen an den traumatischen Erfahrungen zweier Weltkriege. Seit den 1980er-Jahren aber meldete sich das „Katastrophenzeitalter“ mit aller Vehemenz zurück. Die kurze Phase zwischen 1938 und 1945 zog nun beinahe die gesamte Aufmerksamkeit einer geschichtsinteressierten Öffentlichkeit auf sich.