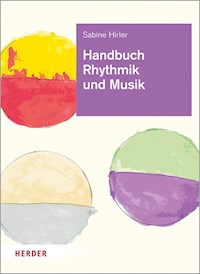
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Musik und Rhythmik stellen in der frühen Kindheit entwicklungsrelevante Bildungsbereiche dar. Angebote mit Musik, Bewegung, Sprache und Materialien geben Impulse zur Entwicklung von vielfältigen Transferkompetenzen. Das ,Handbuch Musik und Rhythmik' vermittelt in diesem Zusammenhang grundlegendes, differenziertes und weiterführendes Wissen in Theorie und Praxis für die Arbeit in der Kindertagesstätte. Es beschreibt, wie Musik und Rhythmik konzeptionell in die Kita integriert werden können. Grundlagenwissen in den Bereichen Entwicklungs- und Musikpsychologie, die Vorstellung von Musikkonzeptionen sowie der methodisch-didaktische Einsatz von Bildungsangeboten machen das Buch komplett.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 349
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Titel
Impressum
Inhalt
Vorwort
1 Musik – ein Medium mit vielen positiven »Nebenwirkungen«
1.1 Sozial-emotionale und sprachliche Entwicklungsförderung durch Musik
1.1.1 »Bindungsverstärker« Musik
1.1.2 Musik und Sprachentwicklung
1.2 Musik und Gehirn – Musik und Kognition
1.2.1 Transfereffekte und Musik
1.2.2 Gehirnreifung und musikalisches Lernen
1.3 Entwicklungsfenster im Bildungsbereich Musik
1.3.1 Psychologische Aspekte der musikalischen Entwicklung des Kindes
1.3.2 Die musikalischen Entwicklungsfenster unter entwicklungspsychologischen und pädagogischen Aspekten
1.3.2 Dokumentation von Entwicklungsschritten durch Rhythmisch- musikalische Angebote
2 Die Entwicklungsgeschichte frühkindlicher Musikpädagogik und Rhythmik
2.1. Frühe Wegbereiter der Pädagogik und der Stellenwert der Musik
2.2 Von der frühkindlichen zur elementaren Musikpädagogik
2.3 Die Entstehung der Rhythmik und ihre wichtigsten Vertreter
2.3.1 Emile Jaques-Dalcroze (1865–1950), Begründer der Rhythmik
2.3.2 Entwicklung der Rhythmik nach Hellerau
2.4 Carl Orff – seine Verdienste in der Entwicklung der Elementaren Musikpädagogik
3 Musikalische Bildung in der Frühen Kindheit
3.1 Erziehung durch und zur Musik
3.1.1 Musikalische Bildung in der Rhythmik
3.2 Musikalische Bildung und Rhythmik in den Bildungsplänen
3.3 Basiswissen zur Umsetzung des Bildungsbereichs Musik in der Kita
4 Institutionelle und didaktische Rahmenbedingungen
4.1 Die institutionellen Rahmenbedingungen in der Ausbildung
4.2 Die Rolle von pädagogischen Fachkräften und ihre pädagogischen Handlungskompetenzen
4.3 Die pädagogischen Handlungsfelder im Kontext von Musik und Rhythmik
4.3.1 Die pädagogische Fachkraft als Prozessbegleiterin in den sechs pädagogischen Handlungsfeldern
4.4 Institutionelle Rahmenbedingungen der Einrichtung
4.4.1 Raumgestaltung
4.4.2 Instrumente – Ausstattung und Einsatz in der Einrichtung
4.4.3 Rhythmikmaterialien und Medien
4.4.4 Musik in der Kita – eine kritische Würdigung technischer Medien zur Tonwiedergabe
5 Singen mit Kindern
5.1 Sozialisation durch Musik und Gesang
5.2 Das Kinderlied – gestern und heute
5.3 Singen – eine komplexe Fähigkeit
5.4 Die Kinderstimme
5.5 Das Kinderlied in der pädagogischen Praxis
5.6 Die Liedvermittlung – ein ganzheitlicher Aneignungsprozess
5.7 Singen im Kindergarten – beispielhafte Projekte
6 Rhythmisch-musikalische Erziehung: Wirkungsfelder und Methoden
6.1 Raum – Zeit – Kraft und Form: Die Methoden der Rhythmik
6.2 Verknüpft – vernetzt – verwoben: Die Wirkungsfelder der Rhythmik
6.2.1 Rhythmikmethoden zur Wahrnehmungsförderung
6.2.2 Rhythmikmethoden zur Förderung der Sprachentwicklung
6.2.3 Rhythmikmethoden im Kontext der Persönlichkeitsentwicklung
6.2.4 Rhythmik und Kreativität
7 Zur Didaktik der Rhythmik – Grundlagen pädagogischen Handelns
7.1 Die zielgruppenspezifische Didaktik der Rhythmik
7.2 Unterrichtsprinzipien
7.2.1 Interaktion und Kommunikation
7.2.2 Sensomotorik und musikalische Bewegung
7.2.3 Das Rhythmische Prinzip
7.2.4 Improvisation und Gestaltung
7.2.5 Das Spiel als pädagogisches Prinzip
7.3 Methoden und ihr Einsatz in der Rhythmik
7.3.1 Fortbewegungsarten
7.3.2 Lieder
7.3.3 Reime und Sprachspiele
7.3.4 Wahrnehmungs- und Bewegungsspiele
7.3.5 Instrumentalspiel auf einfachen Instrumenten
7.3.6 Experimentierphasen mit Materialien und einfachen Instrumenten
7.3.7 Übergänge
7.3.8 Ruhe- und Entspannungsphasen
7.3.9 Darstellendes Spiel
7.3.10 Improvisation
7.3.11 Tanz
7.4 Methodisch-didaktischer Aufbau eines Rhythmikangebotes
7.4.1 Pädagogische Grundlagen zur Entwicklung eines Rhythmikangebotes
7.4.2 Zur didaktischen Einbindung von Rhythmik und Musik in die Einrichtung
7.4.3 Der Aufbau eines Rhythmikangebotes
8 Musik- und Rhythmikangebote in der Praxis
8.1 Experimente mit Klängen, Geräuschen und Materialien
8.1.1 Themenbereich Schallwellen
8.2 Intermediale Angebote
8.2.1 Klanggeschichten
8.2.2 Malen nach Musik
8.2.3 Grafische Notation (vgl. S. Hirler 2011)
8.3 Rhythmikprojekte
8.3.1 Spiellieder und -reime für den U3-Bereich
8.3.2 Rhythmisch-musikalische Sprachspiele »Kenianisches Begrüßungsritual«
8.3.3 Rhythmikprojekt zu einem Bilderbuch »Die Zwergenmütze« von Brigitte Weninger
8.3.4 Rhythmikprojekt zum Gemälde »Der Garten« von Joan Miró
8.3.5 Rhythmikangebote zu Musik von Tonträger
8.3.6 Musik verbindet Generationen Intergeneratives Rhythmikprojekt für Kindergartenkinder und Hochbetagte
Literatur
Personen- und Sachregister
HandbuchRhythmik und Musik
Theorie und Praxis für die Arbeit in der Kita
Sabine Hirler
Neuausgabe 2020(3. Gesamtauflage)© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2014Alle Rechte vorbehaltenwww.herder.deUmschlagkonzeption: R•M•E Roland Eschlbeck / Rosemarie KreuzerUmschlaggestaltung: Verlag HerderUmschlagabbildung: Klara KilleitFotos im Innenteil: Seiten 12, 60, 69, 101, 125, 162, 213: Hartmut W. Schmidt,Freiburg, alle anderen: Sabine Hirler, HadamarSatz und Layout: SatzWeise, Bad WünnenbergHerstellung: Graspo CZ, ZlínPrinted in the Czech RepublicISBN Print 978-3-451-38685-5ISBN E-Book (PDF) 978-3-451-81914-8ISBN E-Book (EPUB) 978-3-451-81916-2
Inhalt
Vorwort
1 Musik – ein Medium mit vielen positiven »Nebenwirkungen«
1.1 Sozial-emotionale und sprachliche Entwicklungsförderung durch Musik
1.2 Musik und Gehirn – Musik und Kognition
1.3 Entwicklungsfenster im Bildungsbereich Musik
2 Die Entwicklungsgeschichte frühkindlicher Musikpädagogik und Rhythmik
2.1. Frühe Wegbereiter der Pädagogik und der Stellenwert der Musik
2.2 Von der frühkindlichen zur elementaren Musikpädagogik
2.3 Die Entstehung der Rhythmik und ihre wichtigsten Vertreter
2.4 Carl Orff – seine Verdienste in der Entwicklung der Elementaren Musikpädagogik
3 Musikalische Bildung in der Frühen Kindheit
3.1 Erziehung durch und zur Musik
3.2 Musikalische Bildung und Rhythmik in den Bildungsplänen
3.3 Basiswissen zur Umsetzung des Bildungsbereichs Musik in der Kita
4 Institutionelle und didaktische Rahmenbedingungen
4.1 Die institutionellen Rahmenbedingungen in der Ausbildung
4.2 Die Rolle von pädagogischen Fachkräften und ihre pädagogischen Handlungskompetenzen
4.3 Die pädagogischen Handlungsfelder im Kontext von Musik und Rhythmik
4.4 Institutionelle Rahmenbedingungen der Einrichtung
5 Singen mit Kindern
5.1 Sozialisation durch Musik und Gesang
5.2 Das Kinderlied – gestern und heute
5.3 Singen – eine komplexe Fähigkeit
5.4 Die Kinderstimme
5.5 Das Kinderlied in der pädagogischen Praxis
5.6 Die Liedvermittlung – ein ganzheitlicher Aneignungsprozess
5.7 Singen im Kindergarten – beispielhafte Projekte
6 Rhythmisch-musikalische Erziehung: Wirkungsfelder und Methoden
6.1 Raum – Zeit – Kraft und Form: Die Methoden der Rhythmik
6.2 Verknüpft – vernetzt – verwoben: Die Wirkungsfelder der Rhythmik
7 Zur Didaktik der Rhythmik – Grundlagen pädagogischen Handelns
7.1 Die zielgruppenspezifische Didaktik der Rhythmik
7.2 Unterrichtsprinzipien
7.3 Methoden und ihr Einsatz in der Rhythmik
7.4 Methodisch-didaktischer Aufbau eines Rhythmikangebotes
8 Musik- und Rhythmikangebote in der Praxis
8.1 Experimente mit Klängen, Geräuschen und Materialien
8.2 Intermediale Angebote
8.2.1 Klanggeschichten
8.2.2 Malen nach Musik
8.2.3 Grafische Notation
8.3 Rhythmikprojekte
8.3.1 Spiellieder und -reime für den U3-Bereich
8.3.2 Rhythmisch-musikalische Sprachspiele »Kenianisches Begrüßungsritual«
8.3.3 Rhythmikprojekt zu einem Bilderbuch »Die Zwergenmütze« von Brigitte Weninger
8.3.4 Rhythmikprojekt zum Gemälde »Der Garten« von Joan Miró
8.3.5 Rhythmikangebote zu Musik von Tonträger
8.3.6 Musik verbindet Generationen Intergeneratives Rhythmikprojekt für Kindergartenkinder und Hochbetagte
Literatur
Personen- und Sachregister
Vorwort
»Musik ist das Lachen der Seele« – diese Aussage vermittelt uns auf wunderbare – fast poetische – Weise die Leichtigkeit und die freudvolle Atmosphäre während des Singens und Tanzens mit jüngeren Kindern. Kinder erleben musikalische Angebote IMMER im positiven Kontext – oder haben Sie schon einmal ein Kind singen gehört, das schlecht gelaunt war?
Von Geburt an ist zu beobachten, dass Musik auf Kinder wirkt. Neugeborene lauschen fasziniert der Stimme der Mutter, und schon Babys besitzen ein intrinsisch motiviertes Bedürfnis, Musik, sei es als »Hoppehoppe Reiter« oder tanzend auf dem Arm der Eltern, zu erleben.
Um Kinder von klein auf über musikalische Aktivitäten in ihrer Motorik, Sprache, Wahrnehmung, Bindungsfähigkeit und sozialemotionalen Entwicklung fördern zu können, ist der freudvolle Umgang der Bezugspersonen mit Liedern und Musikspielen eine Grundvoraussetzung. Kinder lernen viel über die Imitation. Und gerade wegen dieser Vorbildfunktion ist ein breitgefächertes musikalisches und pädagogisches Wissen im Bildungsbereich Musik sowie der methodischen Angebote der Rhythmik in der Frühen Kindheit für pädagogische Fachkräfte essentiell. Für ein professionelles pädagogisches Handeln ist es besonders wichtig, die prozess- und ressourcenorientierte Methodik und Didaktik musikalischer Angebote reflexiv zu betrachten und sich selbst und andere als pädagogisch Handelnde in diesem Bildungsbereich wertschätzend zu begleiten und sich damit die Chance zur Weiterentwicklung zu geben.
Die Rhythmikerinnen Mimi Scheiblauer (1891–1968) und Charlotte Pfeffer (1881–1970) prägten schon vor fast 100 Jahren ein bis heute sehr modernes und inklusives »Bild vom Kind«:Das Kind steht im Mittelpunkt der Rhythmikangebote und wird von dort abgeholt, wo es steht.
Es muss nicht im übertragenen Sinn »über ein Stöckchen« springen, um die Aufgabe »richtig« zu lösen, sondern agiert je nach momentaner Befindlichkeit und Fähigkeit. Vor allem in der Frühen Kindheit ist es besonders günstig, wenn Kinder in pädagogischen Prozessen gefördert werden, die nicht von einer wertenden Haltung geprägt sind. Das bedeutet allerdings, dass die innere Haltung der pädagogischen Fachkraft in der Gestaltung von ko-konstruktiven Bildungsprozessen von großer Bedeutung ist.
Die Prozesshaftigkeit in Rhythmikangeboten heißt für das jüngere Kind vor allem, dass es in diesem Moment spielt … was ein Kind naturgemäß am liebsten macht. Im Spiel können wir dem »Kind im Kind« in wertschätzender Haltung begegnen, vorausgesetzt, wir haben als Erwachsene unsere kindlichen Wesensanteile nicht über Bord geworfen. Für Kinder stellt das Spiel einen geschützten Raum dar, bei dem die Welt voller Regeln, die eingehalten werden müssen, und Rahmenbedingungen, die sie oftmals nicht wirklich vollständig erfassen können, außen vor bleibt.
Musik, Bewegung, Sprache, Materialien und Instrumente sind die methodischen Handlungsmedien der Rhythmik, durch die sich den Kindern in kreativer und freudvoller Atmosphäre ein breites Spektrum an Förderung und individuellen Entwicklungsimpulsen erschließt. Die Wirkungsfelder der Rhythmik (Musik-, Bewegungs- und Sprachentwicklung, Wahrnehmungsförderung, Persönlichkeitsförderung / soziale Kompetenzen) funktionieren innerhalb eines Rhythmikangebotes in faszinierender Vernetzung und Verschränkung: Rhythmischmusikalische Angebote sind in Bezug auf die Wirkungsfelder, die sie ansprechen, multidimensional. Und gerade diese Verschränkung wird heute aus neurobiologischer und -psychologischer Perspektive als äußerst effizient beurteilt. Erfahrungen werden gleichzeitig auf der kognitiven, auf der affektiv-emotionalen und auf der körperlichen Ebene in Form entsprechender Denk-, Gefühls- und körperlicher Reaktionsmuster verankert und aneinander gekoppelt (vgl. Hüther 2010). Dieser in der Psychologie als Embodiment bezeichnete Prozess verdeutlicht, dass die komplexe und vernetzte Wirkungsweise der Methodik und Didaktik der Rhythmik den neurobiologischen und -psychologischen Lernprozessen des Menschen und vor allem des jüngeren Kindes entspricht. Denn in Rhythmikangeboten tauchen die Kinder in das jeweilige Thema ein, das sie in vielfältigen Methoden spielerisch erleben, und mit ihren bisherigen Denk-, Gefühls- und körperlichen Reaktionsmustern verknüpfen.
Unbestritten sind die positiven Wirkungen einer frühzeitigen spielerisch-musikalischen Anregung. Sie, als pädagogische Fachkraft, ermöglichen es den Kindern unter anderem, nicht nur ihr angeborenes musikalisches Potenzial zu entwickeln, sondern auch die musikalische Kultur ihres sozialen Umfeldes zu erleben und zu erlernen. »Jeder Mensch muss, unabhängig von seiner sozialen und ethnischen Herkunft, die Chance auf ein qualifiziertes und breit angelegtes Angebot musikalischer Bildung erhalten, welches auch die Musik anderer Ethnien einschließt« (aus dem Grundsatzpapier des Deutschen Musikrates zur Musikalischen Bildung 2012).
Viele Kinder wachsen mit zwei oder sogar drei Kulturen auf, die nicht nur die jeweilige Sprache, sondern auch entsprechende musikalische Kulturformen wie Lieder, bestimmte Instrumente, eine andere Zusammensetzung von Tonleitern und charakteristische Rhythmen zum Ausdruck bringen. Diese musikalisch-kulturellen Ausdrucksformen sollten wertschätzend in den Alltag integriert werden, um dem Kind eine individuelle Identifikation mit verschiedenen Kulturen zu ermöglichen und um Ausgrenzungserfahrung zu vermeiden.
Was jedoch bedeutet eine Erziehung durch und zur Musik und welche Fähigkeiten braucht eine pädagogische Fachkraft dazu? Zu diesen und weiteren Fragen möchte ich Ihnen eine Antwort geben und hoffe, Ihnen im theoretischen und praktischen Transfer mit dieser Veröffentlichung Informationen und Denkanstöße geben zu können. Des Weiteren wird in diesem Buch neben allgemeinen entwicklungs- und musikpsychologischen Erkenntnissen auch auf die Bildungspläne der Bundesländer im Bildungsbereich Musik eingegangen. Wie jedoch der Bildungsbereich Musik implementiert werden kann, wird ausgehend von den sechs Handlungsfeldern der sozialpädagogischen Arbeit auf anschauliche Weise dargestellt. Nach diesen allgemeinen Überlegungen geht es im Folgenden um das »Singen mit Kindern«, »Wirkungsfelder der Rhythmik« sowie »Methodik und Didaktik der Rhythmik«. Zum Abschluss bietet ein umfangreicher Praxisteil facettenreiche Rhythmikund Musikangebote für unterschiedliche Ziel- und Altersgruppen.
Egal ob Sie ein »alter Hase« oder Neueinsteiger im musikalischen Bereich sind, ich möchte Sie ermuntern, musikalische Angebote – in welcher Form auch immer – durchzuführen und sich selbst die Chance zu geben, sich in diesem Bildungsbereich weiterzuentwickeln – ganz im Sinne des berühmten Geigers Yehudi Menuhin (1916–1999), der sagte: »Musik spricht für sich allein. Vorausgesetzt, wir geben ihr eine Chance.«
Denn auch uns Erwachsenen macht Wissens- und Kompetenzzuwachs großen Spaß, vor allem, wenn wir merken, wie gut es bei den Kindern ankommt und welche positiven Wirkungen musikalische Angebote besitzen.
Viel Erfolg und Freude wünscht Ihnen
Sabine Hirler
Hadamar, im November 2019
1 Musik – ein Medium mit vielen positiven »Nebenwirkungen«
Haben Sie das auch schon einmal erlebt: Sie hören eine Melodie und sind bis in Ihr Innerstes berührt? Sie kämpfen mit den Tränen und wissen nicht, ob es Tränen der Freude oder der Traurigkeit sind. Sie tauchen aus dieser Erfahrung ergriffen und gleichzeitig gelöst auf. Oder: Sie hören Musik und es hält Sie nicht auf dem Stuhl. Sie müssen sich zur Musik bewegen, um ihre Emotionen zum Ausdruck zu bringen. Der ganze Körper ist wie von Zauberhand gepackt; Sie erleben und gestalten die Elemente der Musik durch rhythmisierte und differenzierte Bewegungsausführung. Der charakteristische Klang und Ausdruck der Musik wird tanzend zum Ausdruck gebracht. Individuelle innere Befindlichkeiten verknüpfen sich mit der emotionalen Botschaft der Musik und werden durch Bewegung zu einer sinnlichen Erfahrung.
Wie kann es sein, dass Musik solch eine Macht über Menschen haben kann? Der Schlüssel zur Beantwortung dieser Frage findet sich zu Beginn unserer Existenz. Ob als Musik, Sound, Klang, Geräusch, rhythmisches Klopfen, Vibration – wahrgenommen hat ihn jeder Mensch von Anbeginn: den rhythmischen Herzschlag der Mutter. Musik begleitet uns schon vor der Geburt – und während unseres ganzen Lebens. Die individuelle Prägung des Musikgeschmacks beginnt schon im Mutterleib und ist nach der Geburt besonders stark von emotionalen Bezügen und Erlebnissen mit der sozialen Umwelt geprägt.
Musik ist im wahrsten Sinne des Wortes unfassbar! Sie kann, anders als ein Bild oder eine Statue, nicht betrachtet und berührt, jedoch im doppelten Wortsinn gefühlt werden. Musik ist physikalisch nichts anderes als Schwingung, und Schwingung ist Bewegung. Eine sich bewegende Saite versetzt die Luft in Schwingung, so dass wir sie nicht nur hören, sondern bei tiefen Tönen die Schallwellen auch spüren können. Musik ist ein Phänomen – ein nicht nur emotional berührendes, universell verbindendes und kulturstiftendes Medium der Menschheit.
Musik beeinflusst nicht nur die Emotionen, sondern ist eng mit der Sinneswahrnehmung, und hier vor allem natürlich mit der Hörwahrnehmung, verbunden. Hörereignisse geben uns vor allem in Kombination mit anderen Sinnen, wie zum Beispiel Sehen, Tasten, Spüren, Riechen, Informationen über die Beschaffenheit eines Gegenstandes, über die Größe von Räumlichkeiten, über Situationen (z. B. quietschende Reifen, Donner). Unbestritten ist, dass die auditive Wahrnehmung für das Überleben des Homo sapiens wichtig war und ist. Aus diesem Grund versucht das Gehirn, selbst aus einer beiläufigen Hörwahrnehmung (z. B. Naturgeräusche, Tierlaute) eine Regel oder ein Muster herauszufiltern – es könnte ja eine wichtige Information sein. Auch dort, wo Klänge und Geräusche ohne Absicht entstehen, wie beim Türenschlagen durch den Wind, lauscht der Mensch, und es ist beruhigend, wenn das Geräusch bekannt und vertraut ist. Besonders für Kinder sind Geräusche faszinierend und geheimnisvoll. Wer erinnert sich nicht an eine Situation aus der Kindheit, wie zum Beispiel die erste Übernachtung in einem Zelt, die schlafraubende Aufregung durch die ungewohnt nahen Naturgeräusche …
Was ist eigentlich Musik? Eine Spurensuche
Musik unterscheidet sich von unwillkürlichen Geräuschen, Tönen und Klängen der Natur oder der uns umgebenden dinglichen Welt und kann als absichtsvolles Spiel von Klängen, Lauten und Geräuschen definiert werden. Aus diesem elementar anmutenden Blickwinkel betrachtet, ist das absichtsvolle Rasseln eines Kleinkindes ebenso Musik und zeigt das breite Spektrum, in dem sich das Medium Musik bewegt.
Hören wir als Westeuropäer allerdings Musik aus anderen Kulturen, wie zum Beispiel klassische indische Musik, müssen wir uns erst in die musikalischen Strukturen von Rhythmen und Melodieführung hineinhören, um sie nachvollziehen, das heißt wiedererkennen zu können, damit die Musik für unsere westlich geprägten Hörgewohnheiten in irgendeiner Weise verständlich wird. Ansonsten nehmen wir gewollt oder ungewollt Musik, die sich gänzlich von den musikalischen Konventionen der westlichen Musik unterscheidet, zuerst lediglich als eine Art von »Klangbrei« wahr. Unabhängig von der kulturellen Prägung gibt es individuelle Ausprägungen: Ob bestimmte Musik als Musik oder als Lärm wahrgenommen wird, ist bei jedem Menschen verschieden. Denn was für den einen eine angenehme Musik ist, empfindet ein anderer als Grenze zur Folter (vgl. Geisel 2010).
Musik ist in allen Kulturen ein wichtiger Bestandteil des individuellkulturellen Ausdrucks. Wiegenlieder, Kniereiter, Spiellieder gibt es in allen Ländern der Erde, und sie vermitteln den Kindern in ihrer jeweiligen Muttersprache einen individuellen kulturellen Schatz, der von Generation zu Generation weitergegeben wird und gleichzeitig identitätsstiftend wirkt.
Außerdem ist Musik besonders geeignet, bestimmten Anlässen »eine besondere Note« zu geben: sei es ein Fußball-Länderspiel, bei dem zu Beginn die Nationalhymnen der beteiligten Länder zu hören sind, oder die musikalische Gestaltung einer Vernissage, die das bildhafte ästhetische Erleben durch auditive Klangerfahrungen noch vertiefen soll, oder bei Hochzeiten, Beerdigungen, Stadtfesten … Diese Liste ließe sich beliebig weiterführen, zeigt jedoch, dass Musik das Gefühl von Zusammengehörigkeit vermittelt und Gemeinschaftserleben stärkt. Anthropologisch ausgedrückt: Sie hilft dem »Stamm«, also der Familie, der Stadt, der Nation, eine spezifische kulturelle Identität zu entwickeln und zu festigen (vgl. Altenmüller 2018, S. 60 ff., Kölsch 2019, S. 129 ff.).
Wie die individuelle musikalische Entwicklung beim Kind im neurowissenschaftlichen und im entwicklungspsychologischen Sinne verläuft, das wird im Folgenden beschrieben. Dabei wird deutlich, dass zur Betrachtung des Phänomens Musik und des Bildungsbereichs Musik aus verschiedenen Blickwinkeln unterschiedliche Vorgehensweisen notwendig sind. Der neurowissenschaftliche und neuropsychologische Blickwinkel stützt sich auf messbare naturwissenschaftliche Ergebnisse, wohingegen die allgemeine Psychologie und Pädagogik ihre Erkenntnisse empirisch und vergleichend gewinnen. Interessant ist, wie sich die Ergebnisse der angesprochenen Richtungen ergänzen und die Wirkung von Musik auf die Entwicklung von Kindern gegenseitig bestätigen.
1.1 Sozial-emotionale und sprachliche Entwicklungsförderung durch Musik
In einem Vortrag zum Thema »Musik und kindliche Bildung« konstatierte der Hirnforscher und Psychiater Manfred Spitzer, »… dass Musik einen wesentlichen Beitrag zur Erziehung des kleinen Kindes geben kann« (Spitzer 2005). Was dies im Einzelnen für die Bezugspersonen und pädagogische Fachkräfte bedeutet, und welche Wirkungsebenen vor allem im Hinblick auf eine positive Entwicklung im sozialemotionalen und sprachlichen Bereich dabei angesprochen werden, wird nachfolgend vorgestellt.
1.1.1 »Bindungsverstärker« Musik
Vom ersten Tag reagieren Säuglinge auf soziale Stimuli wie das Gesicht der Mutter und menschliche Stimmen, insbesondere wenn sie positive Emotionen vermitteln. Interessanterweise ist die non-verbale Kommunikation zwischen Betreuungspersonen und dem Säugling durch zahlreiche rhythmische Handlungen bestimmt. Papougek (1996) stellte in ihren Untersuchungen fest, dass tätscheln, streicheln, kitzeln und wiegen fünfzig Prozent der Interaktionen zwischen Müttern und ihren drei Monate alten Säuglingen ausmachen. Diese intuitive Kommunikation zwischen Eltern, Bezugspersonen (»intuitive parenting« nach Papougek & Papougek 1981) mit Babys und Kleinkindern ist geprägt von der Fürsorge der Eltern und ihrer Kommunikationsfähigkeit entsprechend dem Entwicklungsstand ihres Kindes. Sie unterstützen den Entwicklungs- und Reifungsprozess ihres Kindes vor allem mit den Mitteln kindgerechter Musik und Sprache (→ in diesem Kapitel »Kindgerechtes Singen und Sprechen«, S. 17).
Lieder, die den Inhalt durch Berührungen und Gesten spür- und sichtbar machen, wirken dabei wie ein emotionaler Botenstoff, der beiden Seiten – Kind und Eltern – Freude bereitet. Dabei sei dahingestellt, dass bei den Eltern die Freude an diesen Spielformen oftmals erst durch die ansteckende Begeisterung ihres Kindes entsteht. In der Tat geht die moderne Entwicklungspsychologie davon aus, »… dass Individuen nicht nur durch ihre Entwicklungsumwelt beeinflusst werden, sondern ihrerseits Einfluss auf ihre Umwelt nehmen bzw. die passende Umwelt suchen und sich somit ihre Entwicklungsbedingungen partiell selbst schaffen oder wählen« (Oerter & Montada 2002, S. 5).
Vordergründiges Ziel dieser Art der Kommunikation ist es, das Baby oder Kleinkind zum Lächeln und zum Lachen zu bringen und dadurch die Bindung zu ihm zu stärken.
Aus dieser Form von Interaktion zwischen Eltern und Kind entwickeln sich sogenannte »sicher gebundene Kinder«. Eine sichere Bin- dung kann sich nur dann entwickeln, wenn Eltern ihre Kinder während des Baby-, Klein- und Kindergartenalters in ihrem Bewegungsdrang und ihrer Neugierde unterstützen. So entwickelt sich bei den Kindern gleichsam »automatisch« ein positives Selbstwertgefühl, wenn sie sich von klein auf in ihren Aktivitäten, in ihrem »Forscherdrang«, unterstützt fühlen und Selbstwirksamkeit – »Ich kann etwas bewegen!« – erleben.
Diese Selbstwirksamkeitserfahrungen sind ein grundlegender Baustein für eine positive Entwicklung der Persönlichkeit. Denn das Erleben von Selbstwirksamkeit motiviert die Kinder, stärkt das Selbstbewusstsein und fördert die Entwicklung von Autonomie.
Sicher gebundene Kinder entwickeln sich im Vergleich mit unsicher gebundenen Kindern besser. Sie entwickeln gute Problemlösefähigkeiten, die Kinder können sich in der Regel besser konzentrieren, besitzen mehr Ausdauer und haben eine längere Aufmerksamkeitsspanne. Die Kinder sind sozial aufgeschlossener und in ihren Handlungen flexibler und haben genügend Selbstvertrauen, um zum Beispiel Hilfe zu erbitten (vgl. Hirler 2010b, S. 42 f.; vgl Hirler 2018, S. 10). Altersentsprechende Musikspiele und Spiellieder helfen besonders effektiv, eine sichere Bindung bei Kindern zu entwickeln (→ Kapitel 5.5 und → Kapitel 6.2.3).
1.1.2 Musik und Sprachentwicklung
Der aufrechte Gang und die sich dadurch verändernde Lebensweise der Urmenschen vor rund zweieinhalb Millionen Jahren soll den Impuls zur Entwicklung der Sprache gegeben haben. Anthropologen und Sprachwissenschaftler gehen davon aus, dass die Sprache sich als effektives Instrument im Kontext der sozialen Pflege von Beziehungen entwickelte. Ging man früher davon aus, dass die Wissensvermittlung der ausschlaggebende Impuls für die Entwicklung der menschlichen Sprache war, so geht die Wissenschaft heute davon aus, dass der Beziehungsaspekt im Vordergrund stand (vgl. Mithen 2006).
Ausgangspunkt der neuen sprachevolutionären Erkenntnisse ist eine sich verändernde Mutter-Kind-Beziehung. Durch den aufrechten Gang und die geringer werdende Körperbehaarung zum Festhalten ließen sich die Babys nicht mehr so effektiv tragen. Die Nahrungssuche wurde dadurch für die Mütter wesentlich beschwerlicher. Lautierender Sing-sang und verbalgesangliche Frage-und-Antwort-Spiele sollen so wie auch heute noch die Babys beruhigt haben. Der verbalgesangliche Dialog machte es den Müttern schon vor Hunderttausenden Jahren möglich, ohne ihr Kind zum Beispiel auf Bäume zu klettern, um Früchte zu pflücken – und auf die heutige Zeit übertragen gibt er den Eltern einen Spielraum, um den Kinderwagen in das Auto zu laden oder das Essen zu kochen.
Aus Gestik, Mimik, den Gebärden und Lautäußerungen soll sich nach und nach »Sprache« entwickelt haben (vgl. Falk 2004). Diese Aspekte zeigen deutlich, dass musikalische Elemente bereits in der evolutionsbiologischen Urzeit des Menschen eine wichtige Rolle spielten.
Kindgerechtes Singen und Sprechen und seine Wirkung
Die nachfolgend aufgeführten Formen kindgerechten Singens und Sprechens zeigen die besondere Bedeutung dieser oft als »kindisch« angesehenen Kommunikationsformen für die Sprachentwicklung der Allerkleinsten.
▶ Ungeborene (Kisilevsky et al. 2003) und Neugeborene können Tonhöhen, Rhythmen, Klangmuster, Intervalle und Klangfarben unterscheiden.
▶ Die mütterliche Sprache ist, wie schon erwähnt, in vielerlei Hinsicht musikalischer Art. Denn Wiederholungen, starke Rhythmisierungen, Variationen der Tonhöhe und melodische Tonkonturen (Prosodie) zeichnen sie besonders aus. Ansteigende Melodien ziehen die Aufmerksamkeit der Kinder auf sich und absteigende Melodien wirken auf Kinder beruhigend. Das Wahrnehmen der Töne innerhalb einer Tonart (Tonalitätsverstehen) und das Erkennen, wenn ein »falscher« Ton zu hören ist, ist schon bei Kindern im ersten Lebensjahr deutlich ausgeprägt (vgl. Trehub & Trainor 1990 in Maier-Karius 2010, S. 79 ff., 305 ff.; vgl. Trehub 2016).
▶ Beim Singen wird eine höhere Tonlage angestimmt, dabei ist das Tempo langsam und es wird mit größeren Tonschwankungen gesungen (vgl. Trehub & Trainor 1998). Wie oben erwähnt, sind diese Merkmale des kindgerichteten Singens und Sprechens kulturübergreifend (Maier-Karius 2010, S. 74), obwohl sich in allen Kulturen musikalische Ausprägungen unterschiedlich entwickeln.
▶ Musik wird als wirkungsvolles Mittel zur Regulation von Emotionen eingesetzt. Empfindet der Säugling Schmerz oder Hunger, versuchen Bezugspersonen, den Säugling zu beruhigen oder abzulenken, indem zum Beispiel das unleidige Meckern des Säuglings imitiert oder ein Lied gesungen wird. Das Singen beruhigt nicht nur das Baby, sondern auch die erwachsene Person.
Dass diese motorisch-rhythmischen Handlungen in der Regel gleichzeitig stimmlich und sprachlich begleitet werden, zeigt, wie eng musikalische Stimuli, taktil-kinästhetische Wahrnehmung und sozial-emotionale Interaktion in den ersten Lebensjahren miteinander verbunden sind und in kulturübergreifender Weise im Menschen angelegt sind.
Musik und Fremdsprachenlernen
Eine Studie von Good, Russo und Sullivan (2015) von der Ryerson University Toronto erforschte die Wirksamkeit des Singens beim Fremdsprachenlernen. Die Grundschulkinder wurden nach einem zweiwöchigen musikalischen oder sprachlichen Angebot auf ihre Fähigkeit getestet, sich wörtlich an Passagen zu erinnern, englische Vokale auszusprechen und Zielbegriffe vom Englischen ins Spanische zu übersetzen. Kinder, die in der Fremdsprache sangen, waren in den Bereichen Aussprache, Erinnerung und Verständnis der Liedtexte den Kindern, die den Text als Reim sprachen, weit überlegen. Besonders interessant ist, dass die Fähigkeiten nach sechs Monaten immer noch nachgewiesen werden konnten.
›Mitwachsende‹ Sprache
Zur Besänftigung von Babys ist die sprachliche Kommunikation der Bezugspersonen, die sogenannte »Ammensprache« oder »Baby talk«, in allen Kulturen der Welt zu finden. Eine hohe Stimmlage, melodisches Intonieren, rhythmisch-akzentuiertes Sprechen, kombiniert mit einer ausgeprägten Mimik und Gestik der Bezugspersonen kennzeichnen sie. Kinder reagieren darauf außerordentlich direkt und in der Regel sehr freudvoll. Sie lauschen, schauen, beginnen selbst zu lautieren oder zu vokalisieren und Sprache, Gestik und Mimik zu imitieren (vgl. Stadler Elmer 2000). Das Baby wächst in die prosodisch-phonologischen Eigenschaften seiner Muttersprache hinein (prosodische Kompetenz). Ab dem zweiten Lebensjahr verändert sich die sprachliche Kommunikation in eine »stützende Sprache« (»scaffolding«), die den Kindern Zugang zu einem erweiterten Wortschatz und dem Lernen von Satz- und Wortbildung und der Semantik gibt (linguistische Kompetenz). Ab circa dem zweiten Lebensjahr steht die sprachanregende und -lehrende Kommunikation im Mittelpunkt, die auch als als »Motherese« bezeichnet wird. Zum Beispiel werden die Kinder durch Fragen angeregt, sich sprachlich zu äußern (pragmatische Kompetenz) (vgl. Grewendorf et al. 1999, Grimm 2003, Jungmann 2012).
Diese elementaren Phasen werden in der Sprachwissenschaft als Grundvoraussetzung zum Spracherwerb angesehen. Fakt ist, dass erst der charakteristische Singsang mit ausgeprägter Prosodie der Bezugspersonen im wahrsten Sinne des Wortes die Ohren des Säuglings öffnet.
Das Baby filtert aus dem Lautstrom der Eltern sprachliche Muster und Einheiten heraus, Bausteine zum Erlernen seiner Muttersprache (vgl. Papougek 1994/2001). Die Forschung geht heute davon aus, dass Musik und Sprache während des ersten Lebensjahres in denselben Bereichen des Gehirns verarbeitet werden (Koelsch & Siebel 2005 zit. nach Sallat 2009, S. 87; vgl. Jäncke 2008; Merker 2014), da einige Bereiche im Gehirn für die Analyse von Musik- und Sprachinformationen gleichermaßen eingesetzt werden. Musik wird im sogenannten »›Sprachnetzwerk‹ der linken Hemisphäre und Sprache auch im ›Musiknetzwerk‹ der rechten Hemisphäre verarbeitet« (Kölsch 2019, S. 48 f.). Es handelt sich dabei mehr um ein »Musik-und-Sprache-Netzwerk« im Gehirn. Zum Beispiel verarbeiten identische Areale im rechten Hörkortex sowohl Klangfarben von Musikinstrumenten als auch von menschlichen Stimmen (→Kapitel 6.2.2).
Musikalische Verarbeitung von Sprache
Musikalische Aktivitäten wie Singen und Musizieren verbessern die Verarbeitung und Encodierung linguistischer Tonhöhenmuster. Diese sind Bestandteile der Prosodie, die u.a. Intonation, Sprachmelodie und Sprachrhythmus beinhaltet (vgl. Hallam 2010). Eine zu geringe Aktivierung dieser musikalisch-sprachlichen Verarbeitungsnetzwerke im Säuglingsalter kann später in der Sprachentwicklung zu Verzögerungen führen (vgl. Sallat 2008; 2009).
1.2 Musik und Gehirn – Musik und Kognition
Viele Erkenntnisse, die intuitive Erfahrungen und empirische Forschungen ergeben haben, werden durch die Hirnforschung gestützt und ergänzt.
Wie oben dargelegt, ist vorsprachliche musikalische Interaktion die Grundlage der menschlichen Kommunikation, und zwar in allen Kulturen (vgl. Trevarthen 2008). Es wird davon ausgegangen, »… dass die Anpassungen der Sprechmelodik im Vorsilbenalter mehr als durch kulturelle Tradition und Erziehung durch genetische Prädispositionen bestimmt werden« (Papougek 1994/2001, S. 135).
Der Einsatz altersentsprechender musikalisch-sprachlicher Aktivitäten wie Spiellieder und rhythmische Bewegungsreime bewirkt eine neuronale Erregung im gesamten Gehirn und stimuliert die Gehirnentwicklung durch Verknüpfungen und die daraus entstehenden Strukturen besonders nachhaltig.
Dabei erleichtern Spiellieder und Bewegungsreime Eltern und Bezugspersonen die emotionale und soziale Kontaktaufnahme besonders, da Kinder mit großem Interesse und augenblicklicher Aufmerksamkeit auf Musik und rhythmisierte Sprache reagieren. Schon die Allerkleinsten lachen, glucksen und strampeln, wenn mit ihnen Kniereiter und Krabbellieder gespielt werden. Bei Müdigkeit oder Schmerzen kann ein (Wiegen-) Lied Wunder wirken, indem das Baby sich beruhigt oder abgelenkt wird. Doch gleichzeitig wird bei diesen musikalischen Aktivitäten und vielen anderen musikalischen Spielformen in anderen Altersstufen das körpereigene Belohnungssystem durch den Botenstoff Dopamin im Gehirn aktiviert. Voraussetzung für die Bezugspersonen ist die Freude an der Musik, am Singen und an der Bewegung. Nur dann erleben Kinder jeglichen Alters einen positiven emotionalen Zugang zur Musik.
1.2.1 Transfereffekte und Musik
In den letzten Jahren fanden die neurophysiologischen Fachbegriffe »Transfereffekt« oder »kreuzmodale Einflüsse« Eingang in die Terminologie der Pädagogik.
Aus neurophysiologischer Sicht bedeutet der Begriff Transfereffekt das Mit-Lernen in angrenzenden Hirnregionen aufgrund von Nervenverknüpfungen benachbarter Hirnbereiche (vgl. Jackel 2007). Die Herausbildung von Transfereffekten oder kreuzmodaler Einflüsse wird gerade durch musikalische Spielformen in der frühen Kindheit begünstigt.
Durch den häufigen Gebrauch von sogenannten Schnittarealen (angrenzende Hirnregionen) und gemeinsamen Hirnnervenbahnen wie beim oftmals gleichzeitigen Bewegen, Singen, Sprechen und Musizieren, werden unterschiedliche Hirnareale synchron aktiviert. Diese werden in ihrer Funktion durch die Verknüpfung mit anderen Hirnregionen verstärkt und entwickelt.
Am Beispiel der phylogenetischen (stammesgeschichtlichen) Entwicklung der Sprache kann dies beispielhaft verdeutlicht werden: Die parallele Entwicklung der Feinmotorik der Hände, der Sprachzentren und des menschlichen Stimm- und Sprechapparates zeigen auf, dass die entsprechenden Steuerungsareale im Gehirn nicht zufällig aneinandergrenzen, sondern dass dies auf die eng verknüpfte Nutzung der Modalitäten Sprechen, Mimik und Gestik zurückzuführen ist (vgl. Koelsch 2008, S. 202; Richter 1992, S. 162 ff.).
Transfereffekte sind jedoch nicht nur auf die naheliegenden Hirnareale beschränkt, sondern erstrecken sich auf das gesamte Gehirn. Hier ist besonders die Kommunikation der beiden Hirnhälften zu erwähnen, ohne die eine normale Verarbeitung der Sinneseindrücke nur bedingt möglich wäre. Der Einfluss von Musikerziehung auf die Kommunikation zwischen den beiden Hirnhälften ist nachweisbar und wird deutlich am Beispiel des stärker entwickelten Balkens zwischen den Hirnhälften (Corpus callosum) bei von Kindheit an musizierenden Erwachsenen. Anatomische Strukturen des Gehirns werden durch die Produktion und Beschäftigung mit Musik verändert. Es wird angenommen, »dass durch die verstärkte interhemisphärische Kommunikation ein schnellerer Austausch von Informationen und ein effektiver Abruf von komplexen motorischen Programmen möglich ist« (Gembris 1998/2007, S. 143). »Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass während des Musizierens zwangsläufig viele Gedächtnisinformationen aktiviert werden, dies umso mehr, je mehr man gelernt hat, Musikinformationen auch mit anderen Gedächtnisinhalten zu koppeln. Diese Informationen reichen von Tönen, Rhythmen und Melodien bis hin zu Erinnerungen an Episoden, Personen und Emotionen, die mit dem Musikstück assoziiert sind« (Jäncke 2008, S. 409). Da die Bestandteile der Musik wie Rhythmus, Melodie, Harmonie, Tempo und Lautstärke gleichzeitig auf beide Hemisphären wirken, lateralisieren Musizierende auch bei anderen Aktivitäten weniger stark, da sie dies schon durch das Musizieren gewöhnt sind, oder anders ausgedrückt, ihr Gehirn sich entsprechend entwickelt hat. Beide Hirnhälften werden gleichzeitig stärker aktiviert und zur Verarbeitung von Sinneseindrücken verwendet.
Gerade in der frühen Kindheit ist die Hirnentwicklung als Grundlage für die weitere kognitive Entwicklung und die sozial-emotionale Reifung von großer Bedeutung. Die Hirnentwicklung stellt sozusagen eine sich selbst weiter entwickelnde und selbstreferentielle »Software« dar. Jede Sinneswahrnehmung und jede neue Erfahrung kann nur an bereits vorhandene Verschaltungsmuster anknüpfen. Diese werden erweitert und bilden nun wiederum die Grundlage für alle folgenden Anknüpfungsprozesse. »Auf diese Weise erwirbt jeder Mensch im Verlauf der frühen Kindheit nicht nur eine zunehmende Kompetenz in einzelnen Teilgebieten, er gewinnt auch eine zunehmend breitere und komplexere Grundlage für seine generelle Anknüpfungsfähigkeit« (Hüther 2009, S. 35). Musik und Rhythmik fördern durch die Komplexität der Angebote die Anknüpfungsfähigkeit des Gehirns, indem sie zur Entwicklung von Transfereffekten anregen. Musikalische Aktivitäten fördern den Spracherwerb der Muttersprache ebenso wie den Erwerb einer Fremdsprache. Durch Singen-Bewegen und Sprechen wird die Sprachwahrnehmung, die phonologische Bewusstheit, Aussprache und das verbale Gedächtnis positiv beeinflusst, ebenso wie die Lese-Rechtschreib-Kompetenz (vgl. Gembris 2015, S. 7 ff.).
Spiegelneuronen
Die augenblickliche Konzentration einer Kindergruppe, wenn ein Finger- oder Handgestenspiel gespielt und gesungen wird, zeigt, wie diese elementarmusikalisch-sprachlichen Spielformen von den Kindern regelrecht absorbiert werden. Es scheint, als ob die Kinder über ein intuitives Wissen verfügen, dass diese Spiele sie in ihrer Entwicklung unterstützen.
Heute wissen wir, dass diese Affinität zu Musik und Bewegung auch unseren Genen zu verdanken ist und uns die Natur mit Spiegelneuronen (Rizolatti et al. 2007) ausgestattet hat, ohne die das imitative Lernen im emotionalen, sozialen, motorischen und sensorischen Bereich vor allem in der frühen Kindheit nicht möglich wäre.
Spiegelneuronen werden im Gehirn aktiv und stellen dort zuerst eine fiktive Als-ob-Handlung im Vorfeld her. »Wenn wir Zeuge der Handlungen eines anderen werden, macht sich unser Gehirn über seine Körperwahrnehmung den körperlichen Zustand zu eigen, der sich bei uns einstellen würde, wenn wir selbst uns bewegen würden« (Damasio 2011, S. 116). Positives Erleben beim Singen, Tanzen und Musizieren auf einfachen Instrumenten verstärken noch die Aktivität der Spiegelneuronen, da die motorischen Gehirnstrukturen auch mit den emotionalen Gehirnstrukturen verknüpft sind.
1.2.2 Gehirnreifung und musikalisches Lernen
Menschenkinder werden im Vergleich zu anderen hochentwickelten Säugetieren mit einem unausgereiften Gehirn geboren. Die Unausgereiftheit des Gehirns bei der Geburt bedeutet, dass Areale der Groß- hirnrinde, insbesondere des Frontallappens, die u. a. den präfrontalen Cortex beinhaltet, noch nicht synaptisch miteinander verbunden sind. »Wir kommen auf die Welt und sind verschiedensten Reizen ausgesetzt, deren Struktur und Statistik von ganz einfach bis ganz kompliziert reicht. Die Tatsache nun, dass sich das Gehirn entwickelt und zunächst nur einfache Strukturen überhaupt verarbeiten kann, stellt sicher, dass es auch zunächst nur Einfaches lernen kann« (Spitzer 2003, S. 232 f.).
Alles, was ein Kind mittels dieser einfachen Strukturen erfassen und in eine Regelhaftigkeit bringen kann, bleibt, bildhaft ausgedrückt, im Gehirn hängen.
Die Tatsache, dass wir Menschen als Nesthocker zur Welt kommen, besitzt evolutionsbiologisch durchaus seinen Sinn. Das unfertige Gehirn bedeutet für den Homo sapiens die Chance, für alle Lernerfahrungen offen zu sein und sich seiner Umwelt optimal anpassen zu können. Die auffällige Nachreifung des Gehirns nach der Geburt betrifft vor allem den oben schon erwähnten präfrontalen Cortex, der für die kognitiven und emotionalen Fähigkeiten und ihre gegenseitige Verknüpfung zuständig ist. Der menschliche Säugling ist durch die geringe Determinierung des Gehirns in der Lage, mehr unterschiedliche Verknüpfungen im Gehirn zu bilden und Wahrnehmungs-Inputs immer besser verarbeiten zu können. Im Rückschluss bedeutet dies, dass genetisch gewisse Dispositionen für die Abfolge und Präferenzen in der Gehirnentwicklung vorhanden sind, diese sich aber durch entsprechenden Input und wechselseitige Handlungen und Beziehungen zwischen Kind und Umwelt entwickeln können. »Das einzelne Individuum in seiner jeweiligen Besonderheit hat jedoch eine bestimmte Entwicklung und eine bestimmte Lerngeschichte« (Spitzer 2003, S. 239).
Optimal ist eine Synchronisation von geeigneten Lern- und Spielangeboten mit den jeweiligen Reifungsprozessen der Kinder. Im Fall von Musikangeboten in der frühen Kindheit bedeutet dies, dass ein gleichbleibendes Repertoire z. B. an Spielliedern mehrere Jahre die Klein- und Kindergartenkinder in ihren unterschiedlichen Entwicklungs- und Reifungsprozessen begleitet. In der Praxis ist es immer wieder eindrucksvoll zu beobachten, wie Kinder sich diejenigen Lern- und Entwicklungsimpulse herausfiltern und an sie andocken, die für ihre momentane Entwicklung relevant sind. Dieser Prozess zeigt, wie Kinder ganzheitlich lernen und – ganz im Sinne des russischen Psychologen Wygotski – es lieben, durch Wiederholungen, Erweiterungen und Varianten die »Zone der nächsten Entwicklungsstufe« spielerisch zu erreichen (vgl. Wygotski 1964/1981, S. 237).
Ein Beispiel aus der musikalischen Praxis:
Ein fünf Monate altes Baby kann noch nicht mitsingen und hüpfen, aber es weiß zum Beispiel beim Lied und Kniereiter »Hoppehoppe-Reiter«, dass es nach dem Wort »Sumpf« mit dem Körper nach unten geht. Es lernt durch die Wiederholung und streckt seinen kleinen Körper schon in freudiger Erwartung, um bereit zu sein für den geschützten »Abgang«.
Dem Baby wird durch einfache Kniereiter, Krabbelreime und Spiellieder in diesem frühen Alter schon serielles Denken vermittelt, da es erkennt, an welcher Stelle des Liedes seine Lieblingsstelle kommt.
Für die Sprachentwicklung ist dieses Erleben von sprachlichen und musikalischen Mustern, das Erleben von Sprach- und Liedrhythmus, die durch die Wiederholung als auditives Muster im Gehirn gespeichert werden, von großer Bedeutung. Die emotional-soziale Komponente bekommt durch solche musikalischen Spielformen ebenfalls eine positive Grundlage. Das Urvertrauen, der Spaß und die Freude, mit einer vertrauten Person zu spielen und sicher aufgefangen zu werden, wird entwickelt.
Ein- bis Zweijährige lieben »Hoppe-hoppe-Reiter« immer noch, sie versuchen jedoch mitzusingen und bewegen sich aktiv im Rhythmus des Liedes mit. Kindergartenkinder, mit denen der Kniereiter »Hoppe- hoppe-Reiter« noch nie gespielt wurde, wollen diesen auch noch mit fünf Jahren erleben, ohne dass es sie als Spielform für Babys und Kleinkinder anmutet.
Der sogenannte »Mozart-Effekt«
»Mozart macht schlau!« – so hieß es vor einigen Jahren in den Schlagzeilen, und es gab in der Folge viele Baby-CDs mit Mozartmusik. Sinn oder Unsinn?
Der sogenannte »Mozart-Effekt« wurde beobachtet in einem Forschungssetting (vgl. Rauscher, Shaw & Ky 1993), bei dem die Probanden nach zehnminütigem Hören einer Klaviersonate von Wolfgang Amadeus Mozart zu ihren visuell-räumlichen Fähigkeiten getestet wurden. Dabei stellte man eine kurzfristige Zunahme dieser Fähigkeiten fest. Die Forscher interpretierten die Befunde in der Weise, dass das Hören von Musik Mozarts bei Kindern die Intelligenz fördern würde. Dies führte zu einer breiten Reaktion in der Öffentlichkeit. Letztendlich ergab sich aus weiteren Studien jedoch (vgl. Husain u. a. 2002), dass hinter dem »Mozart-Effekt« ein Anstieg des körperlichen, kognitiven und emotionalen Erregungsniveaus und eine durch die Musik vermittelte positive Stimmung steht. Beim ruhigen und meditativen Adagio in g-Moll von Albinioni sank hingegen das Erregungsniveau der Probanden. Gleichzeitig nahmen bei ihnen auch die Leistungen im visuell- räumlichen Bereich ab (vgl. Maier-Karius 2010).
Fazit: Letztendlich sind die Studien ein weiterer wissenschaftlicher Beweis dafür, dass Musikhören sich vegetativ (z. B. auf den Herzschlag) auf den Körper, Kognition und Wahrnehmung und auf die emotionale Grundstimmung auswirkt (vgl. Kopiez 2008, S. 525 ff.).
1.3 Entwicklungsfenster im Bildungsbereich Musik
Viele Eltern und pädagogische Fachkräfte stehen staunend vor dem unbändigen Willen und der Lebensfreude, mit der Babys und Kleinkinder musikalische Elemente wie Singen, Klatschen, Tanzen von ihnen einfordern. Wie schön, wenn das soziale Umfeld diesem Bedürfnis entsprechen kann. Die Entwicklung musikalischer Fähigkeiten wird gerade in der frühen Kindheit mit dem Erlernen der Muttersprache und weiteren kognitiven Fähigkeiten wie der Aufmerksamkeitsspanne und dem Gedächtnis in Zusammenhang gebracht. Die Grundlagen für die Entwicklung von musikalischen Fähigkeiten sind schon im Mutterleib untrennbar mit Bewegung, Gesang und Sprache der Außenwelt verbunden.
1.3.1 Psychologische Aspekte der musikalischen Entwicklung des Kindes
Um sich der musikalischen Entwicklung von Kindern anzunähern, ist es sinnvoll, sich zuerst einmal Gedanken über den Begriff »Musikalität« zu machen. Musikpädagogen hören häufig im Gespräch: »Ich bin unmusikalisch.« Manchmal ist jedoch in dieser verallgemeinernden Aussage eine gewisse Diskrepanz zwischen der eigenen Einschätzung und den tatsächlichen Fähigkeiten herauszuhören. »Ja, aber singen tu ich gerne, vor allem, wenn jemand mitsingt!«, kommt im Nachsatz hinterher und verdeutlicht, dass neben dem Hören von Musik doch eine gewisse musikalische Aktivität gelebt wird.
Musikalität wird in der Musikpsychologie als universelle und biologisch-genetisch vorhandene Fähigkeit bezeichnet, die sich jedem Menschen in seinem jeweiligen kulturellen Kontext in vielfältigen schon vorhandenen Umsetzungsformen vermittelt. In jeder Kultur gibt es musikalische Normen und Gebräuche, und selbst ein Fötus lernt diese musikalischen Ausdrucksformen in Instrumentalmusik, Gesang und Sprache kennen, da er circa ab der 25. Schwangerschaftswoche hören kann. Falls sich die Mutter zur Musik bewegt, wird das Ungeborene sogar im Rhythmus mitbewegt und erhält zusätzlich Anregungen für seine taktil-kinästhetische Wahrnehmungsentwicklung.
Der amerikanische Musikpsychologe Edwin E. Gordon spricht von unterschiedlichen Graden von musikalischen Fähigkeiten, die uns Menschen wohl angeboren sind (vgl. Gordon 2003). Die Entwicklung des musikalischen Potentials eines Menschen ist von seiner jeweiligen musikalischen Sozialisation – vor allem in der frühen Kindheit – abhängig. Nichtmusikalisch zu sein ist somit erlernt (Amusie kommt tatsächlich nur bei einem geringen Prozentsatz von bis zu 5 % der Bevölkerung vor und kann durch eine Hirnschädigung hervorgerufen werden oder genetisch bedingt sein). Oder anders herum ausgedrückt: Das von Geburt an vorhandene Potential wurde vernachlässigt.
Musikalische Entwicklung in der Musikpsychologie
In der Musikpsychologie wird die musikalische Entwicklung in drei Phasen unterteilt.
1. Die präkonventionelle Phase – das unkontrollierte Spielen, bei der sich das Baby und jüngere Kind seiner Umwelt anpasst und die in seinem kulturellen Umfeld üblichen musikalischen Motive, Sprach- und Stimmeinsatz und Bewegungen noch nicht nachahmen kann.
2. Die konventionelle Phase – das kontrollierte Spielen, bei dem das Kind die musikalischen Regeln, Normen und Gebräuche bewusst in Handlungen, Bewegungen und sprachlich-stimmlich umsetzen kann (ab ca. 2 Jahre).
3. Die postkonventionelle Phase – das bewusste Spielen basiert auf den elementaren Fähigkeiten der vorhergehenden Phasen und bedeutet einen bewussten Umgang und Wissen über die musikalischen Konventionen, Abweichungen, Varianten und Neuentwicklungen (Jugend- und Erwachsenenalter).
Diese drei Phasen werden wiederum in sieben Stufen des musikalischen Entwicklungsverlaufs untergliedert, die jedoch weiter erforscht werden müssen (vgl. Hirler & Stadler Elmer 2012b).
Musikalische Konventionen
Musikalische Konventionen werden durch das jeweilige soziokulturelle Umfeld geprägt und spielen eine große Rolle bei der musikalischen Entwicklung von Kindern. Sie werden als kulturell entwickelte musikalische Regeln definiert. Zum Beispiel:
▶ Welche Instrumente und Stücke werden bei welchem gesellschaftlichen Anlass gespielt?
▶ Welchen Tonumfang und welche Tonabstände hat die Tonleiter?
▶ Welchen musiktheoretischen Regeln (z. B. Einsatz und Abfolge von Akkorden) folgt die Harmonielehre des jeweiligen Kulturkreises?
Diese Konventionen werden zwar einerseits über Generationen überliefert, unterliegen andererseits jedoch einem ständigen Wandel.
1.3.2 Die musikalischen Entwicklungsfenster unter entwicklungspsychologischen und pädagogischen Aspekten
Die nachfolgend beschriebenen Entwicklungsfenster zeigen auf, wie eng und originär musikalische Erfahrungen mit kognitiv-sprachlichen, motorischen, sozialen und sensorischen Fähigkeiten verknüpft sind und sich auf die Entwicklung des Gehirns positiv auswirken.
Laufen- und Sprechenlernen sind individuelle Entwicklungsprozesse. Das Laufenlernen kann sich z. B. innerhalb eines Zeitfensters ab dem siebten bis zum 20. Lebensmonat vollziehen. Ebenso individuell beginnen Kinder musikalische Fähigkeiten zu entwickeln. Aus diesem Grund sind die Altersangaben zu den Entwicklungsbereichen als ungefährer Zeitrahmen anzusehen. Die Sprachentwicklung, Entwicklung der Motorik und kognitive Fähigkeiten sind untrennbar mit der musikalischen Entwicklung verbunden und werden – wo relevant – ebenfalls mit aufgeführt.
Vorgeburtliches Hören
Schon im Mutterleib bilden sich neuronale Strukturen durch Musik, Klänge und Geräusche. Die Töne und Geräusche, die zum Ungeborenen durchdringen, sind allerdings gedämpft, können allerdings mit einer Lautstärke von ca. 85 dB bei einer laut singenden Mutter auf das embryonale Gehör einwirken. Aus diesem Grund verfügen Neugeborene über eine erhöhte Sensibilität gegenüber der mütterlichen Stimme und schon in der Schwangerschaft gesungenen Liedern und Musikstücken und der Muttersprache (vgl. Hannon & Schellenberg 2008, S. 131 ff.). »Das Gehör ist in der pränatalen Phase die vorherrschende sensorische Modalität« (vgl. Parncutt 2016, zit. nach Hallam 2018, S. 105). Kinder und Erwachsene erkennen Musikstücke, die ihre Mutter während der Schwangerschaft gesungen oder auf einem Instrument gespielt hat (vgl. Hüther & Krens 2011, S. 87). Viele Mütter berichten, dass sich ihr Baby mit den Wiegenliedern sehr gut beruhigt, die sie während der Schwangerschaft sang.
0 bis 12 Monate
▶ Richtungshören (Kopf hinwenden)
▶ Beidhändig greifen, Pinzettengriff
▶ Robben, krabbeln, sitzen, abstützen, loslassen, greifen
▶ Unterscheiden von kurzen Melodien (ab ca. 5 Monate)
▶ Lallmonologe und Singsang
▶ Tonimitationen und Experimentieren mit variablen Stimmhöhen
Der Säugling beginnt nach der Geburt, die Vorgänge Hören, Vokalisieren und Bewegungen zu koordinieren, damit er seine Bedürfnisse seiner Umwelt immer besser mitteilen kann. Eltern verwenden intuitiv Kommunikationsweisen, die den Säugling beruhigen oder anregen. Andererseits lassen sich die Eltern vom Säugling dazu anregen, seine stimmlichen Äußerungen (Vokalisationen) zu imitieren (vgl. Hirler & Stadler Elmer 2012b). Diese Eltern-Kind-Dialoge stimulieren die vorsprachliche und vormusikalische Entwicklung und sprachlich-musikalische Rituale zwischen Kind und Eltern.
Praktische Umsetzungsmöglichkeiten und ihre fördernde Wirkung:
▶ Singen in Kombination mit Wiegebewegungen vermittelt Geborgenheit.
▶ Lieder haben günstigerweise einen geringen Tonumfang und zeichnen sich durch Wiederholungen aus.
▶ Kose- und Neckspiele geben dem Kind emotionale und multisensorische Eindrücke.
▶ Kniereiter, Krabbelreime, Finger- und Handspiele und gemeinsames Tanzen und Singen entwickeln bei den Säuglingen ein gutes Rhythmusgefühl und fördern die Sprachentwicklung sowie das Körperbewusstsein durch die taktil-kinästhetischen Sinneseindrücke.
Ab dem 2. Lebensjahr
▶ Einfache Bewegungsformen imitieren (z. B. das Trippeln einer Maus)
▶ Das Kind spricht Zweiwortsätze, versteht jedoch schon wesentlich mehr Wörter als es sprechen kann.
▶ Bewegt sich mit Hingabe zu rhythmischer Musik in einem gleichmäßigen Tempo.
▶ Es vokalisiert Fragmente von Melodien.
▶ Ab ungefähr 20 Monaten können Kinder mit beiden Händen abwechselnd auf einer Trommel schlagen.
▶





























