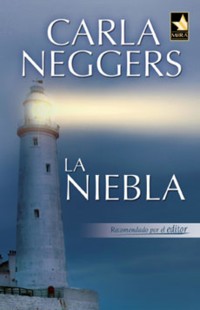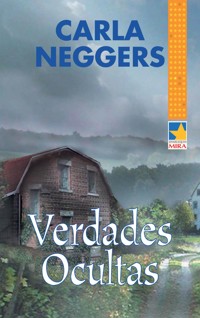5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: MIRA Taschenbuch
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mit jeder neuen Drohung, die Lucy erhält, wächst ihre Angst, und als ganz in ihrer Nähe ein Schuss fällt, weiß sie, dass es höchste Zeit ist zu handeln. Der Sicherheitsexperte Sebastian Redwing, ein Freund ihres verstorbenen Mannes, muss ihr helfen! Doch je länger Sebastian bei Lucy und ihren Kindern in Vermont bleibt, je erotischer die Gefühle werden, die sie füreinander empfinden, desto näher rückt die tödliche Gefahr aus Lucys Vergangenheit in Washingtons Politkreisen, in denen Macht alles ist...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 438
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Alle Rechte, einschließlich das der vollständigen oder auszugsweisen Vervielfältigung, des Ab- oder Nachdrucks in jeglicher Form, sind vorbehalten und bedürfen in jedem Fall der Zustimmung des Verlages.
Der Preis dieses Bandes versteht sich einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Carla Neggers
Haus der Angst
Roman
Aus dem Amerikanischen von Rainer Nolden
MIRA® TASCHENBUCH
MIRA® TASCHENBÜCHER
erscheinen in der Cora Verlag GmbH & Co. KG,
Axel-Springer-Platz 1, 20350 Hamburg
Deutsche Erstveröffentlichung
Titel der nordamerikanischen Originalausgabe:
The Waterfall
Copyright © 2000 by Carla Neggers
erschienen bei: Mira Books, Toronto
Published by arrangement with
Harlequin Enterprises II B.V., Amsterdam
Konzeption/Reihengestaltung: fredeboldpartner.network, Köln
Umschlaggestaltung: pecher und soiron, Köln
Titelabbildung: Corbis, Düsseldorf
Autorenfoto: © by Harlequin Enterprise S.A. Schweiz
Satz: Berger Grafikpartner, Köln
ISBN 978-3-95576-246-9
www.mira-taschenbuch.de
eBook-Herstellung und Auslieferung:
readbox publishing, Dortmund
www.readbox.net
Werden Sie Fan von MIRA Taschenbuch auf Facebook!
Haus der Angst
Immer bedrohlicher werden die Botschaften: Wer hat Lucy und ihre zwei Kinder in Vermont aufgespürt, um ihr friedliches Leben zu zerstören? Sie braucht Hilfe! Ihr fällt nur Sebastian Redwing, ein Freund ihres verstorbenen Mannes, ein. Doch was für eine Enttäuschung: Sie steht einem äußerst unfreundlichen Fremden gegenüber, der sie abweist. Einige Tage später jedoch kommt Sebastian zu ihr. Lucy ist ihm nicht mehr aus dem Kopf gegangen – er muss sie beschützen! Eine dunkle Ahnung sagt ihm, dass er den Täter direkt in den Kreisen der Politprominenz von Washington, zu der Lucy früher gehörte, suchen muss …
Für Dick und Diane Ballou …
Für das Haus, die passende Kleidung, den Spaß und die Freundschaft.
ANMERKUNG DER AUTORIN
Ich danke Corine Quarterman, die mich in großzügiger Weise an den Erfahrungen hat teilhaben lassen, die sie bei diversen Abenteuerurlauben gesammelt hat, und die mich zu meinem ersten Wasserfall in Vermont geführt hat. Der Wasserfall in diesem Buch ist zwar erfunden, aber es gibt eine Menge von wunderschönen, malerischen Wasserfällen in diesem herrlichen Bundesstaat. Ich hoffe, dass die Leser Gelegenheit haben werden, einige von ihnen zu besuchen.
Vielen Dank auch an meinen Mann, Joe Jewell, weil er nicht alles vergessen hat, was er an der Militärakademie von Castle Heights gelernt hat, und an Kate und Zachary für ihre Geduld während eines besonders langen und heißen Sommers, den ich zum Schreiben genutzt habe. Ja, sogar in Vermont war der vergangene Sommer heiß …
Schließlich danke ich meiner Lektorin Amy Moore-Benson für ihre Ermutigung und Begeisterung … und dafür, dass sie mich zu einem Fan von crème brulée gemacht hat. Und meiner Agentin Meg Ruley, die ihrem unglaublichen Ruf wieder einmal mehr als gerecht geworden ist.
Die Handlung und Figuren dieses Romans sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind nicht beabsichtigt und wären rein zufällig.
1. KAPITEL
„Witwe Swift?“ Lucy zog eine Grimasse, als ihre Tochter ihr den neuesten Dorfklatsch erzählte. „Wer um alles in der Welt nennt mich denn so?“
Madison zuckte mit den Schultern. Sie war fünfzehn – und sie saß am Steuer. Auch das war etwas, woran Lucy sich erst noch gewöhnen musste. „Jeder.“
„Und wer ist jeder?“
„Na, zum Beispiel die sechs Leute, die in diesem Kaff wohnen.“
Lucy beachtete den sarkastischen Unterton nicht. Witwe Swift. Großer Gott. Aber vielleicht war das ja auch ein Zeichen von Anerkennung. Ein bisschen merkwürdig zwar, doch immerhin. Freilich gab sie sich keinen Illusionen hin: Sie war keine „echte“ Vermonterin. Selbst nach drei Jahren war sie immer noch eine Außenseiterin, noch immer jemand, von dem die Leute erwarteten, dass er jeden Moment seine Sachen packen und zurück nach Washington ziehen würde. Lucy wusste, dass Madison sich nichts sehnlicher wünschte. Als sie zwölf Jahre alt war, da hatte das Leben im ländlich-beschaulichen Vermont für sie noch viele Abenteuer bereitgehalten. Für eine Fünfzehnjährige war es dagegen eine Zumutung. Wenigstens hatte sie jetzt ihren Führerschein. Aber warum konnte sie nicht im schicken Washingtoner Stadtteil Georgetown leben?
„Na gut“, meinte Lucy, „dann sag jedem, dass ich lieber Lucy genannt werde, oder Mrs. Swift oder meinetwegen Ms. Swift.“
„Klar, Mama.“
„Eine Bezeichnung wie ‚Witwe Swift‘ wird man ja nie wieder los.“
Madison schien die ganze Sache so sehr zu amüsieren, dass sie darüber vollkommen ihre Nervosität vergaß, die sie jedes Mal überfiel, wenn sie einparken musste. Sie kam mühelos in einen Parkplatz vor dem Postgebäude im Zentrum des kleinen Vermonter Dorfs hinein.
„Das war ja einfach“, sagte Madison. „Also – Schalthebel auf Parken. Handbremse anziehen. Motor ausschalten. Schlüssel abziehen.“ Sie lächelte ihrer Mutter zu. Für ihren Ausflug in die Stadt hatte sie ein kurzes Sommerkleid angezogen; die dünnen Riemchen-Sandaletten, die sie dazu tragen wollte, hatte Lucy ihr allerdings verboten. „Siehst du? Ich habe nicht einen einzigen Elch angefahren.“
Seitdem sie in Vermont wohnten, hatten sie gerade einmal zwei Elche gesehen, aber keinen von ihnen auf dem Weg in die Stadt. Lucy sagte lieber nichts dazu. „Gute Arbeit.“
Madison sprang aus dem Wagen und lief hinüber zum Dorfladen, um „mal nach den Pantinen zu schauen“. Sie sagte es allerdings mit einem so unschuldigen Lächeln, dass es überhaupt nicht ironisch wirkte. Lucy ging zum Postamt, um einen Stapel Broschüren für ihr Reisebüro zu verschicken. Sie hatte sich auf Abenteuertrips spezialisiert, und ihre Website wurde oft angeklickt. Das Geschäft lief gut, um nicht zu sagen ausgezeichnet. Sie hatte tatsächlich eine Marktlücke entdeckt und begonnen, für sich und die Kinder eine Existenz aufzubauen. Es brauchte eben alles seine Zeit.
„Witwe Swift“, murmelte sie vor sich hin. „Mist.“
Sie wünschte, sie könnte die Bezeichnung mit einem Lachen abtun. Aber so einfach war die Sache nicht. Sie war jetzt achtunddreißig Jahre alt. Colin war vor drei Jahren gestorben. Sie wusste, dass sie eine Witwe war, doch sie wollte nicht so gesehen werden. Im Grunde genommen wusste sie eigentlich überhaupt nicht, wie sie von den anderen gesehen werden wollte. Jedenfalls nichts als Witwe.
Der Ort döste in der Julihitze. Nicht die leiseste Brise bewegte die Blätter der riesigen Ahornbäume auf dem Dorfplatz. Einen Laden, das Postamt, die Eisenwarenhandlung und zwei Bed-&-Breakfast-Pensionen – mehr gab es hier nicht. Manchester, das ein paar Meilen nordwestlich lag, bot beträchtlich mehr Einkaufsmöglichkeiten und Freizeitvergnügen.
Aber Lucy wollte ihre Tochter nicht so weit fahren lassen. Sie hatte ihren Führerschein schließlich erst seit zwei Wochen. Das hatte nichts damit zu tun, dass Madison noch nicht reif war für dichten Verkehr und belebte Straßen. Sie selbst konnte sich noch nicht an den Gedanken gewöhnen.
Als sie ihre Besorgungen auf dem Postamt erledigt hatte, ging sie wie gewohnt zur Fahrerseite ihres allradbetriebenen Geländewagens – ihren „Vermont-Wagen“, wie Madison ihn mit einem Anflug von Spott nannte. Sie wollte einen Jetta. Sie wollte die Stadt.
Seufzend erinnerte sich Lucy daran, dass ihre Tochter den Wagen lenkte. Fünfzehn – das war noch so jung. Sie ging hinüber zur Beifahrerseite und war überrascht, dass Madison noch nicht hinter dem Steuer saß. Autofahren war das Einzige, was ihre Tochter in diesem Sommer davor bewahrte, sich abgrundtief zu langweilen. Nicht einmal die Aussicht, am nächsten Tag nach Wyoming zu reisen, hatte sie aufmuntern können. Nichts würde sie auf andere Gedanken bringen – höchstens die Aussicht, doch noch ein Schuljahr bei ihrem Großvater in Washington verbringen zu können.
Wyoming. Lucy schüttelte den Kopf. Eigentlich war es eine verrückte Idee.
Sie ließ sich auf den von der Sonne erhitzten Beifahrersitz fallen und überlegte, ob sie den Trip dorthin nicht besser streichen sollte. Madison hatte sich bereits dagegen ausgesprochen. Und J. T., ihr zwölfjähriger Sohn, wäre auch lieber zu Hause geblieben und hätte nach Würmern gegraben. Sie wollte nach Jackson Hole fahren, um einige Fremdenführer aus dem Westen kennen zu lernen.
Im Prinzip ist es Zeitverschwendung, überlegte Lucy. Mit ihrem Reisebüro spezialisierte sie sich auf das nördliche Neu-England und die kanadischen Seen, und sie hatte gerade damit begonnen, Winterreisen nach Costa Rica zu organisieren. Dorthin hatten sich ihre Eltern zurückgezogen und eine Pension eröffnet. Sie hatte also genügend, um das sie sich kümmern musste. Jetzt auch noch Montana und Wyoming ins Programm zu nehmen würde nur bedeuten, dass sie sich verzettelte.
Der wahre Grund, warum sie nach Wyoming fuhr, war Sebastian Redwing und das Versprechen, das sie Colin gegeben hatte.
Aber auch das war genau genommen Zeitverschwendung. Eine Überreaktion von ihr, um nicht zu sagen, reine Dummheit. Nur weil sie ein paar seltsame Dinge erlebt hatte.
Lucy lehnte sich in ihren Sitz zurück. Sie spürte etwas unter ihrem Po. Es war vermutlich ein Kugelschreiber, ein Lippenstift oder ein Spielzeug von J. T. Sie fischte nach dem Gegenstand.
Der Atem stockte ihr, als sie das warme, schwere Metallstück in ihrer Hand sah.
Eine Pistolenkugel.
Sie widerstand dem Drang, das Ding aus dem Fenster zu werfen. Was, wenn es explodierte? Sie schauderte, als sie auf ihre Handfläche starrte. Das war keine leere Hülse. Sie hatte Leben in sich. Groß und schwer.
Jemand hatte diese verdammte Kugel auf ihren Sitz gelegt.
Die Scheiben waren heruntergelassen. Sie und Madison hatten die Türen nicht abgeschlossen. Jeder hätte vorbeikommen, die Kugel auf den Sitz werfen und einfach weitergehen können.
Lucys Hand zitterte. Nicht schon wieder. Verdammt, nicht schon wieder. Sie zwang sich, tief und gleichmäßig zu atmen. Sie kannte sich aus mit Abenteuerreisen – Paddeltouren, Kajakfahrten, Wandern, sie hatte Basiswissen in erster Hilfe. Sie konnte mit allen möglichen Herausforderungen einer jeden Reise fertig werden.
Aber nicht mit Pistolenkugeln.
Und sie wollte auch nichts mit solchen Dingen zu tun haben.
Madison kam mit einigen anderen Teenagern aus dem Dorfladen. Sie hielt den Autoschlüssel so lässig in der Hand, als würde sie schon seit Jahren fahren. Die Mädchen lachten und redeten durcheinander, und sogar als Lucy die Pistolenkugel in die Tasche ihrer Shorts schob, dachte sie: Doch, Madison, du hast Freundinnen hier. Seit dem Ende des Schuljahrs hatte Madison nämlich behauptet, sich überhaupt nicht wohl zu fühlen. Vermutlich nur, um darauf hinzuweisen, wie wichtig Washington für sie war.
Sie sprang auf den Fahrersitz. „Schnall dich an, Mama. Wir sind startklar.“
Lucy sagte nichts von der Kugel. Das war schließlich nicht das Problem ihrer Kinder, sondern ihr eigenes. Sie hoffte immer noch, dass sie nicht mit Absicht belästigt wurde. Die Ereignisse, mit denen sie in den vergangenen Wochen hatte fertig werden müssen, waren zufällig, harmlos, bedeutungslos. Sie hatten nichts miteinander zu tun. Sie waren nicht dazu gedacht, sie einzuschüchtern.
Der erste Zwischenfall hatte sich am Sonntagabend ereignet. Das Fenster im Esszimmer hatte offen gestanden, und die Vorhänge blähten sich in der Sommerbrise. Dieses Fenster öffnete sie normalerweise nie. Madison und J. T. sowieso nicht. Lucy hatte nicht mehr an den Vorfall gedacht, bis am darauf folgenden Abend das Telefon klingelte, kurz bevor es dunkel wurde. Als sie müde den Hörer abnahm, hörte sie nur ein heftiges Atmen, dann wurde die Verbindung unterbrochen. Merkwürdig, hatte sie gedacht.
Als sie dann am Dienstag in ihren Briefkasten schaute, der am Anfang der Einfahrt stand, hatte sie das untrügliche Gefühl gehabt, beobachtet zu werden. Irgendetwas hatte sie beunruhigt – das Knacken eines Zweiges, das Knirschen von Kies. Und sie war ganz sicher, dass sie es sich nicht eingebildet hatte.
Am nächsten Morgen hatte sie dieses Gefühl wieder gehabt, als sie die Hintertreppe fegte. Zehn Minuten später hatte sie eine ihrer Tomatenstauden auf der Veranda vor dem Haus gefunden. Jemand hatte sie aus dem Boden gerissen.
Und heute nun die Pistolenkugel auf ihrem Autositz.
Vielleicht machte sie sich nur etwas vor. Jedenfalls glaubte sie nicht, dass das alles ausreichte, um deswegen zur Polizei zu gehen. Jeder Zwischenfall konnte, für sich genommen, einen ganz harmlosen Grund haben – ihre Kinder, deren Freunde, ihre Mitarbeiter konnten dafür verantwortlich sein, oder einfach nur Stress. Wie hätte sie beweisen können, dass jemand sie beobachtete? Es hätte sich verrückt angehört.
Lucy wusste genau, was passieren würde, wenn sie zur Polizei ginge. Sie würden Washington anrufen, und die Beamten aus Washington würde sich gezwungen fühlen, nach Vermont zu kommen und Untersuchungen anzustellen. Und das hätte das Ende ihrer beschaulichen Lebensweise bedeutet.
Es war nicht so, dass keiner in der Stadt über ihren Schwiegervater Jack Swift Bescheid wusste, den einflussreichen Senator. Jeder war darüber im Bilde. Aber sie hatte nie viel Aufhebens davon gemacht.
Sie war die Witwe seines einzigen Sohnes; Madison und J. T. waren seine einzigen Enkelkinder. Jack würde die Sache in die Hand nehmen. Er würde auf einer gründlichen Untersuchung durch den Sicherheitsdienst des Capitols bestehen, um sich zu vergewissern, dass seine Familie nicht seinetwegen in Schwierigkeiten steckte.
Lucy konnte sich nicht so recht vorstellen, warum jemand, der es auf Jack abgesehen hatte, seiner verwitweten Schwiegertochter eine Pistolenkugel auf den Autositz legen sollte. Es entbehrte jeder Logik. Nein. Sie war sicher. Ihre Kinder waren sicher. Es war einfach nur … merkwürdig.
„Mama?“
Madison hatte den Motor gestartet und war auf die Hauptstraße gefahren, ohne dass Lucy es bemerkt, einen Kommentar gemacht oder Anweisungen gegeben hatte. „Du machst das wirklich gut. Ich war mit meinen Gedanken gerade ganz woanders.“
„Was ist denn los? Irgendwas mit meiner Fahrweise?“
„Nein, natürlich nicht.“
„Ich kann mir auch jemand anderen als Beifahrer suchen. Du musst dich nicht opfern, wenn es dich nervös macht.“
„Du machst mich gar nicht nervös. Mir geht’s gut. Schau einfach nur auf die Straße.“
„Das tu ich doch!“
Madison umklammerte das Steuer. Lucy merkte, dass ihrer Tochter nichts entgangen war. Sie hatte ihr Angst eingejagt. „Madison. Du sitzt am Steuer. Du darfst dich nicht ablenken lassen.“
„Es liegt nicht an mir. Sondern an dir.“
An ihr. Lucy holte tief Luft. Sie konnte das Gewicht der Kugel in ihrer Tasche spüren. Wenn sie nun unter den Sitz gerollt wäre und J. T. sie gefunden hätte? Sie versuchte, diese Vorstellung zu verdrängen. Die Erfahrung hatte sie gelehrt, sich an die Tatsachen zu halten. Es war schon schwierig genug, damit fertig zu werden.
„Kümmer dich nicht um mich. Fahr einfach weiter.“
Madison schnaubte verärgert. Mit ihren blauen Augen und dem kupferroten Haar, der Art und Weise, wie sie sich oft in sich selbst zurückzog, und mit ihrem ungezügelten Ehrgeiz war sie ein getreues Ebenbild ihres Vaters. Sogar die Art, wie sie Auto fuhr – und das gerade mal zwei Wochen –, war ganz und gar Colin Swift.
Er war an Herzrhythmusstörungen gestorben, plötzlich und unerwartet, im Alter von sechsunddreißig Jahren während eines Tennismatchs mit seinem Vater. Ein angenehmes Leben und eine brillante Karriere wurden jäh beendet. Madison war zwölf gewesen, J. T. neun. Kein leichtes Alter, um den Vater zu verlieren. Sechs Monate später hatte Lucy ihre Kinder herausgerissen aus dem Leben, das sie kannten, das ihnen vertraut war – Schule, Freunde, Familie, „Zivilisation“, wie Madison zu sagen pflegte. Aber wenn sie nicht umgezogen wären, wenn Lucy nicht einen radikalen Schnitt gemacht hätte, um ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen, dann hätten die Kinder möglicherweise auch ihre Mutter verloren. Und das wäre bestimmt keine gute Lösung gewesen.
Nach Colins Tod hatte Sebastian Redwing sich nicht gerührt. Keine Blume, keine Karte, nicht ein einziges Wort von ihm. Zwei Monate später hatte sein Anwalt plötzlich vor ihrer Tür gestanden, um ihr das Haus seiner Großmutter in Vermont anzubieten, das er geerbt hatte. Daisy war ein Jahr vorher gestorben, und Sebastian hatte keine Verwendung dafür.
Lucy warf den Rechtsanwalt hinaus. Wenn Redwing nicht einmal sein Mitgefühl bekunden konnte, dann sollte er auch sein verdammtes Haus behalten.
Einen Monat später kam der Anwalt noch einmal. Diesmal konnte sie das Haus weit unter dem Marktwert erwerben. Sie würde Sebastian damit sogar noch einen Gefallen tun. Seine Großmutter hätte es gerne gesehen, wenn jemand aus der Familie das Haus bekäme. Aber er hatte keine Geschwister, und seine Eltern waren tot. Also war Lucy für ihn die beste Lösung.
Sie hatte das Angebot akzeptiert. Sie wusste immer noch nicht, warum. Sebastian hatte ihrem Mann einmal das Leben gerettet. Warum jetzt nicht auch ihres?
In Wahrheit hatte sie nicht einen einzigen überzeugenden Grund vorbringen können. Vielleicht war es der Reiz von Vermont und die Aussicht, ihr eigenes, auf Abenteuertrips spezialisiertes Reisebüro eröffnen zu können; vielleicht war es der Kummer, an dem sie fast erstickte, oder die Angst, ihre Kinder alleine großziehen zu müssen.
Möglicherweise lag es aber auch an dem Versprechen, das sie Colin kurz vor seinem Tod gegeben hatte. Niemand hatte gewusst, dass sein Herz in einem kritischen Zustand war – bis zu jenem Tag auf dem Tennisplatz. Das Versprechen hatte ganz nach einem dieser „Was-würdest-du-machen-wenn-wir-auf-einer-einsamen-Insel-gefangen-wären“-Gedankenspiele geklungen; nicht nach etwas, das jemals Wirklichkeit werden könnte.
Dennoch hatte Colin ganz freimütig und ernsthaft darüber geredet. „Wenn mir mal etwas passieren sollte, dann kannst du Sebastian vertrauen. Er ist ein feiner Kerl, Lucy. Er hat mir das Leben gerettet. Er hat meinem Vater das Leben gerettet. Versprich mir, dass du zu ihm gehst, wenn du jemals Hilfe brauchst.“
Sie hatte es ihm versprochen, und nun war sie in Vermont. Sie hatte nichts mehr von Redwing gehört, geschweige denn gesehen, seitdem sie das Haus seiner Großmutter gekauft hatte. Um die Abwicklung hatte sich einzig und allein sein Anwalt gekümmert. Lucy hatte gehofft, nie mehr in eine so verzweifelte Lage zu geraten, dass sie sich an das Versprechen, das sie Colin gegeben hatte, halten musste. Schließlich war sie intelligent, hatte Mumm und war daran gewöhnt, auf eigenen Füßen zu stehen.
Warum also wollte sie am nächsten Morgen mit den Kindern nach Wyoming fliegen – in den Bundesstaat, wo Sebastian Redwing lebte?
„Mama!“
„Du machst deine Sache großartig. Fahr weiter.“
Mit einem Finger strich Lucy über die glatte Oberfläche der Pistolenkugel in ihrer Hosentasche. Wahrscheinlich gab es eine ganz einfache Erklärung für das Geschoss und all die anderen Vorfälle. Vielleicht sollte sie sich einfach nur auf den Spaß freuen, den sie in Wyoming haben würde.
Die Bewohner des Ortes sprachen von Sebastian Redwings Großmutter immer noch als „Witwe Daisy“, und was von ihrer Farm übrig geblieben war, war für sie nach wie vor der „alte Wheaton-Besitz“. Im Laufe der Zeit hatte Lucy alles über Daisy erfahren. Daisy Wheaton hatte sechzig Jahre als Witwe in ihrem gelben Haus am Joshua-Fluss gelebt. Sie war achtundzwanzig Jahre alt, als ihr Mann bei dem Versuch ertrank, einen kleinen Jungen aus dem tobenden Wasserfall in den Hügeln oberhalb ihrer Farm zu retten. Zu Beginn des Frühjahrs hatte die Schneeschmelze den Wasserfall gefährlich anschwellen lassen. Der Junge hatte seinen Hund retten wollen, und Joshua Wheaton den Jungen. Später wurden die Wasserfälle und der kleine Fluss nach ihm benannt. Joshua-Fälle und Joshua-Fluss.
Daisys und Joshuas einziges Kind, eine Tochter, konnte es kaum erwarten, aus Vermont wegzukommen. Sie zog nach Boston und heiratete, und als sie und ihr Mann bei einem Unfall ums Leben kamen – der andere Autofahrer hatte Fahrerflucht begangen –, hatten sie einen vierzehnjährigen Sohn zurückgelassen. Sebastian war zu Daisy gezogen. Aber auch er war nicht in Vermont geblieben.
Ein paar tausend Quadratmeter Felder, Wälder und Gärten und das gelbe, verwinkelte, mit Schindeln gedeckte Haus – mehr war nicht von der ursprünglich riesigen Wheaton-Farm übrig geblieben. Daisy hatte ihr Land mit den Jahren Stück für Stück verkauft, an Farmer aus dem Ort und Leute, die auf den Grundstücken ihre Wochenendhäuser bauten. Das Herzstück ihres Besitzes behielt sie jedoch für sich oder denjenigen, der nach ihr kommen würde.
Man erzählte sich, dass Daisy nie mehr zu den Joshua-Fällen gegangen war, nachdem sie mitgeholfen hatte, den Leichnam ihres Mannes aus dem eiskalten Wasser zu bergen.
Witwe Daisy. Und jetzt also Witwe Swift.
Lucy zog eine Grimasse, während sie den Kiesweg zu der kleinen Scheune hinaufging. Sie hatte nicht viel an dem Gebäude verändert, als sie es zum Büro umfunktionierte. Plötzlich erschienen ihr die Jahrzehnte, die vor ihr lagen, wie ein langer Weg, und sie stellte sich vor, sechzig Jahre auf diesem Grundstück zu verbringen – allein.
Sie blieb stehen und hörte dem Joshua-Fluss zu, wie er über die Felsen stürzte und zwischen den steilen, von Büschen gesäumten Uferböschungen hinter der Farm entlangrauschte. Die Wasserfälle selbst lagen weiter oben in den Hügeln. Hier unten war der Fluss breit geworden und bewegte sich behäbig fort, ehe er seinen Weg unter einer Holzbrücke fortsetzte und in den Strom mündete. Sie hörte das Summen der Bienen in den Malvenbüschen vor der Garage. Sie schaute sich um, ließ ihre Augen über die weitläufige Wiese schweifen, die nach den jüngsten Regenfällen in üppigem Grün stand, und über das hübsche Farmhaus aus dem 19. Jahrhundert mit den weißen Petunien in den Blumenkästen auf der vorderen Veranda. Ihr Blick fiel auf die mächtigen alten Ahornbäume, die ihre Schatten in den Vorgarten warfen, wanderte über den Garten mit seinen Gemüsebeeten und Apfelbäumen und der Steinmauer, die eine Wiese mit Wildblumen einrahmte, bis hin zu einer weiteren Mauer am Ende der Wiese. Dahinter erstreckten sich die bewaldeten Berge. Alles war so ruhig und wundervoll.
„Du hättest es schlechter antreffen können“, flüsterte Lucy zu sich selbst, als sie ihr Büro betrat.
Das meiste, was sie über die Familie Wheaton-Redwing wusste, hatte sie nicht von dem wortkargen und ausweichenden Sebastian erfahren, sondern von Rob Kiley, ihrem einzigen Angestellten mit einer Vollzeitstelle. Er saß vor seinem Computer in dem großzügigen, schlichten Raum, der das Herzstück ihres Unternehmens war. Robs Vater war der Junge gewesen, den Joshua Wheaton vor sechzig Jahren gerettet hatte – eine dieser weitläufigen, aber wohl unvermeidlichen Verbindungen, mit denen Lucy gerechnet hatte, als sie in diese kleine Stadt gezogen war.
Rob schaute nicht auf. „Ich hasse Computer“, sagte er.
Lucy lächelte. „Das sagst du jedes Mal, wenn ich hier reinkomme.“
„Das tue ich bloß, damit dein Dickschädel es endlich begreift: Wir brauchen hier eine Vollzeitkraft, die diese Maschine bedient.“
„Was tust du denn gerade?“ wollte Lucy wissen. Sie schaute ihm nicht über die Schulter, denn das machte ihn wahnsinnig. Er war ein schlaksiger Vermonter, der die Ruhe weg hatte und dessen Talent zum Paddeln, Kenntnisse über die Berge, Täler, Flüsse und Küsten vom nördlichen Teil Neu-Englands ihn unersetzlich machten – ebenso wie sein Enthusiasmus, seine Ehrlichkeit und seine Freundschaft.
„Ich stelle gerade die endgültige, ab sofort in Stein gemeißelte und nie mehr zu verändernde Marschroute für die Rucksacktour von Vater und Sohn zusammen.“ Das war ein Angebot für Neu-England-Anfänger: Eine Fünf-Tage-Tour mit Rucksack auf nicht allzu schweren Wanderwegen in den südlichen Green Mountains. Das Angebot war schneller ausgebucht gewesen, als er und Lucy es sich hätten träumen lassen. Rob schaute auf, und sie wusste, was er dachte. „J. T. kann immer noch mit uns kommen. Ich habe ihm gesagt, dass ich zwar seinen Vater nicht ersetzen kann, aber wir können trotzdem eine Menge Spaß haben.“
„Ich weiß. Doch das muss er alleine entscheiden. Ich kann nicht über seinen Kopf bestimmen.“
Er nickte. „Na, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Übrigens, er und Georgie graben nach Würmern im Garten.“
Damit hatte Lucy gerechnet. Sie lachte. „Madison wird entzückt sein. Ich habe sie nämlich gerade losgeschickt, sie zu suchen.“
Rob lehnte sich in seinen Stuhl zurück und reckte sich. Es war eine Qual für ihn, vor einem Computer zu sitzen. Lieber hätte er jeden Tag mit Paddeln verbracht. „Wie steht’s denn mit ihren Fahrkünsten?“
„Besser als mit meinen. Sie liegt mir immer noch wegen eines Schuljahres in Washington in den Ohren.“
„Großvater Jack wäre begeistert.“
„Ach, sie verklärt Washington. Es ist alles das, was Vermont nicht ist.“
Rob zuckte mit den Schultern. „Ist doch auch so.“
„Du bist wirklich eine Hilfe!“ Lucy verging das Lachen schnell, als sie die Hand in ihre Tasche steckte und die Pistolenkugel herauszog. „Ich möchte dir mal was zeigen.“
„Gerne.“
„Aber du darfst mit niemandem darüber sprechen.“
„Und warum nicht?“
„Sag mir erst, dass du es nicht tust.“
„Okay, ich tu’s nicht.“
Sie öffnete die Faust und ließ die Kugel über ihre Handfläche rollen. „Was hältst du davon?“
Rob runzelte die Stirn. „Es ist eine Pistolenkugel.“
„Das weiß ich auch. Aber was für eine?“
Er nahm sie ihr aus der Hand und legte sie unbekümmert auf seinen mit Papieren voll beladenen Schreibtisch. Schließlich war er mit Waffen aufgewachsen. „Vierundvierziger Magnum. Es ist eine voll funktionsfähige Patrone und keine leere Hülse.“
Sie nickte. „Das ist mir schon klar. Kann sie auch losgehen?“
„Nicht, wenn sie bloß auf meinem Schreibtisch liegt. Aber wenn du sie im richtigen Winkel zu Boden fallen lässt oder mit einem Rasenmäher oder irgendetwas anderem darüber fährst, könnte sie dir um die Ohren fliegen.“
Lucy unterdrückte ein Schaudern. „Das hört sich gar nicht gut an.“
„Falls sie losgeht, kannst du ihre Richtung nicht beeinflussen. Mit einem Gewehr kannst du wenigstens zielen. Vielleicht triffst du daneben. Aber wenn du mit einem Rasenmäher über so ein Ding fährst, dann hast du keine Möglichkeit, ein Ziel zu bestimmen. Es kann nach allen Seiten losgehen.“ Er klang ruhig, doch seine dunklen Augen blickten ernst. „Wo hast du sie gefunden?“
„Was? Ach so.“ Sie hatte sich keine Geschichte zu ihrem Fund ausgedacht, und sie verabscheute es zu lügen. „In der Stadt. Ich bin sicher, dass es nichts zu bedeuten hat.“
„Da stecken doch nicht etwa Georgie oder J. T. dahinter? Wenn sie mit Pistolen und Munition herumspielen …“
„Nein.“ Lucy stockte beinahe der Atem. „Als ich eben in der Stadt war, bin ich darüber gestolpert. Ich wollte nicht, dass jemand verletzt wird, deshalb habe ich sie mitgenommen. Du solltest mir nur sagen, ob ich mir unnötig Sorgen gemacht habe.“
„Ganz und gar nicht. Da war jemand sehr unvorsichtig.“ Er berührte die stumpfgraue Metallspitze des Geschosses. „Möchtest du, dass ich es für dich entsorge?“
„Bitte, ja.“
„Dann tu mir einen Gefallen. Schau mal in J. T.s Zimmer nach, und ich werde mich mal in Georgies umsehen. Wenn ich etwas finde, sage ich dir Bescheid. Und du lässt es mich wissen. Ich habe kein Gewehr zu Hause, und ich weiß, dass du auch keines hast, aber sie wären nicht die ersten zwölfjährigen Jungen …“
„Es war nicht J. T. oder Georgie.“
Rob schaute ihr fest in die Augen. „Wenn du J. T.s Zimmer nicht durchsuchen willst, dann tu ich es.“
Lucy nickte. „Du hast Recht. Ich werde mal nachsehen.“
„Auch im Keller. Ich habe mich in dem Alter mal fast selbst in die Luft gejagt, als ich mit Schießpulver herumexperimentiert habe.“
„Ich habe kein Schießpulver im Haus.“
„Lucy!“
„Ist ja schon gut!“
Rob musterte sie schweigend. Sie kannte ihn, seitdem sie in Vermont wohnte. Er und seine Frau Patti waren ihre besten Freunde. Georgie und J. T. waren unzertrennlich. Aber von den unheimlichen Vorkommnissen hatte sie ihm nichts erzählt.
Lucy bemühte sich, seinem Blick standzuhalten. Schweiß lief ihr den Rücken hinunter, und ihr Hemd war nass. Es gab so viel zu tun, die Verantwortung war so groß. Das hatte ihr gerade noch gefehlt: Ein Verrückter, der es auf sie abgesehen hatte. „Sieh nur zu, dass du die verdammte Kugel los wirst, ja?“
Rob verschränkte die Arme vor der Brust. „Klar.“
Sie konnte seine Gedanken erraten. Jeder hätte das Gleiche gedacht. Dass sie mit ihren Nerven am Ende war, gereizt und angespannt, weil ihr Unternehmen sich rapide entwickelte und sie viel zu tun hatte, weil sie Witwe war und allein erziehend, und weil sie eine lange Reise in den Westen vor sich hatte. Und dass er mit ihr über all das reden wollte.
Aber Rob mischte sich nicht gern in die Angelegenheiten anderer Leute ein, und Lucy war dankbar für seine Zurückhaltung. „Es tut mir Leid, wenn es so aussieht, als ob ich ein bisschen durcheinander bin. Ich habe an diesem Wochenende so viel um die Ohren mit diesem Trip nach Wyoming. Kannst du die Stellung hier halten?“
„Das steht doch fett gedruckt in meinem Lebenslauf. Kann jede Stellung halten.“
Seine Augen schauten nicht belustigt, doch Lucy tat so, als ob sie es nicht bemerkte. „Was würde ich nur ohne dich machen?“
Die Antwort kam umgehend. „Bankrott.“
Sie lachte. Jetzt, da sie die Pistolenkugel los war, fühlte sie sich besser. Diese Vorfälle konnten einfach nicht zusammenhängen. Es war verrückt und paranoid zu glauben, sie seien Teil einer bizarren Verschwörung gegen sie. Welchen Grund sollte es dafür geben?
Sie ließ Rob allein mit seinem Ärger über den Computer und dem Problem, die Kugel loszuwerden, und ging hinaus. Später wollte sie ihn nach seiner Meinung über dieses „Witwe-Swift“-Gerede fragen. Im Grunde führte sie hier ein angenehmes Leben, und das war schließlich die Hauptsache.
„Ich habe Limonade gemacht“, rief Madison von der Veranda vor dem Haus.
„Prima. Ich bin gleich da.“
Lucy erinnerte sich daran, dass ihre Tochter erst seit einigen Monaten über ihren Umzug nach Vermont bekümmert war.
„Ich tu einfach so, als ob ich in einer Episode von ‚Die Waltons‘ mitspiele“, sagte Madison, als ihre Mutter sich zu ihr in den Korbsessel zwischen den Hängepetunien setzte. Sie hatte tatsächlich einen von Daisys alten Glaskrügen mit Limonade gefüllt und eine ihrer vergilbten Schürzen umgebunden. Sebastian hatte nichts von den Sachen seiner Großmutter mitgenommen, als er das Haus verkaufte.
„Hast du die Jungen gefragt, ob sie auch etwas möchten?“ fragte Lucy.
„Sie graben da draußen immer noch nach Würmern. Es ist ekelhaft. Sie stinken nach Dreck und Schweiß.“
„Du hast auch mal gerne Würmer ausgegraben.“
„Igitt!“
Lucy lächelte. „Na gut, dann werde ich sie eben fragen. Und weil du die Limonade gemacht hast, können sie ja aufräumen.“
Die beiden Jungen arbeiteten immer noch konzentriert in einer Ecke des Gemüsegartens – ziemlich nahe bei Lucys Tomaten. Nicht, dass es ihr etwas ausgemacht hätte. Sie war keine leidenschaftliche Gärtnerin, wie Daisy eine gewesen war. Sie hatte zwar Beete aufgeschüttet, auf die sie Rindenmulch gestreut hatte, und dazwischen Pfade angelegt. So konnte sie Pflanzen züchten, die viel Platz benötigten – zum Beispiel verschiedene Kürbissorten und Gurken. Aber das reichte auch. Sie hatte wenig Lust, das selbst gezogene Gemüse und Obst auch noch einzuwecken oder einzufrieren.
„Madison hat Limonade gemacht. Wollt ihr beiden auch etwas haben?“
„Später“, antwortete J. T. Er war so sehr mit seiner Würmersuche beschäftigt, dass er nicht einmal aufschaute.
Er hatte Colins kupferrotes Haar und seine blauen Augen, obwohl sein stämmiger Körperbau mehr nach den Blackers als nach den Swifts geraten war. Lucy lächelte beim Gedanken an ihren untersetzten, stets freundlichen Vater. Sie hatte die schlanke Figur und die helle Gesichtsfarbe ihrer Mutter geerbt, und genau wie ihre Eltern hielt sie sich am liebsten im Freien auf. Vor kurzem hatten sie sich nach Costa Rica zurückgezogen, wo sie eine Pension führten, nachdem sie lange am Smithsonian Museum gearbeitet hatten. Lucy wollte sie mit Madison und J. T. zu Thanksgiving besuchen und bei dieser Gelegenheit die Einzelheiten einer Reise nach Costa Rica ausarbeiten, die sie ihren Kunden im nächsten Winter anbieten wollte. Das war ein langwieriger und komplizierter Prozess, bei dem sie jede Einzelheit berücksichtigen und jede Kleinigkeit prüfen musste – Anreise, Essen, Unterbringung, Pläne für Notfälle. Sie durfte nicht das Geringste dem Zufall überlassen.
Es wäre vernünftiger, nach Costa Rica zu fliegen, um sie zu besuchen, als nach Wyoming, um Sebastian Redwing zu treffen, überlegte Lucy.
J. T. wühlte mit seinen bloßen Händen die Erde auf und schüttete sie in eine große Konservendose, die er und Georgie aus dem Recycling-Müll herausgefischt hatten. „Wir wollen angeln gehen. Wir haben tonnenweise Würmer. Willst du mal gucken?“
Pflichtschuldig warf Lucy einen Blick in die Dose mit den sich windenden Würmern. „Wunderschön. Aber wenn ihr angeln gehen wollt, bleibt bitte hier unten. Geht nicht in die Nähe der Wasserfälle.“
„Ich weiß, Mama.“
Er wusste es. Natürlich. Ihre beiden Kinder wussten alles. Der Umstand, dass sie noch so jung waren, als sie ihren Vater verloren, hatte ihr Selbstbewusstsein keineswegs untergraben. Sie hatten Colins Optimismus geerbt, seinen Schwung und seine Energie, seinen Glauben an eine bessere Zukunft und die Ausdauer, mit der er seine Ziele verfolgt hatte. Wie ihr Vater liebten es auch Madison und J. T., sich um tausend Dinge gleichzeitig zu kümmern.
Lucy ließ die Jungen mit ihren Würmern allein und ging zurück auf die Veranda. Madison hatte inzwischen Stoffservietten und Butterplätzchen geholt. „Ich glaube, ich bin heute eher Anne of Green Gables.“
„Ist das besser als John-Boy Walton?“
Madison legte die Stirn in Falten und setzte sich auf das Korbsofa. Die schlanken Beine hatte sie hochgezogen und zum Schneidersitz verschränkt. „Mama, ich habe überhaupt keine Lust, nach Wyoming zu fahren. Kann ich nicht hier bleiben? Es ist doch nur übers Wochenende. Rob und Patti könnten auf mich aufpassen. Oder ich frage eine Freundin, ob sie bei mir bleibt.“
Lucy schenkte sich ein Glas Limonade ein und setzte sich auf einen Korbstuhl. Ihre Tochter war verdammt hartnäckig. „Ich dachte, du könntest es kaum erwarten, von Vermont wegzukommen.“
„Aber doch nicht nach Wyoming. Da sind nur noch mehr Berge und Bäume.“
„Höhere Berge, andere Bäume. Und in Jackson gibt es ganz tolle Geschäfte.“
Ihr Gesicht hellte sich auf. „Heißt das, du gibst mir Geld?“
„Ein bisschen. Ich dachte eigentlich eher an einen Schaufensterbummel. Die Preise sind da nämlich ziemlich gesalzen.“
Ihre Tochter fand das nicht komisch. „Wenn ich im Flugzeug neben J. T. sitzen muss, will ich aber erst sehen, was er in seinen Taschen hat.“
„Ich erwarte, dass du die Eigenheiten deines Bruders respektierst, genauso wie ich von ihm erwarte, dass er deine respektiert.“
Madison verdrehte die Augen.
Lucy nahm einen Schluck von der Limonade. Die Mischung von herb und süß war perfekt – genau wie bei ihrer fünfzehnjährigen Tochter. Madison entknotete die Beine und stürzte ins Haus. Nicht nur, dass dieses Kind der Großstadt in der hintersten Provinz festsaß; nun sollte die bedauernswerte große Schwester auch noch neben ihren kleinen Bruder ins Flugzeug gesteckt werden.
Lucy nahm sich vor, sie am Wochenende in Ruhe zu lassen, damit sie mit sich ins Reine kommen konnte. Dann würde sie mit ihr über Lebensansichten diskutieren und darüber, dass sie nicht mehr allzu oft am Steuer würde sitzen dürfen, wenn sie ihre Einstellung nicht änderte.
Sie legte die Füße auf das Geländer und hoffte, dass die kühle Brise ein wenig Entspannung bringen würde. Die Reise nach Wyoming war im Grunde sinnlos. Sie wusste es, und ihre Kinder ahnten es zumindest.
Die Petunien brauchten Wasser. Sie ließ den Blick über die schöne Wiese mit den riesigen Ahornbäumen schweifen, die üppigen alten Rosensträucher, die beschnitten werden mussten. Heute war sie mit ihrer Fünfzehnjährigen, die am Steuer gesessen hatte, in die Stadt gefahren, hatte eine Dose mit Würmern begutachtet und sich mit den bevorzugten Rollenspielen ihrer Tochter beschäftigt – mal John-Boy Walton, mal die entsagungsvolle Anne of Green Gables – und eine Pistolenkugel auf ihrem Autositz gefunden.
Das Tagewerk der Witwe Swift.
Lucy trank noch etwas Limonade. Sie war ruhiger geworden. Sie war schon so lange alleine zurechtgekommen. Sebastian Redwings Hilfe brauchte sie gar nicht. Eigentlich brauchte sie überhaupt keine Hilfe.
J. T. erlaubte seiner Mutter, ihm nach dem Abendessen beim Packen zu helfen. Lucy hielt Ausschau nach Waffen, Pistolenkugeln und anderen gemeingefährlichen Gegenständen. Sie fand nichts. In dem Zimmer herrschte das übliche Chaos, das typisch war für die zahlreichen Interessen und Hobbys eines Zwölfjährigen. Poster von Darth Maul und Wanderfalken, Steifftiere und Lego-Spielzeug, Sportutensilien, hässlich aussehende Superhelden und Monster und viel zu viel Kleinkram.
Er hatte kein Fernsehgerät in seinem Zimmer. Er hatte keinen Computer. Schmutzige Wäsche lag zwischen der sauberen auf dem Boden. Schubladen waren halb herausgerissen, aus einer hing ein Hosenbein heraus, aus einer anderen quollen Boxershorts.
Im Zimmer roch es nach dreckigen Socken, Schweiß und Erde. Ein Dachfenster gab den Blick frei auf den Garten hinter dem Haus, wo sie noch die Spuren seiner und Georgies Wühlarbeiten sehen konnte.
„Du hast die Würmer doch nicht etwa mit in dein Zimmer genommen?“ fragte Lucy.
„Nein. Ich und Georgie haben sie wieder freigelassen.“ Er sah sie an und verbesserte sich: „Georgie und ich.“
Sie lächelte. Als sie sich umdrehte, entdeckte sie ein Foto an seinem schwarzen Brett, auf dem Colin und J. T. zu sehen waren. Unvermittelt schoss ihr das Blut in den Kopf, und sie musste sich zusammenreißen, um nicht in Tränen auszubrechen. Die Ränder des Bildes waren eingerissen und vergilbt und voller Löcher, weil J. T. es so oft umgesteckt hatte. Ein kleiner Junge und ein Vater beim Angeln – für alle Zeit festgehalten.
Traurig lächelte Lucy dem Bild des Mannes zu, den sie geliebt hatte. Sie hatten sich im College kennen gelernt und so jung geheiratet. Sie blickte auf das hübsche Gesicht, sein Lächeln, sein zerzaustes rotbraunes Haar. Sie hatte das Gefühl, dass die Zeit sie vorwärtsgetrieben und verändert hatte, während er derselbe geblieben war, unberührt vom Kummer und der Angst, die ihre Begleiter waren seit jenem Tag, als Colins Vater an ihre Tür klopfte und ihr sagte, dass sein Sohn – ihr Mann – gestorben war.
Der bohrende Schmerz und der Schock der ersten Wochen und Monate hatten allmählich nachgelassen. Sie hatte gelernt, ohne ihn zurechtzukommen. Madison und J. T. auch – auf ihre Weise. Sie konnten über ihn reden und lachen und sich an ihn erinnern, ohne in Tränen auszubrechen – jedenfalls die meiste Zeit.
„Die Sachen, die du sonst noch mitnehmen willst, kannst du in deinen Rucksack packen“, sagte Lucy, während sie sich von dem Foto löste. „Welches Buch liest du gerade?“
„Eins vom Krieg der Sterne.“
„Vergiss nicht, es einzupacken.“
Sie zählte die Hemden, Hosen, Socken, Unterwäsche und überlegte, ob sie sich die Mühe machen sollte, den Keller und die Garage zu durchsuchen. Schließlich hatte J. T. nichts mit der Pistolenkugel in ihrem Auto zu tun.
Sie legte die Kleidungsstücke auf sein Bett. „Das reicht für die Reise, mein Kleiner. Kannst du das alleine in deinen Koffer packen, oder brauchst du meine Hilfe?“
„Das schaff ich schon.“
„Vergiss deine Zahnbürste nicht.“
Sie ging über den Flur in das Zimmer ihrer Tochter. Die Tür war geschlossen. Madison hörte Musik, aber nicht so laut, dass die Wände vibrierten. Wenn sie Hilfe brauchte, würde sie fragen. Lucy ließ sie allein.
Ihr Schlafzimmer war unten. Auf dem Weg dorthin machte sie in der Küche Halt und setzte einen Kessel mit Wasser auf, um Tee zu kochen. Sie würde ihren Koffer später packen.
Es war eine altmodische Wohnküche mit weißen Schränken, verkratzten Arbeitsflächen und sonnengelb gestrichenen Wänden. Die Farbe half, die langen, kalten Winternächte zu überstehen. Am meisten hatte es Lucy überrascht, wie dunkel die Nächte in Vermont waren.
Sie sank in einen Stuhl vor dem Kiefernholztisch und starrte in den Garten hinter dem Haus. Wie oft hat Daisy das wohl gemacht in den sechzig Jahren, die sie hier allein lebte, fragte sie sich. Eine Tasse Tee, ein stilles Haus. Witwe Daisy. Witwe Swift.
Es war dunkel geworden. Der lange Sommertag war endlich in die Nacht übergegangen. Lucy spürte, wie rings um sie die Stille herniedersank und die Abgeschiedenheit und Einsamkeit näher krochen. Manchmal schaltete sie den Fernseher oder das Radio ein, arbeitete an ihrem Laptop, verschickte E-Mails oder telefonierte mit einer Freundin. Heute Nacht musste sie packen. Wyoming. Meine Güte. Sie flog tatsächlich dorthin.
Sie bereitete den Kamillentee und hielt den Becher in der Hand, als sie zur Haustür ging, um abzuschließen. Sie machte sich nichts vor: Die alten Schlösser wären kein Hindernis für einen zu allem entschlossenen Eindringling.
Plötzlich vernahm sie ein Geräusch – möglicherweise der Wind – und ging zurück ins Esszimmer.
Sie hatte es nicht betreten, seitdem sie eingezogen waren. Da waren immer noch der altmodische Schalter für die Deckenlampe aus Milchglas, Daisys handgewebter Läufer mit den ausgebleichten Farben, die Tapete mit den Rosenblättern, die wuchtigen Esszimmermöbel. An einer Wand stand ein Klavier aus den zwanziger Jahren.
Lucy spürte eine Gänsehaut auf den Armen, als ein Windstoß durch das Zimmer wehte.
Jemand hatte ein Fenster geöffnet. Schon wieder.
Die hohen alten Fenster klemmten und ließen sich nur schwer öffnen. Da sie das Esszimmer im Sommer so gut wie nie benutzte, machte sich Lucy auch nicht die Mühe, mit ihnen fertig zu werden. Sie hatte sie reparieren lassen wollen, ehe das schöne Wetter einsetzte, aber sie war nicht dazu gekommen.
Sie tastete mit einer Hand an der Wand entlang und betätigte den Lichtschalter. Es musste eins der Kinder gewesen sein. Wer sonst hätte sich in ihr Haus schleichen sollen, um ein Fenster zu öffnen?
Das Licht der Lampe erzeugte dunkle Schatten. Es könnte wirklich ein fantastisches Zimmer werden. Irgendwann einmal würde sie das Klavier stimmen, den Teppich reinigen und den Holzboden abschleifen und neu ölen lassen. Sie würde es tapezieren lassen, den Esstisch restaurieren und Freunde und Verwandte zum Erntedankfest einladen. Sogar ihren Schwiegervater, wenn er denn kommen wollte.
Auf dem Boden glitzerte etwas. Lucy runzelte die Stirn und schaute genauer hin.
Glasscherben.
Erschrocken trat sie einen Schritt zurück. Das Fenster war nicht geöffnet worden. Es war zerbrochen. Um ein kleines Loch in der oberen Scheibe formten sich feine Risse zu einem Spinnennetz. Eine dreieckige Scheibe war zu Boden gefallen und zerbrochen.
Lucy stellte den Becher auf den Tisch und befühlte vorsichtig die scharfe Kante des Lochs. Das war kein Vogel gewesen, der gegen das Fenster geprallt war, oder ein verirrter Baseball. Dafür war es zu klein.
Ein Stein?
Eine Pistolenkugel?
Ihr wurde schwindlig, und das Herz schlug ihr bis zum Hals.
Das war unmöglich. Nicht zwei Mal an einem Tag.
Sie bemerkte den Zementstaub auf dem Stuhl neben dem Klavier, der genau gegenüber dem Fenster stand. Darüber war ein Loch in der Wand.
Lucy hielt den Atem an, während sie auf dem Stuhl kniete, den Arm ausstreckte und mit der Hand über das Loch fuhr. Die Kante der Tapete war rau. Ihre Fingerspitzen waren weiß vom Kalk.
Das Loch war leer. Die Kugel, die sich hineingebohrt hatte, war entfernt worden.
Auf allen vieren kniend, untersuchte sie den Boden. Sie schaute unter dem Klavier nach. Sie hob die Kanten des Läufers hoch. Sie spürte, wie die Hysterie in ihr wuchs, in alle Poren drang und sämtliche Nervenenden vibrieren ließ.
Sie setzte sich auf ihre Fersen und blieb eine Weile in dieser Stellung. So, dachte sie, das ist es also. Irgendein Mistkerl hatte ein Loch in ihr Esszimmerfenster geschossen, war ins Haus eingedrungen, hatte die Kugel entfernt und war wieder davongeschlichen.
Wann? Wie? Warum?
Hätte nicht irgendjemand – Madison, J. T., Georgie, Rob, der verflixte Briefträger – etwas hören oder sehen müssen?
Gestern Abend waren sie in Manchester gewesen. Möglicherweise war es passiert, als niemand zu Hause war.
Die Fenster gingen nach Osten und boten einen Blick über den Garten an der Seite des Hauses, die Garage, die Scheune und den Joshua-Fluss. Ein Jäger oder jemand, der Schießen übte, war vielleicht im Wald nahe am Fluss gewesen und hatte eine Kugel abgefeuert, die sich in ihr Esszimmer verirrte. Er war in Panik geraten, ins Haus eingedrungen und hatte die Kugel herausgeholt.
„Blödsinn“, sagte sie laut.
Das war kein Unfall.
Lucy zitterte. Ihr war übel. Wenn sie jetzt die Polizei anriefe, wäre sie die ganze Nacht auf den Beinen. Sie würde Madison und J. T. erklären müssen, was passiert war. Sie würde Rob verständigen müssen, und er würde mit Patti herüberkommen.
Und das wäre erst der Anfang. Die Polizei würde in Washington anrufen. Die Beamten vom Sicherheitsdienst des Capitols würden wissen wollen, ob diese Vorfälle in irgendeinem Zusammenhang mit Jack Swift stünden. Man würde ihn benachrichtigen.
Unsicher stellte sie sich wieder auf die Füße und griff nach ihrem Tee.
War sie jetzt verzweifelt genug, um Sebastian Redwing um Hilfe zu bitten?
Sie lief in die Küche, goss den Tee ins Spülbecken und verschloss die Hintertür. „Du brauchst einen Hund“, murmelte sie. „Das ist alles.“
Einen großen Hund. Einen großen Hund, der bellte.
„Einen großen, hässlichen Hund, der bellt.“
Er würde eventuelle Eindringlinge schon ihn Schach halten, und sie könnte ihn dazu abrichten, mit J. T. angeln zu gehen. Sogar Madison würde ein Hund gefallen.
Das war die Lösung. Redwing konnte sie vergessen. Sobald sie aus Wyoming zurückkam, wollte sie sich um einen Hund kümmern.
2. KAPITEL
Sebastian sprang vom Pferd und ließ sich in den Schatten der Pappeln fallen. Er war bis ans äußerste Ende seines Besitzes geritten, wo ihn eigentlich niemand finden konnte. Und trotzdem hatten die Kerle es geschafft. Sie waren zu zweit. In halsbrecherischem Tempo waren sie mit dem Jeep auf ihn zugerast. Er hatte sein Pferd durch den Fluss führen können, aber diese Dummköpfe würden vermutlich die Verfolgung aufnehmen.
Er trank einen Schluck aus seiner Feldflasche, dann nahm er den Hut ab und goss sich ein wenig Wasser über den Kopf. Eine Dusche – das war es, was er jetzt hätte gebrauchen können. Die Luft war heiß und staubig. Trocken. Er hoffte nur, dass die beiden Typen im Jeep selber über genügend Wasser verfügten. Er hatte nämlich nicht vor, seinen Vorrat mit ihnen zu teilen. Wenn sie durstig wären, könnten sie ja aus dem Fluss trinken.
Der Jeep kam näher. „Ruhig“, sagte Sebastian zu seinem Pferd, obwohl es nicht nervös wirkte. Es war noch nicht einmal verschwitzt.
Gut fünf Meter entfernt hielt der Jeep an, und ein Mann sprang heraus. „Mr. Redwing?“
Sebastian verzog das Gesicht. Es hatte nie etwas Gutes zu bedeuten, wenn jemand ihn Mr. Redwing nannte. Mal abgesehen davon war es überhaupt kein gutes Zeichen, von einem Jeep verfolgt zu werden.
Er zog den Hut über die Augen und stützte sich auf seine Ellbogen. „Was gibt’s?“
„Mr. Redwing“, wiederholte der Mann. „Ich bin Jim Charger. Mr. Rabedeneira hat mich geschickt, um Sie zu suchen.“
„Und?“
Charger sagte nichts. Er war ein neuer Angestellter und wartete wohl darauf, dass Sebastian sich so benahm wie der Mann, der die Firma Redwing gegründet hatte, eines der besten international tätigen Sicherheits- und Ermittlungsunternehmen. Doch er behielt den Hut in der Stirn, um sich nicht der Sommersonne von Wyoming aussetzen zu müssen.
Schließlich seufzte er. Jim Charger würde nicht eher verschwinden, bis er seine Nachricht überbracht hatte. Sebastian mochte Plato Rabedeneira.
Sie waren Freunde geworden, als sie beide Anfang zwanzig waren. Er hätte Plato sein Leben anvertraut und das Leben seiner Freunde. Aber wenn Plato der zweite Mann im Jeep gewesen wäre, hätte Sebastian ihn an eine Pappel gebunden und wäre gegangen.
„Nun gut, Mr. Charger.“ Er schob den Hut zurück und musterte den Mann, der vor ihm stand. Groß, blond, durchtrainiert, in teure Western-Klamotten gekleidet, die jetzt bestimmt so staubig waren wie noch nie zuvor. Ein Import aus Washington. Vermutlich ein Ex-FBI-Agent. Sebastian spürte das Blut in seinen Schläfen pochen. „Was ist passiert?“
Wenn Sebastian Redwing nicht den Erwartungen von Jim Charger entsprach, so ließ er es sich nicht anmerken. „Mr. Rabedeneira hat mich gebeten, Ihnen eine Nachricht zu übermitteln. Ich soll Ihnen ausrichten, dass Darren Mowery zurückgekommen ist.“
Sebastian bemühte sich, keine verräterische Reaktion zu zeigen. Doch das Blut in seinen Schläfen klopfte noch heftiger. Vor einem Jahr hatte er Mowery für tot gehalten. „Wohin zurückgekommen?“
„Nach Washington.“
„Und was soll ich jetzt nach Platos Ansicht tun?“
„Keine Ahnung. Er hat mich nur gebeten, Ihnen das mitzuteilen. Und ich soll Ihnen auch noch sagen, dass es wichtig ist.“
Darren Mowery hasste Sebastian mehr, als es die meisten seiner Feinde taten. Vor Jahren hätte Sebastian auch Mowery sein Leben anvertraut – und das seiner Freunde. Aber das war nun vorbei.
„Und noch etwas“, fuhr Charger fort.
Sebastian lächelte schwach. „Jetzt kommt wohl der Teil, den Sie mir laut Plato sagen sollen, wenn ich nicht sofort zu Ihnen in den Jeep springe, was?“
Keine Reaktion. „Mowery hat eine Frau im Büro von Senator Swift kontaktiert.“
Jack Swift, derzeit dienstältester Senator aus dem Bundesstaat Rhode Island. Ein Gentleman-Politiker, ein Mann von Integrität, der sich voll und ganz seinem öffentlichen Amt widmete. Und er war der Schwiegervater von Lucy Blacker Swift.
Verdammt, dachte Sebastian.
Auf der Hochzeitsfeier von Lucy Blacker und Colin Swift hatte Colin Sebastian das Versprechen abgerungen, sich um Lucy zu kümmern, falls ihm irgendetwas passieren würde. „Nicht, dass Lucy gern jemanden hätte, der auf sie Acht gibt“, hatte Colin hinzugefügt. „Aber du verstehst schon, was ich meine.“
Sebastian hatte es allerdings nicht wirklich verstanden. In seinem Leben gab es niemanden, um den er sich kümmern musste. Seine Eltern waren tot. Er hatte keine Geschwister, keine Frau, keine Kinder. Beruflich gesehen war er allerdings verdammt gut, wenn es darum ging, jemanden zu beschützen. Meistens musste er dafür sorgen, dass die Betroffenen am Leben blieben und nicht bestohlen wurden. Aber das hatte nichts mit Freundschaft zu tun und einem Versprechen, das er einem Mann gegeben hatte, der dreizehn Jahre später im Alter von sechsunddreißig Jahren gestorben war.
Colin musste es geahnt haben. Irgendwie hatte er wohl gespürt, dass sein Leben nicht lange dauern würde und dass seine Frau und die Kinder, wenn er welche haben sollte, ohne ihn würden auskommen müssen.
Als Sebastian ihm das Versprechen gab, hatte er nicht im Traum daran gedacht, dass er es jemals würde einlösen müssen.
„Was soll ich Mr. Rabedeneira sagen?“ fragte Charger jetzt.
Sebastian zog den Hut wieder in die Stirn. Vor einem Jahr hatte er Darren Mowery niedergeschossen und war der festen Überzeugung gewesen, ihn getötet zu haben. Es war wirklich unvorsichtig von ihm gewesen, dass er sich nicht vergewissert hatte, ob Mowery wirklich nicht mehr lebte. In einem Geschäft wie dem seinen war ein solcher Fehler unverzeihlich. Dafür gab es keine Entschuldigung. Es spielte keine Rolle, dass Darren einmal sein Lehrer gewesen war oder sein Freund, oder dass Sebastian mit eigenen Augen gesehen hatte, wie er sich selbst ins Verderben hineingeritten hatte. Wenn man gezwungen war, jemanden zu erschießen, musste man sich auch vergewissern, ob man ihn getötet hatte. Das war ein ehernes Gesetz.
Aber hier ging es um Jack Swift. Nicht um Lucy. Plato würde sich um Darren Mowery kümmern müssen. Da Sebastian persönlich betroffen war, würde er die Sache nur vermasseln.
„Sagen Sie Plato, dass ich mich zurückgezogen habe“, meinte Sebastian.
„Zurückgezogen?“
„Ja. Er weiß Bescheid. Sie brauchen ihn nur noch mal daran zu erinnern.“
Charger rührte sich nicht vom Fleck.
Sebastian stellt sich Lucy auf der Veranda vor dem Haus seiner Großmutter vor. Fast konnte er die Sommerbrise von Vermont spüren, den Fluss hören, das kühle Wasser riechen, das feuchte Moos. Es war gut, dass Lucy Washington verlassen hatte, und er hatte dafür gesorgt. Er hatte sein Versprechen also gehalten. Seinem Freund Colin war er nichts mehr schuldig.
Er beschloss, nicht länger über Lucy nachzudenken. Das hatte ihm sowieso nie gut getan.
„Sie haben Ihre Nachricht übermittelt, Mr. Charger“, sagte Sebastian. „Jetzt überbringen Sie meine.“
„Jawohl, Sir.“
Der Mann machte sich auf den Weg. Sebastian vermutete, dass er Jim Chargers Erwartungen nicht erfüllt hatte. Aber das war ihm egal. Er erfüllte ja nicht einmal mehr seine eigenen. Warum sich Gedanken machen über das, was andere von ihm erwarteten?
Er hatte aufgehört zu arbeiten, und damit war die Sache für ihn erledigt.
Barbara Allen suchte nach dem Schlüssel für ihr Washingtoner Apartment. Sie hatte einen bitteren Geschmack im Mund. Ihre Bluse war schweißnass. Ihre Haut juckte und brannte von unzähligen Moskitostichen. Ihr war gleichzeitig zum Weinen und zum Lachen zu Mute. Es war nicht zu glauben! Endlich hatte sie etwas unternommen. Endlich!
Sie drehte den Schlüssel im Schloss und stieß die Tür auf. Die stickige Luft, die ihr entgegenschlug, nahm ihr fast den Atem. Ehe sie nach Vermont aufgebrochen war, hatte sie die Klimaanlage abgestellt. Dort war es kühler gewesen als in Washington und wunderbar erfrischend. Schnell schloss sie die Tür und lehnte sich dagegen. Sie holte tief Luft. Endlich daheim.
Sie spürte keine Reue. Überhaupt nicht. Und das überraschte sie mehr als alles andere. Ihr Verstand sagte ihr, dass sie etwas Unrechtes getan hatte. Die Besessenheit, mit der sie Lucy verfolgte, war vielleicht sogar ein wenig krankhaft. Normale Menschen spionierten anderen Menschen nicht nach. Normale Menschen verfolgten und terrorisierten andere Menschen nicht.
Aber wenn es jemanden gab, der es verdiente, in Angst und Schrecken versetzt zu werden, dann war es Lucy Blacker Swift. Als Mutter war sie das Schlimmste, was man sich nur vorstellen konnte. Sie war nachlässig, unbeherrscht und rücksichtslos. Colin hatte zwar die schlimmsten Auswüchse verhindert. Aber nach seinem Tod gab es keinen mehr, der ihr die Zügel anlegte.
Seit mehr als einem Jahr bereitete es Barbara ein heimliches Vergnügen, Freitagabend nach Vermont zu fahren, um Lucy zu nachzuspionieren, und sonntags nach Washington zurückzukehren. Sie war das Auge und das Ohr von Jack Swift, seine Vertraute, seine engste persönliche Assistentin. Ihm hatte sie zwanzig Jahre ihres Lebens geopfert, jede Niederlage mit ihm ertragen. Sie hatte ihn bei den Achterbahnfahrten in seiner politischen Karriere begleitet, den Attentatsversuch miterlebt, das lange, langsame und schmerzvolle Sterben seiner Frau und den plötzlichen Tod seines Sohnes gemeinsam mit ihm durchlitten.
Und dann hatte Lucy sich ärgerlicherweise entschieden, nach Vermont zu ziehen. Das war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Barbara wusste, wie sehr Jack es bekümmerte, auf welche Art und Weise sie die Kinder seines Sohnes großzog. Madison, die sich nach dem richtigen Leben sehnte. J. T., der mit seinen kleinen schmutzigen Freunden herumtobte. Aber Jack hätte nie etwas gesagt, niemals etwas unternommen, um Lucy zur Vernunft zu bringen. Deshalb hatte sie es getan. Endlich, endlich.
Es war Barbara ganz recht, wenn die Leute sie unterschätzten. Sie brauchten gar nicht zu wissen, was sie an ihr hatten. Das wusste sie schließlich selbst. Sie hatte den Mut und die Selbstdisziplin, um das zu tun, was nötig war.