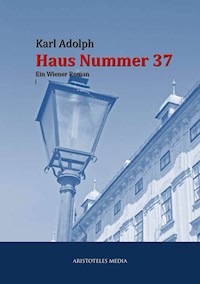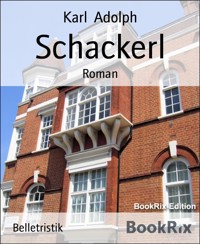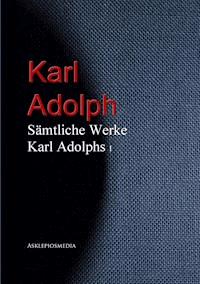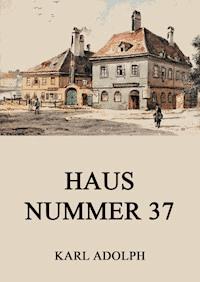
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Adolph Wiener Roman hat Stil und diese besondere Art, die einmal von allem bisher gekannten Österreichischen gründlich abweicht und darüber hinaus den Naturalismus überhaupt in einer merkwürdig eigenartigen Nachblüte zeigt. So kann nur ein Mensch schreiben, der unter den Proletarieren der Stadtbevölkerung aufgewachsen ist, sich entwickelt hat aber immer seinen Wurzeln bewußt war ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 519
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Haus Nummer 37
Karl Adolph
Inhalt:
Haus Nummer 37
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel.
Drittes Kapitel.
Viertes Kapitel.
Fünftes Kapitel.
Sechstes Kapitel.
Siebentes Kapitel.
Achtes Kapitel.
Neuntes Kapitel.
Zehntes Kapitel.
Eilftes Kapitel.
Zwölftes Kapitel.
Dreizehntes Kapitel.
Vierzehntes Kapitel.
Fünfzehntes Kapitel.
Sechzehntes Kapitel.
Siebzehntes Kapitel.
Achtzehntes Kapitel.
Neunzehntes Kapitel.
Zwanzigstes Kapitel.
Einundzwanzigstes Kapitel.
Zweiundzwanzigstes Kapitel.
Dreiundzwanzigstes Kapitel.
Vierundzwanzigstes Kapitel.
Haus Nummer 37, K. Adolph
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849604202
www.jazzybee-verlag.de
Haus Nummer 37
Erstes Kapitel
(Vermittelt uns die Bekanntschaft einiger Herren, die der Mäßigkeitsbewegung in keiner Weise Vorschub zu leisten geneigt sind.)
Jetzt stand er auf der Straße und schimpfte fürchterlich gegen das geschlossene Fabrikstor: »Ös Hundling, ös Falotten, ös Bagasch verfluchte. An Arbeiter außischmeißen? Ös graupert's Burschoag'findel, ös Tagdiab, Bluatsauger! An Famülienvodan zun behandeln wia an Püls? Pfui Teufü! So Gaunerbuam mitanand. Oba spült's enk net! Sunst, wann m'r die Gall überlauft, bring i so an Sauhund um. Heunt wüll scho' jeder so a Lausbua an Werkführer außisteck'n und Leut' mattan, dö was das schon lang verlurn hab'n, wo so a Hundsbua erst hinschmecken muaß.«
Man möge das Befreiende des Sichaustobens noch so hoch einschätzen, man wird dennoch zugeben müssen, daß diese Anhäufung von Verbalinjurien in einem Atem die Grenze des Erlaubten weit überschritt.
Man wird weiters fragen, wem das ganze Lexikon von Kraftausdrücken zugedacht war? Nun, ganz einfach dem Werkführer der Fabrik, weil er Herrn Blaschke, der in gänzlich unmöglichem Zustand seinen Arbeitsort betrat, kurzerhand vor das Tor setzen ließ.
Es läßt sich nun gewiß vermuten, daß der schwergekränkte Mann nach vollständiger Erschöpfung seines Vorrates an Schimpfworten sich weiter getrollt hätte. Um eine so einfache Lösung von Konflikten zu verhüten und dem Romanschreiber Gelegenheit zu geben, mehr oder minder spannende Kapitel auszuspinnen, hat das Schicksal für denDeus ex machinain Gestalt der wohllöblichen Polizei gesorgt. Diese war in dem konkreten Fall durch zwei Wachmänner vertreten. Der erste war ein sehr jovialer, rotwangiger, blaunasiger, bald pensionsreifer Herr.
Er blieb im Vorüberschlendern für einen Augenblick stehn, klopfte Blaschke leicht auf die Schulter und sagte so gemütlich, als es die polizeiliche Würde zuließ:
»Geh ham, leg di nieder und sag, es war nix! Hab'n s' di schon wieder außig'lahnt heut am Montag? Mit dem Dampf, was d' hast, kunnt'st leicht die ganze Fabrik allan treib'n.«
Dabei lachte er über das ganze Gesicht, der Witz mit dem »Dampf« schien zu kostbar.
Der Angeredete blickte mit trüben Augen den Wachmann an, und als er endlich zur Überzeugung gekommen war, für sein Leid eine teilnahmsvolle Seele und in Summa einen alten Bekannten gefunden zu haben, fing er zu schluchzen an.
»Dös hat m'r vön dö roten Raubersbuam, Herr Wachmann. Dö Bombenwerfer, dö Aufwickler, dö an Famülienvodan unglückli machen, weil er in d' Arbat wüll. Herr Wachmann, Sö kennen mi« (er hatte damit in Anbetracht einiger Arretierungen zwecks Ausnüchterung nicht unrecht) »und wia S' mi kennen, wissen S', daß i a natraler Kerl bin . . .«
»Is schon recht. Geh ham, alter Schwammertandler, und mach d'r an kalten Umschlag aufs Hirn.« Mit diesen Worten wollte sich der scherzhafte Hüter der Ordnung wieder an seine Runde machen.
In den Gefühlen Herrn Blaschkes schien sich jedoch eine vollständige Wandlung vollzogen zu haben. War sein Ehrgeiz verletzt, reizte ihn die herablassende Freundlichkeit oder die Uniform des Polizisten – kurz, er schlug aus seiner weichmütigen, trostheischenden Stimmung in deren Gegenteil um.
»Ös Greandippler, wann mir ausrucken, habt's eh die Guri von hint, wie dö Spinatjuri auf eahnere Aufschläg'. Flohbentl, Zwieflkrowot verhatschter . . . !«
Ich muß gestehen, daß ich den diversen Stimmungsumschlägen des grollenden Staatsbürgers ratlos gegenüberstehe, aber mehr noch der Geduld des biederen Wachmannes, der sich damit begnügte zu sagen: »No, wart nur, bis di dein' Alte in die Hand' hat, da wirst mehr derleb'n, als in unserm Flöhtrüherl.« Dann entfernte er sich ruhig.
Der abermals in den tiefsten Tiefen seines Unmutes Aufgeregte hatte sich wieder gegen das Fabrikstor gewendet, als von einer Seitengasse ein anderer, noch ganz junger Wachmann auftauchte, den seine Runde in die Nähe des beschimpften Objektes führte.
Unter Runde versteht man jene Spaziergänge des staatlichen Organes, die sich mit denen eines Kollegen kreuzen, bei welcher Gelegenheit einer den andern befragt, was sich Neues ereignete; die Anlaß geben, sich um Dinge zu bekümmern, die weit außer seiner Interessensphäre liegen und bei Anlässen, die seine Anwesenheit zu einer Sache der Dringlichkeit machen würden – abwesend zu sein.
Als der junge Wachmann sich dem bedrohten Fabrikstor näherte und den gottsjämmerlich schimpfenden Blaschke erspähte, erklärte er sich gleich mit ersterem solidarisch. Er vernahm eben folgende lästerlichen Worte:
»Ölendige Sauhütt'n! A paar Schab Stroh und a Flasch'n Petroleum und a hundert Kila Dynamit, daß d' in d' Luft gehst, wia a Praterballon. Saujud, preußischer Haderlump . . .«
»Entfernen Sie sich oder ich muß einschreiten,« unterbrach der Wachmann die staatsverbrecherische Periode.
Blaschke schien durch den Anblick der neuen Uniform sich des Respektes bewußt zu werden, den jeder Staatsbürger ohne Ausnahme jeglicher Uniform entgegenzubringen hat. Er, als ehemaliger, gedienter Soldat, empfand plötzlich die Neigung, seine militärische Vergangenheit ins beste Licht zu setzen. Daher salutierte er stramm. Die Strammheit war nur durch die Geste vertreten, während der Mann an und für sich bedenklich schwankte.
»Herr Wachmann,« begann er in rapportierendem Tone, »i, a alter Kaiserlicher von dö Vierer Hoch und Spleni, unterm Herrn Hauptmann Greifinger dient, verheirat't, unbescholten . . . .«
»Entfernen Sie sich, sag' ich, machen S' keine G'schichten, oder ich muß Sie arretieren«, war die nochmalige herrische Aufforderung. Inzwischen hatten sich schon Passanten und viele zur Schule ziehende Kinder zum Stehenbleiben bemüßigt gesehen.
»Mi arretiern?« war die verwunderte Frage. »Mi woll'n S' arretiern? Mi? Dös gibt's sein Lebtag net. Hab' i Ihner was tan? Han?«
»Machen S' kein Aigsehn und schaun S', daß S' weiterkommen, sonst erleb'n S' was!«
»Sie armer Batschachter vom Juriregiment (vergnügtes Schmunzeln der Passanten und laute Ausbrüche der Heiterkeit seitens der Schuljngend), gengen S' erst ham und lassen S' Ihnere Baner numerieren, dann kummen S' wieder, i wart' da am Fleck auf Ihner, da am Fleck, wo i steh'.«
Und der im Stadium ironischer Gemütlichkeit gelandete Herr Blaschke bemühte sich, den angedeuteten Fleck dadurch kenntlich zu machen, daß er sich bückte und mit dem Zeigefinger an der Fußspitze vorbei auf den Erdboden tippte. Zu gleicher Zeit versetzte ihm eine unsichtbare Macht einen Stoß, so daß er fast wie aus einem Geschütz geschnellt, in der Art schädelkämpfender Neger, gegen den Wachmann anrannte, so verhängnisvoll, daß dieser umfiel und unter Blaschke zu liegen kam. Das Hallo war ein allgemeines. Die Knaben führten förmliche Indianertänze um die Helden dieses ergötzlichen Schauspieles auf. Nun folgte die dramatische Steigerung. Der bis zur Wut erzürnte und beschämte Unterlegene befreite sich so rasch als möglich, riß den noch immer am Boden liegenden Betrunkenen empor und erklärte ihn für verhaftet. Dieser fing an, sich aus Leibeskräften zu wehren. Jedermann amüsierte sich köstlich bei dieser Balgerei. Ein eben hinzugekommener Passant rief: »Je, das is ja der Blaschke. Herr Wachmann, lassen S' den gehn, der tuat kan Menschen was, nur schimpfen kann er wia a Rohrspatz, wann er sein Klamsch hat. Dafür kriagt er von seiner Alten Birn, daß er zwa Täg net stehn kann.«
»Mischen Sie sich in keine Amtshandlung und schaun Sie, daß Sie weiterkommen!« war die Antwort des vor Zorn und Aufregung purpurroten Sicherheitsorganes. Zu gleicher Zeit bemühte er sich vergeblich, seinen Arrestanten vorwärts zu bringen. Die Menschenmenge schwoll immer mehr an. Verdächtige, sehr defekt gekleidete Bursche machten sich das Vergnügen, gellende Pfiffe und Hooo!-Rufe auszustoßen, gelegentlich einen Schulknaben mit einem Fußtritt beehrend, daß er an das ringende Paar anflog, kurz, die Stimmung war eine famose und äußerst animierte. Jetzt ertönte der schrille Ton des Signalpfeifchens. Von ferne kam Antwort und alsbald war der erstbeschriebene, humoristische Wachmann zur Stelle, seinem Kollegen Hilfe zu bringen. Als er sah, um wen es sich handelte, konnte er eine Äußerung des Unmutes nicht unterdrücken. – Der Übereifer dieser Jungen!
»Das hätt' i mir denken können, daß S' an Patzen machen,« knurrte er seinen Amtsgenossen an. »Wann i woll'n hatt', hätt' i den Kerl ah arretieren können. Jetzt hab'n m'r an Auflauf und weg'n nix und wieder nix.« Dann wandte er sich an den Arretierten, der beim Anblick seines wohlwollenden Bekannten plötzlich ganz ruhig wurde:
»Gengen S' ruhig mit den Herrn Wachmann und machen S' kane Dummheiten! Sonst hat's der Ochsenzehmt gnädig, verstengen S'? Schlafen S' Ihner aus und san S' froh, wann nix nachkummt! Bei Wachebeleidigung und Renitenz gibt's kane Würstln. Allo, marsch!«
Und diese kurze, kernige Epistel machte einen merkwürdigen Eindruck auf den eben vorher so zornwütigen Blaschke. Zerknirscht und geduldig wie ein Lämmchen nahm er die Begleitung seines Feindes an, der, um allen Eventualitäten vorzubeugen, seinen Gefangenen am Ärmel hielt. Gefolgt von einer johlenden, sich drängenden Menschenmenge, schritten die beiden dem Kommissariate zu. – – – –
Unter den Zusehern, denen die Szene unstreitig alle Emotionen einer gesunden und harmlosen Heiterkeit verschaffte, befanden sich zwei Herren, die in ihrem Äußeren und Gehaben verrieten, daß sie, um den Anblick des Sonnenaufganges nicht zu versäumen, schon vierundzwanzig Stunden vorher den Flaum des Bettes von sich abgeschüttelt.
Der eine stak in vollständiger Balltoilette, um von einer näheren Beschreibung seines Habitus abzusehen. Nur sei erwähnt, daß die, vorige Nacht wohl blendend weiße Hemdbrust deutliche Spuren von Gulasch und Bierresten aufwies, sowie daß der am Vortage gewiß frisch gebügelte Zylinder den Verdacht nicht ausschloß, es hätte irgend jemand aus Vergeßlichkeit ihn als Sitzgelegenheit benützt; und nachdem er zum Bewußtsein gelangt, der Gegenstand eigne sich nicht zu solcher Verwendung, hätte er mit geballter Faust und steifem Arme versucht, den früheren Zustand der Form von innen nach außen wieder herzustellen.
Der andere hüllte sich in einen Überzieher, dessen Farbe zwischen der von Segelleinwand und der eines grauschillernden Kanarienvogels die Mitte hielt. Der Hut, mit einer Krempe von der Breite eines Fingers, balancierte mit dem hinteren Rande auf dem Hemdkragen, sonst wäre wohl allen Vermutungen Tür und Tor geöffnet gewesen, als schwebe er in der Luft, oder es sei nur die materialisierte Form einer astralen Kopfbedeckung.
Hatte der erstere Herr Gestalt und Gesicht eines vollkommen normalen, erwachsenen und, was die Weiber nennen, »bildsaubern« Menschen, so reichte ihm sein Begleiter, die aufgestellte vordere Hutkrempe inbegriffen, gerade bis zum schwertförmigen Fortsatze des Brustbeines. Keinen Millimeter höher. Das Gesicht machte den Eindruck, als sei es im Zustande der fötalen Weichheit durch irgendeine mechanische Gewalt in der Richtung von oben nach unten zusammengequetscht worden. Im Munde hielt er eine Virginiazigarre, deren Kürze den Gedanken nahelegte, sie wäre so weit abgeraucht. Das war aber keineswegs der Fall, sie stak vielmehr mit ihrer Spitze tief im Halse ihres Eigentümers, allem Anscheine nach dessen Wohlbefinden in keiner Weise beeinträchtigend, zumindesten nicht die Ausbrüche heitersten Lachens hindernd.
»Geh, Huxtl, wia der den Poli ang'rennt hat, war do zum Hinwerd'n. Geh, Bruader, da steht nix mehr auf«, meinte er mit allen Anzeichen günstigster Unterhaltungslaune.
»Kenn 'hn jo eh«, sagte der andere, »wohnt mit mir in an Haus. Jetzt waßt, wann i die reanscherte Karnali hätt', sein' Alte, i gangt überhaupt nimmer ham. Ehender an Strick. – A so a Weiberl is a Freud, Jessas na!« sang er vor sich hin. »Habe die Ehre, Herr Wachmann!« wendete er sich zu dem blaunasigen Gesetzeshüter.
»Morg'n, Herr Huxtl«, erwiderte dieser. »Na was is, wieder Fruah wurd'n mit der Produktion?«
»Was S' net glaub'n. Das is schon die zweite Fruah. Gelt, Tschickerl?« Die zur Bestätigung auffordernde Frage galt dem Gefährten, der statt aller Antwort zu krähen anhub:
»Weil i a alter Drahrer bin, A so a Au–ufdrahrer bin . . .«
indem er sich bemühte, zur Vervollkommnung der Schönheit dieser Liederperle auf das verdoppelte U des Diphthonges einen Nachdruck zu legen, daß es sich anhörte, als hätte der Sänger das Aufstoßen, eine künstlerische Pointierung, die durch Guschelbauer förmlich Tradition geworden.
»Bist net stad, Tschickerl?« warnte mit vieler Gravität der mit Huxtl Angesprochene, der bezirksbekannte Volkssänger, Liederdichter und Gesangshumorist, seinen lustigen, drahrerbegeisterten Genossen. »Wann di der Herr Wachmann mitnimmt, wirst schaun. Geht's d'r wia 'n Blaschke, dann kannst im Kammerl singen soviel als d' willst. Geln S' Herr Wachmann, Sie sperrn den Hundling ein? Verdienen tät' er's.«
Tschickerl, dessen bürgerlicher Name wohl nur den Registern des Meldeamtes vertraut sein mochte und der sich an seinen Spitznamen ungefähr so gewöhnt hatte, wie ein Azorl, der aber seit einigen Jahren den ursprünglichen Rufnamen mit dem eines Flockerl vertauschte, geriet durch die Aussicht, eventuell »eing'naht« zu werden, in einen Zustand, den nur die spaßhafteste Vorstellung an uns zu bewirken vermag.
»Gehst net doni? Hörst, da legst di nieder, Bruader. Meiner Seel, dös war a Hetz. In Tschickerl einnahn! Geh' a so a Gaudee war no net da g'wesen. Dös müaßt' do' in d'Zeitung kummen. In Tschickerl . . .«
Wie gesagt, diese Vorstellung hatte ohne Zweifel in Beziehung auf ihre Absurdität etwas so Bestechendes, daß von dem heiteren Lachen sogar der biedere Wachmann und der durch das ausgiebige Drahn etwas melancholische Vertreter der Volksmuse angesteckt wurden.
»Geh, Bruader, auf dös hin schau'n mer jetzt, wo's a guat Fruahstuck-Golasch gibt. A Viertel mit Gis dazua, – höher geht's nimmer, Bruader. Herr Wachmann, wann S' beim Stiegl vurbeikumma, so sagn S', der Wirt soll Ihna a Viertel von dem geb'n, den si der Tschickerl nur an sein' Namenstag vergunnt. Wissen schon, was?«
Diese etwas dunkle Hindeutung galt dem Umstand, daß Tschickerl sich in ebenso zarter, als durch den Umgang mit Behörden gebotener Weise für die kitzelnde Vorstellung zu revanchieren versuchte, der Wachmann könnte ihn – den Tschickerl! – arretieren wollen. Zur Belohnung dieses, das Wohlbefinden des kleinen Mannes äußerst fördernden Heiterkeitsanlasses gebührte dem Wachmann ein in besagter diskreter Form angebotener Gratisliter. Eine salutierende Geste bestätigte die Annahme dieser liebenswürdigen Spende.
Dann entfernten sich nach herzlicher Verabschiedung die zwei nacht- und schlafmordenden Gesellen, um durch ein saftiges Golasch und einen Gespritzten die Lebensgeister für eine weitere Bierreise in den Zustand der Tauglichkeit zu versetzen.
Tschickerl, der seinen Spitznamen der Kleinheit und Gedrücktheit seiner Gestalt verdankte, die ihn einem zerkauten »Tschick« (Zigarrenstumpf) selbst nur noch in dessen Diminutivform ähnlich erscheinen ließ, war ein liederlicher Junggeselle, unverbesserlicher Nachtschwärmer und begeisterter Verehrer seines sangeskundigen Freundes. Da er zugleich als Anteilhaber eines vierstöckigen Hauses ein durch keinerlei Arbeit geschändetes, auskömmliches Leben zu führen imstande war, benützte er seine Zeit zu ausgedehnten Exkursionen und eingehenden Alkoholproben jeglicher Form und jeglichen Gehaltes und war Wirten und Nachtkaffeebesitzern ebenso bekannt, wie Branntweinverschleißern und Würstelmännern.
Sein Freund und »Zweschbenröster«, wie die scherzhafte Bezeichnung für ein so inniges Verhältnis lautete, ließ sich im Bewußtsein seiner künstlerischen Vollkommenheit ungeniert freihalten und nahm die Bewunderung des zwerghaften Mannes als einen ihm gebührenden Zoll der Anerkennung gnädigst hin. In einer Art jedoch war er ihm unter. Soviel Huxtl auch an Konsum von Alkoholika und Abbruch des Schlafes zu ertragen vermochte, Tschickerl war ihm noch immer vorbildlich für die Art geblieben, wie man ein »fermer Drahrer« ist. – – – – –
Lassen wir die beiden würdigen Gestalten auf ihrer Rundreise nach Sensationen des gröbsten Suffes allein und wenden uns dem Schicksale des arretierten Blaschke zu, den der Wachmann mit allen Anzeichen einer eben bestandenen gefährlichen Waffentat den Augen der mitfolgenden Gaffer durch einen Schwubs in das Wachzimmer entzog.
Der Herr Kommissär runzelte bei Einlieferung des bezirksbekannten, aber harmlosen Trunkenbolds und Krakeelers die Brauen. Teufel! Wollte man an einem Montag früh alle Elemente dieser Sorte einliefern, man brauchte ein drei Stock hohes Haus allein für Arreste. Nun ließ sich nichts mehr machen als ein Protokoll aufnehmen, im ganzen aber die Sache auf »Unzurechnungsfähigkeit im Zustande der Volltrunkenheit« hinausspielen.
»Wann uns der B'suff d'Pritsch'n anspeibt, soll er nix z'lachen hab'n«, sagte einer der Wachmänner, als man den nun vom Schlafe Halbbezwungenen mit einigen Püffen in das Loch expedierte. »Wann's wenigstens a halbwegs urndlicher Einbrecher war! Aber so Frischg'fangte glaub'n, wann s' nur arretiern. Wird Ihnen schon mit der Zeit vergehn«, wandte er sich an den pflichteifrigen, von seiner Autorität durchdrungenen Kollegen, der ob des Undankes für seine Tat ganz verblüfft dastand, »wird Ihna schon vergeh'n, wann s' es anmal mit andre z'tuan hab'n, die Ihner hinterrucks mit an Feitl a bißl kitzln, daß 's Bluat kummt.«
Als nach einigen Stunden Herr Blaschke in seinembuen retiromit schmerzendem Kopf und hämmernden Schläfen erwachte, blickte er erst erstaunt um sich. Bald jedoch hatte er sich über die Örtlichkeit vergewissert, und an Stelle der früheren Berserkerwut war eine tiefe Niedergeschlagenheit getreten, eine Mattigkeit und Trostlosigkeit erfüllte ihn, daß man ihn mit einem nassen Fetzen hätte niederschlagen können. Nur langsam reihte sich Erinnerung an Erinnerung. Wenn das seine Alte erfuhr! Er zuckte förmlich zusammen. Lieber sollten sie ihn für längere Zeit einsperren.
Ein Räuspern, von der anderen Seite des »Gemaches« kommend, belehrte ihn, daß er einen Mitbewohner habe. Von der Pritsche richtete sich jemand empor und kam auf ihn zu. Eine herabgekommene, verwahrloste Säufergestalt, gekrönt durch einen Kopf mit ungepflegtem Haupthaar, längere Zeit unrasiertem Kinn und einer Trinkernase.
»Meiner Seel«, gröhlte der Verkommene, »das is ja der Blaschke. Na so was! Hab'n s' di a wieder anmal da einig'steckt? Das is a seltenes Vergnüg'n. Hast bisher immer a Glück g'habt mit die He, wannst ah d' Goschen ausg'laart hast, wia a alte Koberin.«
»Hätt mr's denken können, daß du's bist, Fischer. Hast wohl alle Woch'n dein Quartier da?«
»Dösmal wir i jedenfalls no a anders kriag'n, vielleicht Alserstraßn.«
»Was hat's denn geb'n?«
»An Wirbel beim Grünzweig. I kumm d'r eini, an klan' Klamsch hab' i schon g'habt, will m'r der nix einschenken. I mach' an Bahöll, und hast es net g'segn und sixt es net ah, hat d'r Jud ane auf d'Gluahn, daß eahm für a Zeitlang 's Schaun vergehn wird. Dann hab' i no extra all's umdraht, a zwa'n a paar Fotz'n geb'n, bis der Poli kumma is.«
Blaschke saß eine Zeitlang sinnend da. Dann meinte er:
»Hast so was notwendi?«
»Notwendi?« lachte der andere. »Hast es du notwendi? Du kummst nur immer guat draus, weil's d' a so Griasler bist trotz deiner großen Gosch'n, und net um an Kreuzer Guri hast. Warum saufst denn? Der Sunntag und d'r Montag g'hörn immer dir. Kannst nocha über wem andern red'n? Wann i sauf', wir i hamurisch, und a unrechts Wurt – so hab' i an beim Würgl.«
Blaschke stützte den Kopf auf seine zitternden Hände. Wieder schwieg er eine Weile still. Und über sein verwüstetes, verschwelgtes Gesicht rann eine Träne.
»I glaub' gar, du zaunst?« frug Fischer. »Hörst so a Mannsbild wia du g'hört unter d'alten Weiber in d'Versurgung. Geniert's di eppa, daß d' wieder anmal da herin dunsten muaßt? Ha? Was sollt' denn i dann sag'n?«
»Du hast recht, i treib's net besser wia du, hab' aber mehr Grund dazua. Mein' Alte kennst. So a Bisgurn müaßt' 'n besten Menschen zu an B'suffn mach'n. Anmal is s' a Alzerl älter wia i und dann is s' überhaupt kan Auskummen mit ihr.«
»Warum binderst s' dann net anmal urndli o? I an deiner Stell' hätt' dös Krokodül schon halbert derschlag'n. Frag', ob si mein' Alte nur zum Muxn trauet.«
Blaschke hob erregt den Kopf empor.
»Du, vergleich' dein Weib net mit mein'! Is a Kunst, so a arms Ding wia die deine z'haun. Und zwa herzige Kinder hast. Bei dir war anmal all's net notwendi.«
»Geh, Tepp! Willst di vielleicht am Heilg'n außihaun? Was geht di mein' Alte am und dö Bankerten, die eh net von mir san? Dein Drach war m'r no liaber, als dö zaunerte Karnalli. Soll unserans ka Vergnüg'n habn? D'ganze Woch'n arbat'n und dö paar Netsch hamtrag'n? Jetzt wird s' schon a alte Klesch'n, hint nix, vurn nix, und i brauch' was zun Anhalt'n. Dö deine hat wenigstens, was m'r a Füll haßt. Und auf all's andre wird . . .«
Es ist unnötig, den Satz zu vollenden, um so mehr, als in dem Augenblick die Türe aufging und Blaschke aufgerufen wurde.
Der Kommissär ließ ihn vor sich führen. War es der trost- und hilflose Ausdruck im Gesichte des armen Sünders, war es die leise Furche, die die einzige Träne der Reue und Selbstqual verursacht, oder die ganze, nun verzehnfacht zum Ausdruck kommende Harmlosigkeit des einer kurzen Kerkernacht Entstiegenen – der Beamte fühlte sich fast zur Rührung geneigt. Und doch war eine allzumilde Auffassung der Sachlage sehr schwer, wenn nicht ganz unmöglich. Die unanfechtbare, dienstliche Anzeige des Wachmannes lag vor, die Affäre hatte unendlich viele Zeugen besessen, dann, der Mann war als Trinker und Lärmmacher unverbesserlich. Im übrigen Leben ein ehrlicher, auch fleißiger Arbeiter, war er nur zu sehr dem Schnaps zugetan.
»Na, Blaschke, Sie sollten sich aber schämen! Wissen Sie, was für Nichtswürdigkeiten Sie wieder angestellt? Diesmal gibt es keinen Pardon. Wir können nur berücksichtigen, daß Ihr Urteilsvermögen durch schwere Betrunkenheit herabgesetzt war. Aber dem Wachmann den Ringkragen herabzureißen . . . .«
Und der arme Blaschke hob bittend die Hände. »Spirrn S' mi ein, Herr Kommissär, so lang als's geht. Nur vur zwa retten S' mi: vur meiner Alten und vur 'n Branntweiner.« –
Zweites Kapitel.
(Vermittelt die Bekanntschaft einiger weiterer Personen und zeigt die Kehrseite der humoristischen Lebensauffassung des Drahrerordens.)
Es war das letzte Haus der erst zum vierten Teile ausgebauten Straße in dem sich mächtig vergrößernden Fabriksbezirke; ein vorgeschobener Posten der Großstadt gegen die noch durchaus ländlichen Charakter aufweisende Gegend. Von allen Seiten stand es frei, umgeben von wüsten Bauplätzen, die ihres spärlichen Grasbestandes wegen vom Volke »Wiesen« genannt wurden.
Obwohl an die Feuermauern schablonierte Inschriften vor »jeglicher Verunreinigung, Ableeren von Mist, Schutt und dgl.« warnten, bildeten diese sogenannten Wiesen mehr oder weniger bloße Schuttablagerungsplätze.
Freilich hinderte dieser Umstand die armen Bewohner der umgebenden Häuser nicht, diese Plätze als Erholungsstätten zu benützen. Die Mütter suchten sich irgendeinen, mit staubigem Gras versehenen Fleck zum Niedersitzen aus, und mit irgendeiner Flickerei oder dem Strickstrumpf beschäftigt, leiteten sie die ziemlich belanglose Aufsicht der spielenden Kinder.
Zerrissene, verlumpte Trunkenbolde suchten im Schatten der Mauer ein Plätzchen, an dem sie, das Gesicht mit dem Hute bedeckt, den in einem Branntweinladen erkauften Rausch verschliefen. Ab und zu suchte sich einer auch den Ort als Bedürfnisanstalt aus, unbekümmert um die neugierig umherstehenden und gaffenden kleinen Mädchen. Wie ungeschützt die Kinder des Volkes auch sein mögen, die größte Schutzlosigkeit, der sie preisgegeben sind, ist die auf dem Gebiete der Moral.
An den Sommerabenden bildete die Wiese auch den Zusammenkunftsort der vom Tagewerk heimkehrenden müden Arbeiter mit ihren Familien. Eine halbe oder ganze Stunde verrastete wohl auch der Vater den oft sehr weiten Marsch von der Arbeitsstätte, dann zog alles heim zum Abendessen.
Die neue Gasse lag ziemlich abseits von der zur Feierabendzeit äußerst belebten Bezirkshauptstraße, und nur ein winziger Bruchteil der mächtigen Arbeiterlegion hatte hier seine Behausungen. Das erwähnte, einsam dastehende Haus war erst vor kurzem vollendet worden und hauchte dem Vorübergehenden fast noch den kühlen Duft frischen Kalkes entgegen.
Nichtsdestoweniger war es schon vollständig bewohnt, und selbst die im Parterre befindlichen Geschäftslokale hatten bis auf ein, für ein Gasthaus bestimmtes, ihre Mieter gefunden: den unerläßlichen Greisler, einen Branntweinschenker und einen Pferdefleischausschrotter, der auch eine »Kosthalle« hielt, in der man um wenige Kreuzer undefinierbare Speisen vorgesetzt bekam, die sich aber trotzdem vortrefflich rentierte. Besonders zur Abendzeit war das Lokal dicht gefüllt und offenbar schmeckte es den Gästen ganz ausgezeichnet. Der Magen ist ein Despot, heißt es. Aber er ist auch das feigste, anpassungsfähigste Ding der Welt. Und Optimist ist er ebenfalls. Wie eine launische Herrin mag er wählerisch beim Überfluß sein, aber bescheiden und dankbar ist er zur Zeit des Mangels. Ihm wird Fleisch zu Fisch und Fisch zu Fleisch, je nachdem es die Einbildung erfordert. –
Ein Wirt konnte die Konkurrenz noch nicht aufnehmen. An diesem abgelegenen Posten war nicht daran zu denken, ein besseres als konsumtionsloses oder zahlungsunfähiges Publikum anzulocken. Der Greisler stellte in Flaschen ein dünnes Bier, der »Roßfleischhacker« ein fragwürdiges Menü bei. Wer sollte da den Wirt in Anspruch nehmen?
Aus der Richtung der Hauptstraße kamen zwei junge Leute, deren einer einen Handkoffer trug und den zugereisten, stadtfremden Provinzler nicht verkennen ließ. Der andere in Arbeitsbluse war der Typus des autochthonen Bewohners der Kaiserstadt.
Die beiden waren im Begriffe, den Hausflur zu betreten, als ein kleiner, hübscher, aufgeweckter Knabe daraus hervorkam. Von Bekleidung desselben war kaum zu sprechen. Ein Hemd und ein kurzes Höschen war alles. Übrigens die Normalbekleidung aller Knaben und Knäblein in weitem Umkreise.
»No, Franzerl,« sprach der junge Arbeiter den Kleinen an, »wia geht's denn?«
Der zuckte die Achseln und blickte mit traurigen Augen auf den Fragenden.
»Sag's nur, Franzerl, schenier di net, ös habt's an Hunger daham. Hab' i Recht?«
Der Ausdruck des schmalen Kindergesichtes war sprechend genug, um eine Bejahung überflüssig zu machen.
»D'r Voda is schon wieder a paar Täg net hamkumma, was?«
»Schon seit'n Samstag net, und mir wissen ah net, wo er is. D'Muatta fürcht't, daß eahm eppa a Malör g'scheg'n is.«
»Na, das kunnt's schon g'wöhnt sein, daß er net ham kummt. War net dös erstemal. Aber habt's gar nix daham zum Beißen?«
»Seit gestern hab'n m'r nix g'essen«, schluchzte der kleine Kerl.
»Was? Seit gestern? Du und d'Mutter und d'klane Lintschi? Ja, sagt's m'r, werd't's denn ös no Hungerkünstler? Da, kumm her, Franzerl, daß i di net länger aufhalt.« Und der junge Arbeiter zog seine Geldbörse hervor. »Vurige Woch'n hab' i an guaten Akkord g'habt, so kann i ah a bißl was springen lassen. So! Da hast an Guld'n. Geh da zum Greisler und kauf an Lab Brot und an Butter. Beim Ihaha holst a Wurst.«
»Ja, wann i zum Greisler geh', nimmt er mir 's Geld weg und gibt m'r nix, weil m'r eahm schon schuldi san«, äußerte das Kind bedenklich.
»Und liaßt enk verhungern, gelt ja?No wart, i hol' dir's außi.Bleib da derweil beim Haustur stehn. I kumm glei.«
Ohne sich um seinen Begleiter zu kümmern, trat der Arbeiter in den Greislerladen. Der Zurückbleibende sah mit einem Blick, der Mitleid und ein gewisses Staunen ausdrückte, den kleinen Franzerl an, der sich scheu in die Ecke des Haustores drückte und geduldig wartete.
»Wie, mein Kleiner, seit gestern hungert ihr?« frug er ergriffen.
Franzerl blickte scheu zu dem Fremden auf. »D'r Voda hat nix hambracht, und d'r Greisler leicht uns nix.«
»Aber um Gotteswillen . . . . nun, was hilft da alles Reden und Fragen. Wenn ich auch nicht zu viel entbehren kann, da, nimm auch von mir eine Kleinigkeit, gib das Geld deiner Mutter! Vielleicht kommt der Vater heute noch. Was ist er denn?«
»Kutscher, a Schwerfuhrwerker. Aber, wann er ah heut kummt, so bringt er sicher kan Geld, das hat er wahrscheinli schon verdraht.«
»Wie?« fragte der junge Mann, dem die Wiener Ausdrücke nicht geläufig waren.
Franzerl wollte sich gerade verwundern, daß der Herr ihn nicht verstehe, als zwei Frauen aus dem Hausflur auf die Straße traten. Eine trug einen Bierkrug, die andere einen Milchtopf.
»A so a öde Gegend da, Frau Wachtler, i sag' Ihna, was mein' Mann ein'gfall'n is, daß mir uns daher hab'n ziag'n müassen? Jetzt kann i allweil a halbe Stund um's Bier laufen. Das G'wascht in die Flaschen, was der Greisler hat, trinkt er net, er will überhaupt nur a Lager und umadum is ka urnd'lichs Wirtshaus.«
»Bei d'r Mülli hams grad ah dasselbe. Um Ihna teures Geld kriag'n S' nix, wia a G'schlader. Freili für dös G'lumperthaus is all's guat, denkt si d'r Greisler. Was er bei der Bagaschi mit'n Aufschreib'n draufzahlt, solln mir eahm einbringen.«
»Na, Franzerl,« wendete sie sich, als sie den Kleinen erblickte, an diesen, »auf wem wart'st denn?«
»Am Herrn Brenner, er holt m'r a Brot vom Greisler außi. An ganzen Guld'n hat er mir g'schenkt, und der Herr da hat m'r a was geb'n,« sagte der Bub im Überquellen der Dankbarkeit und Freude über so außerordentliche Freigebigkeit.
»So? Na, da hat's der Herr Brenner, wann er so mit dö Guld'n umhau'n kann. Sollt enker Voda liaber hamkumma und net sein Geld beim Branntweiner versauf'n.«
Obwohl beide Frauen angelegentlich den andern Wohltäter Franzls gemustert hatten, fiel ihnen nicht ein, mit einem Worte seiner Güte für das unschuldige Kind zu gedenken. Sie ahnten offenbar nicht das Verletzende ihrer Rede in Gegenwart eines Menschen, der sich derselben Offenbarung eines mitleidsvollen Herzens schuldig gemacht, wie derjenige, dem ihre absprechende Äußerung galt.
»Da plagt si so a junger Mensch die ganze Woch'n,« nahm die Frau mit dem Bierkrug in unerbetener Vertretung fremder Interessen das Wort, »und dann unterstützt er d'Faulheit und dö Lumperei von an Falotten, der selber für seine Leut' sorg'n sollt'. I sag' Ihner, das wird ka guats End mit dem Fischer nehmen. Soll aner ka Famüli gründen, der s' net derhalten kann oder will. Mein Gott und Herr! Da kunnt' unseraner net gnua tuan, wann m'r für so Leut' ah no sorg'n sollt'. Unseraner muaß sie's ah einteil'n. No adje, Frau Wachtler, mein Alter wart't schon auf sein Bier.«
»Adje, Frau Zlamal!«
Im selben Augenblicke trat der für sein Samariterwerk so wenig Bedankte mit einem mächtigen Laib Brot aus dem Laden.
»Da hast a Brot, Franzerl, und an Butter. Da nimm das Geld, was übriblieb'n is. Und wann bei enk d'r Hunger wieder anmal z'groß is, geh nur zum Greisler. Auf a paar Laberln wird's eahm net ankumma, so weit hab' i schon g'redt. Servas!«
»Da hab' i no was von dem Herrn«, sagte Franzerl schüchtern und wies auf der flachen Hand die paar Silberstücke vor.
»So? Da hast ja heut' dein' Geldtag. Und hast di schon schön bedankt?«
»Na,« gestand der Kleine, »i hab' mi net traut.«
Die beiden jungen Leute lachten.
»So bedank di halt jetzt und tummel di zu der Muatta.«
»I dank' schön«, flüsterte Franzl.
»Ist schon gut, mein Kind. Werde nur recht brav!« sagte der fremde Wohltäter.
Der Dank für den jungen Arbeiter bestand in keinem Worte, aber Kinderaugen sprechen deutlicher als der beredste Mund.
Die jungen Männer traten ins Haus und erklommen den dritten Stock, der heute gemeiniglich ein viertes oder fünftes Stockwerk ist. – Mittlerweile harrte Frau Ernestine Ambros schon seit reichlich einer Stunde in der kleinen Küche und lugte hinter dem Vorhange des Fensters auf den Gang hinaus.
Die Ambros war die Wohnungsgeberin Anton Brenners, der sich als »Kammerherr« deklarieren konnte, im Gegensatze zu der überwiegenden Mehrzahl seiner Arbeitsgenossen, die nur »Bettgeher« waren. Heute sollte er mit seinem Vetter erscheinen, der von nun ab auch sein Wohnungsgenosse wurde.
Dieser Verwandte war Student, und schon der Titel eines solchen verlieh ihm das Anrecht auf weitgehendere Neugierde und Teilnahme, als sie sonst einem neuen Einmieter entgegengebracht worden wäre. Dem seltenen Ereignisse entsprechend war die ganze Wohnung in einen viel netteren Zustand versetzt worden, als zu gewöhnlichen Zeiten.
Auch das Äußere der noch jungen, begehrenswerten Witwe, der Delila des Hauses, hatte eine Umwandlung erfahren.
Hübsche Frauen vertragen gewöhnlich das Odium einer gewissen Schlampigkeit. Man zürnt manchmal gar nicht einem abgesprungenen Knopf, einem aufgerissenen Hemde, wenn diese Defekte der Kleidung eine frische weiße Haut zum Vorschein bringen. In diesem Sinne kam die Ambros den Ansprüchen schönheitslüsterner Augen oftmals zu sehr entgegen.
Sie hatte Anlaß zu vermuten, daß der junge Student ein hübscher gebildeter Mensch sei. Gewisse Titel und Beschäftigungen decken sich immer auch mit einem gewissen Bilde. Aristokraten besitzen stets eine lässige, zierliche Vornehmheit, Studenten sind muntere, lockere Sausewinde, die das Zinsquartal nicht respektieren und denen man trotz aller übermütigen Streiche nicht böse sein kann. Daß sich ein Arbeiter einer Manikure anvertrauen könnte, würde niemandem auch nur im Schlafe einfallen.
Kurz, Frau Ambros träumte von einem großen, flaumbärtigen, flotten jungen Mann mit lachenden Augen und burschikosen Manieren.
Jetzt näherten sich Schritte.
Zweimal ließ sie die Ankommenden klopfen und einmal anläuten.
Als sie öffnete, tat sie dies mit dem Gehaben einer Frau, die in dringlichen häuslichen Arbeiten gestört wurde. Delila hatte aber auch diesmal nicht verabsäumt, ihrer häuslichen Tracht jene Korrektur zu verleihen, die geeignet ist, Männer mit Entzücken für ein gewisses Derangement zu erfüllen.
Die junge Frau ließ diesmal viel weniger sehn, als ersehnen. Beinahe enttäuscht schloß sie hinter den Eingetretenen die Türe.
Anton Brenner hatte kurz und abweisend gegrüßt. Der Andere – mein Gott! wo blieb das Studentenideal? – ließ einen Blick an der Erwartenden haften und nach einem gleichfalls kurzen, fast schüchternen Gruß verfügte er sich mit seinem Verwandten durch das Wohnzimmer der Ambros in das Kabinett.
Darin angelangt, ließ vor allem Anton einen erstaunten Umblick über die neue Ordnung gleiten. Alles nett und sauber, einmal seinen Anforderungen entsprechend, wirkliche Ordnung.
Der Begleiter wiederum vergewisserte sich, daß das Fenster des kleinen Raumes eine unbegrenzte Aussicht ins Freie bot, und er richtete sich in Gedanken blitzschnell in seinem künftigen Heime ein. Die Türwand verschaffte günstigen Raum zur Anbringung eines Schreibtisches, die entgegengesetzte zum Aufhängen eines Bücherregals.
Mehr hatte Ludwig nicht erwartet und erhofft. Er betrachtete seinen künftigen Wohnraum mit dem Ausdruck des Behagens, das jedermann empfindet, der seine Erwartungen erfüllt oder übertroffen sieht.
Von früheren Studiengenossen, die schon die Universität bezogen, hatte der junge Provinziale die denkbar schlechtesten Schilderungen über Wiener Wohnungsverhältnisse erhalten. Finstere, ungemütliche Häuser – turmartiger Aufstieg – trostlos dunkle, zellenartige Zimmer – mit der Aussicht in einen trübseligen Hof – so hatte sich seiner Phantasie ein künftiger Aufenthalt in der Reichshauptstadt eingeprägt.
Wie angenehm jedoch mutete ihn sein neues Heim an. Kein Wunder. Ludwig hatte sich nicht imQuartier latineingemietet, sondern im zehnten Bezirke, fast mitten unter Feldern. Den Ausblick aus seinem Kabinettfenster begrenzte keine Hofmauer, sondern weit über den Laaerberg hinaus konnte sein Blick die weite grüne Natur überfliegen. Und wie bei unserem Eintritt in neue Verhältnisse oft verschiedene Dinge zu einem harmonischen Ganzen verfließen, so hatte auch auf Ludwigs Empfinden die junge, hübsche Frau mit ihrem prachtvollen Blondhaar im Vereine mit dem freundlichen, sonnigen Eindruck seines nunmehrigen Wohnortes ein Gefühl freudigen Behagens erzeugt.
Anton hatte mit sichtlicher Genugtuung bemerkt, wie vorteilhaft sein Stübchen auf den Studenten wirkte. Mit Stolz wies er auf die armseligen Schätze der Einrichtung, Überbleibsel aus der ehemaligen einfachen Elternwohnung.
»Alsdann, jetzt mach m'r uns z'erst kommod. Dann werd'n m'r was essen und trinken.«
»Was das Essen anbelangt, so habe ich hier im Koffer Schinken und Bäckerei und Verschiedenes.«
»Is recht. Dann laß i was zum trinken hol'n. Willst Bier oder Wein?«
»Eigentlich bin ich weder das eine, noch das andere gewohnt. Es ist mir daher ganz gleich.«
»So soll uns die Ambros an Wein hol'n.«
Anton ging hinaus, um der Frau den Auftrag zu geben. Er fand sie schmollend und unzufrieden in der Küche.
»Weil's wahr is, dürft' i der Neam'nd sein. Es war do a G'hörtsi g'wesen, daß d' mi eahm vorstellst.«
Anton fuhr sie barsch an. »Hör mir mit dö Dummheiten auf. Und wann i d'r glei an Rat geb'n kann, den Menschen laß in Ruah! Der hat andre Sach'n z'denken, als si von dir 'n Kopf verruck'n z'lassen. Jetzt geh, nimm an Kruag und tummel di. Teller, Gläser und Eßzeug trag' schon i derweil hinein.«
Die Frau gehorchte, wenn auch noch immer maulend und unwillig.
Anton suchte in der Küche Eßgeschirr und Trinkgläser zusammen und kehrte zu Ludwig zurück, der mit dem Auspacken seines Handkofferchens beschäftigt war. Ein halber Schinken, ein halber Laib Brot, einige »Wuchteln«, »Gollatschen«, dann Äpfel und Nüsse wanderten ans Tageslicht.
»Du siehst, wie Mutter um mich besorgt war,« sagte der junge Mann lächelnd.
»Da kann m'r si's schon guat g'scheg'n lassen,« gab der andere heiter zurück, »den ersten Abend in Wean muaßt a bißl einweich'n.«
Anton deckte den kleinen Tisch, ordnete die Eßwaren und die beiden begannen zu essen. Als diese Tätigkeit beendet, zündete sich Anton eine»Sport« an.
Dann erzählten sich beide von ihren Verhältnissen. Die Vettern hatten einander bisher noch nicht persönlich gekannt. Ludwig, der als armer Stipendist und Freitischler in seiner Vaterstadt das Gymnasium absolviert, mußte, um die Universität der Residenz beziehen zu können, sich der größten Sparsamkeit befleißen.
Seine Mutter, eine Wäscherin, hatte mit vieler Zähigkeit und einem großen Talente Leute für ihren Sohn zu interessieren gewußt und es erreicht, diesen einem Handwerk zu entreißen. Ihrer Schwester (Antons Mutter) entgegengesetzt, besaß sie einen energischen Charakter und die arme Witwe, die für sich und ihr Kind durch Waschen in den Häusern sorgen mußte, tat an diesem mehr, als viele bessersituierte Eltern es imstande gewesen wären.
Nun es hieß, in Wien das angefangene Studium zu vollenden, stand Ludwig ganz auf sich allein angewiesen. Er hatte Empfehlungen an verschiedene Persönlichkeiten, mochten sie ihm nun durch Zuweisung von Lektionen oder Freitischplätzen nützlich werden.
Tante Anna hatte sich auch ihres Neffen in Wien erinnert und ihn gebeten, seine Wohnung mit ihrem Sohn zu teilen. Anton war ohne Besinnen auf die Bitte eingegangen. Damit war Ludwig wenigstens gegen die eine Eventualität geschützt, vielleicht gleich in den ersten Wochen, falls er keine Lektionen auftrieb, ohne Obdach zu sein. Der Sparpfennig der Mutter war sehr gering und es hieß haushalten, mit der Willenszähigkeit des armen Studenten.
Jeder dieser jungen, einfachen Leute besaß eine rührende Verehrung für die Mutter.
Der eine für die verstorbene, deren schlichte Güte und Sanftmut noch aus dem Grabe auf den Sohn fortwirkte.
Der andere für die lebende, sorgende, tatkräftige, nur für ihr Kind bedachte.
Das verband die in ihrem Äußern, in ihren Lebensbedingungen und Berufen so verschiedenen Männer.
Mittlerweile war die Ambros mit dem Weinkruge zurückgekommen und stellte ihn mit einem gewissen Zögern auf den Tisch.
Ludwig, der sich seiner Höflichkeitsverpflichtung gegen seine Hauswirtin bewußt wurde, bat sie, für sich auch ein Glas zu füllen und mit anzustoßen.
Also folgte die Frau der Einladung und nahm sogar den angebotenen Platz. Die Gläser klangen zusammen.
»Auf an guaten Eingang ins neuche Leb'n. Hoch! Hoch! Hoch!« rief Anton.
»Auf unsere neue Freundschaft und dein stetes Wohlergehen. Und Sie, Frau . . .« Ludwig zögerte.
»Ambros, junger Herr. Also auf recht viel Glück in der Liab.«
Anton blickte finster, Ludwig lächelte verlegen.
»Das wird für sehr lange Zeit keine meiner Sorgen sein. Sagen Sie, auf ein glückliches Studium!«
Jetzt hatte die Ambros Gelegenheit, den neuen Hausgenossen genauer ins Auge zu fassen.
Sie konstatierte, daß er schöne warmbraune Augen, einen entzückenden Schnurrbart und blendend weiße Zähne besaß. Dazu bei viel Freundlichkeit ein gewisses Selbstbewußtsein, das die sonst kleine Gestalt größer erscheinen ließ.
Sie war sich darüber im klaren, daß trotz Antons Verbot, ihre Absicht auf den jungen Mann zu richten, diese schon fest bestand.
Und bei dem Gedanken lächelte sie leise, was ihr sehr gut stand und was auch Ludwig finden mochte. In dem Augenblicke, da er sie ansah, sah auch sie auf und wie es in solchen Fällen zu geschehen pflegt, erröteten sie heftig.
»Er ist noch ein sehr unschuldiger Mensch,« sagte sich das Weib.
»Sie scheint sehr anständig zu sein,« sagte sich Ludwig. »Hübsch ist sie jedenfalls.«
Anton war, wie aus dem kurzen, in der Küche abgemachten Dialog hervorgeht, der Geliebte seiner Quartiergeberin, wie bisher noch jedes männliche Wesen, das in der Wohnung der Ambros längeren oder kürzeren Aufenthalt genommen hatte.
Aber schon zu Lebzeiten ihres Mannes, während einer kurzen, nur dreijährigen Ehe, hatte es Frau Ernestine mit der ehelichen Treue nicht sehr ernst genommen. Sie war eines jener Geschöpfe, die von Sinnlichkeit und Liebebedürftigkeit gleichmäßig beherrscht werden und die nur ein unbestimmtes Gefühl der Ehrenhaftigkeit, auch besondere Umstände davor bewahren, ihre Liebe erkaufen zu lassen.
Anton, im übrigen gegen die hübsche Witwe gleichgültig, fühlte sich nur aus einem Grunde zu ihr hingezogen, weil er sie noch aus seinen Knabenjahren kannte, und ihre Gegenwart ihn an eine Jugendgespielin erinnerte, an der er mit inniger, aber aussichtsloser Liebe hing. Seltsamerweise stieß ihn eine frappante Ähnlichkeit, die letztere mit der jungen Frau gemein hatte, mehr ab, als daß sie seine Zuneigung vergrößert hätte. Er konnte der Ambros diesen Umstand fast nicht verzeihen.
Aber er war nicht umsonst zwanzig Jahre alt und der Wohngenoß eines hübschen, heißblütigen Weibes. In kurzem war er dessen Geliebter in dem Sinne, daß die Liebe an diesem Verhältnisse gar keinen Anteil hatte, bei dem männlichen Teile wenigstens, und nur die gewöhnliche Sinnenbefriedigung auf ihre Kosten kam.
Im ganzen Hause galt jeder neue Bettgeher oder »Kammerherr« der Ambros als deren legitimer Geliebter. Man nahm das ohne Anstoß als ganz selbstverständlich hin.
Zur Zeit war das Kabinett an Anton Brenner, das Zimmer an vier Bettgeher vermietet. – Ein junges Liebespaar, das sich »zusammengezogen« hatte und die Förmlichkeit eines kirchlich gesegneten Bundes für unbestimmte Zeit hinausschob, schlief in dem einen Bette rechts von der Eingangstüre. Der männliche Teil, ein Tapezierer, hatte aus Latten und Tapetenresten eine spanische Wand verfertigt, gewissermaßen das Feigenblatt der Illegitimität.
Im Falle einer Verehelichung wäre das Ganze unnötig geworden. Sicher ist, daß das Papiergerüste auf keinen Fall mehr eine Nachfolgerin erhalten wird. Das Gewohnheitsrecht ersetzt die Legitimität.
Der dritte Bettgeher war der fidele Volkssänger Huxtl. Dieser, der oft genug Tag und Nacht durchschwärmte, aber niemals vor zwei Uhr früh nach Hause kam und bis gegen Mittag oder auch länger schlief, hatte sich seinen Schlafraum gleichfalls partikuliert. Er schuf sich eine Abteilung mittels eines alten, großen Stehspiegels, wenn von einem Spiegel gesprochen werden konnte, da jedes Splitterchen Glas schon längst verschwunden war. Bilder von Damen im Trikot, Photographien von Bühnenkünstlern und diverse Anschlagzettel schmückten die dem Bette zugewendete Seite des Toilettmöbels, das einen ziemlichen Teil des keuschen Junggesellenlagers verdeckte.
Als vierter Zimmerbewohner, resp. Bewohnerin, hauste in unbestimmbaren Zeitläufen eine alte Krankenpflegerin. Ihr Bett befand sich auf der linken Langseite, dem des Volkssängers entgegengesetzt.
Die Inhaberin der Wohnung selbst schlief in der Küche.
Die friedliche Unterhaltung der drei Leute wurde plötzlich durch ein fürchterliches Geschrei und Geschimpfe, das vom Gange bis herein schallte, unterbrochen.
Die Stimme einer keifenden Frauensperson übertönte das Gemurmel einer angesammelten Menge.
»Was gibt's denn?« frug Anton. »Das is ja d'r Blaschkin ihr' Stimm'. Was hat denn dö Luftzauberin wieder?« Die Ambros eilte hinaus und kam gleich wieder mit der Botschaft zurück:
»Na denken S' Ihner (das Du-Wort galt nur unter vier Augen), d'r Polizeimann war da und hat d'r Blaschke amtlich mit'teilt, daß ihr Mann eing'spirrt is. Als a Bsoffener hat er 'n Wachmann um d'Erd g'haut, 'n Ringkrag'n aberg'rissen und g'schimpft. Jetzt macht die Blaschkin an Murdsbahöll und streit't mit 'n Wachmann.«
Anton lachte. »Der war anmal g'scheit, der Blaschke. Kann a paar Monat' wenigstens a Ruah hab'n.«
Das Geschrei der geifernden Megäre war ein derartiges, daß alle Leute aus den unteren Stockwerken emporgeeilt waren und nun erregt die Neuigkeit diskutierten. Auch die zwei Cousins traten in die Küche, um zu hören, wie die redegewaltige Nachbarin die Wortschlacht schlug.
»B'suffene Sau, Lackl behmische, Haderlump, wann er hamkummt, kriegt er Futz'n, Hundling elendige. Und den gibte net, daß er bleibt einspirrt, wegen ane Rausch und weil Wachmann g'scherte, patscherte sich herumrafen mit so b'suffene, dumme Kedl. I werd' ich seg'n, i hau' ihnen Sauhütten z'samm und werd' mi selber Richter machen.«
Der Wachmann hatte einige Male versucht, den Redestrom zu unterbrechen. Vergebens, er hätte ebensogut mit seinen Armen den Niagara aufzuhalten versuchen können.
So entfernte er sich achselzuckend und frug eine der am Gange herumstehenden Frauen um den Namen Fischer.
»Marrand Anna, Herr Wachmann, is der vielleicht ah . . .?«
»'s wird so was sein«, brummte der. »Nur a bißl ärger. Also wo is sein' Familie?«
»In Keller unten. Mein Gott und Herr, dös arme Weib, die armen Kinder!«
Diese Nachricht hatte sich rasch herumgesprochen. Man bekümmerte sich um die schimpfende Frau Blaschke nimmer, alles drängte dem Wachmanne nach, der sich zur Behausung der Fischerfamilie begab.
In kurzer Zeit brachte die Ambros, die ebenfalls mit hinuntergeeilt war, die Nachricht zurück, daß Fischer, der Vater des kleinen Franzl, wegen schwerer körperlicher Verletzung eines Branntweinschenkers und anderer Exzesse dem Landesgerichte eingeliefert war.
Anton war erschreckt aufgefahren:
»Und was hat das arme Weib g'sagt?«
»O du lieber Himmel, sie hat nur den Wachter ang'schaut und is wia a Stückl Holz umg'fall'n, ohne an Laut. Ja, wo woll'n S' denn hin?« frug sie Anton, der Miene machte fortzueilen. »Hinunter? Is eh das ganze Zimmer voll Leut'. I werd' schon frag'n gehn, wie's mit ihr steht. Da is der Wein.«
»Is wahr, helfen kann i eahna nix. Laß m'r uns den Abend net verderb'n«. Aber ein über das anderemal murmelte er:
»Dös Elend – dös Elend!« und er trank seinen Wein mit weit geringerem Behagen als einige Augenblicke zuvor. Nichtsdestoweniger kam nach kurzer Zeit die Unterhaltung der drei wieder instand. Ludwig bat die Ambros, die Unterbrechung als nicht geschehen zu betrachten und wie es schon kommt, daß bei gewissen, außergewöhnlichen Gelegenheiten selbst die Mäßigsten etwas des Guten zu viel tun, so ließ auch Anton eine nochmalige Auflage des, beiläufig erwähnt, nicht besonders feurigen Rebenblutes holen.
Der junge Arbeiter sah mit einem Blicke, der Wehmut und Heiterkeit zugleich ausdrückte, in dem kleinen Raume umher.
»Das erinnert mi heut an frühere Zeiten,« meinte er. »Nur zwa fehl'n die ane kummt nimmer z'ruck und die andre . . . .« Er schloß mit einem leisen Seufzer. Und als wäre über diesen Punkt schon zu viel gesprochen gewesen, hüllte er sich in den Dampf seiner Zigarette und begann über die Ambros zu brummen, daß das »Weibsbild a Ewigkeit net mit den Wein kummt.«
Endlich hörte man von der Küche her ihre Stimme und die lallende eines Mannes.
»Mein Gott und Herr,« sagte die Ambros, »mit so an Rausch und dem Aufzug! Ja sag'n S' mir nur, schamen S' Ihner denn gar net? Zwa Nächt' drahn S' scho um, das is ja a Schand und Spott.«
»Tinerl, stad sein – net schimpfen!« lallte die männliche Stimme, »jetzt leg' i mi – nieder und schlaf' – mi – mi aus. Heut – wird nix am Brettl – g'standen, der Huxtl mag net.«
»Schauert liab aus, Sie und heunt am Brettl! Recht war's schon, daß Ihner alle Leut' secherten, was S' für a Lump als san.«
»Tinerl – net – net schimpfen!« hörte man den Unglücklichen flehen. »A Gaudee war das, – ah! höcher geht's – nimmer. Denk – nur, in Tschickerl – ham s' richti arretiert – in Sim – Simmering, weil er – mit an Poli keck war – und an offnen Anspanner – an Spanner für a – Pissoir ang'schaut hat – haha!«
»San S' stad, Sie ordinärer Mensch,« sagte die Ambros etwas gedämpft, »und leg'n S' Ihner anmal nieder. Hätten S' nur heut erlebt, was mit dem Saufen und Umdrahn berauskummt. Aber das war ja b'sunders heut zu an Stückl Holz g'redt.«
»An Durst hätt' i, Tinerl . . .«, sagte die Stimme wieder, die, wie man ersieht, Herrn Huxtl angehörte.
»Draust is d' Bassena, wird Ihner guat tuan.« Man hörte nimmer, was Huxtl zu diesem demütigenden Vorschlage äußerte, denn die Ambros kam jetzt zur Tür herein und stellte den Wein auf den Tisch. Ihr Gesicht war vor Entrüstung und Verlegenheit gerötet, was ihre Reize nur erhöhte.
Ludwig blickte sie und Anton fragend an.
»Der Huxtl, a Volkssänger,« erläuterte Anton, »a fescher Kerl, aber a Drahrer wia's höcher nimmer geht. Zu d'r ganzen Welt segt er ›Du‹. Er schlaft im Zimmer draußt.«
»I hatt' eahm schon kündigt,« schob die Ambros ein, »wann er net zu andrer Zeit so a liaber Kerl war. A so tuat er ah nix, wann ma si mit eahm net einlaßt, legt er si ruhig nieder und schlaft bis murg'n nachmittag.«
Jetzt drang von draußen das Geräusch auf den Boden fallenden Schuhwerks herein, dann vernahm man einige Takte eines Liedes, jedenfalls als letzte Ausläufer der famosen Stimmung, die Herrn Huxtl seit mehr als achtundvierzig Stunden beherrscht hatte, und ein Gemurmel, das deutlich auf Tschickerl endigte. Die kleine Gesellschaft unterhielt sich noch ein wenig, bis der Wein getrunken war; und als die Ambros ihren neuen Mieter verließ, war sie überzeugt, noch keinen reizenderen Mann jemals kennen gelernt zu haben.
Drittes Kapitel.
(Läßt uns in kurzen Zügen die Bewohner des Hauses Nr. 37 kennen lernen und handelt von Wohltätigkeit.)
Es gibt Häuser, die ihre Schicksale haben wie die Menschen, Schicksale, die des Erinnerns wert sind. Man braucht nicht zu denken, daß ein hohes, ehrwürdiges Alter dieconditio sine qua nonist, um erzählen zu können. Wie viele hochbetagte Menschen gibt es, deren Erlebnisse über eine glücklich temperierte Alltäglichkeit nicht hinausgehen und wie viele Kinder, deren kurzes Dasein schon eine Tragödie bildet von grauenvoller Größe.
Das Haus Nummer 37, seinen Lebenstagen nach ein Wickelkind gegen viele seiner Genossen im großen Wien, hatte schon eine erkleckliche Anzahl von aufregenden Vorfällen zu erleben Gelegenheit gehabt. Schon, als noch nicht das Dach aufgesetzt war, mußte es sich gefallen lassen, daß dem ersten Stock einige Dippelbäume entfernt und durch neue, bessere ersetzt wurden. Dann stürzte ein Teil des Gerüstes ein und begrub drei Maurer. Später gab die Stiege nach und erschlug einen armen, mit seinem Frühstück beschäftigten Bauwächter. Drei Zimmermalermeister hatten einer nach dem andern ihre Kunstfertigkeit versucht. Der letzte hatte nach hoffnungslosem Bemühen, auch nur einen Kreuzer Geld zu erlangen, wie die zwei andern die Arbeit eingestellt und großmütigerweise die Ausfertigung der angefangenen Piecen einem eventuellen Nachfolger hinterlassen.
Ein Tischlermeister, der sein ganzes Vermögen in Holz und Arbeitslöhnen dem Neubau geopfert, hatte sich an dem Pfosten einer noch uneingemauerten Türe erhängt. Dann ruhte die Arbeitstätigkeit ein halbes Jahr, bis wieder angefangen und ohne sonderliche Beschleunigung, aber auch ohne weitere Zwischenfälle das Haus fertig gebaut und zum Vermieten tauglich gemacht wurde.
Jetzt stand es stattlich da mit seinem Mezzanin und drei Stockwerken und hatte bisher noch keinerlei Reparatur bedurft, trotzdem es schon länger als ein halbes Jahr bewohnt war.
Im dritten Stockwerke wohnte außer der Ambros und dem schon bekannten Blaschke noch ein Stückschneider samt Frau und biblischer Kinderzahl. Das kleine Gangkabinett war an ein altes Ehepaar vermietet, das bei Tage Lumpen sammelte und trank und abends raufte.
Die vierte Wohnung hatte ein Drechsler inne, der seine Werkstätte am Küchenfenster aufgeschlagen. Zu beschreiben, wer außer ihm und seiner Frau die Wohnung noch bewohnte, ist unmöglich. Man kann getrost annehmen, daß er es manchmal selbst nicht wußte. Seine beiden Appartements, Zimmer und Küche, bildeten ein wahres Bienenhaus, oder besser gesagt, ein Rattennest. Jede Woche neue Bettgeher und Bettmädchen. Wohngenossen, deren polizeiliche Anmeldung meistens unterlassen wurde, da dies gar nicht der Mühe wert war. Den ganzen Tag wurde gekocht, gelärmt, getanzt, gesungen und wenn die Türe sich zeitweise öffnete, quoll dem eben Vorübergehenden eine Flut von übeln Gerüchen und ohrzerreißenden Tönen entgegen, daß man sich am liebsten Nasen und Ohren zugleich verhalten hätte. Das zweite Stockwerk hätte beinahe etwas Patrizisches gehabt, wäre dieser Eindruck nicht durch eine Partei gestört worden, deren Einzug selbst in diesem Hause Sensation erregte. Die »Einrichtung« bestand aus einem bettähnlichen Gestell, vier oder fünf Strohsäcken und einer einstmaligen Kommode. Die Partei setzte sich aus zehn oder zwölf Personen, Männern, Weibern, Kindern, zusammen, und verlieh dem ganzen Gange augenblicklich ein fast italienisches Gepräge. Alle Vorgänge spielten unter den Augen der Öffentlichkeit. Der Korridor wurde förmlich mit der Wohnung vermählt und die Wohntüre schien das überflüssigste Ding der Welt.
Das ganze Konglomerat bildete eine Familie; doch die Verwandtschaftsgrade waren nicht zu ermitteln. Es schien, daß eigentlich niemand zum andern in streng verwandtschaftlichem Verhältnisse stehe, mit Ausnahme eines Ehepaares samt Kind. Ob jedoch ein wirklicher Ehebund vorlag, wußte keine Seele. Die Beteiligten wollten es glauben machen. Aus all den Originalköpfen dieses Clans ragte besonders einer hervor, der des Herrn »Kapral.«
Er behauptet, vor Jahren Korporal gewesen zu sein und schätzte diese Stufenleiter der militärischen Hierarchie so hoch ein, als dürfte er General gewesen sein. Zum Beweise seines einstigen Befehlshabergrades trug er eine alte, verschossene Militärmütze. Einige Parteien behaupteten einmütig, den »Kapral« eines Tages vollkommen – nüchtern gesehen zu haben. Da die Aussage dieser streng moralischen Leute nicht in Zweifel gezogen werden kann, mag sie als geschichtlich erwiesene Bestätigung eines abnormalen Zustandes des Korporals gelten.
Das erste Stockwerk war (wie das zweite mit erwähnter Ausnahme) vollkommen farblos. Lauter Parteien, die den »Zins« als Heiligtum erklärten. Brave Arbeiter, die zur Bestreitung der Mietskosten ebenfalls einige Aftermieter hielten.
Das Mezzanin war leer. Es war zur dereinstigen Aufnahme von Geschäftsräumen bestimmt, und verlangte kein Trockenwohnen.
Das Souterrain, vielmehr Keller, enthielt einen einzigen Wohnraum. Er war durch einen weißgetünchten Vorplatz vom Zugange zu den eigentlichen Kellerräumen geschieden. Die Fenster gingen auf die Straße. Es waren jedoch nur zwei verglaste Öffnungen, an Größe den üblichen Kellerfenstern gleich.
Hier hauste die Familie Fischer. – – – – –
Anton verabsäumte am nächsten Morgen nicht, sich um seine Schützlinge zu bekümmern. Noch bevor er zur Arbeit ging, suchte er, mit dem Überrest des Schinkens, den Bäckereien und dem Obst versehen, die arme Frau heim.
Als er eintrat, fand er sie auf einem Schemel sitzend vor dem einzigen Bette, in dem noch die Kinder schliefen. Ein Blick genügte, um die ganze jämmerliche Besitzlosigkeit, das ganze trostlose, niederdrückende Elend dieser Behausung zu konstatieren. Die geweißten Wände zeigten große, dunkle Flecken: die Feuchtigkeit, die unablässig den Mörtel durchdrang und dem Raum eine dumpfe, dunstige Atmosphäre verlieh. Es war, wie gesagt, nur ein Bett vorhanden. Ein anderes Lager war auf rohen, zusammengestellten Kisten errichtet und mit den verschiedenartigsten Lumpen bedeckt, die nur sehr notdürftig die lose Strohlage verhüllten. Ein wackliger Tisch, der jedoch noch auf bessere Zeiten hindeutete, die er in irgendeinem Bürgerhaus gesehen haben mochte, ein ebensolcher Stuhl und ein Küchenstockerl waren im Verein mit den erstbeschriebenen »Möbelstücken« die ganze Ausstattung des Zimmers. Ein Ofen fehlte ganz, und wäre der unnötigste Einrichtungsgegenstand gewesen, da er auch nicht das mindeste Stückchen Kohle als Fütterung erhalten hätte.
Anton war von öfteren Besuchen her dieses Bild gewohnt und dennoch griff ihm der Anblick desselben heute stärker ans Herz als sonst.
Er verglich die unbekümmerte, lachende Armut der Familie des Kapral mit dem widerlichen, faulenden, trostlosen Elend, das ihm hier entgegengrinste. Kein einziger Lichtblick in der öden Nacht der Verkommenheit. Nicht einmal der Anblick der Kinder gewährte ihn, wie sie so bleich und kränklich aneinandergeschmiegt dalagen. Und erst das unglückliche Weib, dem eine feiner organisierte Natur und schwächliche Gesundheit wehrten, die Schicksalsschläge mit tapferem Arm zu mildern.
Baum und Blüten vom Verfall angenagt, jener siech bis ins Mark, diese welk und vertrocknet, und nicht bestimmt, zur reifen Frucht zu werden.
Eine Weile stand Anton in den traurigen Anblick versunken da. Er vermeinte, die Frau wäre eingeschlafen. War dieses auch nicht der Fall gewesen, so mußte doch der Bann einer schläfrigen Müdigkeit auf ihr liegen, so daß sie dem Eintritte eines Fremden kein Interesse entgegenbrachte. Als sie den Blick auf den Besucher richtete, grüßte sie ihn mit einem flüchtigen, traurigen Lächeln und streckte ihm die magere Hand entgegen. Sie war dem Freunde dankbar um ihrer Kinder willen, die ohne seine bescheidene Hilfe manchen Abend öfter, als es ohnehin geschah, hätten hungrig zu Bette gehen müssen.
Anton grüßte ebenfalls schweigend mit einem stummen Druck der Hand und legte die mitgebrachten Speisereste auf den Tisch.
»O, mein Gott, Herr Brenner, wia guat Sie san!« murmelte Frau Fischer. »Wia kann i Ihner denn danken?«
»Von dem is ka Red. Aber mir scheint, Sie san die ganze Nacht so dag'sessen?« Als die Frau müde nickte, fuhr sie Anton unwillig an:
»Das is a förmlichs Verbrechen, muaß i Ihner sag'n. Schon weg'n die Kinder. Wann Sie so forttan und über alles Ihner so alteriern, bleibn S' no anmal lieg'n, dann is 's Elend erst firti. San S' froh, wann S' anmal für a Zeit von dem Menschen derlöst san. Jetzt kann er Ihner und die Kinder nimmer malträtiern. Aber aus derer Lucken müassen S' anmal heraus, die is ja z'schlecht für an' Hund. – Nur net gar so nachgeb'n! Sie wissen, i man' Ihner's guat, mir derbarmen halt dö zwa Hascherln so viel.«
Die Frau hatte ergeben, fast teilnahmslos zugehört. Ihre Gedanken schienen gar nicht in der Gegenwart zu sein. Sie flüsterte nur, als ob sie einen einzigen Sinn aus Antons Worten herausgelöst:
»Der Mensch! der unglückselige Mensch!«
»Ja, mein Gott, is denn schad' um eahm? Hungern hat er Ihner eh gnua lassen, das bißl, was er dann und wann hambracht hat, war fürs Leb'n z'weni, fürs Sterben z'viel. Und dö Marterei – i sag' Ihner, san S' froh. Sie werd'n Ihner do so halbwegs durchbringen, nur a bißl anpackn muaß m'r d'G'schicht' können.«
»O, Herr Brenner, wann i arbeiten kunnt', glaub'n S', a Minuten hätt' i den Jammer mitg'macht? Na, na! Mir wär' nix z'wider g'wesen. Schaun S' die Arm' an,« sie zeigte ihm zwei Arme, die dürr und gebrechlich wie morsche Holzstücke aussahen, »schaun S' es an, horchen S', wann mi 's Huasten packt, schaun S' mir zua, wann i an Stock steig' – – – o du mein liaber, liaber Herrgott im Himmel! Wann i allan wär', i fürchtet mi net der Sünd'n und machert a End.«
»Schaun S', das hat gar kan Zweck. Sie san eb'n net allani. I wir nachdenk'n, vielleicht fallt m'r was ein, daß wenigstens für d' erste Zeit a Hülf is. Dö Leut' in den Haus können selber net viel tuan – no, mir werd'n ja seg'n.«
Jetzt erwachte auch der kleine Franzerl und grüßte Anton mit einem freudigen Blick.
»No, Franzerl, schon auf? Da schau am Tisch, was i enk bracht hab'. Es is eigentli von dem Herrn, der dir gestern schon das Geld geb'n hat. Jetzt schickt er euch das ah no. Und was macht denn 's Lintscherl?«
Das Lintscherl, das noch schlief, war ein vierjähriges, kränkliches Mädchen mit gelbem Gesicht, scharfen Zügen und mit von der Rachitis verkrümmten Gliedmaßen. Gewöhnlich saß es teilnahmslos auf dem zerlumpten Lager oder von Franzl behütet auf einem Erdhaufen der »Wiese«. Das stärkt die Knochen, behaupteten alle Nachbarinnen. Kräftige Kost und eine gesunde Wohnung hätten diesen Dienst sicher besser verrichtet. Aber der Erdhaufen war umsonst, also mußte der genügen.
Franzerl blickte, im Bette knieend, mit leuchtenden Augen auf die Schätze. Er hätte gerne gleich das Schwesterchen geweckt, was Anton jedoch verhinderte.
»Net verzweifeln, Frau Fischer«, mahnte er dann nochmals, als er sich empfahl. »Es packt Ihner hart an, i six ja, aber denken S', daß S' für die Kinder da san, net für Ihner allan. Also adje.«
Und im Hinaufschreiten murmelte er immer für sich hin: »Das Elend! das Elend! Wer kann da helfen?«
Der junge Arbeiter war keineswegs eine sehr weichmütige oder gar sentimentale Natur. Jedoch die herben Erinnerungen an eine in strenger Zucht verbrachte Kindheit meldeten sich, wenn er ein Kind leiden sah. Ein zuzeiten ungezügeltes, rohes, gewalttätiges Temperament, das Erbteil seines Vaters, vermochte nicht, die edelsten Regungen menschlichen Erbarmens zu ersticken. Er konnte im Zorne eine fast bestialische Roheit entwickeln, aber ein Blick aus einem kranken, verwelkten, grausam gezeichneten Kindesantlitz konnte ihn zur Weichmütigkeit besänftigen. Wie viel Menschenliebe war in diesem einsamen, verschlossenen Burschen aufgehäuft!
Er blieb dem Hasse nichts schuldig, noch weniger der Liebe. In ihm waren Tugenden und Fehler der Eltern zu gleichen Teilen gemischt. Der heftig aufbrausende Jähzorn, die Härte des Vaters, verband sich mit der Weichheit und Güte der Mutter. Die Einsamkeit unter lauter ihm innerlich fremden Naturen prägte sich seinem Gehaben auf. Es lag etwas Verschlossenes, Hochfahrendes in seinem Wesen, das ihn keine Freundschaft erringen ließ.
In der Werkstätte, wo er arbeitete, vermochten einmal vier Männer ihn kaum zu bändigen, als er sich auf einen Beleidiger werfen wollte. Der Mann wäre verloren gewesen. Eine unbedachte Neckerei hatte die Ursache abgegeben.
Fischer haßte er aus tiefstem Grunde seines Herzens. Dieser mochte das stets gefühlt haben, denn der bei aller Brutalität dennoch feige Säufer hätte nie gewagt, eine Ursache zum Anbinden mit dem jungen, starken, durch keinerlei Laster geschwächten Arbeiter zu geben.
Nichtsdestoweniger vergalt er den ihm entgegengebrachten Haß – an seinem Weibe, dem er, so absurd es in Anbetracht des frühgealterten, ausgemergelten Frauenkörpers scheinen mußte, unerlaubte Beziehungen zu dem uneigennützigen Freunde vorwarf. In diesem dumpfen Grolle äußerte sich nichts als die berechtigte Scham über sein vertiertes Wesen, die er in keiner anderen Weise einzugestehen vermochte.