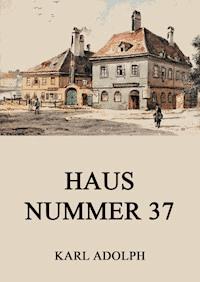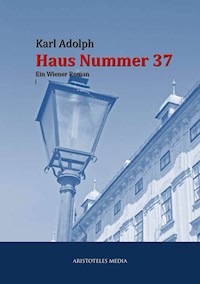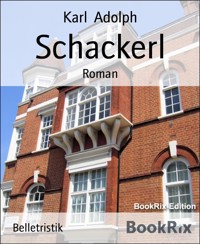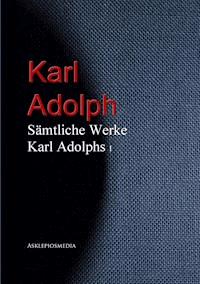Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Der Band enthält die Texte "Das Märchen", "Ein Totschlag", "Der Riskonto", "Karlis Freude", "Klein-Bertas Pfingsten", "Drei Geschichten vom Amt", "Der alte Uhrmacher", "Die Großmutter", "Opfer", "Verwehen", "Ihre erste Rede", "Heimkehr" und "Dioskuren"; manchmal heitere, öfter traurige, immer aber genau beobachtete Miniaturen aus dem alten Wien, die mittlerweile natürlich alle "von früher", aber darum nur umso interessanter sind, schon da sie uns Einblicke in ein heute vergessenes alltägliches Leben bieten, dass uns oft genug alles andere als alltäglich dünkt. Da ist zum Beispiel "Das Märchen", eine zu Herzen gehende Geschichte über einen alleinerziehenden Vater aus einfachstem Hause, der von seinem gelähmten vierjährigen Sohn dazu veranlasst wird, die vergessene Macht der Fantasie wieder in sich zu entdecken – kein Märchen an sich also, sondern eine tiefsinnige Geschichte über die verändernde Kraft des Märchenerzählens. Da ist "Ein Totschlag"; eine Geschichte über die Entmenschlichung in Zeiten der Not und über einen hundefleischessenden Slowaken, der doch noch so himmelhoch über dem schließlich Erschlagenen wohlhabenden Österreicher steht, dass nach Meinung des vor Gericht stehenden Täters dessen Totschlag schon dadurch gerechtfertigt ist, dass schon sein bloßes Weiterleben eine Beschmutzung der Ehre des Slowaken wäre; da ist "Karlis Freude", wo der Krieg ganz eigenartig in das Leben zweier Kinder eindringt und sie erst auseinander- und, nach dem Kriegstod eines der Väter – und makabererweise sehr zu Karlis Freude –, wieder zusammenbringt; da ist "Heimkehr", ein schroff-nüchterner Text über die Desillusionierung und Entfremdung des Kriegsheimkehrers in ebendem Moment, auf den er sich doch all die Jahre über gefreut hat; und da ist noch vieles, vieles mehr: drastische, schonungs- und illusionslose, niemals süßliche Geschichten, die heute wiederzuentdecken sich unbedingt lohnt. Ein Lichtblick unter all der dumpf-patriotischen drögen, verlogenen deutschsprachigen Mainstreamliteratur der damaligen Zeit!-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 165
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Karl Adolph
Von früher und heute
Wiener Skizzen
Saga
Von früher und heute. Wiener Skizzen
© 1924 Karl Adolph
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711570029
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
Das Märchen
Niemals kam der Vater abends um sieben Uhr heim, ohne sich erst in der Küche gründlich das von Maschinenfett und Russ geschwärzte Gesicht sowie die noch viel schwärzeren Hände zu reinigen. Nach diesem Verfahren, eines zivilisierten Europäers würdig, erschien er in dem gemieteten kleinen Kabinett, wo sich aus einem der darin befindlichen zwei Betten zwei magere Kinderarme dem Eintretenden entgegenstreckten.
Denn nichts als diese Ärmchen vermochte der Kleine zu bewegen. Die Beine waren und blieben steif für alle Ewigkeit. So hatte es eine unerbittliche Notwendigkeit der Natur angeordnet, und in dem Sinne nahmen es die Ärzte, nahm es schliesslich der Vater und ganz unbewusst der kleine Dulder selbst, der niemals im Leben (es war ja noch so kurz, kaum vierjährig) das gelernt, was man strampeln heisst. Er konnte nur in Sehnsucht seine kleinen Arme gebrauchen.
Den ganzen lieben langen Tag lag er in seinem Bette, wenn ihn nicht die um geringes Geld dazu gemietete Quartierfrau heraushob, in das Zimmer trug und auf das alte Sofa setzte, um mittlerweile im Kabinett die Betten von Vater und Kind zu „machen“.
Mein kleiner, aber trotz alledem lustiger Dulder vergnügte sein kaum vierjähriges Dasein, so gut es ging, mit seinen Spielsachen. Ach, wie sahen die aus! Da waren darunter einige Ausschneide- und Ankleidebildchen, eine Eisenbahn, die zur Weihnachtszeit (wenn ich einem gewissen Herrn Kohn glauben darf) zum Selbstkostenpreis siebzig Heller gekostet, eine zerbrochene Rechenmaschine, ein unvollständiges Zusammenlegebild, einige alte, zusammengetragene, geschenkte, zerfetzte Bilderbücher und dann Überbleibsel eines von wem immer geschenkten Ankersteinbaukastens. Zu erwähnen wäre noch ein Tennisball, ein geflickter Gummiball und eine fast unmögliche Puppe. Derart war sie nämlich an Armen und Beinen mitgenommen worden. Auch hatte sie die Perücke verloren und erwies sich als ein mit einem Kahlkopf versehenes kleines Ungetüm.
Wenn der Vater erschien, kreischte das Würmchen laut auf vor Freude über das Erscheinen seines einzigen und liebsten Freundes und breitete ihm sehnend die mageren Ärmchen entgegen.
Und dann lächelte der ernste, sonst fast niemals lächelnde Mann und beugte sich über das Bett, um sein Kind zu betasten und seinen rauhen, struppigen, von Maschinenöl duftenden Bart über dessen Gesicht zu breiten, was er küssen nannte. Und in diesem Augenblick war lallende und unbewusste, verschwiegene Religion in beider Herzen.
Das waren die Feier- und Weihestunden des Vaters. Ich vermag nicht anzugeben, wie klein das Kabinett war, wie dürftig, wie dumpfig — aber ich kann mit aller Beruhigung und Herzensfreude sagen: es waren zwei glückliche Menschen darinnen.
Es war nicht allzu lange, dass deren drei waren ... Der Vater brachte gewöhnlich das Abendessen mit oder liess es von der Quartierfrau aus dem nächsten Gasthause holen. Dazu trank er ein Glas Bier, dann machte er es sich bequem, zündete seine Pfeife an, und nun wurde es erst recht vergnügt, indem Vater und Sohn sich ansahen, der erste schweigsam, der andere in der Sprache redend, die wohl Engel sprechen müssen, einfach lallend, oft kreischend, kurz, mit der Sprache des Kindes, das weiter nichts ausdrücken kann als die ernstesten, erhabensten und reinsten Dinge, die wir später alle nicht mehr verstehen: Freude, Dankbarkeit und Liebe.
Und das war so bis zum heutigen Tage geblieben.
Aber heute hatte der Kleine, nachdem ihn sein Vater, wie gewöhnlich, lange Zeit paffend angestarrt, dessen rauhe, schwarze Hand mit seinen kleinen Händchen umfasst und die Aufforderung getan:
„Vatta, tsäl ma a Tsicht.“
Es hiess wirklich nichts anderes, als der Vater solle eine Geschichte erzählen. Der aber war über die neue Zumutung ganz starr und sah seinen Sprössling mit einer Miene an, die nur höchstes Erstaunen ausdrückte. Woher war dem Kleinen eine solche Idee angeflogen gekommen?
Darüber zerbrach sich der Ältere (bildlich genommen, denn solche Ausdrücke darf man beileibe nicht ernst nehmen) den Kopf. Aber der Junge beharrte auf seinem Verlangen.
Die Ursache dieses war, dass sich die Quartierfrau bei der Umlagerung des kleinen, plauderlustigen und neugierigen Menschenkindes zu einer Art von Erzählung eines Märchens verstiegen hatte. Und wie alles Wurzel schlägt, ob Unkraut oder gedeihliches Korn, also hatte das Märchen Wurzel geschlagen und drängte nach Ausbreitung auf dem einzigen Nährboden, den es besitzt, dem einer kleinen Kinderseele.
„Vatta, tsäl ma a Tsicht ...“
Die Mahnung war eine so dringende, dass der Vater von dem Wolkenheim des Erstaunens glatt auf dem Boden der Wirklichkeit ankam und endlich begriff, dass die Zeit des gegenseitigen väterlichen Anstarrens und kindlichen Kreischens einer anderen gewichen war: der eines geistigen Austausches.
Und plötzlich stand das Märchen hinter dem schweigsamen Manne, und seine Berührung verlieh ihm Worte. Nicht glänzende, von oratorischem Geiste getragene. Nein, so zusammengestoppelte Worte, wie sie ein einfacher Geist für einen noch einfacheren zu finden vermag.
Dabei half eine schon lang vergessene Erinnerung an eine Frau, die ihm vor vielen Jahren derlei erzählt, und diese Frau war eine Nachbarsfrau gewesen, da er selbst noch so klein, mutterlos und verlassen in seinem Bette lag wie heute sein Kind.
Also begann er:
„Es war amal a grosser Ries’ ...“
„Du, Vatta, was is a Ties’?“
„A Ries’ is so gross ...“
„Wie toss denn?“
„No, a Ries’ is halt recht gross ... So wia der Stephansturm.“
Es war eine jedenfalls äusserst glücklich gewählte Vergleichsform, da der Kleine den Stephansturm nie gesehen’ noch beschreiben gehört hatte. Aber sei es, weil er ein Wiener war — er gab sich mit der Auskunft zufrieden.
„Und was hat der Ties’ ’tan?“
„No ... der Ries’ is amal in’ Wald gangen ...“
„Vatta, was is a Ald?“
„A Wald ... ja, a Wald, das san lauter Bam’.“
„Bamm?“
„Ja, wasst, solche Bam’ wia in’ Park, wo m’r manchmal hingengan.“
„Und wia viel Bamm?“
„O je! So viel ... No ja, halt lauter Bam’. Und der Ries’ is in dem Wald an’ Zwergl begegn’t ...“
„Vatta, was is a Wergl?“
„A Zwergl? Der is so viel klan.“
„Techt tlan?“
„Recht klan. So klan ... no, so klan wia du.“
„To tlan? ... Und was hat der Wergl ’tan?“
„Ja ... der Zwergl hat den Riesen begegn’t.“
„Und was hat der Wergl und der Ties’ ’tan?“
„Dö san halt in’ Wald spaziert und san so ’gangen, immer weiter ’gangen. Do hat der Ries’ g’mant, i hab’ an’ Hunger. Schau’n m’r, dass m’r wo a Hütten finden.“
„Was is a Itten?“
„Das is a klan’s Haus. Und da san s’ zu an’ Haus ’kumma, da ha’m s’ an’klopft. Auf das schaut beim Fensta a alte Hex’ aussi und fragt: Wer is dada?“
„Vatta, was is a Ex?“
Der Erzähler blieb diesmal dem Unterbrecher eine Antwort schuldig und fuhr in seiner Erzählung voll Eifer fort:
„Der Ries’ hat g’sagt, mir san dada. Und der Zwergl hat aa g’mant: Mir san dada und ha’m an’ Hunger. Und die Hex’ hat g’sagt: Nur der Zwergl kann in mein Haus eini, denn für’n Ries’n hab’ i kan’ Platz. Und da hat der Ries’ zum murr’n ang’fanga und die Hex’ a alte Hex’ g’schimpft. Und der Zwergl is in die Hütt’n ganga, zu der Hex’, und hat den Ries’n ausg’lacht. Die Hex’ hat eahm viel zum ess’n geb’n ...“
„Techt viel?“
„Natürlich, recht viel. Und viele guate Sach’n.“
Die Augen des Horchenden erglänzten.
„Was denn alles Tut’s?“
„No, an’ Schinken, an’ Kas und Wuchteln und Kaffee und Dschokolad ...“
„Und Bacherei?“
„Viel Bacherei und Zuckerln ...“
„Und an’ Mog’ntudl aa? Und Twetgen und Äpfl’n und an’ Milireis? ...“
„All’s hat er kriagt, aa a guat’s Banfleisch mit Essigkren und a Schweinernes und Hendeln und ...“
„... an Dudlhupf! ...“
„Den hat er aa kriagt.“
„Und der arme Ties’,“ forschte der mitleidige Zuhörer, „hat der nits tiagt?“ Der Erzähler erlahmte in seiner Einbildungskraft. Aber da berührte ihn wieder das Märchen, dass er den Faden fand aus dem Irrgang, in den er nach Art von Stegreiferzählern geraten. Und nun stellte sich neben das Märchen die Phantasie und berührte den Mann. Und dann kam der Schlaf und berührte den Kleinen und später den Vater, und dann kam der Traum und liess beide ein seliges Märchen weiter erleben.
Und alle kamen allabendlich getreulich wieder, bis einst einer kam und das Recht an dem Kleinen forderte. Alle traten schweigend zurück — das Märchen hatte ein Ende.
Ein Totschlag
Also erzählen Sie!“ sagte der Vorsitzende zu dem wegen meuchlerischen Totschlages Angeklagten. Dieser begann: „Ich habe meinen Verteidiger gebeten, mir selbst die Vertretung meiner Angelegenheit zu überlassen. Er möge es nicht als Misstrauen in seine Fähigkeiten auffassen. Aber wie der natürliche Aufschrei der Not fester ins Ohr dringt als der gekünstelte der Darstellung, so glaube ich, meine Herren Geschwornen, wird meine einfache Erzählung Sie mehr dem Motiv meiner Tat nähern, als es die mittelbare Darstellung des Herrn Verteidigers vermöchte.
„Der Tatverhalt ist folgender: Mich hat ein Mensch tötlich beleidigt, und ich schlug ihn hinterrücks nieder. Ich leugne nichts und werde mich bemühen, auch nichts zu beschönigen, soweit es die in mir empörte menschliche Natur zulässt. Verzeihen Sie, wenn ich mich meines Opfers nur insoweit erinnere, dass ich eine unnütze, gefährliche Bestie aus dem Wege geräumt habe.
„Ich bin das, was man einen ‚gebildeten Proleten‘ nennt. Ein Mann mit aufgestapeltem Wissen, fähig zu hohen Berufen, aber unfähig, sein Brot durch Lastentragen zu verdienen. Meine Hände vertragen keine Schwielen, und mein Hirn — leider Gott! — es war weniger zu gebrauchen als meine Hände. Allen fehlte die rauhe Rinde der Erwerbsfähigkeit.
„Ich mute den Herren des hohen Gerichtshofes nicht einmal die Vorstellung zu, dass sie es probieren möchten, tagelang mit ungesättigtem Magen herumzulaufen, nächtelang im Freien zu schlafen, solange es die milde Natur gestattet; denn das, was Obdachlosen oft als Obdach zugemutet wird, konnte ich nicht ertragen. Ein Deklassierter ist eben anspruchsvoll, zu seinem Unheil.
„Bisher jedoch war auch mein Magen ebenso anspruchsvoll wie der Ihre — das heisst, ich konnte gewisse Fleischgattungen nicht ohne Widerwillen, ja Abscheu auch nur nennen hören. Aber jetzt waren mir Stücke aus einer Pferdefleischauskocherei ein Leckerbissen geworden. Begreifen Sie doch! ... Ein Feiertagsbissen. Nun etwas weiter ... Wie ich zu Hundefleisch kam ... Eines Tages irrte ich ausserhalb der Stadt durch die Felder. Wie gern durchwanderte ich einst diese. Wo ich als Kind Gott den allmächtigen Herrn gelobt, der Blumen und Falter gerade zu meinem Vergnügen geschaffen hatte, sank ich hin, verlassener als die hungrigste Bestie.
„Der Hunger des ‚verschämten Armen‘ hatte mich ohnmächtig, willenlos, feig, verzweifelt gemacht.
„Da, am Rande des Feldes, sitzt auf einem Stein ein Mensch und kaut an einem Stück Fleisch. Ja: Fleisch, sage ich Ihnen, den Begriff werden Sie nie ermessen. Ich könnte vielleicht sagen, das Wasser rann mir im Munde zusammen — doch hat die Sprache keinen Ausdruck für die Empfindung meines damaligen tierischen Hungers.
„Mein Anblick muss erbarmungswürdig gewesen sein. Doch — nicht das! Meine Augen müssen gesprochen haben, mit der schreienden Sprache die die Natur den leidenden Kreaturen als leider nur immer zu stumpfe Waffe mitgegeben hat.
„Ob Tier — ob Mensch! Mich haben solche Blicke stets gerührt ... Doch ich verirre mich nun. Ich sage, mein Anblick oder die Sprache meiner Augen müssen es gewesen sein, die den armen, am Wege lungernden Slowaken veranlassten, mir den widerlichen Brocken anzubieten.
„Ich wusste noch nicht, was ich ass.
„Als ich gesättigt war und mir dessen bewusst wurde, den treuesten, dankbarsten Freund unseres Geschlechtes gefressen zu haben ... Worte sagen nichts — Tränen alles. Der arme, landstreicherische Slowak ... wie gütig war er und doch wie grausam, als er grinsend sagte: ‚Hund is gut zum Fressen, sehr gut.‘ Ich war zu gesättigt und zu müde von der Sättigung, um Abscheu empfinden zu können. Und so dankbar war ich. Ich stand neben dem Menschen, der mehr Tier war als der Hund, der uns zum Frasse gedient. Aber war ich jetzt erhaben über diesen armen, unwissenden Mitbruder? Wodurch denn? Dass ich mehr gelernt hatte, mehr verstand von Dingen, die mir nichts nützen konnten, um den Hunger zu stillen?
„Gütig, wie die meisten selbst Darbenden sind, reichte mir der brave Slowak noch seine Schnapsflasche (wohl sein kostbarster Besitz), und ich trank — während mir unaufhaltsam Tränen über die Wangen rollten, sich an der Flasche brachen und sie mit dem köstlichsten Nass in Berührung brachten, das je die Fläche dieses Glases benetzte. Dann griff der arme Kerl in seine Tasche, wühlte in ihr herum und brachte endlich — einen Kreuzer zum Vorschein, den er mir treuherzig reichte. Lachen Sie, meine Herren Geschwornen! Es gibt noch Leute, die ihr Letztes teilen oder verschenken.
„Wahrhaftig, dem Andenken dieses Parias war ich es schuldig, die menschliche Gesellschaft von einer Unzier zu reinigen; jener Edle wäre noch heute beschmutzt, lebte die dahingestreckte Bestie noch.
„Einen Kreuzer! ... Merken Sie den Betrag! Denn nun komme ich zur Sache, zur Tat, die mich vor diese Schranken gebracht hat. Zur Tat, die ich nicht bereue und niemals bereuen werde im Erinnern an den mildtätigen slowakischen Landstreicher, der Hunde fing, um sie zu fressen.
„Vielleicht haben die sogenannten Wilden recht, die meinen, alle Eigenschaften des getöteten Geschöpfes gingen auf seinen Verzehrer über ... ich hatte zum mindesten die Dankbarkeit des Hundes in meine Seele — gefressen.
„Wie ich die nächste Nacht und den folgenden Tag verlebte? Meiner Treu ... ich weiss es heute selbst nimmer. Ich schlief im Gehen, im Stehen, beim Sprechen, ich war ein Automat ... Ich habe selbst nicht mehr so viel Bewusstsein, dass ich mich elend, verzweifelt gefühlt hätte. Nur einer Empfindung bin ich mir bewusst: wenn ich Hunden begegnete, war ich tief ... tief traurig. Wie wenn ich im Jenseits mit unauslöschlicher Trauer ein nie zu Verzeihendes, einen Vatermord oder was Ähnliches beklagt hätte. Ich weiss auch nimmer, wer der unselige Wohltäter war, dem ich zehn weitere Kreuzer verdankte. Jedenfalls auch einer der Kategorie, die die Hälfte von dem verschenkt, was sie besitzt.
„Es war nach einer bösen, kalten Nacht. Ich verschmähte bis dahin, mich einem Asyl anzuvertrauen; ich Narr vermeinte noch immer, meinem ‚Menschen‘ damit etwas zu vergeben. Statt mich in die Reihen meiner Brüder zu flüchten, zog ich es vor, wie ein aus der Herde gestossenes Tier in der Einsamkeit zu irren.
„Ich jagte durch die Strassen wie gehetzt oder wankte wie ein Betrunkener. Ich rannte, statt zu schreiten, nur um mich warm und wach zu halten und böse Gedanken von mir zu bannen.
„Elf Kreuzer! Ach, was wissen Sie von solchem Reichtum! Er machte mir die Nacht erträglich, verstehen Sie? Der Gedanke daran, er rettete mir damals das Leben und brachte mich am Ende hieher, um Rechenschaft abzulegen wegen der ausgelöschten Existenz einer unnützen Kreatur.
„Auch — Mensch!
„Wäre der arme slowakische Vagabund nicht gewesen, vielleicht — ich sage nur vielleicht — hätte ich den anderen geschont.
„Und nun kam es so. Mit meinen elf Kreuzern in meiner Tasche erwartete ich den anbrechenden Morgen.
„Ach, das ist ein Gefühl, der Sonne entgegenzuträumen!
„Man öffnet zuerst die Bäcker- und Branntweinläden. Es herrscht keine angenehme Luft in letzteren, aber man kann ruhen. Bald erscheint der Bäcker, und mit angenehm bezwingendem Geruch duftet das frische Gebäck. Seligkeit, hineinzubeissen und dann ein kleines Gläschen Branntwein, Tropfen um Tropfen, zu schlürfen! Das träge gewordene Blut wird reger, die Apathie wird zu momentaner Energie, und man versöhnt sich für Augenblicke mit der besten dieser Welten. Möge einer nur die rasende, hungrige, gierige Sehnsucht kennen, dass ein verschlafener Aufwärter die Rollbalken öffne! Wie scheu, gehetzt und doch wie getröstet tritt man ein in solche von ‚anständigen‘ Leuten verfemte Orte. Noch der Geruch des Menschenschweisses, eingesperrt seit dem letzten Abend — o, was tut der Herdentrieb! Man ist glücklich, wieder einen Menschen zu sehen, zu sprechen, ein Dach über sich zu fühlen statt des stummen, erbarmungslosen, sterneglitzernden Nachthimmels.
„Eine Wollust der Sättigung, des Wärmegefühls, des Geborgenseins hatte mich überkommen. Es war eine Orgie der erwachten Lebenslust. Die Nacht, die böse Nacht der Heimlosen war wieder einmal vorbei, und es schien die Sonne ... Ach, zweien wäre wohler gewesen, hätten sie diese Sonne damals nicht aufgehen sehen. Plötzlich das Rollen von Wagenrädern, das vor dem Lokal innehielt. Lachende Männer- und Weiberstimmen ... Herein traten in Begleitung zweier elegant geputzter Dirnen zwei Männer jener Sorte, denen man das Beiwort ‚Kavalier‘ beilegt. Zur Abwechslung wollten sie wohl einmal einen gemeinen Branntweinladen aufsuchen.
„Es dünkt mich zur Zeit unerhört, was die Gesellschaft alles befahl, trank und mit klingender Münze dem Aufwärter überzahlte. Auch ich hatte das einmal getan. Aber jetzt ... Ach, nur einige dieser rollenden, glitzernden Münzen zu besitzen! Wie viele Tage und Nächte wären mir rosig und heimisch gemacht worden!
„Mochte mein Gesicht so gesprochen hoben, war die Verwahrlosung, in der ich mich damals befand, der Dolmetsch meiner Gedanken — kurz, meine hilflose Bescheidenheit erweckte eine Abart des Humors in den Gefühlen des einen der lustigen Gesellschaft.
‚Schau nur,‘ meinte der eine Kavalier, ‚wie gut es dem Plebs eigentlich geht. Kaum aus den Federn und schon in der Butike.‘
„Dabei lachte er gewaltig und steckte damit die anderen an. Auch der Aufwärter grinste pflichtschuldig zu dem Witz — und ich lächelte ebenfalls. Gewiss, ich lächelte, wie alle Unterdrückten, Verfluchten lächeln, wenn ihr einigermassen gesättigter Magen es gestattet.
„Ich war einst ein stolzer Mensch. Ha! Hätt’ einer früher gewagt, mir das zu sagen, was ich jetzt geduldig anhörte! So jedoch lächelte ich, in der kriecherischen, hündischen Erwartung, die gute Laune der Herren Kavaliere würde sich für mich durch eine einzige dieser vielen Münzen lohnend machen. Und dann war ich im Augenblick gegen die Menschheit so grossmütig. Die fortgesetzte Entbehrung, manchmal gelindert, macht stets verzeihend und aller Erbitterung entsagend.
„Nun weiss ich, warum das Volk so geduldig ist.
„Mein Aussehen mag ein höchst heruntergekommenes gewesen sein, ein traurig-drolliges, das den Menschenfreund zu erschüttern imstande ist, auf rohe Naturen aber zur Bestialität aufreizend wirkt.
„Wie schon erwähnt, hafteten meine Blicke mit einer Art hypnotisierender Begehrlichkeit auf den verschiedenen Münzen, die ab und zu auf das Schenkbrett geworfen wurden.
‚He, Landstreicher oder was du da bist,‘ redete mich der Kavalier an, und ich merkte an seinem breiten Jargon, der gedehnten Aussprache des Deutschen, den Trans-Ausländer, ‚wenn du Geld verdienen willst, lass mich einen Jux machen, wie ich ihn gern zu Hause mache!‘
„Geld verdienen! O wie gern! Welchen Jux meint der hochgeborne Herr, den ich am liebsten geohrfeigt hätte? Aber Geld verdienen, der bösen, schaurigen, eisigen Sturmnacht für einige Zeit entgehen — das gab den Ausschlag.
‚Du bist, scheint mir, so eine Art Intelligenzprolet, desto besser. Stelle dich her und glotze nicht so aufrührerisch. Halte dich gerade! Ich gebe dir eine Ohrfeige, und du erhältst dafür hundert Kronen. Bin heute in einer lustigen Stimmung. Hältst du gut, ohne zu mucken, darfst du noch Schnaps trinken, was dir gefällt. Einverstanden?‘
„Ich schloss nach diesem Vorschlag die Augen, vielleicht sekundenlang. Aber was während dieses Zeitraumes alles an mir vorbeizog, welche Erwägungen ich anstellte, welche Vergleiche ich zog — all das zu schildern, ist mir jetzt unmöglich. O meine Herren, bedenken Sie, ich wählte zwischen Schmach und erhabenem Menschentum. Ich sank, ich ward ein Verbrecher an diesem. Statt den frechen, abscheulichen Verächter der Menschenwürde niederzuschlagen, gleich im richtigen Augenblick, ging ich ein feiges Kompromiss ein: erdulden die Schande — aber dann war die Rache ...
„Hundert Kronen konnten mich aus dem ärgsten Jammerleben herausretten. Ich konnte wieder Mensch werden, wie ich es gewohnt war, meine gesellschaftliche Position wieder erringen, konnte den frechen Trunkenbold vor meine Pistole zwingen — Larifari! Der Hunger ist stärker als die Ehre, meine Herren. Man kann das Leben missachten, es der fürchterlichen Entscheidung der Schlacht anheimstellen, es für das Leben eines gehassten Feindes aufopfern, es selbst vernichten, qualvoll, aber rasch. Niemals jedoch dem Verhungern weihen, wo rings der Überfluss lockt und aufreizt.
„Zuvor noch hatte mich die karge Sättigung,