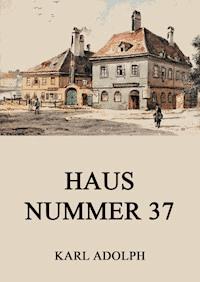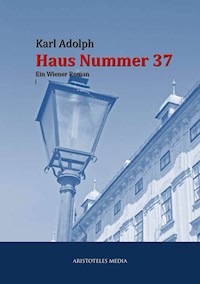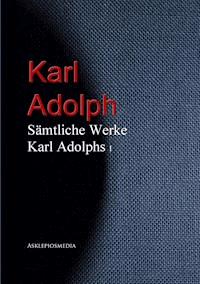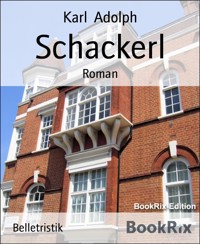
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Erstes Kapitel: Befasst sich mit der Schilderung von Schackerls Geburtshaus, dem Charakter einiger seiner Bewohner und macht Mitteilung von einem folgenschweren Beschluss der Mutter des Helden, ohne den dieser nicht das Licht der Welt erblickt hätte ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Schackerl
Roman
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenErstes Kapitel
Befasst sich mit der Schilderung von Schackerls Geburtshaus, dem Charakter einiger seiner Bewohner und macht Mitteilung von einem folgenschweren Beschluss der Mutter des Helden, ohne den dieser nicht das Licht der Welt erblickt hätte.
Einzeln bestehen sie noch heute, diese einstigen lieben, lachenden Wiener Häuser.
Aber sie sind schon lange auf die Liste der Pfründner gesetzt. Man lässt sie verfallen, vermorschen, verwittern und sucht aus ihnen noch so viel Profit herauszupressen wie möglich. Nicht einmal der billige Kalk wird angewendet, um sie lichter, heiterer und reinlicher zu gestalten.
Sie gleichen den unreinen Greisen, die man in ihrer Hülle von Schmutz und Unrat belässt, soweit es der Umgebung rätlich erscheint, da doch kein Reinigungsversuch eine nennenswerte Dauer hat und der Marastische sich in seiner Lage wohl befindet.
Damals bildeten diese alten, lieben Häuschen noch nicht einzelne Oasen in der öden Ziegelwüste der werdenden GRossstadt. (Ich rede nämlich von der Zeit, da Schackerl noch durch sein Verharren im ungeweckten Keimzustand seine Eltern betrübte.)
Sie bestanden noch unendlich zahlreich in Gruppen als Gassen und Gässchen, die sich lange gegen die fahlen, lichtlosen, hochragenden, protzigen Eindringlinge wehrten, welche wie alle Protzen eine unendlich öde Innenseite zeigen.
Was sie an billigem Flitter nach der Straßenfront aufweisen, macht die Rückseite tausendfach wett mit ihren Rundbauten, deren kleine Fenster nicht auf die edelste Bestimmung der Menschheit weisen.
Wie die Zellen von Gefängnissen gleichen die Wohnungen einander.
Die Türen mit ihrem schlechten Ausputz einer meist misslungenen Naturholzimitation gähnen einander an, als stürben sie selbst vor Langeweile darüber, so gleichmäßig ausgestattet zu sein.
Blickte man damals durch einen der breiten, gewölbten Hausflure jener alten Häuschen, nickte einem ein liebliches Gärtchen entgegen.
Rote, grüne, gelbe, blaue, silbern- und goldfarbene Glaskugeln auf in die Erde gelassenen grünen Stangen blitzten in der Sonne. Die mit roten Ziegelsteinen gepflasterten Fußwege des Hofes bildeten zu dem grüngestrichenen Holz- oder Eisengitter des Gartens einen angenehmen Gegensatz.
Und erst wenn man den Hof selbst betrat!
Wie schimmerten die lichtgelben Mauern; wie blitzten die Fenster; wie leuchteten die weißen Türen; wie glänzten die Vorhänge; wie dufteten, lockten die Blumen in ihren roten Geschirren von allen Fenstersimsen!
Da gellten, schrieen, tollten die Kinder um die Wette mit den in ihren Vogelhäuschen an dem Ganggeländer aufgehängten Kanarien, die sich schier so frei und glücklich fühlten wie die freien Sänger des Gartens, über dessen Wunder zu berichten ich mir vorbehalte.
Frauen umstanden den ebenfalls grün gestrichenen, mit einer roten Kappe versehenen Schöpfbrunnen und rieben das Holzgeschirr und die Küchengeräte blank, saßen abwechselnd auf dem von einem schier ungeheuren Waldriesen stammenden Hackstock, plauderten und lachten oder zankten nach uralter Weibersitte und Brauch.
In den Werkstätten klopfte, hämmerte, sägte, kreischte es – und das alles wurde unterbrochen, gestillt durch die Töne eines Werkels oder einer Harfe. Damals lauschte man noch (und hatte den ruhigen Atem dazu) den linden Tönen jenes Instruments, das heilige Frauen spielten, wie uns die Maler früherer Zeiten erzählen.
Man lauschte noch. Denn, Gott sei Dank, in diesen kleinen Betrieben des Gewerbefleißes stand noch nicht das hässliche Motto angebracht: Zeit ist Geld. Nämlich nicht in dem Sinne verstanden wie heute, wo ein sekundenlanges Ausatmen schon den Bruchteil eines Geldverlustes bedeutet.
Man kannte damals auch noch nicht die in den Hausfluren angebrachten Warnungen, dass Betteln, Hausieren und Musizieren verboten seien. Letzteres Verbot würde nicht nur die Musikausübenden jeder Sorte, sondern auch alle Hausbewohner grimmig empört haben, denn Musik welcher Art immer war stets willkommen.
Das Haus schien Gemeineigentum zu sein.
Der Hausherr war Patriarch. In fast allen Fällen Despot, aber in den allermeisten Fällen doch nichts als ein höchst brummiger und dabei höchst friedfertiger Despot.
Es gab schon damals arme, wohlhabende und reiche Leute. Aber es gab kein so quälendes, zu Herzen gehendes Elend der Massen, das gemieden wird wie die Pest.
Man verkroch sich nicht in seine Behausung, um ja nur jede Berührung mit dem Nachbarn zu vermeiden, der in den meisten Fällen ein Fremder bleibt und bei dem man löblicherweise voraussetzt, er könne einem einmal unangenehm werden.
Um auf die Hausherren zurückzukommen, so verboten sie weder das Halten von Hunden und Kaninchen noch das Kindererzeugen. Auch drohten sie nicht gleich mit der Kündigung, wenn eine Partei der Ansicht zuneigte, der Erste des Quartals wäre zu früh erschienen.
Da früher in einem solchen ehrbaren Hause Kinder auf sehr anständige Weise ehelich innerhalb der vier Pfähle gezeugt zu werden pflegten und nicht auf freiem Felde oder vor den Toren wüster Tanzlokale oder in den kahlen Zimmern eines Hotels während der Hetzjagd einer Hochzeitsreise, so war die Geburt eines Kindes beinahe Angelegenheit des ganzen Hauses.
Man brachte dem Erscheinen eines neuen Sprossen am Stamme der Menschheit liebevollste Sympathie entgegen. Ward der Segen auch oft in einer Familie zu gRoss, so tadelte man die Eltern nicht wie verstockte Verbrecher, sondern tröstete sie mit dem Axiom: Gibt der Herrgott 's Haserl, gibt er auch das Graserl.
Und es blieben immer noch die für das jüngste Häschen notwendigen Hälmchen.
Das Haus, dem Schackerl die Ehre zuteil werden lassen sollte, ihn geboren und – ach! – nur so kurze Zeit beherbergt zu haben, war in der stillen, kleinen Gasse das vornehmste. Denn es besaß eine Längsfront von zwölf Fenstern und eine Höhe von zwei Stockwerken. Es hatte selbst eine wenn auch nur mäßig verzierte Fassade und das breite Tor mit einem barocken Volutenaufsatz unter einem vortretenden Rundfenster konnte sich mit einem Herrschaftsportal messen. Also behaupteten wenigstens damals die Leute der Gasse.
Jedenfalls besaßen die Baumeister früherer Tage das rühmliche Bestreben, nicht mehr oder weniger zu tun, als unter gegebenen Umständen notwendig war, im vorteilhaftesten Gegensatz zu unseren heutigen Baukünstlern.
Hätte das Haus aber nach außen hin noch mehr als die vorerwähnten Reize besessen, so würden sie doch nichts bedeutet haben gegen die Schönheit der Hofseite.
Wenn man durch die breite »Einfahrt« an der schweren eichenen Wäscherolle linker Hand vorbei in den Hof trat, mutete es einen gar zu lieb und traulich an. Alles, was von vorbeschriebenen Schönheiten und Eigentümlichkeiten alter Wiener Häuser gesagt wurde, fand sich hier im reichsten Maße.
Der Hof, dessen Mitte ein weitästiger, dichtbelaubter Nussbaum beherrschte, war von drei Fronten des Hauses umschlossen, die eine Ergänzung in dem nicht allzu gRossen Garten fanden, der überdies noch dadurch gewann, dass sich an ihn Gärten der Nachbarhäuser reihten.
Alles blitzte vor Reinlichkeit und strömte Heiterkeit und Behagen aus. Und über allem lag viel, unendlich viel Himmel, den unsere geldgierige Zeit uns stiehlt. Es lag noch Verträumtheit über der kleinen, lächerlichen Gasse, die mich im Laufe der Begebenheiten mehrmals nötigen wird, über sie zu erröten.
Die Mauerfronten umzogen Galerien unangestrichenen Holzes, sogenannte offene Gänge, von denen man nach Überwindung zweier steiler Schneckenstiegen zu den Wohnungen gelangte.
An der rechten Front bis oberhalb der ersten Galerie, schlang sich ein mächtiger Weinstock empor, mit seinem Blätter- und Rankenwerk die ganze Mauer verdeckend. Er war das Schmerzenskind des Hausbesitzers, der zur Lesezeit unbefugten Näschern nicht wehren konnte.
Der Nussbaum war gRossmütigerweise den Plünderungen der Hausjugend preisgegeben worden, da der alte Herr zu wenige und zu stumpfenhafte Zähne besaß, um sich an dem Kern der Steinfrüchte zu erfreuen. Jedoch die Trauben des mehr als hundertjährigen Weinstockes, noch von seinem UrgRossvater gepflanzt, waren der Aug- und Zankapfel des biederen alten Hauspatriarchen, der vom ersten leisen Reifen dieser kostbaren Beeren in steter, nicht unbegründeter Aufregung erhalten wurde.
Um den verbrecherischen Gelüsten der zahlreichen Kinderschar nach seinen Lieblingen zu begegnen, hatte er einmal versucht, zur Traubenzeit den kleineren und größeren Naschdieben similia similibus beizukommen. Zu diesem Zwecke ließ er auf dem Naschmarkt eine »Butten« der süßesten Weintrauben einkaufen und verteilte sie unter die Schar der unmündigen Eigentumsverächter.
Die Wirkung dieser Art hinterlistiger Maßregel war die, dass sich die Schlingel fast zum Krankwerden vollfraßen, aber trotzdem weiterstahlen. Sehr zum uneingestandenen Vorteil Herrn Saltners (dass er einmal in aller Form vorgestellt wird), der ohne diese belebenden Aufregungen der Sorge, Entrüstung, unaufhörlicher Strafpredigten und gelegentlicher Verfolgung eines ertappten Diebes mit geschwungenem Pfeifenrohr ein Opfer seiner beschaulichen Lebensweise geworden wäre.
Wo sind sie hin, jene vielen braven, alten, despotischen, topfguckerischen Hauspatriarchen? Vielleicht lebt noch ein oder das andere Exemplar dieser nicht allzu lang untergegangenen Art in einem Versorgungsheim, wie in Menagerien seltene Geschöpfe als letzte Ausläufer ihrer Rasse dahindämmern.
In dem Hause Herrn Saltners wie noch in vielen anderen gleich ihm zog man niemals aus noch ein. Man wurde darinnen geboren, erzogen, heiratete hinein oder hinaus und ließ sich endlich nur wegtragen, da man um die Erlaubnis dazu weder gefragt wurde noch sie gewähren oder verweigern konnte.
Herr Saltner hatte die würdigen Traditionen einer Reihe von Ahnen geerbt, die in ihrer Art mindestens so gut waren wie manche hochadelige. Es ward ihm aber leicht gemacht, sie aufrecht zu erhalten und sich nichts zu vergeben. Seine Parteien, die seit Menschengedenken niemals mit dem Zins gesteigert wurden, blickten meist wie er selbst auf eine Reihe würdiger Ahnen zurück, denen in diesem Hause das Wiegenlied der Mutter und die Abschiedsseufzer der Kinder und Enkel erklungen.
Die stille, abgelegene Gasse hatte seit nahezu zweihundert Jahren ihr Gesicht behalten wie in den Tagen, da sie erstanden. Nach wie vor betrachtete sie das Saltnersche Haus als den Stolz ihres Besitzstandes, denn es war das stattlichste unter den übrigen unscheinbaren, einstöckigen Baulichkeiten.
Vielleicht ist die Beschreibung des schlichten Hauses zu weitschweifig und langatmig ausgefallen. Mag sein. Aber wenn von interessanten Männern die Rede ist, schenkt man auch den Stätten ihrer Geburt, ihrer Kindheit und ihres Schaffens eine liebevolle Aufmerksamkeit.
Man hat sich um das ehemalige Heim eines mehr oder minder gRossen Mannes oft erst lange danach bekümmert, als er schon tot war. Ich wollte diesem Beispiel zuvorkommen, indem ich das Geburtshaus Schackerls einer näheren, anschaulichen Beschreibung würdigte.
Sonst aber – forscht nach dem Hause nimmer! Ihr würdet erschrecken wie bei dem Anblick eines Menschen, der noch im Liebreiz aller Gesundheit und Schönheit von euch Abschied nahm und den ihr auf seinem Siechen- und Sterbelager findet.
Das Gärtchen Herrn Saltners samt den anderen, die es umgaben, ist verschwunden. An seiner Stelle erhebt sich ein stinkender, qualmender Fabriksschlot und eine gellende, misstönende Dampfpfeife versetzt mit ihrem ohrenbetäubenden, unvermittelt einsetzenden Geheul die ganze Nachbarschaft in stete Aufregung.
Die blinkenden Fenster des Hauses sind stumpf und schmierig geworden, viele sind zerbrochen oder mit Papier verklebt. Dahinter hantieren Männer und Weiber. – Tausende Pappschachteln werden aus Wagen verladen, die in dem geräumigen Hofe stehen.
Ach! Wie sieht der aus!
Wo ist der Nussbaum, wo der alte, ehrwürdige Weinstock? Der eine umgehauen, der andere abgestorben, verstümmelt. Das liebe, hölzerne, stets so reinliche Geländer starrt vor Ruß und Schmutz.
Die ehemals so lichten, stets neu gefärbelten Mauern sind ebenfalls von ihm überzogen, und trauernd lugen unter dem abgefallenen Mörtel die alten, wackeren Ziegel hervor.
Habt ihr den Mut, einen noch lebenden und dennoch schon verwesenden Körper anzusehn? Dann sucht das alte, einst so liebe Haus Herrn Saltners ...
Aber ich werde euch den Weg nicht weisen.
Die Werkstätte des Wagnermeisters Konrad Kolb lag mit einem gRossen Tor und vier Fenstern gegen die Gasse und mündete noch in den Hof hinein. Die Küche bildete den neutralen Raum zwischen Arbeitsort und Wohngemächern, drei in der Anzahl. Sie vermittelte den Eingang vom Hofe sowohl nach der Werkstätte als den anderen Räumen.
Mit vier Gesellen und einem Lehrjungen hantierte der Meister den langen lieben Tag fleißig, bedächtig, ohne Hast, mit allen dem Handwerk ziemenden Pausen.
Herr Kolb war ein Riese, mit der Gutmütigkeit, die diese Menschengattung auszuzeichnen pflegt. Die niedrigen Türen seiner Wohnung konnte er nicht passieren, ohne sich erheblich bücken zu müssen. Seine Frau, nur um Kopfeshöhe kleiner als ihr gigantischer Gemahl, war eine äußerst hübsche, lustige, lebhafte, gern plaudernde Person. Wenn die Natur ihrem harmlosen Charakter einen verdunkelnden Fleck verliehen, so war es der Neid; aber nur in einer speziellen Abart.
Das Ehepaar Kolb besaß trotz seiner körperlichen Stattlichkeit und einem zehnjährigen christlichen Ehewandel nichts, was man einen Leibeserben nennt. Und da der Neid nur das Resultat einer Vergleichung ist, ergibt sich, dass Frau Kolb die Unfruchtbarkeit ihrer Ehe mit der Fruchtbarkeit einer anderen verglich.
Gegenüber den Wohnfenstern befanden sich die des Rosshaarkremplers Beugler. Jedes Jahr zu einer bestimmten Zeit und für eine bestimmte Frist entzog sich die Frau dieses Gewerbsmannes den Blicken der Hausgenossen, um nach Ablauf genannter Frist mit einem Säugling wieder auf der Bildfläche zu erscheinen.
Die Regelmäßigkeit dieser Art weiblicher Berufserfüllung war eine fast sprichwörtliche in der Gasse geworden. Bis zur Stunde tummelte sich in der Wohnung, im Hofe und auf der Gasse eine Schar von Kindern jeder Altersstufe, jeder Größe, jeden Temperaments und jeder Haarfarbe herum. Es war schier wunderbar, wie sie alle gewartet, genährt und in Ordnung gehalten werden konnten.
Die Mutter selbst wie der jeweilig ankommende Sprössling bewegten sich in stetig absteigender Größe. Die Gebärerin wurde schon lange von der drittältesten Tochter an Größe übertroffen und die Kleinheit des letzten Säuglings möchte keine Schilderung veranschaulichen.
Wäre die Wagnermeisterin nicht eine so gutmütige, harmlose, heitere Frau gewesen, die niemandem auch nur das geringste Böse wünschen konnte, so hätte sie die Fruchtbarkeit der Beuglerin als persönliche Beleidigung auffassen können.
Und wenn ihr sanftes Gemüt einer nicht ganz einwandfreien Regung zugänglich war, so war es, wie schon gesagt, der Neid, aber in so verdünnter Form, dass er schließlich doch nichts ward als seufzende Sehnsucht und in seiner Äußerung nichts als eine flüchtige Wolke der Trauer.
Und jedes Mal, wenn die Rosshaarkremplerin mit einem neuangekommenen Beweise der Liebe ihres Gatten in der Öffentlichkeit erschien, führte ihr erster Weg zur Frau des Wagnermeisters, um dieser einen demütigen Dank für alles auszusprechen, was die kinderlose Frau der kinderreichen an Wohltaten erwiesen.
Dann schluchzte wohl die Erste: »Mein Gott, Beuglerin, nur ans von den vielen, die Ihner der Herrgott schenkt, nur ans wann er mir gebert!«
Und dann weinten beide Frauen zusammen, die eine, weil des Segens zu wenig, die andere, weil des Segens so viel und des Brotes zu wenig war.
Da die Menschheit die Schwere ihrer Kümmernisse gern auf die Schultern einer stärkeren, wenn auch ungekannten Macht bürden möchte, war es kein Wunder, wenn die zwei Frauen sich zur befriedigenden Erledigung ihrer Sorgen an den Himmel zu wenden und sich dabei der Vermittlung einer in ihren Augen besonders gut akkreditierten Persönlichkeit zu bedienen gedachten.
Der Glaube! Dieses unsichtbare, aber ewige und feste Seil, das von nur geahnten Regionen auf diese harte, steinige Erde reicht, wir ergreifen es alle, und wenn wir nur die Möglichkeit des günstigen Zufalles ins Auge fassen.
Es war eben acht Tage nach der Zeit, da die Frau des Rosshaarkremplers zum letzten Mal sich den Augen der Nachbarn gezeigt hatte, als Frau Kolb an dem Bette der Wöchnerin saß und die aber- und abermaligen Danksagungen der kleinen, bleichen Frau entgegennehmen musste.
Schier allen Vorrat an Kinderwäsche, den sie in den Jahren ihrer Ehe in Anhoffung endlicher Erfüllung eines Herzenswunsches im Stillen verfertigte, hatte sie der Beuglerin nach und nach geschenkt. Hier war Bedarf an solchen Dingen, während sie zu Hause vergilbten und durch ihren Anblick die kinderlose Frau stets aufs Neue betrübten.
Nachdem der Vorrat an Dankesworten endlich erschöpft war und die Tränenbäche der beiden Frauen versiegt erschienen, machte die Wöchnerin ihrem Besuch einen Vorschlag, der noch des Näheren erörtert wird. Dann drang die andere wieder in die Vorschlagspenderin mit einem neuen Vorschlag, der offenbar so überwältigend wirkte, dass er nur zögernd und mit abermaligen heißen Dankesworten angenommen wurde.
Aber die leuchtenden, zuversichtlichen Mienen der beiden Frauen gaben Zeugnis für die Vortrefflichkeit, Sicherheit und verblüffende Einfachheit ihrer geheimen Abmachung.
Wohl zwei Stunden hatte die denkwürdige Unterredung gewährt, als der Säugling aus einem tiefen und, wie es schien, gesunden Schlummer erwachte und offenbar aus Nahrungstrieb zu weinen begann.
»Beuglerin ... sollt' das a Zeichen sein?«, stammelte Frau Kolb tief ergriffen.
»Unser Herrgott tuat no Wunder!«, erwiderte nicht minder ergriffen Frau Beugler.
»Dass 's a Anfang is für Ihner ... Da hab'n S'. I bind's dem Klan' halt früher für die Tauf' ein. Auf a guat's Werk schaut unser Herrgott. Sunst macht er kane Wunder!«
Mit diesen Worten drückte Frau Kolb der Wöchnerin etwas in die Hand, das sich schwer und hart anfühlte, und ohne einem neuen Strom von Danksagungen standzuhalten, verließ sie rasch das Zimmer.
Zweites Kapitel
In dem Frau Kolb ihren Gatten für einen gefassten Beschluss zu gewinnen weiß und diesen unter den denkbar günstigsten Auspizien zur Ausführung bringt
Herr Kolb hatte die löblichen Gewohnheiten einer geregelten Lebensweise.
Pünktlich um sechs Uhr früh stand er schon mit seinem Stabe in der Werkstätte. Der Magen ward in Vertröstung auf das Frühstück, das um sieben Uhr stattfand, mit einem, manchmal zwei Gläschen echten, guten Wacholders abgefunden. Dann gab es je nachdem Milch- oder Einbrennsuppe oder Kaffee. Um neun folgte ein ausgiebiges Gabelfrühstück und punkt zwölf Uhr ein noch ausgiebigeres Mittagessen.
Der Mittagstisch vereinigte das Meisterpaar, die Gesellen und den Lehrjungen zu gemeinsamem Mahle. Ein Überbleibsel der patriarchalischen Einrichtungen früherer Tage, die Meister und Gesellen einander näherten und in diesen oft eine gewisse Liebe zur Familie aufkommen ließen.
Herr Kolb war nicht im Mindesten das, was man so gemeinhin fromm nennt. Aber er achtete die Überlieferung seiner Vorfahren, die seit Urgrossvaterszeiten an demselben Tische gesessen, gespeist und vorher ihr Tischgebet gesprochen hatten. Daher wurde vor Beginn des Mahles ein Kreuz geschlagen, je nach Übung, Temperament und Überzeugung jedes Einzelnen. Man saß eine Weile mit verschlungenen Fingern, etwas geneigtem Haupte da, bewegte die Lippen, was besonders Peperl, der Lehrjunge, als Gebet auszugeben pflegte, obwohl es meist nichts anderes war als ein zurückgehaltenes Schmatzen nach den Speisen, dann teilte die Meisterin aus.
Diese Überlieferungen einer in manchem Sinne guten alten Zeit waren schon seltene Ausnahmen geworden. Aber erst die neueste Zeit hat dem Patriarchismus allüberall die unheilbarsten Wunden geschlagen.
Sie hat recht, die neue Zeit, wie das Neue ja stets im Rechte ist. Aber wenn das baufällige Hüttchen zusammengerissen wird, um einem neuen schönen Hause Platz zu machen, nimmt die Harke des Demolierers mit dem verfaulten Stroh oder den Schindeln des Daches das alte, herrliche Moos mit, verwüstet das angebaute Gärtchen und verjagt die lieben, unsichtbaren Geister, die jedes alte Haus bewohnen.
Mit dem Unkraut, das jede Revolution, ob blutig oder unblutig, wegzuräumen beauftragt ist, stirbt manche liebe, herzige Blume, die nur zu erfreuen bestimmt war.
Und deren blühte so manche im Schatten des endgültig gefällten Patriarchismus. Anhänglichkeit, Treue, Liebe zur Familie des Meisters oder Dienstherrn – diese Tugenden hat unsere mächtige eiserne Zeit mit ihren Schritten zerstampft, ausgerottet.
Ein misstrauisches Geschlecht wacht sorgsam über seine errungenen Rechte. Wie es kein Unrecht dulden will, ist es auch zu keinen Opfern bereit.
Die Idylle ist tot. Und wie sehr man das Naturgesetz zu achten gezwungen ist, kann einem die Trauer nicht verwehrt werden beim Anblick eines vom Blitze gespaltenen Baumes, eines vom Hagel vernichteten Blumengartens.
Die Abendmahlzeit um sieben Uhr vereinte nur die zwei Gatten im Wohnzimmer, nicht im gemeinschaftlichen Speisezimmer. Dort wurde nur den Gesellen und dem Lehrjungen der Tisch gedeckt und sie wurden sich für den Rest des Abends allein überlassen.
Die Zeit während des Abendessens und ein Verdauungsstündlein war den Erörterungen des Ehepaares über die verschiedenen Sorgen des Haushalts und des Geschäftes gewidmet.
Denn um halb neun Uhr brach Herr Kolb zu seinem Gange nach dem Stammgasthause auf, um dort inmitten einer fidelen Kneiprunde einige »Stutzen« zu sich zu nehmen. Um dreiviertel elf war Aufbruch und um elf schlief der Meister schon in seinem Bette.
Diese gewöhnliche Zeiteinteilung fand nur im Fasching insofern einige Ausnahmen, als er von dem Ehepaar verwendet wurde, auf zehn oder zwölf Haus- oder Wirtshausbälle zu gehen und dort bis in die Frühstunden wacker zu tanzen, Krapfen zu essen und Wein zu trinken, um dann von dem Orte der jeweiligen Lustbarkeit an das gewohnte Tagewerk zu gehen. Die Konstitution der beiden liebenswürdigen Riesen hielt derlei mit Leichtigkeit aus.
An dem Abend nach dem Besuch Frau Kolbs bei Frau Beugler seufzte die Erste, während ihr Gatte mit der Zermalmung eines Knochens beschäftigt war, einigemal tief auf, was dem Meister stets als Zeichen galt, es bereite sich was vor, zu dem seine Zustimmung gesucht werde. Er widmete daher dem Knochen eine erhöhte Aufmerksamkeit.
Weitere drei bis vier aus der Tiefe geholte Seufzer schienen an ein taubes Ohr zu dringen. Mehr an Verstellung konnte aber der gutmütige Riese nicht aufbringen. Er knurrte daher:
»Hör' anmal auf mit der Seufzerei! Wannst a so anfangst, waß i scho, dass d' was willst von mir.«
Die hübsche Frau presste noch einmal einen leichten, schon sehr an der Oberfläche geholten Seufzer hervor, dann wischte sie sich die Augen, ein Verfahren, von dem sie wusste, dass es auf den biederen Gatten fast lähmend wirke.
»Heut war i bei der Beuglerin«, leitete sie den Schlachtplan ein. »Mein Gott und Herr! Es is wirkli a Jammer. Scho wieder was Klan's und Schmalhans Kuchelmaster.«
Herr Kolb, der ein weiches Gemüt besaß, es aber nach Art aller Leute, die wirklich damit bedacht sind, nicht zur Schau tragen wollte, nahm eine schier menschenfresserische Miene an, die, wenn sie die ganze Welt getäuscht hätte, seine Frau nicht zu der Überzeugung gelangen ließ, ihr Gemahl wäre ein verstockter Menschenfeind.