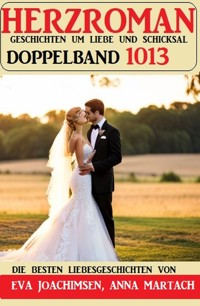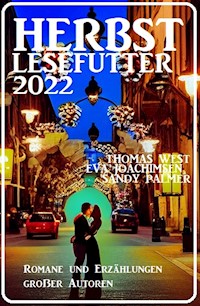
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CassiopeiaPress
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch enthält folgende Geschichten: (399XE) Thomas West: Geisel seines Herzens Sandy Palmer: Heißer Sex über den Wolken Thomas West: Schicksalhafte Begegnung im Krankenhaus Sandy Palmer: Meine große Liebe - ein Bigamist Thomas West: Jans Vater Eva Joachimsen: Tanz in die Liebe Eva Joachimsen: Schuhträume Dr. Wilde ist ein sehr zurückhaltender Mensch, niemand weiß etwas von dem Schicksalsschlag, der ihn vor fünf Jahren getroffen hat. Erst als der übermütige Jan nach einem Sturz lebensgefährlich verletzt eingeliefert wird, geht er etwas aus sich heraus. Dazu trägt auch Jans alleinstehende Mutter bei. Doch dann sieht sie ihn eines Nachts in einer verfänglichen Situation, und die zarten Gefühle füreinander scheinen zerstört.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 834
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thomas West, Sandy Palmer, Eva Joachimsen
Inhaltsverzeichnis
Herbst Lesefutter 2022 - Romane und Erzählungen großer Autoren
Copyright
Geisel seines Herzens
Heißer Sex über den Wolken
Schicksalhafte Begegnung im Krankenhaus
Meine große Liebe – ein Bigamist
Jans Vater
Tanz in die Liebe
Schuhträume
Herbst Lesefutter 2022 - Romane und Erzählungen großer Autoren
Thomas West, Sandy Palmer, Eva Joachimsen
Dieses Buch enthält folgende Geschichten:
Thomas West: Geisel seines Herzens
Sandy Palmer: Heißer Sex über den Wolken
Thomas West: Schicksalhafte Begegnung im Krankenhaus
Sandy Palmer: Meine große Liebe - ein Bigamist
Thomas West: Jans Vater
Eva Joachimsen: Tanz in die Liebe
Eva Joachimsen: Schuhträume
Dr. Wilde ist ein sehr zurückhaltender Mensch, niemand weiß etwas von dem Schicksalsschlag, der ihn vor fünf Jahren getroffen hat. Erst als der übermütige Jan nach einem Sturz lebensgefährlich verletzt eingeliefert wird, geht er etwas aus sich heraus. Dazu trägt auch Jans alleinstehende Mutter bei. Doch dann sieht sie ihn eines Nachts in einer verfänglichen Situation, und die zarten Gefühle füreinander scheinen zerstört.
Copyright
Ein Cassiopeiapress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author
COVER A. PANADERO
© dieser Ausgabe 2022 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Zum Blog des Verlags geht es hier:
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
Geisel seines Herzens
von Thomas West
ArztromanDer Umfang dieses Buchs entspricht 140 Taschenbuchseiten.
Eigentlich wollen Dr. Alexandra Heinze und ihr Mann beim Kollegen Molani einen fröhlichen Abend verbringen, doch weil der Hund mit dabei sein muss, geht alles schief. Das große Problem taucht jedoch einige Tage später auf, als Dr. Molanis Frau, die mit dem Nachbarn eine heftige Affäre hat, bei einem missglückten Banküberfall als Geisel genommen wird.
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books und BEKKERpublishing sind Imprints von Alfred Bekker ( https://www.lovelybooks.de/autor/Alfred-Bekker/)
© Roman by Author/ COVER MARA LAUE
© dieser Ausgabe 2019 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Zum Blog des Verlags geht es hier:
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
1
„Etwas Ernstes?“ Erschrocken ließ Jasir seine Teetasse sinken. Er zog seine schwarzen Brauen hoch, und seine dunkelbraunen Augen weiteten sich. Wie immer, wenn er sich Sorgen machte.
„Nur ein leichter Druck im Unterleib“, wehrte Marion ab. „Aber mir ist es lieber, wenn mein Gynäkologe einen Blick darauf wirft.“ Sie strich sich eine Strähne ihres blonden, langen Haares aus dem Gesicht und wich seinem bekümmerten Blick aus.
„Aber natürlich musst du zum Arzt gehen, Liebste.“ Jasir stellte seine Tasse ab und stand auf. „Selbst Frauen in deinem Alter können gar nicht vorsichtig genug sein.“ Er kam um den Wohnzimmertisch herum und legte seine gepflegten, feingliedrigen Chirurgenhände auf Marions Schultern. „Ich habe letzte Woche erst mit unserem Chef-Gynäkologen darüber gesprochen. Der sagte, dass Gebärmutterkrebs bei …“
„Ist doch gut, Jasir“, unterbrach sie ihn, „nur ein leichter Druck, weiter nichts, und ich bin eine vorsichtige Frau.“ Ihre Stimme wurde heftiger, als sie es gemeint hatte.
„Entschuldige, Liebste“, er küsste sie zärtlich in den Nacken. „Eine sehr vernünftige Frau bist du. Wann gehst du zum Arzt?“
„Morgen. Er hatte nur noch einen Termin um zwölf Uhr frei.“
„Nun, dann werde ich das Mittagessen ausfallen lassen und die Zwillinge von der Schule abholen.“ Jasir und Marion hatten zwei Jungen in der ersten Grundschulklasse. „Vielleicht kann ich ihnen sogar schnell etwas kochen.“
Marion seufzte. So war Jasir immer. Er überschlug sich fast vor Liebe und Fürsorge. Das machte es ihr ja so schwer. „Das brauchst du doch nicht, Liebster. Karin wird die Zwillinge mitbringen, wenn sie Ina von der Schule abholt. Sie können auch bei ihr essen.“
Karin war die Nachbarin. Sie und ihr Mann Benno hatten zwei Kinder in ähnlichem Alter wie die Zwillinge. Die beiden Familien waren gut befreundet. Sehr gut sogar.
„Und was ist mit der Bank?“
„Ich habe mir morgen frei genommen.“ Seitdem die Kinder in die Schule gingen, also seit etwa einem Jahr, arbeitete Marion wieder halbtags in ihrem Beruf als Bankkauffrau. Das Kindermädchen war zwar alles andere als billig, aber diesen Luxus leistete sie sich. Jasir verdiente als Arzt genug Geld.
Die Jahre, in denen ihr Leben sich im Wesentlichen zwischen Wickelkommode, Küche, Spielplatz und Kindergarten abgespielt hatte, waren zwar schön gewesen, aber am Ende hatte es Marion kaum noch erwarten können, bis die beiden Jungen eingeschult wurden. Sie wollte endlich wieder raus aus Küche und Kinderzimmer.
Die Arbeit in der Bank tat ihrem Selbstwertgefühl gut. Sie konnte gar nicht verstehen, dass Karin, ihre Nachbarin, so zufrieden und ausgefüllt war. Hausfrau und Mutter ist doch der ideale Job, sagte Karin manchmal. „Der ideale Job, um langsam aber todsicher zu verblöden“, dachte Marion dann immer. Sie hatte es aber noch nie ausgesprochen.
„Wir werden übrigens Gäste haben morgen Abend“, sagte Jasir. Marion sah ihn fragend an. „Die Heinzes – ich habe dir doch von der Kollegin erzählt. Ihr Mann ist Kinderarzt. Er hat eine Praxis in der Beethovenstraße.“
„Schön“, sagte Marion, und sie meinte es ehrlich, denn inzwischen war sie schon soweit, dass sie über jeden Abend froh war, den sie nicht allein mit Jasir verbringen musste. „Haben sie Kinder?“
„Nein, merkwürdigerweise nicht. Aber einen Hund“, Jasir schüttelte den Kopf, „ein Riesenvieh – ich habe es mal gesehen, als Frau Heinze von ihrem Mann abgeholt wurde.“ Marion runzelte besorgt die Stirn. „Keine Sorge, Liebste“, lachte er, „den Hund bringen sie nicht mit.“
Er räumte das Teeservice zusammen und trug das Tablett in die Küche. Dann hörte sie seine Schritte auf der Treppe. Sie wusste, dass er hoch in das Kinderzimmer ging, um nach seinen Söhnen zu sehen. Sie konnte sich keinen besseren Vater vorstellen als Jasir. Und eigentlich auch keinen besseren Mann. Er war alles andere als ein Pascha.
Wie hatte ihre Mutter sie gewarnt damals: „Du wirst doch keinen Perser heiraten! Was glaubst du denn, wie diese Moslems ihre Frauen behandeln? Er wird die Füße hochlegen und Tee trinken, und du darfst dir die Hacken abrennen!“ Solche Prophezeiungen hatte sie sich monatelang anhören müssen.
Das Gegenteil war richtig. In den anstrengenden ersten Monaten mit den Zwillingen war Jasir auch nach seinen kräftezehrenden Nachtdiensten noch am Wickeltisch gestanden oder hatte die Säuglinge spazieren gefahren, damit Marion sich ausruhen konnte. Und an freien Tagen war er es, der am Herd stand und kochte. Er war eine Perle, und alle Freundinnen von Marion, die ihn kannten, beneideten sie um ihn.
Wieder seine Schritte auf der Treppe. „Kian und Ulan schlafen“, sagte er. „Und wie beschließen wir den Sonntag? Mit einem Nachtspaziergang oder mit einem Krimi?“
Marion schlug den Krimi vor, und Jasir schaltete den Fernseher ein. Sie bekam nicht allzu viel mit von dem Film. Ständig schweiften ihre Gedanken ab. Einerseits war es die Angst, irgendjemand könnte sie ertappen. Natürlich meldete sich auch ihr Gewissen – je liebevoller Jasir war, um so heftiger. Vor allem aber prickelte eine aufregende Vorfreude in ihrem Körper – morgen, zwölf Uhr. Hoffentlich kam nichts dazwischen.
2
Er riss das Kalenderblatt ab: Montag, 9. September. Dann warf er seine Ledermappe auf den Schreibtischsessel, schaltete auf dem Weg zur großen Kommode den PC an und zog zielsicher eine CD mit Jazzmusik aus dem Ständer neben der Kommode. Er schob die Scheibe in den Player, ging dann zum Waschbecken, stellte die Kaffeemaschine ein und begann seinen Dreitagebart zu stutzen.
So ungefähr begann jeder Tag. Seit fast zwei Jahren. Seitdem Benno Mayenfeld sich als EDV-Berater selbstständig gemacht hatte. Die Jahre zuvor hatte er für eine große Firma EDV-Anlagen in Banken, Versicherungen und Krankenhäusern gewartet und installiert. Jetzt verkaufte er Softwaretrainings, und viele seiner Kunden waren ehemalige Kunden seines alten Arbeitgebers.
Natürlich – Zwölf-, Vierzehnstundentage waren obligatorisch. Aber was bedeutete das schon gegen den Vorteil, sein eigener Chef sein und den Arbeitstag irgendwann im Lauf des Vormittags mit Jazz und Bartpflege beginnen zu können? Außerdem arbeitete Benno gerne. Um nicht zu sagen: Er konnte ohne Arbeit nicht leben.
Er legte die Bartschere weg und betrachtete sein Profil im Spiegel. Das schmale, kantige Gesicht war braungebrannt. Er war mit Karin und den Kindern fast fünf Wochen lang in Sizilien gewesen. Seine Augen hatten die Farbe von Bernstein, nicht braun und nicht gelb – eben bernsteinfarben. Das lange, blauschwarze Haar trug er zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden.
Das Telefon. Die Personalabteilung einer Bank. Eine neue Software sollte eingeführt werden. Die mittlere Führungsebene der Bank brauchte ein Schulung. Das Geschäft war schnell vereinbart.
„Die Woche fängt gut an, Benno!“ Er rieb sich die Hände und schenkte sich einen Kaffee ein. Mit viel Zucker und Milch. Dann drehte er sich eine Zigarette und griff nach seinem Diktiergerät. Bis um zehn Uhr die Sekretärin kommen würde, wollte er noch einige Briefe diktieren.
Der Vormittag ging vorbei wie im Flug: Benno koordinierte die Schulungen für die nächsten drei Wochen, telefonierte mit seinen Mitarbeitern – er selbst gab nur noch selten Seminare – rief einige Firmen an, die er gerne als Kunden an Land ziehen wollte, und empfing einen arbeitslosen Lehrer, der in seiner Firma Computerkurse geben wollte.
Er nahm sich Zeit für den Mann. Ständig boten sich ihm Leute als freie Mitarbeiter an. Und Benno brauchte Mitarbeiter. Allerdings hatte er seine eigenen Vorstellungen von Qualität. Und wer zufriedene Kunden wollte, musste seine Leute sehr sorgfältig aussuchen. Der ehemalige Lehrer suchte vor allem einen schlauen Job und schnelles Geld.
„Ich lass von mir hören“, verabschiedete Benno ihn. Er würde den Teufel tun und den Mann noch einmal anrufen. Bis um halb zwölf vertiefte er sich in einige Computerzeitschriften, um sich über neue Software zu informieren. Danach rief er Karin an.
„Hi, Herzblatt – ich komm heute nicht zum Mittagessen.“ Was Benno sagte und tat hatte etwas von der Selbstverständlichkeit einer Naturerscheinung. Die meisten Menschen akzeptierten es widerspruchslos. Auch seine Frau. Wenn auch nicht immer klaglos.
„Schade“, seufzte sie, „du hättest für eine Stunde bei den Kindern sein können, ich wollte nämlich noch etwas für den Gemeindenachmittag besorgen.“ Karin war engagiertes Mitglied der Kirchengemeinde. Schon seit ihrer Jugend. Ohne sie wäre der Pfarrer aufgeschmissen gewesen. Benno war nach seinem Studium aus der Kirche ausgetreten. Aber dieses Thema war nie ein Streitpunkt zwischen Karin und ihm gewesen. Überhaupt gab es so gut wie keine Streitpunkte zwischen ihnen.
„Sorry, Herzblatt – ich habe ne Menge Aufträge reinbekommen heute morgen. Die Arbeit muss so schnell wie möglich verteilt werden. Um zwölf treff’ ich mich mit ein paar von meinen Leuten zu ’ner Sitzung.“
„Schon gut, Schatz“, sagte Karin, „ich lass mir was einfallen. Hals dir bloß nicht zu viel auf, hörst du?“ Sie hauchte einen Kuss in die Leitung und legte auf.
Benno betrachtete ihr weiches, fast mütterlich lächelndes Gesicht auf dem Foto neben dem Telefon. Karin war die ideale Frau für einen Workaholic, wie er einer war. Sie würde eher die Nacht durcharbeiten, als ihn gegen seinen Willen einzuspannen. Ganz davon abgesehen, dass er sich nicht gegen seinen Willen zu irgendetwas einspannen ließ.
Seit er die Firma gegründet hatte, war sie doppelt bemüht, jede private Verpflichtung von ihm fernzuhalten. Und dann ihr soziales und kirchliches Engagement. Benno hatte selten eine Frau mit solch hohen ethischen Maßstäben kennengelernt. Er konnte ihr bedingungslos vertrauen. Und was noch wichtiger war: Sie vertraute ihm bedingungslos.
Er zog sein Jackett über und strich sich vor dem Spiegel über das dichte Haar. Einen Augenblick verharrte er regungslos, als würde er in sich lauschen. Keine Spur von schlechtem Gewissen. Er grinste sich aus dem Spiegel entgegen. Ein Blick auf die Uhr: Viertel vor zwölf. Höchste Zeit!
„Ich bin jetzt anderthalb Stunden nicht erreichbar“, sagte er zu seiner Sekretärin. „Ein Essen mit einem wichtigen Kunden. Da möchte ich nicht gestört werden. Nehmen Sie eventuelle Anrufe auf, ich rufe ab vierzehn Uhr zurück.“ Fünf Minuten später saß er in seinem blauen BMW-Roadster und steuerte den Stadtwald an.
An einer Kreuzung sprang die Ampel auf Gelb. Statt zu bremsen beschleunigte Benno. Rechts, am Straßenrand, sah er einen schwarzen Schatten. Er erschrak und trat auf die Bremse. Etwas schlug dumpf von unten gegen das Auto. Mitten auf der Kreuzung kam der Sportwagen zum Stehen.
Benno stieg aus. Zehn Schritte hinter seinem Wagen zuckte eine schwarze Katze auf der Straße. „Scheiße!“ Kurz darauf regte sich das Tier nicht mehr. Er fasste es am Schwanz und trug es an den Straßenrand. Ein ungutes Gefühl beschlich ihn, als er weiterfuhr. Wenn heute morgen nicht dieser lukrative Auftrag hereingekommen wäre, hätte er gesagt: Die Woche fängt schlecht an. So atmete er nur tief durch, schüttelte unwillig den Kopf und murmelte: „Kann passieren.“ Doch immer, wenn er sich später an diese schlimme Woche erinnern würde, sollte ihm als erstes die tote Katze einfallen.
Bald erreichte er den Stadtwald. Marions roter Polo wartete schon auf dem Waldparkplatz. Er hielt neben ihr, stieg aus und öffnete die Beifahrertür ihres Wagens. Im Polo war mehr Platz als in seinem Zweisitzer.
Kaum hatte er sich auf den Beifahrersitz fallen gelassen, hing sie schon an seinen Lippen und küsste ihn leidenschaftlich.
3
Alexandra hatte einen anstrengenden Wochenenddienst hinter sich. Mittags, im Ärztekasino, registrierte sie erst, dass es inzwischen Montag geworden war: Rouladen mit Speckbohnen, Kartoffelpüree und zum Nachtisch Schokoladenpudding. Das war ein obligatorisches Montagessen. Alle vierzehn Tage gab es dieses Menü im Kasino. Es gab Tage mit schlechterem Essen.
Während Mariechen Brückmann ihr den Teller füllte, sah Alexandra auf die große Wanduhr über der Casinotür: Kurz vor halb eins. In etwas mehr als einer Stunde würden Clemens Stellmacher und sein Team sie ablösen. Sie freute sich darauf, einen halben Tag lang etwas anderes zu sehen als OP-Tische, den Behandlungsraum im Notarztwagen und die roten Jacken ihrer Sanitäter.
Sie nahm ihr Tablett und wandte sich den Tischen zu. Gleich am nächststehenden entdeckte sie ein bekanntes Gesicht – Dr. Jasir Molani. Der sympathische Perser arbeitete seit dem letzten Herbst auf der Chirurgie. Alexandra kannte niemanden, der ihn nicht schätzte. Mit seiner offenen, hilfsbereiten Art, die so gar nichts Dünkelhaftes an sich hatte, stand er in der inoffiziellen Beliebtheitsskala des Marien-Krankenhauses ganz oben. Auch Alexandra mochte ihn.
„Hallo, Herr Kollege, darf ich?“
„Aber bitte, Frau Heinze, nehmen Sie Platz.“
Alexandra setzte sich. „Das OP-Programm schon beendet?“
Er nickte. „War nichts Großes heute. Einen guten Appetit.“ Schweigend aßen sie eine Zeitlang. Dann sagte er: „Wann dürfen wir Sie heute Abend erwarten?“
Alexandra ließ sich ihren Schreck nicht anmerken. Natürlich! Sie waren ja für den Abend zu den Molanis eingeladen! Durch den Wochenendstress war ihr die Verabredung völlig untergegangen. „Ist Ihnen acht Uhr recht?“
„Selbstverständlich“, nickte Molani, und Alexandra überlegte, wo sie auf dem Nachhauseweg ein passendes Gastgeschenk besorgen könnte. Und Werner musste sie anrufen! Nicht, dass er die Verabredung auch vergessen hatte!
Ihr Teller war kaum leer, als ihr Piepser losschrillte. Die Nummer der Ambulanz erschien auf dem Display. Das nächste Telefon stand auf dem Fensterbrett. „Frau Dr. Heinze, bitte kommen Sie schnell in die Ambulanz!“ Sonja Fischer war am Apparat. „Eine Rasenmäherverletzung!“
Alexandra winkte Dr. Molani zu und verließ das Kasino. Ein Rasenmäherunfall Anfang September! Das war eigentlich eine typische Sommerverletzung. Und zwar eine von der scheußlicheren Sorte.
Lautes Stöhnen empfing sie in der Ambulanz. Die untersetzte Gestalt Fritz Hombergs beugte sich über das Fußende des Behandlungstisches. Das Gesicht des Patienten war schmerzverzerrt.
„O Gott, o Gott“, stöhnte er ständig. Alexandra begrüßte ihn mit einem Kopfnicken. Der große, hagere Mann trug zerrissene Jeans und lange, graue Haare. Alexandra schätzte ihn auf Mitte vierzig.
Am linken Hosenbein war die Jeans bis über das Knie aufgeschnitten. Schwester Sonia trug eben einen zerfetzten und blutigen Turnschuh zum Abfalleimer. „Wir mussten das Bein betäuben, um den Schuh ausziehen zu können“, sagte Dr. Fritz Homberg und gab den Blick auf den verletzten Fuß frei. Die Großzehe war völlig zerfetzt, die anderen Zehen bluteten stark.
Alexandra sah wieder den stöhnenden Mann an. Wenn das Bein betäubt war, konnte er eigentlich keine Schmerzen haben. Er war kaltschweißig und leichenblass. „Ist Ihnen schlecht?“ Er nickte.
Sonia legte ihm eine Blutdruckmanschette um, und Alexandra schob ihm eine Nadel in die Armbeuge. Der Mann musste dringend eine Infusion haben. Sein Kreislauf schien kurz vor dem Kollaps zu stehen.
„Ein Krankenwagen hat ihn gebracht“, sagte Homberg. „Ich dachte immer, Biobauern würden nicht mit dem Rasenmäher hantieren, Herr Schwinger“, sprach er den Verletzten an.
„Ich hab ein Rattennest unter dem Hühnerstall entdeckt, und eine wollte mich angreifen und da habe ich …“
„Ach, du Schande“, stöhnte Alexandra jetzt. „Bitte erzählen Sie nicht weiter.“
Die Wunde war so verschmutzt, wie Alexandra es von dieser Art Verletzung gewohnt war. Gemeinsam mit ihrem Kollegen reinigten sie die Zehen mit Wasserstoffsuperoxyd, schnitten das zerstörte Gewebe von den Wundrändern, und nähten die große Zehe so gut zusammen, wie es eben ging.
Sonia trug eine antibakterielle Salbe auf die sterile Kompresse, bevor sie damit die zugenähte Wunde abdeckte. „Und jetzt fahren wir sie in die Röntgenabteilung“, sagte Homberg, „wahrscheinlich ist der Zeh gebrochen.“
„Ich muss doch nach Hause“, jammerte der Mann.
„Wir werden Sie ein paar Tage hierbehalten, Herr Schwinger“, brachte Alexandra dem Bauern so schonend wie möglich bei, „solche Wunden entzünden sich normalerweise. Wir werden sie im Auge behalten und mit Antibiotikum behandeln müssen.“
Der Mann protestierte heftig. Aber Homberg ließ sich auf keine Diskussion ein, und Alexandra schilderte ihm die zwei schlimmsten Rasenmäherverletzungen, die ihr spontan einfielen. Wahrscheinlich, weil beide mit einer Zehenamputation geendet hatten. Der Patient gab seinen Widerstand auf.
Kurz darauf verließ Alexandra die Klinik. Im Krankenhausgarten blieb sie einen Augenblick stehen und atmete tief die milde Spätsommerluft ein. Sie zwang sich, den hektischen Schritt abzulegen, mit dem sie den ganzen Vormittag zwischen Notarztwagen, Bereitschaftszimmer und Ambulanz hin und her gehetzt war. Bewusst langsam ging sie zum Parkplatz. Als sie eine halbe Stunde später eine Kunstgewerbe-Handlung betrat, in deren Schaufenster sie einen wunderschönen Kerzenhalter entdeckt hatte, dachte sie nicht mehr an die Klinik. Nicht mal an die Rasenmäherverletzung.
4
„Bitte erheben Sie sich.“ Der Richter stand auf und nahm das Dokument vom Schreibtisch in beide Hände, als bräuchte er etwas, woran er sich festhalten musste. Auch Tenninger, seine Frau und ihre Anwälte standen auf. „Im Namen des Volkes ergeht in der Sache Tenninger gegen Tenninger folgendes Urteil …“
Michael Tenninger fühlte sich innerlich wie betäubt. Als wäre er nur Schein zum anwesend, als wäre das alles nur ein Theaterstück, in dem er zwar eine Rolle spielte – okay, das schon – aber das ihn im Grunde gar nichts anging.
Oder hatte das tatsächlich mit ihm zu tun, dass der Richter gerade die Scheidung von Tina und Michael Tenninger aussprach? Eine Scheidung, die er nie gewollt hatte? Und diese horrende Summe, die er monatlich an Unterhalt für Tina und die beiden Kinder bezahlen sollte, hatte die etwas mit ihm zu tun? Und dass sein Anwalt schon seit Beginn der Verhandlung hartnäckig jeden Blickkontakt mit ihm vermied, hatte das etwas für ihn zu bedeuteten?
Plötzlich begriff er, wie sehr ihn das alles anging. Denn eben sah ihn Tina triumphierend an, und die Art und Weise, wie der Richter ihn musterte, hatte etwas von der Art und Weise, wie Derrick im Fernsehen immer guckte, wenn er irgendeinem armen Schwein mitteilen musste, dass Frau, Mann, Sohn oder Tochter leider ermordet worden waren.
Okay – das Leben kann einem nicht jeden Tag einen Lottogewinn bescheren, aber selbst Michael Tenninger, der sich für einen harten Knochen hielt, konnte nur ein begrenztes Maß an Unglück vertragen. Sogar das Haus sprach der Richter Tina zu. Was zu viel war, war zu viel.
„Eine Schweinerei ist das!“ War er das, der da so losbrüllte? „Soll ich unter der Brücke schlafen, oder was?“ Das Gesicht des Richters nahm einen erschrockenen Ausdruck an. „Soll ich jetzt betteln gehen, verflucht?“ Mit drei kurzen Schritten war Tenninger vor dem Schreibtisch des Richters. „Ich hab Sie was gefragt, Sie …“ Er spürte, wie sein Anwalt ihn am Arm packte. „Habe ich Ihnen nicht gesagt, dass meine Firma bankrott gegangen ist, oder was?“ Hinter sich hörte er, wie die Tür geöffnet wurde. „So was müssen Sie doch in Ihrem gottverdammten Urteil berücksichtigen!“ Der Richter konnte gerade noch ausweichen, sonst hätte Tenninger ihn am Kragen gepackt.
Hinter sich hörte er zwar Schritte, aber Tenninger sah nur noch rot und trommelte mit beiden Fäusten auf den Schreibtisch. Starke Arme packten ihn und rissen ihn zurück. Der Anblick der beiden Ordnungsbeamten ernüchterte ihn.
Für einige Augenblicke sagte keiner ein Wort. Jeder schien den Atem anzuhalten. Dann redeten alle durcheinander. „Reißen Sie sich zusammen, Mann“, zischte ihm sein Anwalt ins Ohr.
„Glauben Sie jetzt, dass er mich geschlagen hat?“, kreischte Tina.
„Ich werde mir überlegen, ob ich Ihnen dafür ein Strafverfahren anhänge, Herr Tenninger.“ Der Richter sprach stoßartig und heiser, fast krächzend, als hätte er Sand in der Kehle.
„Kommen Sie“, rief einer der Beamten. Widerstandslos ließ er sich hinausziehen. Sie brachten ihn bis vor die große, gläserne Eingangstür des Amtsgerichtes.
Dort blieb er ein paar Minuten stehen. Kopfschüttelnd und mit sich selbst sprechend. „Das gibt’s doch gar nicht! Das gibt’s doch gar nicht!“ Einen Moment blickte er zurück in das Gerichtsgebäude. Sollte er auf Tina warten und sie ordentlich verprügeln? Doch die Wut wich schnell einer lähmenden Resignation. Tenninger machte kehrt und verschwand in einer Seitengasse.
Er steuerte die Rheinpromenade an, lief am Fluss entlang, als wäre jemand hinter ihm her und setzte sich endlich auf eine Bank, die etwas versteckt in einem kleinen Park zwischen zwei Holunderbüschen stand. Dort rauchte er ungefähr eine halbe Schachtel Zigaretten.
Wieder dieses Gefühl von Leere und innerer Betäubung. Als würde nur seine Hülle hier auf der Bank sitzen und eine nach der anderen rauchen. Es gelang ihm nicht, irgendeinen klaren Gedanken zu fassen. Wut, Resignation und Angst spielten ihr wildes Fangspiel in seinem Bauch.
Irgendwann zog er seine Brieftasche heraus und zählte sein Geld: Fünfundachtzig Mark und ein paar Pfennige. In seinem Hotelzimmer, für das er die Miete schon seit zwei Wochen schuldig war, hatte er noch zwei oder drei Hunderter deponiert. Mal sehen – vielleicht würde er auch in dem einen oder anderen Jackett noch ein paar Scheinchen finden.
Er hatte plötzlich das dringende Bedürfnis, sich maßlos zu betrinken. Und wenn ihn dieses Bedürfnis überfiel, kam es schon mal vor, dass fünfundachtzig Mark nicht ganz ausreichten. Das Hotel lag auf der anderen Seite der Stadt. Viel zu weit weg. Also musste er eine Bank aufsuchen.
Er sah auf die Uhr. Schon nach fünf. Nun gut – wozu gab es Geldautomaten? Tenninger stand auf und machte sich auf den Weg in die Innenstadt. Vor dem Geldautomaten einer Filiale seiner Bank zückte er die Scheckkarte, steckte sie in den Schlitz und gab seine Geheimnummer ein. Ungeduldig stierte er in das Display, das ihm die Bearbeitung seines Auftrages in Aussicht stellte. Doch statt des erwarteten Wahlmenüs für die Geldsumme erschien eine Mitteilung auf dem Bildschirm, die ihm für einen Augenblick den Atem verschlug: Soll DM dreizehntausend-zweihundersiebzehn, und der zur Verfügung stehende Betrag ist überschritten. Wenden Sie sich bitte an einen unserer Mitarbeiter. Fluchend wandte er sich ab.
5
Marion bog in die letzte Straße der Neubausiedlung ein. Sie fühlte sich aufgekratzt. Ein Gedanke an das Rendezvous mit Benno reichte, um ihren ganzen Körper erneut in Wallung zu bringen.
Sie fuhr in die Garteneinfahrt des vorletzten Hauses vor dem Waldrand und parkte den Polo in der zweiten Garage. Durch den Garten ging sie hinüber auf das Grundstück von Benno und Karin. Einige Blätter schwebten aus den Buchen des Laubwaldes in den Garten herunter. Aber das nahm sie nicht wahr.
„Hallo Marion“, begrüßte Karin sie durch die offenen Trassentür. Am Wintergarten vorbei ging Marion ins Haus. Sie umarmten sich. Die ersten Schuldgefühle bohrten sich feinen Nadelstichen gleich in Marions Eingeweide. Doch sie hatte sich inzwischen an das Theater Karin gegenüber gewöhnt. Als sie zum ersten Mal mit Benno geschlafen und Karin einen Tag später umarmt hatte, war ihr fast das Herz stehen geblieben vor Scham.
„Was machen die Kinder?“, erkundigte sie sich und versuchte, ihre Stimme so unbeteiligt wie möglich klingen zu lassen. Das fiel ihr nicht besonders schwer. Einmal wirkte sie nach außen hin sowie eher kühl, fast herb – sie war an der Nordseeküste aufgewachsen – und zum anderen war sie schon immer eine gute Schauspielerin gewesen.
„Alles bestens.“ Karin ging ihr voran in das große Wohnzimmer der Villa. „Hocken alle im Spielzimmer und spielen Das verrückte Labyrinth.“
Karin war eine große Frau mit weichen und runden Körperformen. Zwei Jahre älter als die blonde, hagere Marion, sah sie doch jünger als vierunddreißig aus. Das Haar trug sie kurz und mahagonirot gefärbt, in ihrem freundlichen Gesicht saß eine kleine Stupsnase, die dem fast mütterlichen Ausdruck etwas Freches, Jungenhaftes gaben.
Sie wies auf einen Sessel und ging in die Küche, um Kaffeebecher zu holen. „Ich hatte Lisa für eine Stunde engagiert, weil ich noch etwas besorgen musste.“ Lisa war ein Teenager aus der Nachbarschaft, den auch Marion ab und zu als Babysitter anstellte. Karin kam mit der Kaffeekanne und zwei Bechern ins Wohnzimmer zurück. „Du weißt doch – ich stecke gerade mitten in den Vorbereitungen des Gemeindenachmittags. Kommst du auch?“
„Das ist am Freitag, nicht wahr?“ Karin bestätigte. „Da muss ich ausnahmsweise auch nachmittags in die Bank. Lisa wird die Kinder betreuen.“
Marion war dankbar für den Gemeindenachmittag, auf dem das zehnjährige Bestehen des Kindergartens gefeiert werden sollte. Lisa, das Mädchen aus der Nachbarschaft, würde mit den Zwillingen zum Fest gehen. Karin war den ganzen Nachmittag dort engagiert, und Jasir würde gar nicht nach Hause kommen, weil er von Freitag auf Samstag Nachtdienst hatte. Sie und Benno würden das ganze Haus für sich haben …
„Und was sagt der Gynäkologe?“, wollte Karin wissen.
„Eine leichte Entzündung des Muttermundes. Nicht schlimm.“ Marion winkte ab. „Er hat mir eine Salbe verordnet.“ Die Salbe hatte sie bereits letzte Woche in einer Apotheke gekauft. Sie tranken Kaffee, plauderten ein bisschen und schauten nach den Kindern.
Gegen vier sahen sie Bennos BMW in den Hof fahren. Marions Herz schlug schneller. Auch er betrat das Wohnzimmer durch die Terrassentür neben dem Wintergarten. „Nanu, Liebster – schon Feierabend?“
Er beugte sich zu Karins Sessel hinunter und küsste sie auf die Stirn. Die Schuldgefühle in Marions Bauch bohrten heftiger.
„I wo, Herzblatt“, sagte er leichthin, „ich will nur eine Kleinigkeit essen und mich mal eben den Kindern zeigen, damit sie mich nicht ganz vergessen.“ Er reichte Marion die Hand. „Hallo, Frau Nachbarin – wie stehen die Aktien?“
Marion drückte die warme, sehnige Hand, die sie noch vor zwei Stunden auf ihrem Körper gespürt hatte. „Selten gut“, antwortete sie.
Auch diese Situation war nichts besonderes mehr für sie beide. Schließlich sahen sie sich fast täglich auch ganz offiziell und taten so, als wären sie weiter nichts als Nachbarn und gute Freunde. Während Karin ihren Mann in ein Gespräch verwickelte, zog sich Marion langsam zurück. Sie ging die Treppe hoch, um ihre Kinder aus dem Spielzimmer abzuholen. Sie wollte nach Hause.
„Nur das Spiel noch, Mami“, rief Kian.
„Nur das Spiel noch!“, wiederholte Ulan wie das Echo seines Bruders. Beide Jungen hatten das schwarze Haar und die bronzene Haut ihres Vaters. Marion ließ sie gewähren und setzte sich hinter ihre Söhne auf den Boden.
Sie sah sich um. In diesem Zimmer war es geschehen. Es war ein kalter Winterabend Ende Januar, Anfang Februar gewesen. Sie hatte die drei kleinen Mayenfelds gehütet, während Benno seine Frau auf irgendein Wochenendseminar in die Eifel gefahren hatte. Jasir hatte Nachtdienst an diesem Abend. Es hatte geschneit, und Benno war sehr spät zurückgekommen. Sie war gerade beim Aufräumen gewesen, hier, in diesem Zimmer. Er hatte ihr geholfen. Danach hatten sie noch ein Glas Rotwein getrunken und sich Dinge voneinander erzählt, die man nur wenigen Menschen anvertraut. Irgendwann hatten sich ihre Hände berührt, und dann war alles sehr schnell gegangen.
„Noch ein Spiel!“, krähte Karins Jüngste.
„Nein, nein.“ Marion stand auf. „Wir gehen jetzt.“ Unten an der Treppe wollte sie sich von Benno und Karin verabschieden.
„Nächste Woche bin ich übrigens für zwei Tage in Dortmund“, hörte sie Benno sagen. Sie spürte genau, dass dieser Satz vor allem für ihre Ohren bestimmt war. Sie hatte extra eine alte Schulfreundin im Ruhrgebiet erfunden, die sie immer dann besuchte, wenn Benno in der Gegend zu tun hatte. Ohne Kinder natürlich. Nächste Woche würde sie diese Freundin also wieder besuchen.
6
Natürlich hatte Alexandra vergessen, Werner noch einmal an die Einladung für den Abend zu erinnern. Durch den armen Biobauern mit seiner zerfleischten Großzehe war ihr dieser Vorsatz vollkommen entfallen. Und dann war sie doch noch länger in der Stadt geblieben als geplant, hatte eine Freundin getroffen und kam schließlich erst gegen sechs in die Beethovenstraße.
Werner fiel aus allen Wolken, als er aus der Praxis kam, und Alexandra ihm das Abendprogramm eröffnete. „Scheiße!“ Er schlug sich an die Stirn. Alexandra zog missbilligend die Augenbrauen hoch. „Schön, wollte ich natürlich sagen“, korrigierte Werner sich.
„Das möchte ich dir auch geraten haben“, sagte Alexandra mit gespielter Strenge. „Der Kollege Molani ist der netteste Mann im ganzen Marien-Krankenhaus.“ Sie war jedes Mal froh, wenn sie ihren Mann bewegen konnte, etwas mit ihr zu unternehmen. Meistens war er nach einem Praxistag viel zu müde dazu.
„Hoppla“, eine skeptische Falte erschien zwischen Werners Brauen, „das klingt ja gefährlich. Den Mann sollte ich mir wohl wirklich mal ansehen.“
Fünf Minuten später rief er aus der Dusche: „Wir können gar nicht ausgehen heute Abend, Alexandra!“
„Wieso nicht?“, antwortete sie mit einem Stimmvolumen, das Werner nahelegen sollte, sich seine Antwort sehr genau zu überlegen.
„Meine Mutter hat in der Praxis angerufen und gefragt, ob wir sie bräuchten heute Abend!“
„Na und?“ Alexandra begriff nicht, worauf er hinauswollte.
„Ich sagte nein, und jetzt ist sie zum Kegeln gegangen.“
„Würdest du mir bitte erklären, was das mit unserer Einladung …“, Alexandra unterbrach, verdrehte die Augen und fasste sich an die Stirn. „Ach, du Schande – der Hund!“
Werner kam aus dem Bad. Er hatte ein Badetuch um seinen Körper gewickelt und strahlte. „Wir können Anuschka unmöglich allein lassen. Und mitnehmen können wir das Vieh schon gar nicht. Schade, nicht wahr?“
Alexandra schluckte eine unfreundliche Bemerkung hinunter und verschwand in der Küche. Kurz darauf erschien sie mit dem Handy im Schlafzimmer, wo Werner sich pfeifend anzog. „Du darfst dich freuen – wir können doch ausgehen heute Abend“, sagte sie mit einem spitzbübischen Grinsen.“
„Und Anuschka?“
„Ich habe gerade bei Molanis angerufen. Der Kollege freut sich sehr, auch unseren kleinen Hund kennenzulernen.“
„Na, da fällt mir aber ein Stein vom Herzen“, sagte Werner säuerlich, „ich dachte schon, ich müsste den ganzen Abend die Beine auf den Tisch legen, Fußball gucken und mir von dir den Nacken kraulen lassen. Sicher hast du den Leuten wahrheitsgemäß erzählt, was für ein schwarzes Riesenmonster wir ihnen heute ins Haus schleppen werden.“ Statt einer Antwort erhielt er einen Boxer in die Rippen.
Zwei Stunden später – Alexandra saß schon im Auto – hielt Werner der Dogge die hintere Wagentür auf. „Steig ein, Mädchen, wir sind eingeladen.“ Er schlug die Tür zu, setzte sich auf den Fahrersitz und drehte sich zu dem riesigen Hund um. „Der Kollege Molani freut sich sehr, unseren kleinen Hund kennenzulernen, weißt du?“
7
Michael Tenninger hatte sich eine warme Mahlzeit gegönnt. Es war gegen acht Uhr, und er goss eben den letzten Schluck seines elften oder zwölften Bieres in sich hinein. Vielleicht waren es auch mehr. So genau wusste er das nicht mehr.
Er hockte in der hintersten Ecke einer kleinen Pinte, die von einem ehemaligen Fernfahrer namens Kurt betrieben wurde. Den Nachnamen des dickleibigen Wirtes hatte Tenninger noch nie gehört. An der holzverkleideten Wand hingen vergrößerte Fotos von Lastzügen, eine Gitarre, Bilder von John Wayne, von Johnny Cash und anderen Countrysängern, deren Namen Tenninger nicht kannte. An der Decke über der Theke war eine riesige US-Flagge befestigt.
Von seinem Platz aus konnte er die dicht bevölkerte Theke beobachten, wo sich von Stunde zu Stunde mehr Gäste versammelten. Fast ausschließlich Männer.
Einige kannte er näher als nur flüchtig, weil er öfter in dieser Kneipe verkehrte. Die meisten waren LKW-Fahrer, die zu einer Art Country-Club gehörten, in dem man von Zeit zu Zeit zur Gitarre sang und ein bisschen amerikanische Trucker-Romantik beschwor.
Drei der Männer traf man jeden Abend in Kurts Kneipe – abgehalfterte Frührentner, die hierher kamen, um ihren Frust in Unmengen von Bier zu ertränken. Es waren genau die drei, die um diese Zeit schon Mühe hatten, von der Theke zur Toilette oder zum Zigarettenautomaten zu gehen, ohne zu schwanken. Zusammengesunken hingen sie auf ihren Barhockern oder klammerten sich an der Theke fest.
Tenninger wusste, dass er sich heute Abend in genau dem gleichen Zustand befand wie diese drei Männer: Betrunken, ohne Zukunftsperspektiven und völlig überflüssig in dieser Scheißwelt. Er dachte daran, wie er hier bis vor Kurzem Lokalrunden ausgegeben hatte, wie man ihn mit großem Hallo begrüßte, und natürlich keine Gelegenheit ausließ, ihn anzupumpen – ihn, den Unternehmer, den Besitzer einer Spielhallenkette, den Porschefahrer und Hauseigentümer, der mit Anfang dreißig kurz vor seiner ersten Million stand. Und nun war nichts mehr übrig davon – nichts. Kalte Angst kroch ihm den Rücken herauf. Angst, in absehbarer Zeit selbst Abend für Abend an so einer Theke zu hängen und sein bisschen Leben zu versaufen.
„Noch’n Bier, Mike?“ Gerda, Kurts Frau, stand plötzlich an seinem Tisch. Zwanzig Jahre jünger als Kurt und spindeldürr, höchstens ein Viertel ihres Mannes, den sie wahrscheinlich in Ermangelung eines Vaters geheiratet hatte. Tenninger nahm an, dass sie krank war. Er hatte mal was von einer psychischen Krankheit gelesen, bei der Frauen sich zu Tode hungerten. Er nickte, und Gerda tänzelte mit seinem leeren Bierglas zur Theke zurück.
Es war natürlich Quatsch, noch ein Bier zu trinken. Aber er hatte längst die Schwelle überschritten, vor der er sich noch unter Kontrolle hatte. Er wollte nichts mehr spüren müssen, nichts mehr denken müssen, sich an nichts mehr erinnern müssen. Er wollte trinken, trinken, trinken. Obwohl er genau wusste, dass der Suff ihm seinen Zustand noch aussichtsloser erscheinen lassen würde.
Gerda kam mit dem Bier zurück und stellte es vor ihn hin. „Es geht dir nicht gut, Mike – stimmt’s?“ Wäre sie ein Mann gewesen, hätte er laut gelacht und behauptet, dass es ihm gar nicht besser gehen könnte. Aber sie war eine Frau, sie war Gerda, eine kindliche, vielleicht sogar kranke Frau, die schon manches Mal, wenn er sie auf ein blaues Auge oder eine aufgeplatzte Lippe angesprochen hatte, ihr Herz bei ihm ausgeschüttet hatte. Deswegen senkte Tenninger nur den Blick und sagte gar nichts.
„Scheidungstermin?“ Gerda setzte sich ihm gegenüber an seinen Tisch.
Er nickte. „Heute.“ Seine Zunge gehorchte nur noch widerstrebend.
„Und die Firma ist am Arsch?“ Sie sprach vorsichtig, als hätte sie Angst, ihn zu verletzen.
„Bankrott, vor zwei Wochen. Irgendein Russe hat die Spielhallen übernommen.“
„Armer Mike“, sie berührte ihn zaghaft und ganz kurz an der Hand. Tenninger sah, dass Kurt von der Theke aus zu ihnen herüberspähte. Obwohl Gerda das unmöglich sehen konnte, zog sie die Schultern hoch. „So weit ist es schon, dass sie die Blicke ihres Alten spürt“, dachte Tenninger.
„Alles Scheiße“, lallte er. „Das Haus ist weg, und einen Wahnsinnsunterhalt muss ich zahlen.“ Er erzählte von der Verhandlung. Er erzählte von seinem Porsche, den er verkaufen musste, um die Gehälter seiner Mitarbeiter wenigstens teilweise auszahlen zu können. Er erzählte von der Botschaft, die ihm das Display des Geldautomaten vor wenigen Stunden aufs Auge gedrückt hatte.
Gerda nickte nur und schwieg. Er war ihr dankbar dafür.
„He, Gerda!“ Von der Theke her versuchte Kurt die laute Musik zu überbrüllen. „Hier sind Gäste, verdammt noch mal! Quatschen is’ jetzt nich!“
Gerda zuckte zusammen. „Kannst anschreiben lassen.“ Ein scheues Lächeln huschte über ihr mädchenhaftes Gesicht. Sie stand auf und eilte in Richtung Theke davon. Tenninger sah ihr nach. Er wusste genau, dass Kurt seiner Frau ein Szene machen würde, wenn er erfuhr, dass sie nicht bar abkassiert hatte bei ihm. Unter Umständen eine sehr schmerzhafte Szene. Plötzlich war ihm zum Heulen zumute. Er wankte zur Toilette, schloss sich ein, und zerdrückte ein paar Tränen. Das war ihm schon seit Jahren nicht mehr passiert. Ach was – seit Jahrhunderten!
Als er die WC-Tür wieder öffnete, betrat einer der beiden volltrunkenen Frührentner die Toilette. Lallend und schwer atmend torkelte der höchstens zehn Jahre ältere Mann auf eines der Pissoirs zu. Im Spiegel über dem Waschbecken beobachtete Tenninger, wie der Mann mit der Rechten seinen schwankenden Körper gegen die Kachelwand stützte und mit der linken versuchte, ins Pissoir zu zielen. Es gelang ihm nicht.
Ekel stieg in Tenninger hoch. Er trocknete sich die Hände ab und riss die Toilettentür auf. Plötzlich hörte er hinter sich einen dumpfen Schlag. Er fuhr herum – der Betrunkene war gegen die Holzwand der WC-Kabine getorkelt und lang auf die Fliesen hingeschlagen. Panik erfasste Tenninger. Er eilte zurück in den Gastraum, griff sich seine Jacke und schob der verblüfften Gerda einen Fünfzigmarkschein über die Theke. Fluchtartig verließ er die Pinte.
Als er fast eine Stunde später den erleuchteten Eingangsbereich seines Hotels sah, wusste er nicht mehr, wie er dorthin gekommen war. Er wusste nur, dass er nicht so enden wollte, wie der jämmerliche Kerl unter den Pissoirs in Kurts Kneipe. Lieber wollte er sterben. So betrunken er war, fasste er an diesem Abend einen Entschluss. Er würde sich von den zwei oder drei Hundertern, die er noch irgendwo in seinem Koffer versteckt hielt, eine Waffe kaufen. Eine Pistole. Keine gute, keine große. Aber gut genug und groß genug, um sich ein Loch in den Schädel zu schießen.
8
„Eine Entzündung des Muttermundes“, sagte Marion. „Nichts Besonderes. Aber der Arzt hat mir eine Salbe verschrieben.“ Sie stand auf und half Jasir, das Abendessen abzuräumen. „Und wir sollen uns die nächsten zwei Wochen zurückhalten.“
Sie hielt seinem Blick stand. Er stellte die Teller auf die Spüle, lachte und nahm sie in den Arm. „Wir haben eine Schwangerschaft überstanden“, er strich ihr liebevoll über das lange Blondhaar. „Wir werden auch diese zwei Wochen überstehen.“
Das Schuldgefühl zuckte ihr plötzlich bis in den Hals hinauf und schnürte ihr die Kehle zu. Zum ersten Mal kam ihr der Gedanke, dass dieses Doppelleben eine Menge Kraft kostete. Vielleicht zu viel Kraft? Und sie dachte daran, dass sie ja von Benno schwanger werden könnte. Und wie würde sie das Jasir erklären, wenn sie zwei Wochen nicht mit ihm schlief?
„Quatsch“, dachte sie und wandte sich von Jasir ab, damit er ihr Gesicht nicht sehen konnte. „Du hast eine Spirale, du misst deine Temperatur – was soll da passieren?“
„Ich habe ein paar Flaschen italienischen Rotwein gekauft“, sagte Jasir, „und ein bisschen was zum Knabbern.“
„Und ich habe Baguette besorgt und Camembert.“ Marion holte den Käse aus dem Kühlschrank. Während sie den Käseteller vorbereitete, schnitt Jasir das Weißbrot auf. „Ich werde übrigens nächste Woche mal für einen Tag nach Dortmund fahren und Cornelia besuchen.“ Marion teilte das so beiläufig wie möglich mit.
„Tu das, Liebste.“ Wahrscheinlich würde er nicht anders reagieren, wenn sie ihm mitteilen würde, dass sie einen Wochenendbesuch in New York gebucht hatte. „Hat deine Freundin sich gemeldet?“
„Ja, sie hat angerufen“, erzählte Marion. „Sie ist gerade von einer Asienreise zurückgekommen und überlegt sich nun, ob sie die Stelle wechseln soll. Ihr Chef hat ihr einen Heiratsantrag gemacht, und sie hat abgelehnt. Seitdem hat sie nichts mehr zu lachen in ihrem Büro.“ Im Dichten war Marion schon immer großartig gewesen. Als Kind hatte sie ihren beiden jüngeren Brüdern immer Gute-Nacht-Geschichten erzählt, die sie spontan erfunden hatte.
„So, so“, grinste Jasir, „will sie uns denn nicht mal besuchen?“
„Ich hoffe schon“, sagte Marion, „ich habe sie jedenfalls eingeladen.“
„Übrigens: Die Heinzes bringen ihren Hund mit!“, sagte Jasir. „Die Schwiegermutter von Frau Heinze hatte wohl heute Abend keine Zeit, sich um das Tier zu kümmern.“
„Oh, bitte nicht!“, rief Marion entsetzt aus. „Du weißt doch, dass ich Hunde verabscheue!“
„Tut mir leid, Liebste!“ Jasir zuckte entschuldigend mit den Schultern. „Hätte ich die Leute deswegen wieder ausladen sollen? Mach dir keine Sorgen, der Hund wird irgendwo unter dem Tisch schlafen, und wir werden gar nicht merken, dass er da ist.“
„Ist es denn ein großer Hund?“, erkundigte Marion sich besorgt. Seit sie als kleines Mädchen einmal von einem Riesenschnauzer angefallen worden war, wechselte sie meistens die Straßenseite, wenn ihr ein Hund entgegenkam.“
„Nein, nein“, beschwichtigte Jasir, „ein ganz kleiner, wenn ich Frau Heinze richtig verstanden habe.“ Er wusste zwar, dass Heinzes eine Dogge hatte, hatte aber keine rechte Vorstellung von dieser Hunderasse. Der Wunsch, seine Frau zu beruhigen, war größer als sein Bedürfnis nach Genauigkeit. Hierin war er ganz Orientale. Und mit dieser Schwäche hatte er Marion schon mehr als einmal auf die Palme gebracht.
Kurz nach acht Uhr klingelte es. Jasir ging an die Tür. Die beiden Jungen kamen die Treppe herunter galoppiert. Das taten sie immer, wenn es klingelte. Diesmal waren sie ganz besonders neugierig, denn Jasir hatte ihnen erzählt, dass ein Hund zu den Gästen gehörte.
„Herzlich willkommen, Frau Heinze!“, rief Jasir in seiner charmanten Art. Marion strich sich das Kleid glatt und setzte ein Lächeln auf, bevor sie die Küche verließ, um die Gäste zu begrüßen. Es fiel ihr geradezu aus dem Gesicht, als sie den schwarzen Hund sah: Das Tier war so groß wie ein Kalb!
Alexandra erfasste die Situation sofort. Wahrscheinlich hatte ihr Kollege seine Frau nicht genügend auf Anuschkas Anblick vorbereitet. „Keine Angst, Frau Molani“, stieß sie hastig hervor, „Anuschka ist so harmlos wie ein kleines Kind.“
Marion hatte sich schnell wieder in der Hand. Zögernd näherte sie sich und gab Alexandra und Werner die Hand. Jasir, der auch Werner schon aus der Klinik kannte, machte sie miteinander bekannt.
„Freut mich sehr“, erklärte Werner mit einem verbissenen Lächeln. Er hatte Mühe, Anuschka festzuhalten. Ganz davon abgesehen, dass ihm die Situation peinlich war. Wenn er gewusst hätte, was an diesem Abend noch alles auf ihn zukommt, hätte er wahrscheinlich sofort kehrt gemacht.
Zunächst mal passierte weiter nichts, als dass die beiden Jungen der Molanis von der Treppe aus den riesigen Hund begutachteten.
„Sie heißt Anuschka“, sagte Alexandra, „ihr könnt sie ruhig streicheln, sie ist sehr lieb und verspielt.“ Die Zwillinge wagten sich näher an die Dogge heran, und Kian begann, sie zwischen den Ohren zu kraulen.
Damit schien die etwas unangenehme Situation fürs Erste gemeistert zu sein. Werners Gesichtszüge entspannten sich deutlich, Jasir lächelte charmant, und Alexandra sagte irgendetwas Nettes über die beiden Molani-Kinder und reichte der Frau ihres Kollegen das Gastgeschenk. Marion schälte den Kerzenständer aus dem blauen Geschenkpapier, und endlich gelang es auch ihr wieder, ihre Mundpartie zu einem Lächeln zu bewegen. „Vielen Dank!“
„Kommen Sie, wir wollen uns setzten.“ Die orientalische Gastfreundschaft Jasirs entkrampfte die Atmosphäre um ein paar weitere Nuancen. Er ging voran ins Wohnzimmer, bot Plätze an und schenkte Rotwein ein.
Marion musste mit ansehen, wie das schwarze Ungetüm über ihren Wollteppichboden tappte und sich längs neben dem Glastisch niederließ. Obwohl die Dogge sich lang ausstreckte, überragten ihre Ohrenspitzen noch die Tischfläche. Die Zwillinge hockten sich neben sie und wollten gar nicht mehr aufhören, das Tier zu streicheln.
Während Marion Käse und Brot servierte, hantierte Jasir mit dem Korkenzieher herum und plauderte munter darauf los. Alexandra, die merkte, dass die Frau ihres Kollegen sich innerlich gegen die Anwesenheit Anuschkas sträubte, spielte mit dem Gedanken, dem Besuch ein frühes Ende zu bereiten. Aber Jasir plauderte so charmant und schien derart guter Dinge zu sein, dass sie es einfach nicht über das Herz brachte. Also bemühte sie sich, Marion in einen Smalltalk zu verwickeln, um sie von Anuschka abzulenken. Werner saß neben ihr. Krampfhaft hielt er die Hundeleine fest, lauerte auf jede Bewegung Anuschkas und versuchte gleichzeitig dem Gespräch zu folgen. Geradezu körperlich spürte Alexandra, wie die Laune ihres Mannes sich unaufhaltsam dem Nullpunkt näherte.
Dann ging alles sehr schnell: Sie stießen an, tranken den ersten und letzten Schluck Rotwein dieses Abends, die beiden Jungen standen auf, um nach oben in ihre Zimmer zu gehen, und Anuschka wollte ihnen hinterherlaufen. Dabei sprang sie so abrupt auf, dass der kleine Glastisch zur Couch hin umkippte, und Käseplatte, Rotwein und Weißbrot sich von einer Sekunde auf die andere auf Alexandras Kostüm, Marions Couch und Jasirs Hose wiederfanden. Werner, dem so unerwartet die Hundeleine entglitten war, perfektionierte das Unglück noch, indem er vor Schreck das Weinglas über sein Hemd, auf den Sessel und auf den Teppich leerte.
Marion stieß einen spitzen Schrei aus, schlug die Hände vors Gesicht und sprang auf. Die Dogge stand inzwischen laut bellend an der Treppe.
„Anuschka!“, brüllte Werner. Der Hund kam zurück ins Wohnzimmer gerannt und stieß dabei eine Bodenvase mit einem Sonnenblumenstrauß um. Marion wollte sich schnell in die Küche zurückziehen, was der Hund falsch verstand. Völlig falsch. Glücklich, statt der beiden Kinder nun einen anderen Spielgefährten gefunden zu haben, sprang er kläffend an Marion hoch. Wieder schrie sie, fiel rücklings auf den brüllenden Werner und stürzte mit ihm zusammen neben den umgekippten Tisch.
„Um Gottes Willen“, stöhnte Alexandra und befreite sich von Käse und Brot, um Werner zur Hilfe eilen zu können. Der war gewaltig sauer und schlug nach Anuschka aus.
„Liebste!“, rief Jasir, der nun natürlich nicht mehr charmant lächelte. Er griff nach Marions Hand und wollte sie hochziehen.
„Lass mich!“ Sie schrie hysterisch und floh heulend aus dem Zimmer. Sekunden später knallte im oberen Stockwerk eine Tür. Werner rappelte sich ebenfalls auf und griff schimpfend nach der Hundeleine. „Tut mir leid!“, bellte er an Jasir gewandt und zerrte die winselnde Anuschka hinter sich her aus dem Haus.
Alexandra und Jasir standen fassungslos vor dem Chaos. Betreten sahen sich an. „Es tut mir so leid, Herr Molani“, flüsterte Alexandra. „Es ist ganz allein meine Schuld, ich hätte den Hund niemals mitbringen dürfen!“
Jasir winkte müde ab. „Es ist meine Schuld, ich hätte Ihnen sagen sollen, dass meine Frau keine Hunde mag.“ Kopfschüttelnd bückte er sich nach der Bodenvase und den Sonnenblumen. „Gründlicher kann ein Abend wohl nicht in die Hosen gehen.“
9
Gegen acht Uhr schloss Benno sein Büro hinter sich ab. Genug für heute. Er trat in den milden Abend hinaus und sog die noch warme Luft ein. Bald würde der Sommer zu Ende sein – Grund genug, heute Abend weiter nichts mehr zu tun, als müßig auf der Terrasse zu sitzen, ein Glas Sekt zu schlürfen, und sich diesen Spätsommerabend mit seinem zauberhaften Licht auf der Zunge zergehen zu lassen.
Gut gelaunt setzte Benno sich in seinen Wagen und fuhr los. Als er den Stadtwald passierte, dachte er an die wunderbare Mittagspause mit Marion, und seine Stimmung wurde noch besser.
Marion – manchmal fragte er sich, ob es eigentlich Liebe war, was er für sie empfand. Eine Antwort hatte bisher noch nicht gefunden. Was Karin betraf, konnte er seine Gefühle genau benennen: Diese Frau liebte er mehr als alles andere auf der Welt. Bei Marion wusste er nur, dass sie ihn geradezu magisch anzog, und dass die Romanze mit ihr ihn ungeheuer belebte. Davon profitierte letztlich auch seine Frau.
Er lächelte vor sich hin. Vielleicht gehörte er ja zu den Männern, die zwei Frauen lieben können, oder mehr. Warum nicht? Jedenfalls war es gut so, wie es war. Wenn nur Jasir und Karin nichts davon mitbekamen. Benno wollte auf keinen Fall seine Ehe gefährden. Und möglichst auch nicht die gute Nachbarschaft mit Jasir.
„Es gibt so viele Möglichkeiten im Leben, so viele Möglichkeiten in der Liebe – warum soll ich nicht zwei Frauen lieben?“, dachte er. „Wenigstens eine Zeitlang.“
Vor Jasirs und Marions Haus stand ein fremder Wagen. Offenbar hatten die beiden Besuch. Benno fuhr den Roadster in eine der beiden Garagen. Als er das Garagentor schloss, hörte er lautes Hundegebell aus dem Nachbarhaus. Neugierig sah er hinüber, konnte aber niemanden sehen, obwohl die Terrassentür, die von außen direkt ins Wohnzimmer der Molanis führte, weit offen stand.
Er schloss die Haustür auf und betrat das Haus. „Hallo, Herzblatt!“, rief er. Er fand Karin im Wohnzimmer. Sie stand an der offenen Terrassentür und lauschte. Benno umarmte sie von hinten. „Da bellt ein Hund, nicht wahr?“
„Da schreit jemand“, flüsterte Karin. Angst flackerte in ihren Augen.
Jetzt hörte Benno es auch: Es war Marions Stimme. Plötzlich schrie auch eine Männerstimme. Er spurtete los. Hinter sich hörte er Karins schnelle Schritte. Durch den Garten der Molanis rannten sie direkt auf die Terrasse zu. Aus den Augenwinkel sah Benno, wie neben dem fremden Auto ein Mann mit einer riesigen Dogge erschien.
Benno erreichte die Terrasse, war mit zwei Schritten an der offenen Tür und sprang ins Wohnzimmer. Jasir und eine fremde Frau standen mitten im Zimmer und starrten ihn entgeistert an. Benno sah sich um. Einige Sonnenblumen lagen neben der großen, blauen Bodenvase, und ein riesiger feuchter Fleck breitete sich um die Vase herum aus. Der Tisch war umgekippt, auf der Couch und davor auf dem Teppich lagen Käsestückchen, Weißbrotscheiben und eine Weinflasche. Rotwein tropfte von der Couch.
„Was ist denn bei euch los?“, keuchte Karin, die inzwischen neben Benno stand.
Die fremde Frau senkte den Blick. Benno hatte den Eindruck, dass sie ein wenig rot wurde. Und Jasir sagte: „Wir hatten einen kleinen Hund zu Besuch.“
10
Zunächst schwieg Werner eisern. Sein Gesicht wirkte wie aus Stein gemeißelt. Er fuhr viel zu schnell. Anuschka kauerte mit angelegten Ohren auf der Sitzbank im Fond des Wagens und gab keinen Mucks von sich.
Vorsichtig berührte Alexandra ihren Mann am Arm. „Tut mir leid, Werner, ich hätte auf dich hören sollen!“
„Das fällt dir mal wieder zu spät ein!“, knurrte er. Sie spürte die Wut, die in ihm brodelte.
„Meinst du, unsere Versicherung bezahlt den Schaden?“ Alexandra versuchte, ihn auf sachliches Terrain zu locken. Wenn ihr das gelang, verrauchte seine Wut meistens sehr schnell.
Diesmal hatte sie Pech. „Versicherung“, äffte er sie nach, „als ob eine Versicherung so etwas wieder gut machen kann!“ Er wurde laut.
„O Gott, Werner!“ Alexandra verdrehte unwillig die Augen. „Das weiß ich selber! Aber ich kann’s ja nun nicht mehr ungeschehen machen.“
„Du hättest auf mich hören sollen, verdammt noch mal!“ Wenn er sich einmal festgebissen hatte, ließ er so schnell nicht mehr los. „Ich sage dir noch: Alexandra, wir können mit dem Hund nicht zu diesen Leuten gehen. Und was macht meine Frau? Ruft an und fragt, ob der Herr Kollege kein Interesse hätte, unseren kleinen Hund kennenzulernen!“ Er schlug auf das Lenkrad. „Das darf nicht wahr sein!“
„Jetzt hör bloß auf, mich anzuschreien!“, verbat sich Alexandra den Ton. „Da kann doch ich nichts dafür, wenn der Kollege mir verschweigt, wie empfindlich seine Frau ist! Außerdem war der Hund für dich nur ein Vorwand, weil du zu träge warst, etwas mit mir zu unternehmen!“
Jetzt platzte Werner endgültig der Kragen. „Werd bloß nicht unsachlich!“ Auf der hinteren Sitzbank hob Anuschka den Kopf und jaulte. „Sei ruhig, du blödes Vieh!“, schrie Werner.
Er schrie während der ganzen Autofahrt, und Alexandra biss kräftig zurück. Zuhause stritten sie weiter. Und da sie das selten taten – viel zu selten sagte Alexandra nach solchen Zusammenstößen immer – nutzten sie die Gelegenheit und präsentierten sich gegenseitig sämtliche offenen Rechnungen, die sich seit ihrem letzten Streit angesammelt hatten. Das waren nicht wenige.
Gegen Mitternacht verzog Werner sich ins Bett. Alexandra war so aufgekratzt, dass an Schlaf nicht zu denken war. Eine Zeitlang marschierte sie unruhig im Esszimmer auf und ab. Irgendwann kroch Anuschka unter dem Tisch hervor und drückte sich winselnd an ihr Bein.
„Da hast du dich mal wieder von deiner besten Seite gezeigt, Mädchen!“, seufzte Alexandra und klopfte ihr auf den Hals. „Aber kein Grund, so ein Geschrei zu veranstalten, was?“ Gefolgt von der Dogge stieg sie die Treppe zur Haustür hinunter. Dort legte sie ihr das Hundehalsband an. „Komm, wir gehen noch spazieren, es ist Vollmond – vielleicht kann der uns ein wenig trösten.“
11
Nicht wie aus einem Schlaf, sondern wie aus einer Betäubung wachte er auf. Sein Schädel dröhnte, sein Mund fühlte sich trocken an wie ein alter Staublappen, und ihm war speiübel. Ächzend schob er die Beine aus dem Bett und setzte sich an den Bettrand. Er wartete ein paar Minuten, bis das Hotelzimmer aufhörte sich zu drehen. Dann stand er auf und ging ins Bad.
Das runde Gesicht im Spiegel war blass und zerknittert. Nicht das Gesicht eines Dreiunddreißigjährigen, sondern eines Vierzig- oder Fünfzigjährigen. Er starrte sich an. „Michael Tenninger – geschieden, bankrott, abgehalftert. Vorbei.“
Er stieg unter die Dusche und drehte das Wasser auf. Wohlige Schauer durchrieselten ihn, als das warme Wasser auf seine Haut prasselte. Er duschte lange. Im Badezimmer sammelte sich heißer Dampf. Abschließend spritzte er sich eiskalt ab. Das hatte er sich beim Bund angewöhnt.
Nach dem Duschen fühlte er sich besser. Er zog sich an, löste zwei Aspirin-Tabletten auf, und trank eine Flasche Mineralwasser. Bei dem Gedanken an etwas Essbares krampfte sich sein Magen zusammen. Also zog er das Frühstück erst gar nicht in Erwägung.
Stattdessen öffnete er den Kleiderschrank und begann sämtliche Hosen-, Mantel- und Jackentaschen nach Geld zu durchsuchen. Er warf alle Münzen und Scheine, die er fand, aufs Bett. Im Koffer, den er vom Schrank zog und öffnete, fand er tatsächlich noch drei Hunderter. Am Schluss lagen insgesamt fünfhundertsechsundvierzig Mark und ein paar Pfennige auf dem Bett.
Auch ein altes Kuvert mit Euroschecks fand er. Doch wer nahm heute noch Euroschecks? Außerdem wollte er sein Konto nicht noch weiter belasten.
Er setzte sich auf einen Stuhl, der gegenüber dem Bett unter dem Fenster stand und betrachtete die Scheine und Münzen. „Fünfhundertsechsundvierzig Mark, Tenninger“, murmelte er. „Drei Tage leben und eine Waffe.“ Er stand auf und drückte die letzte Aspirin aus dem Film. „Bis Freitag“, sagte er, während er das Wasser auf die Tablette im Glas goss. „Am Samstag machst du’s.“
Er stellte sich vor, wie er sich von den letzten paar Mark eine Flasche Schnaps kaufen, sie auf ex trinken und sich danach auf der Rheinbrücke erschießen würde. Natürlich jenseits des Brückengeländers.
Oder nein, er würde es vor seinem Haus tun, vor seinem ehemaligen Haus. Genau, alle sollten sehen, wer die wahre Schuldige an seinem Schicksal war!
Am späten Vormittag zog er los. Das Geld trug er in der Innentasche seines Jacketts bei sich. Er hatte nur eine ungefähre Vorstellung davon, wo er sich eine Waffe besorgen könnte.
Zunächst versuchte er es bei einem ehemaligen Geschäftspartner. Der Mann hatte mal zwei Spielhallen bei ihm gepachtet – die gehörten jetzt ebenfalls dem neuen Besitzer – und Tenninger wusste, dass in den Hinterzimmern um viel Geld gepokert wurde. Er war sich ziemlich sicher, dass dieser Mann niemals unbewaffnet war und folglich wissen musste, wo man eine Pistole kaufen konnte, auch wenn man keinen Waffenschein besaß.
Der Mann empfing ihn kühl und unfreundlich. Er ließ ihn deutlich spüren, dass er ihn für einen Loser hielt, der in dieser Spielhalle nichts mehr zu suchen hatte. Tenninger erkundigte sich nach dem Geschäft, machte ein paar Bemerkungen über das Wetter und über alte, gemeinsame Zeiten und erntete nichts als einsilbige Kommentare. Er verzichtete darauf, den Mann nach dem Schwarzmarkt für Waffen zu fragen und verließ ärgerlich die Spielhalle.
Als nächstes suchte er die Zentrale einer kleinen Security-Firma auf, die eine Zeitlang für ihn gearbeitet hatte. Der Chef empfing ihn freundlich. Er wusste noch nichts von Tenningers Misere. Tenninger kam sofort zur Sache.
„Ich hab da einen Freund in Düsseldorf – heißes Pflaster, weißt ja – von dem wollen sie Schutzgeld erpressen“, erzählte er. „Der Mann hat Angst, klar, er braucht ’ne Waffe. Hast du ’ne Idee?“
Der Security-Mann – er trug eine schwarze Uniform – schob ihm seine Visitenkarte über den Schreibtisch. „Gib ihm die. Wir arbeiten auch in Düsseldorf.“
Tenninger ließ nicht locker. Der Mann bräuchte dringend eine Waffe. Dann solle er schleunigst einen Waffenschein beantragen. Tenninger bohrte weiter, und der Security-Mann, der langsam den Braten roch, verwies auf die Gesetzeslage. Unverrichteter Dinge verabschiedete sich Tenninger.
Inzwischen war es Mittag geworden. Seine Kopfschmerzen hatten sich gelegt. Dafür meldete sich sein Magen. Er betrat ein Bistro und bestellte ein kleines Frühstück.
Während er sich ein Croissant mit Butter bestrich, stand am Nebentisch ein Mann auf, bezahlte an der Theke und verließ das Bistro. Seine Zeitung hatte er liegen gelassen.
Tenninger holte sie sich an seinen Tisch. Er liebte es, während des Frühstücks Zeitung zu lesen.
Spaziergang zur Bank – hundertzwanzigtausend!, lautete die riesige Schlagzeile. Tenninger überflog den Bericht nur: Mann … etwa vierzig Jahre alt … spazierte in Kölner Bank … vorgehaltene Waffe … von den meisten Mitarbeitern und Kunden unbemerkt … einhundertzwanzigtausend … von Zeugen zuvor an der Rheinpromenade gesehen … Fahndung ergebnislos … Ein Phantombild war abgedruckt. Tenninger blätterte um und vertiefte sich in den Sportteil.
Eine Stunde später verließ er das Bistro und machte sich zu Fuß auf den Weg ins Industriegebiet. Unter den Kontaktanzeigen der Zeitung hatte er die Inserate einiger Prostituierten entdeckt. Das hatte ihn auf eine Idee gebracht.
Er kannte im Industriegebiet eine der Damen, die dort in einem Wohnwagen ihrem Gewerbe nachging. In früheren Jahren hatte Tenninger ab und zu ihre Dienste in Anspruch genommen. Von daher wusste er, dass sie immer eine Pistole unter dem Kopfteil ihrer Matratze stecken hatte.
Er klopfte an, und nachdem sie ihre Enttäuschung heruntergeschluckt hatte – sie hatte gehofft, mit ihm einen zahlenden Kunden in den Wohnwagen zu lassen – verriet sie ihm tatsächlich, wo sie ihre Waffe gekauft hatte.
Kurz nach drei betrat Tenninger den kleinen, halbdunklen Laden eines Antiquitätenhändlers. Der Laden war vollgestopft mit kitschigen Bildern, antiquarischen Waffen, Stahlhelmen, Orden, Offiziersdegen aus Kaiserzeiten und zahllosen Büchern.
Der Händler war ein stämmiger, hemdsärmeliger Mann, mit Doppelkinn und faltigen Tränensäcken unter den Augen. Fragend sah er Tenninger an.
„Ich brauche so ein Gerät“, Tenninger deutete auf eine Glasvitrine, in der Duellpistolen aus dem achtzehnten Jahrhundert lagen. „Allerdings etwas moderner.“
Die Augen des Antiquitäten-Händlers wurden schmal. „Wie – moderner.“
„Modern genug, um damit schießen zu können.“
„Wer hat Ihnen meine Adresse gegeben?“
Tenninger nannte den Namen der Hure. Die Gesichtszüge des Mannes entspannten sich etwas. Wortlos wandte er sich einer Tür links hinter der Ladentheke zu und bedeutete Tenninger, ihm zu folgen.
Das Hinterzimmer war genauso dunkel wie der Laden selbst, und genauso vollgestopft mit unzähligem Krimskrams. Tenninger nahm an einem Tisch Platz, und der Mann legte ein halbes Dutzend Pistolen und Revolver vor ihn hin. Tenninger entschied sich für eine kleinkalibrige Walther.
Eine halbe Stunde, nachdem er den Laden betreten hatte, verließ er ihn um zweihundertfünfzig Mark ärmer. In der Jackentasche umklammerte er den Knauf seiner Waffe. Eine Erregung, die seinen Atem beschleunigte, schien von ihr auszugehen.
12
„Hier ist es!“, rief Ewald Zühlke und deutete auf das große Bürogebäude neben der Einfahrt zu den Parkplätzen einer Spedition. In der offenen Glastür des Eingangsbereiches standen winkende Menschen. Zühlke gab der Rettungsleitstelle die Ankunft am Einsatzort durch.
Jupp Friederichs hielt, Zühlke und Alexandra Heinze sprangen aus dem Notarztwagen. Zühlke zog den großen Notfallkoffer aus Aluminium aus dem Heck des Fahrzeugs und folgte seiner Notärztin ins Gebäude.
„Hier lang!“, rief ein Mann in blauem Nadelstreifenanzug. Er lief Alexandra und Zühlke voran in einen Aufzug. Während der Fahrt in den vierten Stock berichtete er. „Unser Chefbuchhalter. Bricht plötzlich zusammen. Er reagiert auf nichts mehr. Hoffentlich nicht das Herz!“
Die Aufzugtür schob sich auseinander. Der Mann stürmte durch eine offenstehende Bürotür, Alexandra und Zühlke hinterher. Frauen und Männer erhoben sich von ihren Knien und gaben den Blick auf den Bewusstlosen frei.
Alexandra sah die nasse Stirn, fühlte den kalten Schweiß des Mannes, bemerkte, dass auch sein weißes Hemd schweißnass war, und erfasste sofort die Situation. „Hämoglucosetest“, wies sie Zühlke an, der gerade den Blutdruck des Bewusstlosen kontrollierte.
„Hat Ihr Kollege Zucker?“, fragte sie die Umstehenden Mitarbeiter des Fuhrunternehmens. Die zuckten nur hilflos mit den Schultern.
„Er hat selten über Privates gesprochen“, sagte ein junges Mädchen, wahrscheinlich ein Lehrling. Alexandra legte einen venösen Zugang für die Infusion. Zühlke hielt den Teststreifen in das heraustropfende Blut.
„Trage?“, fragte Friederichs von der Tür aus. Alexandra nickte und schloss die Infusion an, die Zühlke ihr reichte – eine Traubenzuckerlösung.
Alexandra sah einen Ehering an der Hand des etwa Vierzigjährigen. „Ich brauche die Privatnummer Ihres Kollegen.“ Die Leute sahen sich hilflos an. Einer lief zur Tür hinaus.
Zühlke wischte den Blutstropfen vom Teststreifen und reichte ihn der Ärztin. Das Testfeld war hellbeige. Der Mann war völlig unterzuckert.
„Diabetischer Schock?“, fragte Zühlke. Alexandra nickte. Wortlos und ohne eine Anweisung der Ärztin abzuwarten, holte der Sanitäter eine Zwanzigmilliliter-Ampulle Glucose heraus und zog eine Spritze damit auf. „Zwanzigprozentige Glucose“, sagte er und reichte die Spritze der Notärztin.
Alexandra bohrte die Nadel in den braunen Gummiansatz des Infusionsschlauchs. Langsam drückte sie die Traubenzuckerlösung in den Kreislauf des Mannes. Sobald die Hirnzellen wieder mit Zucker versorgt waren, würde er zu sich kommen.
Die Privatnummer des Bewusstlosen wurde hereingereicht. Alexandra erreichte seine Frau. Der Mann war tatsächlich juveniler Diabetiker! „Machen Sie sich keine Sorgen“, beruhigte Alexandra die Frau, „wir nehmen Ihren Mann vorsichtshalber mit in die Klinik. Aber er wird in Kürze wieder zu sich kommen.“
Friederichs hatte kaum den Motor gestartet, da schlug der Mann die Augen auf. Alexandra brachte ihm behutsam bei, was geschehen war. „Wir bringen Sie auf die Innere. Vielleicht muss Ihr Insulin neu eingestellt werden.“
Der Mann kniff genervt die Augen zu. „Und meine Kollegen standen alle dabei?“ Alexandra nickte. Offenbar hatte der Mann sonst keine Sorgen.
Sie brachten ihn auf die Innere. Alexandra nutzte die Gelegenheit, bei Lore Keller vorbeizuschauen, um ihr den katastrophalen Abend zu schildern. Lore lachte lauthals. „Alexandra! Das ist die lustigste Geschichte, die ich seit Langem gehört habe!“
„Du hättest mal hören sollen, was Werner und ich uns danach für Nettigkeiten zu sagen hatten.“ Alexandra ließ sich in den Bürosessel ihrer Freundin fallen. „Das war alles andere als lustig“, seufzte sie.
„Tut mir leid“, Lore grinste noch immer, „aber das kriegt ihr schon wieder hin.“
„Komm“, Alexandra stand auf, „geh mit mir zum Essen und erzähl mir was Schönes. Das wird mich trösten.“
„Tut mir leid, Alexandra“, bedauerte Lore, „der Chef kommt gleich. Der will noch vor dem Mittagessen seine Privatpatienten sehen. Ich bin noch mindestens eine Stunde beschäftigt.“
Also ging Alexandra allein ins Ärztekasino. Es gab einen feinen Blumenkohlauflauf mit Salzkartoffeln. Das hob ihre Stimmung beträchtlich. Aber nicht lange. Denn als sie sich umdrehte, sah sie Dr. Molani mutterseelenallein an einem Tisch sitzen.
„O Gott!“, seufzte sie innerlich. „Wäre ich bloß nicht zum Essen gegangen!“ Sie konnte sich unmöglich an einen anderen Tisch setzen. „Also los, Alexandra, reiß dich zusammen!“ Tapfer steuerte sie Molanis Tisch an.
Der Arzt legte sein Besteck beiseite, als er Alexandra kommen sah. Er tupfte sich den Mund mit der Serviette ab. „Das ist nett, dass Sie sich neben mich setzen, Frau Heinze, bitte.“ Er wies auf den Stuhl ihm gegenüber.
„Da bin ich aber froh, wenn sie das nett von mir finden, Herr Molani.“ Erleichtert ließ sie sich nieder. „Nach der mittleren Katastrophe, die wir gestern bei Ihnen angerichtet haben, war ich nicht mal sicher, ob ich mich noch zu Ihnen an den Tisch wagen kann.“
„Das waren doch nicht Sie“, lachte er, „das war doch Ihr kleiner Hund!“ Er griff nach seinem Besteck. „So lange uns nichts Schlimmeres passiert …“
An diesen bedeutungslosen Satz sollte Alexandra noch denken. Drei Tage später. Als das Schlimmere dann tatsächlich passierte.
13
„Ich habe den Kindern noch etwas vorgelesen.“ Benno beugte sich zu Karin herunter und küsste sie auf den Mund. „Sie sind schon halb eingeschlafen.“ Karin saß in ihrem Fernsehsessel, über den Bildschirm flimmerte der Vorspann eines Krimis. „Was kommt?“
„Ein Psychothriller mit Mel Gibson.“
Benno blieb neben ihrem Sessel stehen, als wäre er unschlüssig. „Ach, ich glaube, ich gehe lieber noch ein wenig spazieren.“
„Tu das, Schatz“, sagte Karin, ohne den Fernseher aus den Auge zu lassen, „das wird dir gut tun nach den zwölf Stunden im Büro.“
Benno verließ das Wohnzimmer. Karin hatte sich einfach an seine abendlichen Spaziergänge gewöhnt, zu denen er seit mehr als einem halben Jahr ungefähr zwei bis drei Mal die Woche aufbrach. Sie wollte nicht mal wissen, welchen Weg er zu nehmen pflegte.
Neben der Haustür lag ein sorgfältig gebündelter und verschnürter Stapel Altpapier. Benno bückte sich danach und nahm ihn mit aus dem Haus. Er öffnete das Garagentor und legte das Altpapier in den Kofferraum seines Roadsters. Die Papierentsorgung war sein Job. Sein Weg führte ihn jeden Morgen an einem Altpapier-Container vorbei.
Bevor er sein Grundstück verließ, blickte er hinüber zum Haus von Jasir und Marion. Im Kinderzimmer brannte kein Licht mehr. Das bläuliche Flimmern hinter den Wohnzimmerfenstern verriet, dass auch für Jasir ein Fernsehabend begonnen hatte.
Benno ging die Straße hinunter. Es war halb zehn. Die Dämmerung schickte sich gerade an, auch das letzte Tageslicht zu vertreiben, und über dem Horizont sah Benno den ersten Stern stehen. Er verließ die Neubausiedlung und steuerte den Friedhof an, der am Waldrand auf der anderen Seite dieses Ortsteils lag.
Etwa zweihundert Meter vor ihm schlenderte ein anderer Spaziergänger die Straße hinunter. Im Licht einer Straßenlaterne erkannte Benno den hellen Sommermantel Marions und ihr blondes Haar. Er beschleunigte seinen Schritt.
Als sie den Friedhof erreichten, ging er nur noch fünfzig Schritte hinter ihr. Ohne sich nach ihm umzusehen verschwand sie in der Zypressenhecke, die den Seiteneingang zum Friedhof verdeckte. Benno hörte das Quietschen des Eisengatters.
Es stand offen, als er die Hecke erreichte. Er trat ein und entdeckte Marion zwischen den Birkenstämmen, die hier den Weg zur Trauerhalle säumten. Er lief auf sie zu, zog sie an sich und küsste sie.
Dann gingen sie schweigend nebeneinander. Marion schob ihre Hand unter seine Jacke und presste sich an ihn. „Was macht Karin?“
„Fernsehen. Einen Psychothriller.“
„Den sieht Jasir auch“, seufzte Marion, „dann haben wir über eine Stunde Zeit.“ Sie bogen in einen schmalen Seitenweg ab. „Wie geht es dir?“, erkundigte Marion sich.
Benno schüttelte kaum merklich den Kopf. „Nicht berauschend – heute hat sich einer meiner besten Mitarbeiter von mir getrennt. Ein herber Verlust – dabei hatte die Woche so gut angefangen.“ Sofort fiel ihm die Katze ein. Er zog es jedoch vor, nichts von dem Unfall zu erzählen.