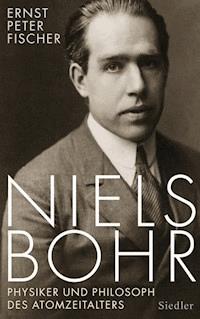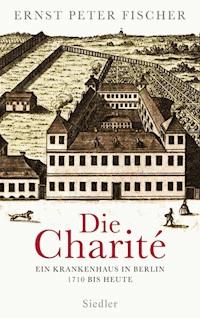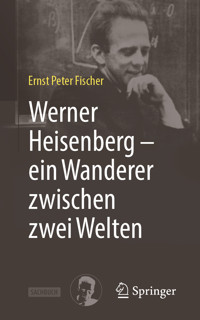12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Vom Lebensbaum bis Google Earth: über die Bilder, mit denen wir uns die Welt erklären. Was ist die Welt, und wie sieht sie aus? So lautet eine der ältesten Fragen der Menschheit, und noch heute begegnen wir ihr nicht anders als in Urzeiten: Wir entwerfen Weltbilder, die da anfangen, wo unsere Sinneswahrnehmung aufhört. Ernst Peter Fischer erzählt so spannend wie lehrreich die Geschichte jener Bilder, die den Menschen und seine Zeit spiegeln und zugleich fundamental prägen: von der babylonischen Vorstellung einer Scheibe unter dem Firmament, die sich auch im Alten Testament findet, über den Lebensbaum der Maya, der Himmel und Erde, Leben und Tod verbindet, bis hin zu den Aufnahmen, die den Erdball erstmals aus dem All zeigten. Fischer berichtet von Entdeckungsfahrten und Kartographie, von dem Blick durch das Teleskop wie durch sein Gegenstück, das Mikroskop – denn nicht nur im Größten, auch im Kleinsten, in Genen und Atomen, liegen Weltbilder begründet. Wie sich zeigt, hat die moderne Wissenschaft die Welt keinesfalls «entzaubert», sie hat nur unsere Horizonte verschoben. Doch wo liegen die Horizonte, die es heute noch zu überwinden gilt? Ernst Peter Fischer nimmt das große Ganze in den Blick. Er erkundet eine Grundlage des menschlichen Selbstverständnisses, die Welt in unseren Köpfen – so ist diese Geschichte der Weltbilder auch eine Geschichte der Menschheit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 469
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Ernst Peter Fischer
Hinter dem Horizont
Eine Geschichte der Weltbilder
Über dieses Buch
Vom Lebensbaum bis Google Earth: über die Bilder, mit denen wir uns die Welt erklären.
Was ist die Welt, und wie sieht sie aus? So lautet eine der ältesten Fragen der Menschheit, und noch heute begegnen wir ihr nicht anders als in Urzeiten: Wir entwerfen Weltbilder, die da anfangen, wo unsere Sinneswahrnehmung aufhört. Ernst Peter Fischer erzählt so spannend wie lehrreich die Geschichte jener Bilder, die den Menschen und seine Zeit spiegeln und zugleich fundamental prägen: von der babylonischen Vorstellung einer Scheibe unter dem Firmament, die sich auch im Alten Testament findet, über den Lebensbaum der Maya, der Himmel und Erde, Leben und Tod verbindet, bis hin zu den Aufnahmen, die den Erdball erstmals aus dem All zeigten. Fischer berichtet von Entdeckungsfahrten und Kartographie, von dem Blick durch das Teleskop wie durch sein Gegenstück, das Mikroskop – denn nicht nur im Größten, auch im Kleinsten, in Genen und Atomen, liegen Weltbilder begründet. Wie sich zeigt, hat die moderne Wissenschaft die Welt keinesfalls «entzaubert», sie hat nur unsere Horizonte verschoben. Doch wo liegen die Horizonte, die es heute noch zu überwinden gilt?
Ernst Peter Fischer nimmt das große Ganze in den Blick. Er erkundet eine Grundlage des menschlichen Selbstverständnisses, die Welt in unseren Köpfen – so ist diese Geschichte der Weltbilder auch eine Geschichte der Menschheit.
Vita
Ernst Peter Fischer, geboren 1947 in Wuppertal, studierte Mathematik, Physik und Biologie und habilitierte sich 1987 im Fach Wissenschaftsgeschichte. In den Jahren darauf lehrte er als Professor an den Universitäten Konstanz und Heidelberg. Als Wissenschaftspublizist schreibt er unter anderem für die «Welt» und «Focus». Fischer ist Autor zahlreicher Bücher, darunter des Bestsellers «Die andere Bildung» (2001). 2015 erschien «Durch die Nacht. Eine Naturgeschichte der Dunkelheit».
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Oktober 2017
Covergestaltung Frank Ortmann
Coverabbildungen: Farbige Aquatinta, 1791, Ausschnitt aus «Fontenelle méditant sur la pluralité des mondes» von Jean-Baptiste Morret nach Jacques Swebach-Desfontaines/akg-images; shutterstock.com; iStockphoto.com
ISBN 978-3-644-10018-3
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für meine Enkel,
die alle einen anderen Horizont haben werden.
Einleitung
Der Mensch und seine Horizonte
Im Vorwort ihres Buches «Mit den Meeren leben» beschreibt die jüngste Tochter von Thomas Mann, Elisabeth Mann Borgese, wie sie in Kindertagen zum ersten Mal mit ihrem Vater am Meer steht und beide «ganz benommen in die Ferne» schauen. Und während sie da stehen und den Blick schweifen lassen, nimmt etwas die Aufmerksamkeit der Tochter in Anspruch: «Was mich am tiefsten beeindruckte, war der Horizont, der sich fest und ungebrochen, wie von einem überdimensionalen Zirkel gezeichnet, von einem Ende des Blickfeldes zum anderen hinzog. ‹Das ist der Horizont›, erklärte mein Vater. ‹Und was ist hinter dem Horizont?›, fragte ich. ‹Der Horizont und dahinter wieder der Horizont. Je weiter du hinausruderst, umso weiter zieht sich der Horizont zurück, so dass du immer nur einen Horizont siehst, bis ganz, ganz zuletzt das Land in Sicht kommt, und dann ist der Horizont verschwunden. Du kannst ihn aber wieder sehen, wenn du dich umdrehst.›»[1]
Mit anderen Worten: Der Horizont selbst bleibt den Menschen unerreichbar. Und doch scheint sich dahinter eine geheimnisvolle Welt zu öffnen, zu der sich die menschliche Neugierde unaufhaltsam hingezogen fühlt. Schon früh in ihrer Geschichte haben Menschen die Vorstellung entwickelt, dass sich hinter oder über dem Horizont der Wolkendecke ein Himmelreich mit göttlichen Bewohnern befindet, und so denken viele auch, dass hinter der Linie, an der sich Himmel und Erde still küssen, wie es poetisch heißt, etwas ganz anderes liegt, das man gerne als das Wesentliche versteht. Doch was der Mensch auch unternimmt, um hinter diese Horizontlinie schauen zu können, am Ende aller Bemühungen meldet sich das Heimweh, und zuletzt zieht es ihn wieder zurück an den Ausgang. Er kommt nicht hinter den Horizont, sondern kann immer nur von einem zum anderen gehen.
Um den neuen Horizont zu sehen, muss man zwar die Blickrichtung ändern, wie Thomas Mann seiner Tochter erläutert, man kann dabei aber sein anfängliches und naturgemäßes Verlangen bewahren, Zugang zu der sich verborgen haltenden Sphäre hinter der geheimnisvoll wirkenden Grenze zu bekommen, die sich augenscheinlich vor dem Schauenden auftut. Dieser Wunsch gehört zum Menschen und charakterisiert sowohl sein biologisch bedingtes als auch sein historisch gewachsenes Wollen. Man könnte die drei Fragen, deren Beantwortung nach Immanuel Kant zu sagen erlaubt, was der Mensch ist, demnach folgendermaßen beantworten: Was kann der Mensch wissen? Er kann seine Grenze oder seine Grenzen kennenlernen, zum Beispiel den Horizont am Meer. Was kann der Mensch tun? Er kann versuchen, sie zu überwinden. Und was darf der Mensch dabei hoffen? Dass ihm bei diesem Bemühen Erfolg beschieden ist und dass er die ihn treibende Neugierde dadurch befriedigen kann – bevor ihn eine neue Grenze, ein neuer Horizont lockt.
Elisabeth Mann Borgese hat der Vorschlag ihres Vaters offenbar beeindruckt, denn er löste langfristig etwas in ihrer Seele aus: «Ich musste oft über den Horizont nachdenken, und er hatte die unterschiedlichsten Bedeutungen für mich. Als ich zwölf Jahre alt war, schien er mir die Einheit von Zeit und Raum in einem sich ausdehnenden Universum verständlich und anschaulich zu machen. So, wie man sich in den Raum hinausbewegt, was ja Zeit dauert, so erweitert sich der Horizont des Universums, dachte ich mir, und die Endlichkeit wird zur Unendlichkeit.»[2]
Diese Empfindung haben auch andere beschrieben. Der große Physiker Werner Heisenberg, dem die Menschheit die erste zutreffende Theorie der Atome – sie heißt Quantenmechanik – verdankt, erinnert sich in seiner Autobiographie «Der Teil und das Ganze», dass es ihm 1925 auf der Insel Helgoland möglich war, «beim Blick über das Meer einen Teil der Unendlichkeit zu ergreifen».[3] Dieser Eindruck hat den damals Vierundzwanzigjährigen inspiriert und ermutigt, die scheinbar unüberwindlichen Grenzen der klassischen Form seiner Wissenschaft hinter sich zu lassen und zu neuen Ufern, seinem inneren Amerika, aufzubrechen.
Noch einmal zurück zu dem Mädchen am Meer. Wer von den universalen und über den Himmel hinausreichenden Vorstellungen der jungen Dichtertochter liest, kann sich mit ihr freuen, wird aber auch darüber staunen. Als Elisabeth zwölf Jahre alt war, schrieb man das Jahr 1930, und umso verwunderlicher ist es, dass sich in der Familie Mann bis zu den Kindern bereits herumgesprochen zu haben scheint, was die damaligen Kosmologen seit den späten 1920er Jahren erst allmählich in ihre Überlegungen einbezogen: die Expansion des Weltalls in Form einer Raumzeit und die erstaunliche Möglichkeit seiner geometrischen Unbegrenztheit trotz physikalischer Endlichkeit. Das inzwischen längst durch zahlreiche Beobachtungen gestützte Bild eines expansiv-dynamischen und sich endlos ausweitenden Universums konnte im Anschluss an die Allgemeine Relativitätstheorie entworfen werden, die Albert Einstein in den Jahren des Ersten Weltkriegs entwickelt hatte.
Einstein prägte dem Weltall eine neue Geometrie auf und lud die Menschen dazu ein, sich den von ihnen bewohnten Kosmos als vierdimensionales Gebilde vorzustellen, als eine Raumzeit. In diesem Bild wurde und wird es für die Neuzeit sehr schwierig, wenn nicht gar unmöglich, sich einen Rand der Welt oder einen entsprechenden Horizont auszumalen. Einsteins Weltbild bereitete zunächst selbst Physikern von Rang einige Mühe, und es stellt viele Zeitgenossen des 21. Jahrhunderts noch immer vor zahlreiche und keineswegs triviale Probleme. Einsteins Einsichten in «die Welt als Ganzes» scheinen aber schon früh das Verständnis und auf jeden Fall die Sympathie der Familie Mann gewonnen zu haben, wenn man dem Bericht der Tochter trauen darf, was gerne geschehen soll. In ihren Reihen konnten die Manns offenbar spielerisch und vergnüglich über den wissenschaftlichen Horizont hinaussehen, an dem die Blicke der meisten Zeitgenossen verständlicherweise hängen blieben und hängen bleiben – damals wie heute.
Unsere Augen reichen nicht so weit wie Einsteins Gedanken. Die für das Licht sensitiven Organe erfassen den Lebensraum nur bis zu der Linie, an der Erde und Himmel aufeinandertreffen, wobei dieser Horizont die Welt nicht abschließt, sondern sie – im Gegenteil – der Neugier öffnet. Wer der Verlockung nachgibt und hinter die sichtbare Grenzlinie blicken will, braucht geeignete Mittel, und damit sind nur bedingt Teleskope und andere Instrumente gemeint. Die Rede ist vielmehr vor allem von Weltbildern. Das Entwerfen und Verfertigen von Weltbildern erlaubt es den Menschen seit Anbeginn ihrer Geschichte und in allen Kulturen, den Blick dorthin zu lenken, wo die Augen normalerweise nicht hinreichen, nämlich hinter den Horizont.
1.Einblicke
Eine Welt und viele Bilder
Es gibt Wörter, die jeder benutzt und zu verstehen scheint und die deshalb kaum einer Erläuterung bedürfen. Wer hat nicht schon von der oder einer «Welt» gesprochen – von der Welt im Kopf ebenso wie von der Welt im Kochtopf –, ohne sich dabei besondere Gedanken darüber zu machen, was das Wort in diesem wie in jenem Fall bedeutet? Und wer fragt sich noch, was ein Bild ist, wo man doch tagtäglich von einer Flut – vor allem unzähliger zappelnder Fernsehbilder – überschwemmt wird und nach statistischen Schätzungen heute während eines Fußballspiels in einem vollen Stadion mehr Bilder aufgenommen werden als während des ganzen 19. Jahrhunderts? Wobei vermutlich ein einziges Bild aus der alten Zeit mehr Betrachter gefunden hat als die Millionen von heute.
Wer mit dem Begriff der Welt und dem Betrachten von Bildern vertraut ist, dem fällt darüber hinaus die Rede von einem «Weltbild» leicht. Wir können uns Weltbilder sogar in bunter Vielfalt denken und dann munter miteinander vergleichen. Jeder wird mühelos verstehen, was das mechanische Weltbild der Physik mit den dazugehörigen Gesetzen für die Bewegungen von materiellen Körpern meint, und sich wundern, wenn zu erfahren ist, dass dieses Bild angeblich zerstört worden ist. Auch wird jeder unmittelbar erfassen, was Zeitungen in diesen Tagen meinen, wenn sie Terroristen unterstellen, ein «rechtsextremistisches Weltbild» zu propagieren, das Hass auf unschuldige Menschen mit sich bringt. Und jeder Leser begreift sofort, was Patrick Süskind vor Augen oder anderen Sinnesorganen hat, wenn er in seinem Roman «Das Parfum» einen Dufthersteller erleichtert feststellen lässt, dass sein «parfümistisches Weltbild» wieder in Ordnung ist, nachdem er verstanden hat, wie eine wohlgefällige Duftnote zustande gekommen ist. Ein Weltbild zu haben kann einfach eine Sicht der Dinge meinen, die einem allgemein passt oder an besonderer Stelle gelegen kommt, und niemand wird Mühe haben, das eigene Weltbild einmal daraufhin zu prüfen.
Wenn auch jedem das Trio aus den beiden Einsilbern «Welt» und «Bild» und dem Kompositum «Weltbild» schon mehrfach untergekommen ist, so soll hier dennoch der Versuch unternommen werden, die Begriffe etwas genauer zu fassen und sie knapp zu explizieren, ohne sie ausführlich definieren zu wollen. Der Versuch einer Definition wäre eher kontraproduktiv, denn in dem Wort «Definition» steckt das lateinische «finis», also das Ende, wobei damit das Ende des Erkundens gemeint ist, das zu einer abschließenden Festlegung führen soll. Diese zieht tatsächlich eine künstliche Grenze, hinter der nichts weiter von Belang erwartet wird, weshalb sie – außer zur Warnung – gar nicht erst in Betracht kommen soll.
Was die «Welt» angeht, so meint das Wort zum Beispiel den Gegenstand einer Wissenschaft namens Kosmologie, die exotische Objekte wie Schwarze Löcher oder Rote Riesen findet. Es kann aber auch die Erde und die Menschen erfassen, die auf ihr leben, und das kurze Wort kann darüber hinaus ganz allgemein die Gesamtheit der physischen Wirklichkeit benennen, wobei derjenige, der von dieser Welt spricht, keine besondere Einstellung ihr gegenüber vertreten muss.
Was das «Bild» angeht, so fällt sofort auf, dass es zum einen innere und äußere Bilder gibt – man kann sich schließlich sowohl etwas einbilden und vorstellen als auch Fotografien oder Gemälde betrachten – und dass es sich zum Zweiten lohnt, Bilder, die jemand Punkt für Punkt und Strich für Strich auf einer Leinwand zustande gebracht hat, von denen zu unterscheiden, die jemand mit einer Kamera und einem einzigen Druck auf den Auslöser aufgenommen hat. Bilder werden – wie die Welt selbst – mit Augen betrachtet, wobei seit der Romantik bekannt ist, dass es neben den äußeren Sehorganen im Kopf auch ein inneres Augenpaar gibt, mit dem sich das Eigentliche erkennen lässt, das unter der Oberfläche der Erscheinung oder hinter dem Horizont des Sichtbaren steckt und nur in einer Einbildung offengelegt – oder sogar offenbart – werden kann. Das ergibt insgesamt drei Dopplungen, und wahrscheinlich finden sich noch mehr, wenn Menschen ihre Aufmerksamkeit den Bildern zuwenden.
Wichtig ist der Hinweis, dass ein Bild im Normalfall etwas zeigt, was es selbst nicht ist. Das Bild einer Pfeife ist bekanntlich selbst keine Pfeife, wobei Betrachter immer wieder schmunzeln werden, wenn sie das berühmte Bild von René Magritte aus dem Jahre 1929 anschauen, auf dem eine Pfeife zu sehen ist, unter der geschrieben steht: «Dies ist keine Pfeife.» Magritte wird von der Kunstgeschichte als Surrealist gehandelt, was ausdrücken soll, dass die in seinen Bildern gemalten Sachverhalte jenseits der Wirklichkeit anzutreffen sind oder über sie hinausgehen, ohne völlig von der Realität abgelöst zu sein. Übrigens: Das Bild mit der Pfeife trägt den Titel «Der Verrat der Bilder», wobei sich der Autor dieser Zeilen im Scherz die Frage erlaubt, was ihm denn die Bilder verraten. Sie verraten ihm vor allem eines, nämlich dass Wirklichkeit nicht als einfaches Konzept zu verstehen ist, sondern mehr als etwas daherkommt, das ein Forellenkleid trägt und sich dem Betrachter im wechselnden Licht immer wieder anders darstellt.
«Der Verrat der Bilder» von René Magritte, gemalt 1928/29, als die Physik verstanden hatte, dass Atome kein Aussehen haben und Menschen sich kein Bild von ihnen machen können. Wer immer ein Atom malt, muss darunterschreiben: «Das ist kein Atom.» Das Bild von Magritte ist ja auch keine Pfeife, sondern besteht aus Ölfarben auf einer Leinwand (die wiederum aus Atomen besteht). Ebenso gilt für jedes Weltbild: «Das ist nicht die Welt» – sondern nur ein Bild von ihr, das wir selbst erschaffen haben.
Was nun das Kompositum «Weltbild» betrifft, so möchte ich dem Philosophen Martin Heidegger auf seinen keineswegs in die Irre gehenden «Holzwegen» folgen, bei deren Abschreiten und Erwandern er sich im Jahre 1938 nicht zuletzt Gedanken über «Die Zeit des Weltbildes» macht – wobei man meinen könnte, er habe Einsteins Buch «Mein Weltbild» aus dem Jahre 1934 gekannt. Heidegger charakterisiert bei den ersten Schritten auf seinem Weg durch den dichten Wald die Wissenschaft mit dem Hinweis, sie gehöre «zu den wesentlichen Erscheinungen der Neuzeit». Unter dieser zugleich erfreulichen und großmütigen Vorgabe fragt er «nach dem neuzeitlichen Weltbild», ohne zu verraten, welche naturwissenschaftlichen Einsichten er im Auge hat. Die Chemie etwa lernte damals, radioaktive Elemente herzustellen, und näherte sich durch die Analyse von Vitaminen den Lebensvorgängen. Unabhängig davon beginnen Heideggers philosophische Überlegungen zur Freude mindestens eines Lesers höchst einfach, unmittelbar nachvollziehbar und zudem äußerst sympathisch: «Was ist das – ein Weltbild? Offenbar ein Bild von der Welt. Aber was heißt hier Welt? Was meint da Bild? Welt steht hier als Benennung des Seienden im Ganzen. Der Name ist nicht eingeschränkt auf den Kosmos, die Natur. Zur Welt gehört auch die Geschichte.» Im Anschluss fängt der Philosoph an, tiefer zu graben. Er spricht über die «Wechseldurchdringung» von Natur und Geschichte und führt sogar einen «Weltgrund» an, der in «Beziehung zur Welt gedacht wird».[4]
Bevor der Philosoph jetzt allzu sehr ins Grübeln kommt, soll der Gedanke ernst genommen werden, zur Welt gehöre «auch die Geschichte». In diesem Fall haben Weltbilder ebenfalls eine Geschichte, und möglicherweise zeigen Weltbilder die ganze Geschichte, allein schon deshalb, weil die Welt nie etwas anderes getan hat, als sich zu ändern und immer wieder in einem neuen Licht zu zeigen. Das Seiende im Ganzen ist ein dauerhaftes Werden ihrer Teile, wie die neuzeitliche Wissenschaft immer besser zu sagen weiß, weshalb ein Weltbild auch eher als ein Prozess, als ein fortgesetztes Geschehen, als eine unendliche Geschichte zu verstehen ist, eben als eine «Weltbildung». Mit diesem Wort meint man eine Welt und zugleich das fortgesetzte Arbeiten an ihrer Erscheinung.
Zurück zu Heideggers Worten. Er erklärt das Weltbild als «ein Gemälde vom Seienden im Ganzen», was für ihn konkret bedeutet, dass wir damit «die Welt selbst meinen». Diese Wendung gilt es zu beachten: «Weltbild, wesentlich verstanden, meint daher nicht ein Bild von der Welt, sondern die Welt als Bild begriffen.» Die Möglichkeit, die Welt als ein Bild zu begreifen, zeichnet die Neuzeit aus. Ihr philosophisches Wesen besteht nämlich darin, «dass überhaupt die Welt zum Bild wird», und damit zeigt in diesem Fall das Bild, was es selbst ist, nämlich die Welt, was einen selbst ins Grübeln bringen kann.[5]
An dieser Stelle erlaubt sich der Verfasser dieser Zeilen, auf einen Gedanken hinzuweisen, der in den 1920er Jahren in der Physik aufgekommen ist, als deren Vertreter dabei waren, die oben erwähnte Umwandlung des Weltbilds ihrer Wissenschaft zu vollziehen. Bei dem Versuch, die Atome und ihre Wirklichkeit zu verstehen, bemerkten die Physiker auf einmal, dass sie gar keine Beschreibung der Natur lieferten, wie sie zuvor immer gedacht hatten. Ihre Physik lieferte vielmehr eine Beschreibung des Wissens, das sie von der Natur hatten. So war es zum Beispiel gar nicht möglich, sich ein Bild von einem Atom zu machen, weil diese Gegebenheiten der Natur überhaupt kein Aussehen erkennen ließen. Die Physiker konnten ein Atom nur als Bild begreifen, also im Modus der Kunst und durch die Form, die sie ihm verliehen, und sie durften sich dabei sogar freuen, dass sich die Objekte der Begierde durch eine dauerhafte Gestalt auszeichneten, die sich der menschlichen Einbildungskraft als zugängig erwies. Welche Experimente sie auch mit Atomen unternahmen, zuletzt zeigten sich immer wieder die alten (ewigen, urtümlichen) Atome, nur mit neuen Formen.
Mit diesen Erfahrungen verstanden und praktizierten die Physiker in ihren Laboratorien und mit ihren Theorien höchst konkret, was Heidegger in seinen «Holzwegen» mehr allgemein ausgedrückt hat, dass Atome nämlich zum Bild werden und sich in diesem Umsturz des alten physikalischen Weltbilds das philosophische Wesen der Neuzeit zu erkennen gibt. Ob Heidegger die damals entstehende neuartige Physik der Atome gekannt und so verstanden hat?
Heideggers Gedanke, «dass überhaupt die Welt zum Bild wird», wäre etwa im christlichen Mittelalter noch nicht möglich gewesen. Damals lag das Seiende – Heidegger zufolge – nicht als Bild, sondern nur als «das vom persönlichen Schöpfergott als der obersten Ursache Geschaffene» vor.[6] Es war das «ens creatum», wie man auf Lateinisch dasjenige bezeichnet, was aus höheren Sphären als das Gegenständliche vor die Menschen gebracht und ihnen zugänglich gemacht wird. Wer sich wörtlich auf diese Vorschläge einlässt, wird naturgemäß Mühe haben, vom «Weltbild des mittelalterlichen Menschen» zu sprechen. Dennoch soll auf dieses Konzept hier nicht verzichtet werden, gerade weil der Vorwurf bekannt ist, den Goethes Faust seinem Gesprächspartner Wagner zu Beginn des Dramas macht: «Die Zeiten der Vergangenheit sind uns ein Buch mit sieben Siegeln; was ihr den Geist der Zeiten heißt, das ist (…) der Herren eigner Geist, in dem die Zeiten sich bespiegeln.» Mitglieder der Neuzeit, die sich mit Weltbildern beschäftigen und das entsprechende Denken des Mittelalters verstehen wollen, können gar nicht anders, als diesem die Form eines Weltbilds zu geben, mit dem sie sich selbst zurechtfinden wollen. Nur so lässt sich dann auch der Versuch unternehmen, die Einsichten einer Wissenschaft wie der Physik in ihrer historischen Folge vorzustellen.
Jede Zeit, jede Kultur und jede wissenschaftliche Disziplin macht sich Gedanken über die Welt und die Stellung des Menschen in ihr. Zu jeder Zeit fragen Menschen nach dem Ursprung der Dinge und ihrer Entwicklung. Sie fragen, welcher Sinn in dem ganzen Prozess steckt, an dem sie bewusst und voller Leben teilnehmen und teilhaben. Die Welt wird zum Bild, wenn der Mensch zum Subjekt wird, meint Heidegger. Und zum Subjekt wird der Mensch vor allem in der Wissenschaft, die ihr suchendes Auge auch dem Mittelalter zuwenden kann. Mit der Wissenschaft und ihrer Forschung richten sich moderne Menschen in der Welt ein. «Der Grundvorgang der Neuzeit ist die Eroberung der Welt als Bild», meint der Philosoph in seiner behaglich elektrifizierten Schwarzwaldhütte, und man stimmt ihm gerne zu.[7]
Wer mitverfolgen möchte, wie diese Eroberung der Welt als Bild vonstattengeht, wird fündig in dem Vortrag «Die Physik im Kampf um die Weltanschauung», den Max Planck im Jahre 1935 gehalten hat. Planck betont zu Beginn, dass «eine Weltanschauung, die Anspruch auf umfassende Geltung erhebt, auch auf die Gesetze der unbelebten Natur Rücksicht nehmen muss». Im Verlauf seiner Rede führt er dann aus, «wie die Weltanschauung eines Forschers stets auf die Richtung seiner wissenschaftlichen Arbeit mitbestimmend einwirken» wird und «auch umgekehrt die Resultate seiner Forschung nicht ohne Einfluss auf seine Weltanschauung bleiben können».[8] Man kann sich diesem strebenden Bemühen, diesem Ringen nicht entziehen. Es ist unser Kampf, wenn man so sagen und für die Menschen sprechen darf. Er bestimmt «in den Stürmen des Lebens» (Planck) ihre Geschichte und ihre Kultur. Mehr geht nicht, und die Hoffnung bleibt, die in Goethes Worten lautet: «Wer immer strebend sich bemüht, / Den können wir erlösen.»
2.Durch das Fenster der Wissenschaft
Von Uhren und Wolken, Atomen und Genen
Vom Weltbild der Physik war schon mehrfach die Rede, weshalb das dazugehörige Gemälde in den kommenden Abschnitten genauer vorgestellt werden soll. Natürlich haben andere Disziplinen der Naturwissenschaft – etwa die Chemie, die Biologie und die Geologie – eigene Beiträge zu dem geliefert, was man als Weltbild der Wissenschaft bezeichnen kann. Aber die Physik nimmt in diesem Spektrum als eine Art grundlegende Wissenschaft mit allgemein anwendbaren Gesetzen eine besondere Position ein, weshalb ich mit ihr beginnen will.
Die Eigentümlichkeiten der «Naturwissenschaft mit Sonderstellung», wie die Physik einmal genannt worden ist,[9] lassen sich nicht zuletzt an einigen merkwürdigen Fehleinschätzungen ablesen, die ihren Vertretern durch die Jahrhunderte hindurch unterlaufen sind. Diese Fehleinschätzungen entfalten nach wie vor ihre Wirkung – auch in den dazugehörigen Weltbildern – und stiften manches Unheil bei der öffentlichen Einschätzung der Wissenschaft. Nicht loszuwerden ist zum Beispiel die im frühen 17. Jahrhundert geäußerte Ansicht Galileo Galileis, es gebe «ein Buch der Natur», das in der Sprache der Mathematik verfasst worden ist und das nur von denen gelesen werden kann, die dieses Idiom beherrschen. Zwar konnte im ausgehenden 17. Jahrhundert Isaac Newton tatsächlich ein Gesetz der Gravitation aufstellen, das ausschließlich mathematische Symbole verwendete und die Zeitgenossen dazu verleitete, das Universum als ein Uhrwerk – «Newton’s Clockwork» – anzusehen, das keinerlei Abweichungen zulässt. Aber die Natur besteht neben den durch Schwerkraft bewegten Körpern unter anderem auch aus chemischen Substanzen und lebendigen Wesen mit kreativen Köpfen, und auf einen «Newton des Grashalms» oder eine «Physik der Sitten und des Rechts» wartet die Menschheit bis heute vergeblich (um zum einen eine Formulierung des Philosophen Immanuel Kant und zum Zweiten einen Buchtitel des Soziologen Émile Durkheim zu zitieren).
Natürlich kann man einwenden, dass die Gesetze der Physik letztlich überall gelten und so auch allen Abläufen in der Natur und sogar menschlichen Handlungen zugrunde liegen müssen. Aber der Schluss, dass man die Welt vollständig verstehen und berechnen – und damit banalisieren und entzaubern – kann, wenn man sich nur gut genug bei Atomen, Elektronen und ihren Wechselwirkungen auskennt, führt rasch und nachhaltig in die Irre.
Um es ganz bestimmt und eindeutig zu sagen: Es gibt dieses «Buch der Natur» nicht, von dem Galilei geredet hat und das von irgendeinem transzendenten Autor verfasst worden sein müsste, der ebenso schwer zu fassen bleibt. Wenn man im Bild der Druckerzeugnisse bleiben möchte, lässt sich bestenfalls sagen, dass es ein Magazin der Natur gibt, in dem sich mathematische Beschreibungen mit künstlerischen Darstellungen und begrifflichen Analysen abwechseln und in dem folglich jeder Leser etwas findet, das seinem Geschmack und seiner Neugierde entspricht.
Mechanische und statistische Welten
Bekanntlich ist das Ganze oft nicht nur sehr viel mehr als die Summe seiner Teile, sondern etwas vollkommen anderes: Aus einzelnen und eher trocken daherkommenden H2O-Molekülen kann zum Beispiel im vielfältigen Verbund eine lebensspendende Flüssigkeit namens Wasser werden, und erregbare einzelne Nervenzellen können sich in komplexen Netzwerken zusammenfinden, mit denen sich in aller Ruhe etwas denken lässt. Bei aller mathematischen Geschicklichkeit und Raffinesse mussten die Physiker bald zur Kenntnis nehmen, dass es Grenzen ihres Zugriffs auf die Welt gab. Zu Newtons Zeiten etwa blieb man ratlos vor der Frage, wie die Schwerkraft den Weg von der Erde zu dem Apfel findet, den sie dann auf den Boden zieht, oder gar zu dem Mond, den sie auf seiner Bahn hält. Unabhängig von solchen Unklarheiten im Detail triumphierte zunächst Newtons mathematische Physik im großen Ganzen, und sie hat bis heute ihre Gültigkeit bewahrt – wenn auch etwas eingeschränkt auf passende Gelegenheiten vor allem im Alltag. Wenn Bälle durch die Luft fliegen oder Autos zusammenstoßen, kann man das immer noch mit Newtons Gleichungen nachrechnen, ohne etwas anderes bemühen zu müssen. Das durch den grandiosen Erfolg seiner Bewegungslehre vermittelte mechanische Weltbild spukt vermutlich noch in vielen Köpfen herum, in die es vielfach auch durch den Schulunterricht hineinbefördert wurde.
Mit dem mechanischen Weltbild der Physik ist etwa die Ansicht gemeint, dass physikalische Gesetze die Abläufe der Welt weitgehend erfassen oder gar komplett berechenbar machen könnten. Die Welt zeigt sich in dieser besorgniserregenden Vorstellung wie oben erwähnt als ein Uhrwerk, dessen Räder- oder Federmechanik gnadenlos abläuft, was der polnische Aphoristiker Stanisław Jerzy Lec in die hübschen Worte gegossen hat: «Die Uhr schlägt. Alle.»
Tatsächlich denken viele Zeitgenossen sofort an einen unangenehmen Determinismus, wenn sie von den Gesetzen der klassischen Physik hören, und sie nehmen eher zurückhaltend zur Kenntnis, dass diese exakte Form der Wissenschaft mit ihrer mathematischen Sprache im Verlauf der nachfolgenden Geschichte eine Revolution der Wahrscheinlichkeit erleben und vollziehen musste. Die neuere Physik hat bemerkt und verkündet, dass es vor allem statistische Gesetze sind, die in der Natur wirken. Überall wimmelt es von Wahrscheinlichkeiten und Zufälligkeiten, die in einer komplexen und vielfach vernetzten Welt kaum noch exakte Vorhersagen gestatten – nicht beim Wetter oder beim Börsenhandel und erst recht nicht beim Klima oder bei Wetten auf Fußballergebnisse. Mit dieser Befreiung von den deterministischen Fesseln des mechanischen Denkens können dem Wunsch nach Freiheit neue Möglichkeiten eingeräumt werden, die jetzt immerhin auch im physikalischen Rahmen Platz finden.
Ihren anschaulichen Höhepunkt haben die Entwicklung des statistischen Denkens und ihre Betonung des Zufälligen in jüngster Zeit in dem gefunden, was als «Schmetterlingseffekt» nicht nur in wissenschaftlichen Kreisen, sondern auch im Laiengespräch zirkuliert. In dieser Erzählung vermag es der Flügelschlag eines Schmetterlings etwa irgendwo in Europa, sich über nichtlineare physikalische Wechselwirkungen immer stärker aufzuschaukeln und zuletzt einen Wirbelsturm in der Karibik oder sonst wo auszulösen. Die Physiker können diese merkwürdige Kausalkette mit den Werkzeugen der Komplexitätsforschung berechnen, wobei sie von einem sogenannten deterministischen Chaos ausgehen, mit dessen Hilfe sich physikalische Systeme entwickeln und die Ordnung annehmen, die sich ihren Beobachtern zeigt. «Nichts kann existieren ohne Ordnung», wie Einstein einmal formuliert hat, um zu ergänzen, «nichts kann entstehen ohne Chaos». Es ist nicht leicht, sich in einem chaotischen Zustand zurechtzufinden. Hier verläuft zwar alles brav kausal, wie man es im Alltag gewohnt ist, aber vergleichbare Ursachen führen meist zu stark abweichenden und ungewöhnlichen Folgen.
Diese vielen Worte lassen sich ganz einfach auf ihren weltanschaulichen Punkt bringen, wie es der Philosoph Karl Popper einmal unnachahmlich vorgeschlagen hat. Demnach darf man sich die Welt nicht mehr als Uhrwerk vorstellen, wie man es nach Newton getan hat und wie es noch im 18. Jahrhundert in Mode war – man sollte sich die Welt vielmehr als Wolke denken. Das ist schon allein deshalb ein schönes Bild, weil man nun ohne einen mechanischen Apparat auskommt, den es dauernd aufzuziehen gilt. Dafür bewegt man sich jetzt mit einer luftig-leichten Beweglichkeit am Himmel ohne die schleppende Dynamik der Erde. In einer Wolke gelten natürlich durchgehend und überall die physikalischen Gesetze, nur dass die Menschen nicht mehr in der Lage sind, die genaue Form der himmlischen Gebilde vorherzusagen, die sich zudem dauernd verändern. Warum sich nicht einfach mal an einem schönen Sommertag ins Gras legen und die Wolken betrachten, wie sie am Himmel entlangziehen – bis sich ein Gewitter nähert und es zu grummeln beginnt?
Der Wechsel vom regelmäßig ablaufenden mechanischen Uhrwerk zur chaotisch gestaltreichen dynamischen Wolke vollzieht sich im Anschluss an Entwicklungen des 19. Jahrhunderts, in dem den Menschen «Die Verwandlung der Welt» gelang, wie Historiker die damals einsetzende Verwissenschaftlichung des Daseins mit industriellen Folgen auf den Begriff gebracht haben. Zu dieser Verwandlung trug zum Beispiel die Tatsache bei, dass es dank des Bemühens von Chemikern, die den Einfluss von Licht auf entsprechend empfindliche Substanzen untersucht haben, zum ersten Mal möglich wurde, fotografische Aufnahmen von Gegenständen und Menschen anzufertigen. Diese lieferten so etwas wie ein objektiv wirkendes Bild der Welt und schienen somit auf den ersten Blick ein korrektes Weltbild zu erlauben. Zur umfassenden Verwandlung der Dinge kam es auch deshalb, weil Mathematiker und Physiker die Wirklichkeit, die zuvor ein Thema der Kunst war, von nun an sauber und korrekt als Statistik erfassten. Sie verwandelten den individuellen Menschen in einen Durchschnittsbürger, dessen Lebenserwartung plötzlich berechenbar wurde, was das irdische Dasein zwar nicht entzauberte, aber immerhin das Aufkommen des Versicherungswesens ermöglichte und begünstigte.
Tatsächlich: Das 19. Jahrhundert erlebt einen Triumph der Wahrscheinlichkeit und eine Hinwendung zum Zufälligen, und dieser Wandel des Weltbilds nimmt seinen Ausgang im Bereich der Naturwissenschaften, in dem Physiker anfangen, von Verteilungen zu sprechen und mit ihnen zu rechnen. Wer ein Gas und seine vielen Bausteine untersucht, fragt nicht mehr nach der Bewegung jedes einzelnen Partikels etwa der Luft. Er fragt nach der Verteilung der Geschwindigkeit bei diesen Partikeln, die sich bei der immensen Zahl von Molekülen berechnen und beobachten lässt und dann zum Beispiel erlaubt, die Temperatur eines Gases vorherzusagen. Das heißt, niemand versucht mehr, über einen einzelnen Baustein Auskunft zu geben – das wäre allein der Menge wegen weder sinnvoll noch möglich –, man bemüht sich vielmehr zu ermitteln, welcher Anteil an Molekülen unter welchen Bedingungen durch welche Wechselwirkungen seine Eigenschaften bekommt, die dann als Druck oder Temperatur gemessen werden können und die statistische Sicht der Dinge bestätigen.
So offensichtlich dies im historischen Rückblick erscheint, so leicht übersieht man dabei, dass das, was die Physiker im 19. Jahrhundert mit ihren Gegenständen – vorzugsweise mit Gasen – taten, zur gleichen Zeit einem berühmten Biologen half, das Weltbild seiner Wissenschaft vollständig neu zu entwerfen. Gemeint ist der Brite Charles Darwin, der 1859 den Gedanken einer Evolution der Organismen vorlegte. Es ging ihm darum, die enorme Vielfalt der Organismen und ihre erstaunliche Anpassung an die jeweilige Umwelt zu verstehen. Darwin verzichtete in seiner Darstellung von der Wandlungsfähigkeit der Lebewesen darauf, die Wirkung der natürlichen Selektion in irgendeinem Einzelfall vorherzusagen. Er begnügte sich mit statistischen Aussagen und erklärte, wie Tiere sich auf lange Sicht mit und in ihren vorgefundenen oder ausgewählten Nischen einrichten und ihre Lebensweise entsprechend anpassen. Mit anderen Worten: Darwin nutzte die universelle Gültigkeit des statistischen Denkens aus, mit dem das wissenschaftliche Weltbild des 19. Jahrhunderts charakterisiert werden kann. Dieses Denken ist heute längst selbstverständlich geworden oder sollte es zumindest sein in Zeiten, in denen eine Verkehrs- oder Gesundheitsstatistik der anderen folgt und die Medien unentwegt Wahlprognosen verbreiten oder Wanderbewegungen von Wählern analysieren und dabei mit Prozentzahlen nur so um sich schmeißen.
Der Horizont der Wissenschaft hängt von den jeweiligen Zeitumständen ab. Hinter diesem Horizont liegt die Zukunft, die man vorhersagen möchte, und zwar am besten mit Hilfe des Wissens, das Physiker, Biologen und Chemiker fleißig sammeln. «Zwar weiß ich viel, doch möcht ich alles wissen», verkündet ein trockner Schleicher namens Wagner in Goethes Faust, und im 19. Jahrhundert werden viele Forscher gedacht haben, dass sich dieses Ziel erreichen lässt. Was dabei unter anderem übersehen wurde: Das angestrebte «alles» bleibt ihnen und allen Menschen verwehrt, sobald es auch um die Zukunft geht und sie selbst zu ihr beitragen. Denn so viel Menschen auch zu einem gegebenen Zeitpunkt wissen, eines werden sie nicht wissen, nämlich das, was sie in Zukunft – also hinter dem Horizont der Zeit – wissen werden. Solange sie das Wetter oder die Ausbreitung eines Virus vorhersagen, können sie hoffen, mit ihren Informationen zu verstehen, was auf sie zukommt. Sobald es aber um Prognosen von Abläufen geht, zu denen sie selbst beitragen und deren Beeinflussung sie ändern können, wenn sich ihr Wissen ändert – etwa im Fall des Virus durch Informationen über die Ansteckungsgefahr oder durch Entwicklung von Medikamenten –, entzieht sich das Künftige der Betrachtung. Diese Grenzlinie der kommenden Zeit bleibt den Menschen nicht nur erhalten, sie rückt paradoxerweise mit zunehmendem Wissen näher. Eine Gegenwart, die durch ihr Wissen geprägt ist, muss erleben, wie sich der Horizont der Zeit ihr nähert – und nicht umgekehrt –, während es ihr gleichzeitig verwehrt bleibt, über die schwarze Wand der Zukunft hinauszuschauen. Je mehr Menschen wissen, desto weniger können sie hinter diesen Horizont sehen.
Zurück zu Darwin. Natürlich muss seine Leistung noch unter einem weiteren Aspekt gesehen werden, steckt doch die wesentliche Neuerung seiner Ideen gegenüber dem vorausgehenden Denken in der dynamischen Anschauung der Erde und des Lebens, das sich auf ihr zeigt und entwickelt hat. Vor dem Beginn des 19. Jahrhunderts ging die von Platon initiierte und vom Christentum geförderte durchgängige Sicht auf die Welt davon aus, eine stabile Erde mit konstanten Arten als Produkt einer göttlichen Schöpfung vor Augen zu haben, die für die Ewigkeit angelegt war. Nach 1800 zeigte sich mehr und mehr eine evolutionäre Sicht der Dinge, und zwar sowohl bei geologischen als auch bei biologischen Gegebenheiten. Es war die Zeit, in der Naturforscher zu Weltreisen aufbrachen, um einen Eindruck von der irdischen Mannigfaltigkeit zu gewinnen, der dann Eingang in ihr Weltbild fand.
Alexander von Humboldt prägte in der damaligen Aufbruchsstimmung den kühnen Satz: «Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben.»[10] Mit einer solchen selbstverschuldeten und bequemen Eingrenzung des Horizonts kamen Menschen vom 19. Jahrhundert an nicht mehr weiter, als die Verwandlung der Welt zu einem globalen Dorf mit neuen Bildungsanforderungen ihren historischen Anfang nahm. Die dazugehörige Dynamik bleibt im gegenwärtigen 21. Jahrhundert ungebrochen und zeigt eher steigende Tendenzen, die aus dem Ruder zu laufen scheinen, was viele Folgen für die Fertigung aktueller Weltbilder mit sich bringt, auf die noch einzugehen sein wird.
Es lohnt sich, einen Moment bei Alexander von Humboldt zu verweilen, um die besondere Welt- und Natursicht dieses Reisenden und Forschers in den Blick zu nehmen. Auch sie steht beispielhaft für den Wandel des Weltbilds, der sich um die Wende zum 19. Jahrhundert abgespielt hat. Humboldt wollte eine Naturkunde begründen, die systematisch vorgeht, aber weder auf das Sinnliche verzichtet noch vom Gemüt des Forschers absieht. Es ging ihm darum, die wissenschaftliche Natursicht «um die Dimension der ästhetischen Vernunft zu erweitern und bereichern» und eine «Synthese von Wissenschaft und Ästhetik, von Begriff und Anschauung» herzustellen, wie es Kant in seiner «Kritik der reinen Vernunft» zwar vorgeschlagen, aber selbst nie umgesetzt hat. Solch eine ästhetisch angelegte Wissenschaft würde ihre Ergebnisse in Form von «Naturgemälden» vorstellen, die man auch die dazugehörigen Weltbilder nennen kann.[11]
Der Ausdruck «Naturgemälde» geht auf Humboldt selbst zurück, der damit ein schwer zu erreichendes Ziel bezeichnete. Er hoffte, langfristig eine Verbindung zwischen Wissenschaft und Kunst herstellen zu können. Nur auf diese Weise sah er den humanen Charakter des Unternehmens Naturwissenschaft gewahrt. Für Humboldt war es Aufgabe der Kulturwelt, den Dreiklang «Humanität, Kunst und Wissenschaft» erklingen zu lassen und für alle Menschen hörbar zu machen, eine Aufgabe, die uns immer noch aufgegeben ist. Die Schwierigkeiten, die Humboldts Naturverständnis bereitet, hängen damit zusammen, dass sich hier «eine durchaus romantische Sehweise» zeigt, die viele Menschen für rückwärtsgewandt halten. Sie «beruht auf der Spannung zwischen Individuum und Landschaft, wobei sich diese Spannung in Bewusstsein und Gefühl des Menschen, in seinem Inneren, widerspiegele».[12]
«Am Gestade eines Sees», schreibt Humboldt, «in einem großen Walde, am Fuß dieser vom ewigen Eis bedeckten Berggipfel ist es nicht die materielle Größe, die uns mit dem heimlichen Gefühl der Bewunderung erfüllt. Was zu unserer Seele spricht, was so tiefe und mannigfache Empfindungen in uns wachruft, entzieht sich unseren Messungen, wie auch den Formen der Sprache. Wenn man Naturschönheiten recht lebhaft empfindet, so mag man Landschaften von verschiedenem Charakter gar nicht vergleichen; man würde fürchten, sich selbst im Genuss zu stören.»[13]
Entscheidend ist, dass Humboldt diesen Zugang zur Natur als eine von zwei komplementären Möglichkeiten betrachtet hat. Ästhetischer Naturgenuss und wissenschaftliche Naturerkundung gehören untrennbar zusammen. Deshalb beschreibt Humboldt die Natur wie ein Dichter und Maler – mit poetischer Sprache und in lebendigen Bildern. Er bezieht den Eindruck der Natur auf die menschliche Seele mit ein und redet von Genuss, Gefühl, Furcht, Bewunderung und Erlebnis.
Wie kein Zweiter hat Humboldt Goethes Diktum «Bezüge sind alles, Bezüge sind das Leben» in die wissenschaftliche Tat umgesetzt und erkennend verwirklicht. Humboldt hat sein wissenschaftliches Leben unter anderem damit verbracht, die Lagerung von Gesteinen zu vergleichen, und er hat die wechselseitigen Beziehungen zwischen Pflanzen und Tieren notiert: «Diese Form der Typen, die Gesetze dieser Beziehungen und die ewigen Bande zu bestimmen, durch welche die Erscheinungen des Lebens mit den Phänomenen der unbelebten Natur verknüpft sind: das ist das zentrale Problem für eine Physik der Erde.»[14]
Der Horizont am Himmel
Was die Wissenschaft im Allgemeinen und die Physik im Besonderen angeht, so endet das 19. Jahrhundert dramatisch, und das 20. Jahrhundert beginnt mit Paukenschlägen, die den Umsturz im Weltbild der Physik ankündigen, von dem schon die Rede war und mit dem sich heute eine merkwürdige Antwort auf die berühmte Frage geben lässt, was die Welt im Innersten zusammenhält. Doch bevor dieser aufregende und wahrlich revolutionäre Wechsel im Verständnis der Wirklichkeit zur Sprache kommt, soll ein neugieriger Blick an den Himmel geworfen und gefragt werden, was im Laufe der Geschichte da mit oder ohne Fernrohr gesehen wurde.
Wie relevant dasjenige, was am Firmament erscheint, für das wissenschaftliche Weltbild ist, belegt schon die historische Tatsache, dass die antiken Physiker – wenn man die damals tätigen Philosophen so nennen darf – lieber an den Himmel schauten, um die Bahnen der Planeten und die Positionen der Fixsterne zu erfassen, als sich mit der Bewegung von Äpfeln, Speeren, Steinen und anderen irdischen Gegenständen zu beschäftigen. Eine klare Unterscheidung findet sich bei Aristoteles, der heutigen Lesern den Gefallen tat, einen einsichtigen Horizont am Himmel anzubringen, nämlich die Bahn des Mondes. Der Grieche unterschied die sublunare Sphäre, in der die Menschen auf der Erde leben und in der alles nach physikalischen Vorgaben abläuft, von der supralunaren Welt, in der so etwas wie göttliche Regeln oder kausal übergeordnete Gesetze gelten. Weil in den oberen Gefilden die Götter am Werk sind, laufen die Planeten auf perfekten Kreisen umher. Es gibt kugelförmige Sphären, die sich in aller Ewigkeit drehen und die Planeten erst in sich aufnehmen und dann mit sich herumführen.
Wohlgemerkt – Aristoteles verlegte einen Horizont an den Himmel, vor oder unter dem die Menschen und hinter oder über dem die Götter hausen, was die merkwürdige und wichtige Folge hatte, dass sein Kosmos genau genommen kein Uni- sondern ein Duoversum war, da es sich aus zwei unterscheidbaren Teilen zusammensetzte. Dass dieser Gedanke verworfen werden muss, konnte eigentlich erst im 19. Jahrhundert gezeigt werden, und die wissenschaftliche Quelle, aus der das neue und einheitliche Weltbild entspringt, wird manchen Leser überraschen. Doch dazu später mehr.
Eine eindrückliche bildliche Darstellung des Horizonts am Himmel stammt von Camille Flammarion. «Wanderer am Weltenrand» heißt der berühmt gewordene Holzschnitt, den der französische Astronom und Verfasser zahlreicher populärwissenschaftlicher Schriften 1888 in Paris geschaffen hat. Er zeigt einen Wanderer, der in kriechender Haltung mit Stab, Hand und Haupt den Sternenhimmel durchstößt und hinter den von sechszackigen Leuchten und einer Mondsichel gebildeten Horizont schauen kann. Jenseits des offenbar nicht sehr festen Himmelszeltes, über das sich weder eine Kristallschale noch ein Empyreum oder sonst etwas erhebt, wie es sich sowohl heidnische als auch christliche Himmelgucker früherer Jahrhunderte erträumt oder gedacht haben, zeigt sich eine festgefügt wirkende und eher starre Ordnung.
Der Wanderer erblickt merkwürdige Wolkenformationen, einen Strahlenkranz, ein seltsames Doppelrad ohne erkennbare mechanische Funktion und manches mehr. Angedeutet wird damit eine strukturierte Weite mit endlosen Wiederholungen, die über den Rahmen des Bildes hinausläuft. Ein Mensch kann zwar durch den Himmel und über den Rand der Welt hinaussehen, der Betrachter des Bildes aber bleibt mit den Augen am Rand des Holzschnitts hängen, mit dem Flammarion seine Komposition ein- und abschließt.
Der «Wanderer am Weltenrand», wie ihn Camille Flammarion, ein Zeitgenosse von Vincent van Gogh, 1888 dargestellt hat. Flammarion zeigt dem Betrachter, wie sich das 19. Jahrhundert ein mittelalterliches Weltbild ausgemalt hat, in dessen Rahmen ein Mensch das Diesseits verlassen und in ein Jenseits blicken kann. Mit englischen Ausdrücken, die kein deutsches Pendant haben, könnte man sagen, der Mensch gelangt durch den «Sky» in den «Heaven».
Flammarions kleines Bild misst etwa hundert mal hundertneunzehn Millimeter und wurde lange Zeit für eine Darstellung aus dem Mittelalter gehalten, die einen Pilger auf seiner Reise ans Ende der Welt zeigt. Heute weiß man dank kunsthistorischer Analysen, dass der Holzschnitt im späten 19. Jahrhundert geschaffen wurde, also zu einer Zeit, als sich auch Vincent van Gogh von den jüngsten Erkenntnissen der Astronomie begeistert zeigte und die damals neuen Einsichten in die Spiralform von Galaxien in seiner «Sternennacht» künstlerisch umsetzte. Flammarion erwies sich für van Gogh als kenntnisreicher Wegweiser in die neue Wissenschaft des Himmels, und es könnte sein, dass sein Wanderer einem Gefühl des 19. Jahrhunderts Ausdruck verlieh: Die Menschen hatten endlich gelernt, sich aus dem Kerker der irdischen Lufthülle zu befreien, um in die fernen Dimensionen des Raumes und in die Sphäre der lichten Wahrheit zu schauen. Wer sie erblickt, sieht unter anderem das rätselhafte Doppelrad, von dem die ikonographische Forschung inzwischen annimmt, dass damit das seltsame «Rad im Rad» am Thronwagen Jahwes gemeint ist, über das im Alten Testament der Prophet Ezechiel berichtet, ohne dass man mit dieser Auskunft verstehen müsste, wie sich das Gefährt bewegt.
Überhaupt zeigt Flammarions Außenwelt Aspekte der biblischen Himmelsvision des Propheten Ezechiel. Auf jeden Fall ist sein «Wanderer am Weltenrand» dort angekommen, «wo Himmel und Erde sich berühren», und er durchbricht die Trennlinie, ohne beim Anblick der dahinter sich offenbarenden Wahrheit zugrunde zu gehen und zu sterben. Gelehrte sprechen deshalb mit ernsten Worten davon, dass der himmlische Horizont in dem Holzschnitt «prämortal transzendiert» wird,[15] und was Flammarion 1888 seinen Zeitgenossen mit großer Geste zeigt, ist die Sicht des Menschen, wie sie den Schriften von Nikolaus von Kues und Giovanni Pico della Mirandola am Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit zu entnehmen ist. Der irdische Mensch wird in diesen Schriften erhöht und als sterblicher Gott gesehen, der in der Lage ist, neue Welten zu schaffen und die dazugehörigen grandiosen Visionen zu entwerfen, was Flammarion selbst erfolgreich unternimmt.
Niemand kann genau sagen, was die mittelalterlichen Menschen glaubten, welches Bild der Welt ihnen im Kopf umherging und was sie hinter dem Horizont der alten und vertrauten Welt meinten finden zu können. Im 19. Jahrhundert aber taucht die Sicht einer dahinterliegenden dynamischen Mechanik auf, mit der alles ins Rollen gerät. Die Frage, ob die Menschen sich in dieser Umgebung besser zurechtfinden und in dem jenseitigen Maschinenpark hinter dem Horizont der erlebten Sphäre gut aufgehoben sind, bleibt offen.
Im Licht der Sterne
Im Verlauf des 19. Jahrhunderts versuchten Philosophen unter der Führung des Franzosen Auguste Comte, die Denkrichtung des Positivismus zu etablieren. Diese erhielt ihren Namen von der Vorgabe, ein Weltbild nur auf Grundlage von positiven Befunden – also mittels beobachteter oder gemessener Bedingungen und Sachverhalte – zu entfalten. Comte zufolge konnte es keine positiven Befunde der so definierten Art von weit entfernten Himmelskörpern wie den Sternen geben, da man nicht zu ihnen hinreisen konnte, um etwas von dort mitzubringen. Damit war der alte aristotelische Gedanke eines Duoversums philosophisch abgesegnet und scheinbar für alle Zeiten besiegelt.
Allerdings hatten die positivistischen Denker die Rechnung ohne die immer raffinierter werdende experimentelle Wissenschaft gemacht, womit in diesem Falle vor allem die Chemie gemeint ist. Diese hatte angefangen, ihre Elemente durch sogenannte Spektralanalysen zu charakterisieren. Man spricht dabei von «Flammenproben», die der Verfasser dieser Zeilen noch in seinem Chemiepraktikum durchzuführen hatte und bei denen die Aufgabe darin bestand, aus dem farbigen Licht verbrennender Substanzen, das durch ein geeignetes Gerät – ein Spektrometer – vermessen wurde, auf die einzelnen Elemente zu schließen, die in der Probe zu finden waren.
Die Idee, aus dem Spektrum der Farben in den Flammen auf die leuchtenden chemischen Elemente zu schließen, geht auf die in Heidelberg tätigen Professoren Robert Bunsen und Gustav Kirchhoff zurück, die 1860 eine Abhandlung mit dem Titel «Chemische Analysen durch Spektralbeobachtungen» vorlegten. Hier vermeldeten die beiden Gelehrten eine folgenreiche Horizontüberschreitung und erläuterten ihre Folgen. Die Untersuchung des Lichts, so heißt es dort, also die Spektralanalyse der Strahlung, bietet nicht nur «ein Mittel von bewunderungswürdiger Einfachheit dar, die kleinsten Spuren gewisser Elemente in irdischen Körpern zu entdecken», sie eröffnet der chemischen Forschung zudem «ein bisher völlig verschlossenes Gebiet, das weit über die Grenzen der Erde, ja selbst unseres Sonnensystems hinausreicht. Da es (…) ausreicht, das glühende Gas, um dessen Analyse es sich handelt, zu sehen, so liegt der Gedanke nahe, dass dieselbe Analyse auch anwendbar sei auf die Atmosphäre der Sonne und die helleren Fixsterne.»[16]
Bunsen und Kirchhoff war es gelungen, hinter den Horizont zu gelangen, den Aristoteles errichtet hatte und den die Positivisten zementieren wollten. Die analysierenden Naturforscher konnten mit ihren durch Instrumente verstärkten Augen sehen, was sich jenseits des Mondes und auch jenseits der Sonne in der Welt verbarg: dieselben Elemente, die man auf der Erde gefunden und in einem Periodensystem geordnet hatte. Der den Menschen aufnehmende Kosmos erweist sich also wahrlich als materielle Einheit. Er ist wörtlich ein Universum, in dem überall dieselben Elemente – und keine anderen – zu finden sind, und dieses universell ausgreifende Weltbild verdanken die Menschen der irdischen Wissenschaft namens Chemie.
Das schöne Gefühl, in einem Universum zu leben, scheint dagegen nicht für die Ewigkeit gemacht zu sein, denn die Physiker unserer Tage sind eifrig damit beschäftigt, Paralleluniversen in die Welt setzen. Von einem Inflations-Multiversum ist ebenso zu lesen wie von vielen Welten der Quantentheorie, die auf ein Quanten-Multiversum zulaufen, oder von Schwarzen Löchern, die ein holographisches Multiversum zu erkennen geben. Vor allem der an der amerikanischen Columbia-Universität lehrende Astrophysiker Brian Greene hat viel zu erzählen über «Die verborgene Wirklichkeit», wie sein Buch zu dem Thema heißt, in dem auch simulierte und letztmögliche Multiversen auftauchen. Bei alldem geht es um die unerhörte Idee, dass Menschen nicht in dem, sondern nur in einem Universum leben, das zu einem Multiversum gehört. Sie erlaubt es den Physikern, den er- und belebten Kosmos als eine Blase aus einem Urweltmedium hervorgehen zu lassen, was dann ein neues Urweltbild zur Folge hat, in dem der menschlichen Welt jede Art von Sonderstatus genommen worden ist.
Aber schon Kopernikus hat im 16. Jahrhundert der Welt ihren Sonderstatus genommen. Seinen Ideen soll jetzt die Aufmerksamkeit gebühren, wobei es genügt anzunehmen, dass es den Raum und die Zeit und die Dinge gibt, die sich als Welt dem Nichts entgegenstellen. Das Etwas, diese plumpe Welt, ist unsere kosmische Wohnstätte und Heimat, und nicht irgendein Multiversum, und es bereitet den Menschen genug Herausforderungen und großes Vergnügen.
Kopernikus ernst genommen
Im 19. Jahrhundert vollzog sich also eine Fülle von Verwandlungen in der Welt, und dies passierte auch ganz konkret im Bereich der Physik, die einen immer genaueren und präziseren Blick in den Himmel richtete. Zu Beginn der 1830er Jahre bekam der Königsberger Astronom Friedrich Wilhelm Bessel aus der Münchener Werkstatt von Joseph von Fraunhofer ein neues Instrument, das Heliometer heißt und exakte Beobachtungen von Sternpositionen zuließ. Bessel wandte seine Aufmerksamkeit vornehmlich einem mit der Nummer 61 bezeichneten Himmelskörper im Sternbild Schwan zu – es handelt sich, genauer gesagt, um einen Doppelstern, der als 61 Cygni in der Literatur geführt wird –, und 1838 konnte er nachweisen, dass die Bestimmung seiner Position im Frühjahr ein anderes Ergebnis liefert als im Herbst. Die Fachwelt sprach von der schwierigen Messung einer winzigen Parallaxe, wobei ihre gelungene Ermittlung für den Kenner ein für allemal bewies, dass sich die Erde um die Sonne dreht. Im Laufe eines Jahres verändert sich nämlich dank dieser Rotation der Winkel, unter dem 61 Cygni anvisiert werden muss, und so klein diese Parallaxe auch ist, mit dem neuen Heliometer konnte Bessel sie ausmachen.
Die Zeitgenossen feierten sein Vorgehen und die Messungen als den «größten und ruhmvollsten Erfolg der praktischen Astronomie», vor allem weil sie der Meinung waren, dass ihre Wissenschaft nun endlich Mittel und Wege gefunden hatte, das Universum in seiner vollen Größe zu durchmessen. Zudem teilten sie Bessels Ansicht, dabei habe sich unter anderem gezeigt, «dass die Sonne auch nur ein gewöhnliches von den zahllosen Sandkörnern ist, welche das Weltall erfüllen» – eine Erkenntnis, die ihn und seine Kollegen nicht entsetzt hat und über die sie vielmehr ausgelassen jubeln konnten.[17]
Diese großen Worte verdecken allerdings etwas, das für die historische Betrachtung von Belang ist: die für manchen vielleicht überraschende Tatsache, dass Bessels sorgfältiger und scharfer Blick auf den Doppelstern der erste wirklich wissenschaftliche Nachweis dafür war, dass sich die Erde um die Sonne dreht und nicht umgekehrt, so wie Nikolaus Kopernikus zum ersten Mal im 16. Jahrhundert vorgeschlagen hatte. Als Kopernikus 1543 auf seinem Totenbett sein epochales Werk über «Die Umwälzungen der Himmelssphären» («De revolutionibus orbium coelestium») in Händen halten konnte, in dem das geozentrische Weltbild der Antike durch eine heliozentrische Konstruktion mit der Sonne im Mittelpunkt der Welt abgelöst wurde, da gab es keinerlei durch Beobachtungen gestützte Beweise für seine Sicht der himmlischen Dinge. Sie gab es weder im 17. Jahrhundert, als Johannes Kepler und Galileo Galilei sich zum heliozentrischen Weltbild bekannten, noch im 18. Jahrhundert, als Newton versuchte, bessere Fernrohre zu konstruieren, mit denen er und andere hofften, weiter sehen zu können.
Die Welt musste auf das Fraunhofer’sche Heliometer und Bessels Präzisionsmessung im 19. Jahrhundert warten, um für die kopernikanische Wende endlich «Mission accomplished» melden zu können – wobei sich die merkwürdige Beobachtung machen lässt, dass die Mehrzahl von Bessels Zeitgenossen diesen Aspekt unbeachtet links liegenließ. Das neue Weltbild mit der ruhenden Sonne im Zentrum und einer Erde, die sich auf ihrer Umlaufbahn bewegte, hatte sich offenbar längst ohne irgendeine empirische Evidenz durchgesetzt. Das sollte einen aber nicht daran hindern zu fragen, was zum Erfolg und zur Akzeptanz der kopernikanischen Umwälzung führen konnte, die für Galilei und seine Zeitgenossen noch lebensgefährlich war und die eigentlich dem Augenschein widerspricht. Man sieht doch, dass die Sonne morgens auf- und abends untergeht, und man sieht und spürt auch nicht, dass sich die Erde dabei dreht.
Bevor darauf eingegangen wird, soll die polemisch wirkende Frage gestellt werden, wer sich in der gegenwärtigen Zeit eigentlich ein angemessenes Bild davon macht, was es heißt, in einem heliozentrischen System auf einer sich rasend drehenden Erde zu leben. Wer macht sich wenigstens ab und zu einmal klar, dass er oder sie die meiste Zeit des Lebens «mit dem Kopf nach unten im Weltall hängt», wie Erich Kästner es in seinem Gedicht mit dem Titel «Kopernikanische Charaktere gesucht» fordert? Der Verfasser dieser Zeilen vermutet, dass die meisten Menschen zwar mit ihrem Kopf wissen, dass sie auf einer Kugel im All schweben. Die Nachricht bleibt aber auf dem Weg zum Herzen stecken. Man mag sich zudem vorstellen, stets oben auf der Kugel zu sein, und diese Vorstellung auch dann beibehalten, wenn man sich in Australien und damit «down under» befindet oder nach Südamerika fliegt. Der Himmel ist oben, egal, wo man sich aufhält.
Primum Mobile
Dass auch Gott immer oben, im Himmel, zu finden ist – während unten nur die Hölle wartet –, lässt sich nicht nur psychologisch leicht nachvollziehen – wo wenn nicht oben soll der Höchste denn sein? –, diese Anordnung bereitet auch historisch keine Mühe. Der Grund dafür liegt darin, dass das christliche Mittelalter etwa um das Jahr 1300 das antike Weltbild mit kugelförmigen Sphären übernahm, das nach den Tagen des Aristoteles weitergeführt worden war und irgendwann einmal den Namen des Astronomen Claudius Ptolemäus erhalten hatte, der in der Bibliothek von Alexandria arbeiten konnte.
In seiner berühmten Schrift mit dem arabischen Namen «Almagest» ergänzte Ptolemäus in den ersten nachchristlichen Zeiten das von seinen Vorgängern überlieferte Modell. Dieses war in Form von Zwiebelschalen angelegt: Es gab sieben Sphären für die sieben bekannten Planeten, und sie wurden von einer achten Sphäre abgeschlossen, in der die Fixsterne ihren Platz zugewiesen bekamen. Ptolemäus beließ die ruhende Erde mit den zum Himmel schauenden Menschen im Mittelpunkt dieses Zwiebelschalenkosmos. Er fügte dem Ganzen aber noch eine neunte Sphäre hinzu, was zwar aus rein astronomischen Gründen geschah, dann aber aus anderen – weltanschaulichen – Motiven gern übernommen wurde und eine erweiterte Sicht der Dinge ermöglichte.
Ptolemäus war besorgt um das Ergebnis einiger sorgfältiger Messungen, die eine allmähliche Bewegung am Himmel erkennen ließen, die heutige Sternkundige mit dem Begriff «Präzession» kennzeichnen. Gemeint ist damit eine langsame Richtungsänderung der Erdachse, und diese läuft neben der vertrauten Rotation ab, die den Wechsel von Tag und Nacht hervorbringt. Ptolemäus konnte von dieser Eigendynamik des Planeten nichts wissen – das himmlische Denken konnte sie erst nach Kopernikus in Angriff nehmen –, aber er wollte die Messergebnisse in sein System einbauen, und so führte er im 2. Jahrhundert nach Christus eine neunte Sphäre als Hilfskonstruktion ein, wobei auf die erstaunlich komplizierten Details hier nur mit einem bewundernden Kopfnicken hingewiesen werden kann. Wichtiger ist, dass sein Vorschlag von den nachfolgenden Philosophen begeistert aufgegriffen wurde. Die Neuplatoniker zeigten sich nicht unbedingt an den kosmischen Feinheiten interessiert, träumten dafür aber von einem reinen Kristallhimmel, der über allem schwebte und der folglich nur jenseits des Horizonts liegen konnte, den die Fixsterne bildeten.
Die neunte Sphäre hinter dem Horizont – sie stellte für das frühe nachchristliche Denken das ersehnte Eine in der Welt dar. In den Augen der Neuplatoniker stand sie für das höchste Sein, aus dem heraus die Himmelskörper in Bewegung versetzt wurden, weshalb sie dieser Sphäre auch den Namen «Primum Mobile» gaben, also den eines ersten Bewegers der Welt. In dieser Gestalt, mit diesem Schlussstein des antiken Systems aus Kugelschalen, gelangte der heidnische Kosmos in die christliche Kultur des Abendlandes, wie man es zum Beispiel bei Dante in der «Göttlichen Komödie» nachlesen kann.
In dem überlieferten materiellen Stufenbau erkannten die Gläubigen natürlich zusätzlich eine ethische Schichtung, und da in diesem Denken galt, «alles Gute kommt von oben», wurde der im Himmel thronende Gott-Vater in der obersten Sphäre angesiedelt, wobei die frühmittelalterlichen Patriarchen dafür den Namen «Empyreum» einführten, was so viel wie «Feuerhimmel» heißt. Diese Festlegung liefert zugleich den Grund, warum sich die Menschen in und seit dieser Zeit im Zentrum der Welt mit ihrer ruhenden Erde wohlfühlen konnten, wenn das das richtige Wort ist. Wenn Gott ganz oben ist, mussten sie ganz unten sein, und einen tieferen Punkt als die Mitte gibt es in diesem Modell nicht, das immer noch nach Zwiebelschalen geformt ist. Das heißt, zwar lebten die Menschen in der Mitte der Welt, aber nicht in der Mitte der Kugel, auf der sie hockten. Man nahm eher an, oben auf der Erde zu sein, und dann gab es etwas Tieferes, nämlich den Erdmittelpunkt und die Rückseite. Dort siedelte Dante die Hölle an, denn auch sie musste einen Ort haben. Er lag eben in der Unterwelt. Mit anderen Worten und der Hölle zum Trotz: Die zentrale Position der Menschen und ihres Heimatplaneten im Weltbild des Ptolemäus zeigte keine bevorzugte Stellung an. Sie drückte vielmehr im Gegenteil die Selbsterniedrigung der Menschen und ihre demütige Haltung Gott gegenüber aus.
Ein Wandel dieser Selbstsicht vollzog sich erst mit den Zeiten der Renaissance, in denen Kopernikus lebte und auftrat. Als sich der polnische Astronom daranmachte, die Sonne zu verschieben und anzuhalten und die Erde um sie kreisen zu lassen, da unternahm er das unerhörte Wagnis, sich und seinesgleichen näher zu Gott zu bringen und in diesem Sinne zu erhöhen. Wer – wie etwa Sigmund Freud – meint, die kopernikanische Wende bringe eine Erniedrigung oder gar eine gesundheitsschädliche Kränkung des Menschen mit sich, der liegt nicht nur völlig falsch, er verbreitet zudem gefährlichen Unsinn und übersieht zuletzt eine besondere Pointe. Sie besteht darin, dass der Begriff der kopernikanischen Wende nicht durch einen Astronomen, sondern durch den Philosophen Kant eingeführt wurde.
Kant kannte sich mit Kopernikus aus, und er hatte verstanden, dass die Erde (mindestens) zwei Drehungen vollzieht – die erste um die Sonne und die zweite um ihre eigene Achse. Kant war besonders fasziniert von der zweiten Rotation. Er kam zu dem Schluss, dass die Bewegungen der Sterne, wie sie sich am Himmel darbieten, nicht durch die Objekte selbst, sondern durch die Drehung der Erde und des Beobachters auf ihr zustande kommt. Der Philosoph regte nun eine entsprechende metaphysische Wende an, indem er vorschlug, dass die Gesetze, die sich in der Natur zeigen, nicht dort zu finden sind, sondern vielmehr von und aus dem Menschen stammen, der sie aufstellt und der Natur auferlegt. Die Menschen halten sich nicht in Raum und Zeit auf, Raum und Zeit sind Erkenntnisformen, mit denen der Mensch die Welt wahrnimmt.