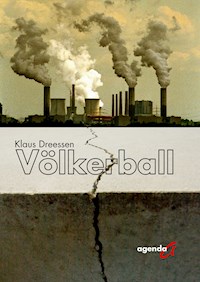Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
"Kein Volk kann ohne geschichtliche Identität leben", sagen führende deutsche Historiker. Deutschland verfügt gegenwärtig über keine Identität. Warum nicht? Wer verhindert das? Darf das deutsche Volk überhaupt eine geschichtliche Identität für sich beanspruchen, oder erschöpft sich diese seit dem Zweiten Weltkrieg in der kollektiven Schuld an den Verbrechen der Nazis? Klaus Dreessen erzählt in diesem zweiten Teil seiner Spurensuche die Geschichte Europas vom Westfälischen Frieden 1648 bis in die heutige Zeit. Er stellt unbequeme Fragen: Musste das Verlassen des heiligen römischen Sonderwegs zwangsläufig in den Nationalsozialismus führen? Welche Rolle spielten Preußen, Frankreich, England, Russland, Charles Darwin, Karl Marx und das imperiale, industrielle Fortschrittsfieber beim Marsch in den ersten Weltkrieg? Wollte Hitler wirklich Deutschland retten oder nur sich selbst? Ist Deutschland kollektiv schuldig für die Morde Hitlers? Waren Lenin und Stalin Sozialisten oder rot lackierte Faschisten? Eine überaus spannende Suche nach neuen Antworten, die Überraschendes zutage fördert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 890
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zum Autor:
Klaus Dreessen studierte Volkswirtschaft in Münster und Hamburg und promovierte mit einem Thema über die DDR (erschienen 1973 bei J.C.B. Mohr, Tübingen). Er ist Autor mehrerer Sachbücher und befasst sich seit vielen Jahren mit der Frage nach den Ursachen des deutschen Sonderwegs in der Geschichte. Wie schon in seinem ersten Buch mit dem Titel Spurensuche - auf der Fährte zum deutschen Sonderweg geht der Autor auch hier der Frage nach der geschichtlichen Identität Deutschlands nach. Klaus Dreessen gehört keiner politischen Partei oder Gruppierung an. Er schreibt für ein breites Publikum, das sich dafür interessiert, weshalb Deutschland heute da steht, wo es steht, weshalb es siebzig Jahre nach Kriegsende immer noch als ein von Neurosen geplagtes Volk ist. Auch dieses Buch ist keine trockene Kost für Historiker, sondern eine überaus spannende, unterhaltsam geschriebene und lehrreiche Erzählung der Geschichte und zugleich eine Aufzeichnung von guten Gründen, die es nahelegen, im Vertrauen auf eine grundsolide, tausendjährige deutsche Geschichte neurotische Anwandlungen ad acta zu legen und den notwendigen Schritt in die erlösende Normalität zu tun.
Inhalt
Sultan Mehmed der Prächtige und Louis der Allerherrlichste
Ein christlicher Orden als Keimzelle Preußens
Die Hanse – erste nichtstaatliche Organisation und Großmacht
Vom Ritterstaat im Land der Pruzzen zum Herzogtum Preußen
Friedrich der Große verlässt den heiligen deutschen Sonderweg
Preußens Desinteresse am Kampf um eine Vormacht an der Ostsee
Die Französische Revolution gebiert Chaos, Krieg und Diktatur
Die „gänzliche Abwesenheit eines deutschen Nationalgeistes“
Napoleon schleppt Krieg und französisches Chaos nach Europa
Der Wiener Kongress bleibt im Sumpf des Alten stecken
Die Deutschen träumen
Jetzt geht ein Ruf wie Donnerhall
Zwei Revolutionen entwurzeln die Menschen in Europa
Allmächtige Masterpläne für die Entwicklung der Menschheit
Allmachtswahn vergiftet die Geister
Herrscher von gestern mit den Waffen von morgen
Britische Beklemmungen und Ängste
Blind rennen alle ins Verderben
Ein Kampf deutscher Kultur gegen europäische Zivilisation?
Die Presse lügt wie gedruckt
Wer beendet den Wahnsinn?
Vom Krieg in den Bürgerkrieg
Frieden als Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln
Ein Bumerang aus dem Osten fliegt zurück ins Reich
Verschnaufpause in den Goldenen Zwanzigern
Roter Faschismus in Moskau
„In Goldman Sachs we trust“
Ein giftiges Biotop für einen kriminellen Psychopathen
Hitler und die minderjährigen Mädchen
Die Jagd des Psychopathen nach Endorphinen
Der Irrsinn im Kopf entspricht dem Irrsinn im Land
Das Volk spurt und kommt unter die Räder
Die Morde Stalins beflügeln Hitlers Aufstieg
Eine Jugend ohne Perspektive
Der Psychopath nimmt Platz im Cockpit des Reiches
Er fackelt nicht lange – erster Blitzkrieg gegen das eigene Volk
Jugend wehrt sich
Pseudowissenschaftliche Komplizenschaft im Rassenwahn
Die Reichskristallnacht – ein gezielter Überfall zur Geldbeschaffung
Die Kirche und der Fall Reuchlin
Völkermord als Heldentat – und Staatsgeheimnis
Der Untergang des braunen Faschisten und seine Folgen
Fischers Fritz fischte im Trüben
1968 mit blinder Wut zur reinen Wahrheit
Die Divisionen des Papstes und der Untergang des Roten Faschismus
Mit dem Mut der Protestanten
Der Bankrott der Bonzen
Krisenmanagement der Hilflosen
Aufräumen im Osten ohne Schuldzuweisungen
Aufräumen im Westen mit falschen Schuldzuweisungen
Wenn alle Schwäne weiß sein müssen
Christliche Bürger schützten jüdische Bürger
Der Fall Wilhelmine Berenskötter und andere
Der deutsche Sonderweg als Betriebsunfall von 1871?
Mit der Hypermoral auf einen neuen deutschen Sonderweg
„Wir sind das Volk“ und „Wir schaffen das“
Hoffnung auf Frischluft im Augiasstall der Historiker
Die Wiederkehr der Pädophilen
Ein Blick auf unsere Flüchtlinge
Literatur
Sultan Mehmed der Prächtige und Louis der Allerherrlichste
Nach der völligen Zerstörung Deutschlands im Dreißigjährigen Krieg hätte sich für Frankreich die Möglichkeit geboten, endlich die seit langem angestrebte Rolle der Führungsmacht in Europa zu übernehmen. Aber Frankreich nutzte diese Chance nicht. Das Land hatte auch keinerlei Erfahrung im Umgang mit einem Gebilde wie dem Heiligen Römischen Reich. Ihm fehlte das Sensorium für das komplizierte Zurückstecken eigener Interessen gegenüber dem europäischen großen Ganzen. Und es hatte schon bald einen König, der ganz besonders wenig in der Lage war, sich in diese Regelmechanismen einer Reichsidee hinein zu denken oder wenigstens zu fühlen. Er hatte davon offensichtlich nicht einmal eine Ahnung. Anstatt das ganze Deutschland, das zerschlagen an seiner Seite am Boden lag, für sich einzunehmen – nicht zu vereinnahmen – und ihm und auch den anderen europäischen Staaten das Gefühl zu vermitteln, mit ihren Lebensinteressen gut bei Frankreich aufgehoben zu sein, insbesondere den Deutschen den Phantomschmerz einer nochmals geschwächten Reichsführung zu nehmen und ihnen möglicherweise sogar das Gefühl zu vermitteln, von Paris aus besser koordiniert zu werden als zuvor von Wien, anstatt also den ganzen, großen deutschen Kuchen in loser Form an sich zu binden, wollte Ludwig XIV die kleine Rheinpfalz – und nicht nur diese – fest und dauerhaft seinem Reich einverleiben. Und so galoppierte er, der Sonnenkönig, der von sich selber sagte „Die Leidenschaft für den Ruhm hat in Meiner Seele gewiss den Vorrang vor allen anderen“, sein Leben lang in die Vorgärten anderer europäischer Staaten und Völker mit der Behauptung, sie gehörten alle ihm, und er mehrte diesen seinen Ruhm auf Kosten seiner Nachbarn und letztlich auf Kosten des Ansehens seines Landes, das er zudem wirtschaftlich ruinierte.
Seine Politik hatte einen Namen: „Reunionspolitik“ nannte er den Versuch, Frankreich als ein großes Gallien auferstehen zu lassen. Frankreich in den Grenzen Galliens vor der Eroberung durch Caesar. Alle Erniedrigungen und Niederlagen der zurückliegenden 1.700 Jahre sollten getilgt werden, ausgelöscht, vergessen. Frankreich sollte endlich die Position in Europa einnehmen, die allein seiner würdig war, deren Grundlagen Caesar aber schon sehr früh zerstört hatte und die die Deutschen mit ihrer „heiligen Reichsidee“ tausend Jahre lang für sich in Anspruch und wahrgenommen hatten: die Position der herrschenden Vormacht in Europa, wie sie zuvor nur die Römer innegehabt hatten.
Sie nannten es Reunionspolitik, als hätte zwischen dem Rhein und der französischen Grenze im Elsass und in Lothringen und in der Pfalz, in Mainz und Trier und Köln seit hunderten von Jahren eine französische Exklave existiert, in der die Menschen die ganze Zeit sehnlichst darauf gewartet hätten, mit dem französischen Mutterland wiedervereint zu werden. Sie nannten „Wiedervereinigung“, was nichts anderes war als die brutale Eroberung von Landstrichen, in denen 1.700 Jahre lang nicht gallische Stämme, sondern deutsche relativ friedlich gelebt, gearbeitet, gesungen, gedichtet und Kinder gezeugt hatten und irgendwann gestorben und beerdigt worden waren. Um dem Landraub den Anschein eines legalen Anspruchs zu geben, hatte der Sonnenkönig Reunionskammern eingerichtet, die die angebliche historische Zugehörigkeit der linksrheinischen Gebiete zu Frankreich nachzuweisen hatten. Dieses Verfahren ähnelt in seiner Dürftigkeit und Dreistigkeit durchaus dem Versuch der Habsburger, Caesar zu ihrem Urgroßvater und ihr Herzogtum zu einem Erzherzogtum zu machen. Dieses Verfahren des Sonnenkönigs war schon damals – und sogar in Frankreich – umstritten und hat vor der Geschichte ebenso wenig Bestand gehabt wie die Mogeleien der Habsburger.
Mit der Einverleibung fremder Territorien begann Ludwig in Spanien. Dort wollte er aus seiner Ehe mit Maria Theresia, der Tochter des spanischen Königs Philipp IV., Kapital schlagen. Als Bedingung für einen Frieden nach einem vierundzwanzigjährigen Krieg Frankreichs gegen Spanien hatte der spanische König 1659 seine Tochter Maria Theresia mit dem Sonnenkönig verheiraten müssen. Böses ahnend hatte Philipp zur Bedingung gemacht, dass seine Tochter damit auf alle Erbansprüche nach seinem Tod verzichtete. Der Vater war 1665 kaum tot, als der Sonnenkönig eben diese Ansprüche erhob. Sie betrafen Teile der Spanischen Niederlande, also jene Teile im Süden der Niederlande, die katholisch geblieben waren, als die nördlichen zum Protestantismus übergetreten waren und sich 1579, als Protestantische Republik der Vereinigten Provinzen unter Wilhelm von Oranien, für von Spanien unabhängig erklärt hatten. Übrig geblieben waren damals jene niederländischen Provinzen, die heute im Wesentlichen Belgien und Luxemburg umfassen. Die wollte sich der Sonnenkönig einverleiben. Im Einzelnen waren das die Herzogtümer Brabant und Limburg Cambrai, die Markgrafschaft Antwerpen, die Herrschaft Mechelen, Gelderland, die Grafschaft Namur, Artois und Hennegau, ein Drittel der Freigrafschaft Burgund und ein Viertel des Herzogtums Luxemburg. Als Begründung für seine Forderung gab der Herrlichste aller Herrscher an, die Mitgift für Maria sei geringer gewesen als vereinbart und damit ihr Erbverzicht unwirksam.
Ludwig XIV. im Krönungsornat (Porträt von Hyacinthe Rigaud, 1701)1
1667 erklärte er Spanien den Krieg. Den Habsburger Kaiser hatte er in Geheimverhandlungen ruhiggestellt mit dem Versprechen, nach einem Sieg Spanien zwischen Frankreich und dem Habsburger Reich aufzuteilen. Das Reich sollte ganz Spanien, das Herzogtum Mailand und alle spanischen Kolonien erhalten, während Frankreich sich mit den Spanischen Niederlanden, der Franche-Comté, Navarra und dem Königreich Neapel-Sizilien begnügen wollte. Diese französische Bescheidenheit kennzeichnet auf der einen Seite die Intensität des französischen Wunsches, das Reich hier herauszuhalten, und auf der anderen die Einfalt des Habsburgers, das Angebot so eines Charakters ernst zu nehmen. Zwei Jahre dauerte der Krieg, in dessen Verlauf nahezu alle anderen Staaten von Rang in Geheimverhandlungen eines jeden gegen jeden eingebunden waren, bis 1668 in Aachen Frieden geschlossen wurde, in dem Spanien einige Gebiete an Frankreich abtreten musste. Von einer Aufteilung Spaniens und seiner Kolonien war nicht mehr die Rede. Der Krieg ging ursprünglich wahrheitsgemäß als erster Raubkrieg Ludwig des XIV. in die Geschichtsbücher ein. Heute heißt er politisch korrekt „Spanischer Erbfolgekrieg“.
Vier Jahre später marschierte Ludwig der Herrliche gegen die Vereinigten Niederlande, weil die im vorherigen Krieg zuerst gemeinsame Sache mit ihm gemacht hatten, da sie gerade in einen Krieg gegen England verstrickt gewesen waren und Ludwig ihnen die Aufteilung des katholischen Rests der Spanischen Niederlande angeboten hatte – wieder einmal. Dann aber hatten die Niederlande doch lieber einen schnellen Frieden mit England geschlossen und waren mit diesen und den Schweden gegen eine französische Vormacht in Europa angerannt. Das musste nun bestraft werden. Es entstand ein siebenjähriger Krieg von 1672 bis 1679 gegen die Niederlande, in dem sich letztlich auch England auf die Seite der Franzosen stellte, ebenso der Fürstbischof von Münster und der Erzbischof von Köln, die sich die Chance nicht entgehen lassen wollten, einem protestantischen Abtrünnigen eins auszuwischen. Gegen diese Übermacht konnten die Niederländer nicht bestehen. Alleingelassen von aller Welt wussten sie sich keinen anderen Rat, als ihr Land zu fluten. Um eine vollständige Niederlage zu verhindern, öffnete der militärische Führer Wilhelm von Oranien Schleusen und Dämme und setzte das Land unter Wasser, um den Vormarsch der Franzosen zu stoppen. Die Bewohner wurden hinter die Wasserlinie evakuiert. Die Franzosen wandten sich anderen Zielen zu. Zur Unterstützung der Niederländer griffen schließlich Spanien und das Reich ein. Und weil auch Brandenburg den Holländern zu Hilfe eilte, wollte Schweden die Chance nicht ungenutzt lassen und marschierte in Abwesenheit der brandenburgischen Truppen in die nordöstliche Streusanddose des Reiches ein – aus der allerdings der brandenburgische Kurfürst Friedrich Wilhelm I. sie mit Unterstützung der Dänen wieder verjagte. Der Krieg des Sonnenkönigs, den er für sich entscheiden konnte und der ihm einige Zugewinne an Land brachte, fand als zweiter Raubkrieg Ludwig des XIV. Eingang in die Geschichtsbücher.
Weil aber der Appetit beim Essen kommt und nichts so erfolgreich macht wie der Erfolg, nutzte Ludwig XIV. die Ergebnisse der Reunionskommissionen zu weiterer Landnahme. Er besetzte – ohne auf militärischen Widerstand zu treffen – in den folgenden Jahren der Reihe nach große Teile des Elsass, Luxemburgs, der Pfalz und des heutigen Saarlandes und gliederte sie in den französischen Staat ein. Auch Gebiete, für die selbst die Reunionskammern eine historische Zugehörigkeit zu Frankreich nicht konstruieren konnten, wurden von ihm annektiert. Dazu gehörte auch die Stadt Straßburg. Die militärische Gegenwehr des Reiches war ausgeblieben, weil Kaiser und Reich seit 1664 in einen neuen Feldzug der Türken gegen das Reich verwickelt waren. Um dem Risiko eines Zweifrontenkrieges zu entgehen, bemühte man sich im Westen um Schadensbegrenzung. Die kaiserlichen Verhandlungsführer gestanden dem Sonnenkönig 1684 im „Regensburger Stillstand“ zu, nichts gegen seine bisherigen Eingemeindungen zu unternehmen, wenn er sich mit dem begnügte, was er sich bereits genommen hatte. Damit hofften sie den Aderlass auf dieser Seite des Reiches zu stoppen und sich ganz der noch größeren Gefahr des Türkensturmes widmen zu können.
Den Türken war schon lange nichts Großes mehr gelungen. Seit der siegreichen Schlacht auf dem Amselfeld 1389, unter der die Serben heute noch heftig leiden, und seit der Eroberung Konstantinopels 1453, mit der die Türken die Reste eines alten Weltreiches zum Einsturz gebracht hatten, hatten sie nichts wirklich Weltbewegendes mehr zustande gebracht, wenn man mal von der Löschung Ungarns von der Landkarte 1526 absieht, das sie in ihr Imperium eingegliedert hatten. 1529 hatten sie kampflos von Wien abziehen müssen, weil ihnen die Verpflegung ausgegangen und der Winter zu kalt gewesen war. 1552 hatten sie die Österreicher besiegt, aber kaum Land gewonnen. Mal hier-, mal dorthin waren sie galoppiert, gegen die Serben und die Kroaten, gegen die Österreicher und gegen die Russen, mal gegen die Polen und dann wieder gegen die Ungarn. Kleinkram hatten sie eingesammelt, wie die Festung Neuhäusl, und teilweise auch wieder verloren. Unterwegs gewesen waren sie immer.
Auch Ahmed Köprülü der Großwesir war im April 1663 mit einigen zigtausend Mann losgezogen. Er hatte im August die Österreicher besiegt und Belgrad besetzt. Im Mai des darauffolgenden Jahres war er mit vierzigtausend Mann weitergezogen nach Mogersdorf zum entscheidenden Schlag gegen das christliche Abendland. Zunächst hatte es gut ausgesehen für Ahmed, aber dann hatten die kaiserlichen Truppen plötzlich Verstärkung aus Bayern, Schwaben, Niedersachsen, Westfalen und Franken erhalten. Und die hatten ihn in die Flucht geschlagen. Von seinen vierzigtausend Mann hatte der Großwesir zehntausend verloren, gegenüber zweitausend bei den Truppen des Reiches. Im August 1664 hatte er Frieden schließen müssen. Schlimmer noch war es den Osmanen in Polen ergangen. In deren Riesenreich hatten die Kosaken in der polnisch dominierten Ukraine rebelliert und die Osmanen um Hilfe gebeten, damit Polen diese Gebiete an den Sultan abträte. Als den Polen das missfiel, hatte der Sultan 1672 gegen das Heer von Jan Sobieski losgeschlagen und sich im November 1673 eine katastrophale Niederlage eingefangen. Jan Sobieski war daraufhin zu Hause zum König Johann Sobieski III. von Polen gekürt worden.
Die Türken hatten dann eine Pause eingelegt in ihren Eroberungsplänen. Bis Sultan Mehmed IV. zehn Jahre später 1683 erneut eine Chance zur Attacke witterte, als er wieder einen Wink vom französischen König erhielt, dass es dem genehm wäre, wenn der Türke den Kaiser im Osten beschäftigen würde. Das ließ sich Mehmed nicht zweimal sagen. Im März 1683 brach er mit hundertfünfzigtausend Mann zu einem neuen Versuch der Eroberung des christlichen Abendlandes auf. Tatsächlich ging es nicht nur um die Existenz des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, sondern um die Existenz des Christentums und die der europäisch-abendländischen Kultur. Sogar den Papst ließ es von seinem Heiligen Stuhl hochschnellen. Er bewegte den Kaiser und den polnischen König zur Unterschrift eines Vertrages, in dem sich diese zum gemeinsamen Kampf gegen den Türkensturm verpflichteten. Ob er auch in Frankreich angefragt hat, ist nicht überliefert. Möglicherweise war ihm klar gewesen, was für eine Antwort er erhalten hätte. Österreich hatte sich bereit erklärt, alle Schulden Polens gegenüber den Schweden aus dem letzten polnisch-schwedischen Krieg zu übernehmen und auch die eigenen Forderungen gegen Polen zu streichen. Der Kaiser selbst war – als Habsburger – nicht so sehr der starke Krieger. Als die Türken unter ihrem Großwesir Kara Mustafa 1683 immer näher an Wien heranrückten, hatte Leopold I., der allerchristlichste Beschützer der Christenheit, sich mitsamt seiner Familie unter den staunenden Blicken der Wiener Bevölkerung aus dem Staube gemacht, um sich in Passau in Sicherheit zu bringen, wo er am 17. Juli 1683 eintraf. Vermutlich hätte er dem Mustafa eher höchstpersönlich einen Heiratsantrag gemacht – obwohl er nicht schwul war –, als persönlich mit dem Schwert gegen ihn anzugehen. Darin unterschied er sich im Übrigen auch nicht vom Sonnenkönig, der seine Truppen immer mal wieder vorn an der Front besuchte, wobei er im Tross stets seine Frau und seine beiden Mätressen mitführte sowie den gesamten höfischen Komfort und einige Maler, damit die ihn in vorteilhafter Pose abbilden konnten. Die schönsten Posen dieses edlen Gewächses können wir heute noch in den Museen und Schlössern besichtigen. Zum Schwert gegriffen hat auch er nicht. Man muss sich erhalten für den Staat, wenn man selbst der Staat ist. Ein späterer preußischer König sollte da völlig anderer Ansicht sein. Aber der war da noch nicht zugegen.
Derweil hinterließen die Türken schon bei ihrem Anmarsch auf Wien eine breite Spur der Verwüstung; Städte waren niedergebrannt worden, 90% der jeweiligen Bevölkerung umgebracht. Als am 14. Juli 1683 die Nachricht von der Belagerung Wiens in Warschau bei König Jan Sobieski III. eintraf, hatte der sofort sein Kommen signalisiert, und auch die deutschen Stämme rüsteten sich zum Kampf. Am 23. Juli waren bayerische Hilfstruppen in einer Stärke von zehntausend Mann in Passau eingetroffen, wo sie von Ihro Gnaden Leopold I. willkommen geheißen wurden. Am 27. Juli hatte der Kaiser die Nachricht aus Warschau erhalten, dass Jan Sobieski III. nicht nur höchstpersönlich mit fünfzigtausend Mann zur Schlacht anrücken wolle, sondern auch sein Sohn Jakob Ludwig Heinrich mit dabei sein würde. Bis zum 20. August wollten sie vor Wien sein. Aus Sachsen waren zehntausend Mann unterwegs. Derweil war Kaiser Leopold I. in Passau an Durchfall erkrankt. Am 8. August war Prinz Eugen von Savoyen in Passau eingetroffen – ein in Paris geborener Prinz aus dem Hause Savoyen, den der Sonnenkönig als Soldaten nicht hatte haben wollen, weil er ihm zu klein und auch ein wenig schief gewachsen schien. Der Habsburger konnte nicht so wählerisch sein. Bei seinem chronischen Mangel an Soldaten nahm er, was kam, also auch den Prinzen. Der wusste zu berichten, dass alle französischen Offiziere, die gegen die Türken hatten kämpfen wollen, eingesperrt worden waren. Am 12. August waren tausend Mann des Prinzen von Neuburg in Passau eingetroffen; am 21. August achttausend Franken.
Am 25. August machte sich dieses Entsatzheer in Richtung Wien auf den Weg. Der Kaiser selbst wagte sich zu Schiff vorerst mal bis Linz vor. Am 31. August traf König Sobieski III. mit dem lothringischen Herzog Karl V. zusammen, dem der Kaiser die Führung des kaiserlichen Heeres übertragen hatte. Nach einem Streit zwischen den beiden über die Frage, wer das Entsatzheer führen solle, hatte der Papst entschieden: Sobieski führt. Der hatte diese Barbaren zehn Jahre zuvor immerhin schon einmal in die Flucht geschlagen. Das zählte. Am 7. September vereinigte sich die polnische Armee mit den Heeren aus Sachsen, Bayern, Franken, Schwaben, Baden, Oberhessen, Venedig und den kaiserlichen Truppen in Tulln, dreißig Kilometer vor Wien. Der Kaiser bewegte sich heldenhaft von Linz aus abermals mit dem Schiff bis Dürnstein, wo er nun doch erschreckend nah ans Geschehen herangerückt war. Mehr mochte er nicht riskieren.
Die Truppen schlichen sich durch den Wienerwald an den Ort der Schlacht heran. Der Tross mit der Verpflegung musste zurückgelassen werden, weil es im Wienerwald keine Wege gab. Auch die Artillerie musste zurück bleiben. Die Soldaten mussten zwei Tage ohne Verpflegung marschieren. Ein kühner Plan. Am 11. September stiegen die Truppen dann vom Kahlengebirge herab zum Ort der Schlacht am Kahlenberg. Am 12. September griff das Entsatzheer mit 60.000 Mann die Osmanen an. Die Schlacht verlief erfolgreich. Die Osmanen wurden in die Flucht geschlagen, aber nicht weiter verfolgt, so dass sie sich bei Raab erneut sammeln konnten. Als der Kaiser vom Sieg erfuhr, begab er sich umgehend zu Schiff nach Klosterneuburg und von dort nach Wien, wo er sich feiern ließ.
Bei der anschließenden Verfolgung der türkischen Truppen zeichneten sich die polnischen Soldaten abermals durch außergewöhnliche, aber auch halsbrecherische Kühnheit aus, als sie am 7. Oktober gegen den Rat der deutschen Führer mit zweitausend Mann gegen eine Streitmacht von vierzigtausend Türken anrannten und vollständig aufgerieben wurden. Abermals gegen den Rat der Deutschen zog wenig später König Sobieski in aberwitziger Selbstüberschätzung nunmehr mit viertausned Mann gegen die Türken in die Schlacht, aus der aber auch er sich nur durch eine wilde Flucht zu den Deutschen retten konnte. Am 9. Oktober 1683 schließlich wurden die Türken gemeinsam mit den deutschen Truppen in der Schlacht bei Párkány fürs Erste endgültig besiegt. Und am 25. Dezember ließ der türkische Sultan den Großwesir Kara Mustafa für diese Schmach erdrosseln. Aber die Türkenkriege waren damit nicht vorüber. Es gab weitere Schlachten an anderen Orten mit anderen Teilnehmern und unter anderen Führern. 1686 schloss Russland sich dem Krieg gegen das Osmanische Reich an. Prinz Eugen besiegte im August 1687 in der Schlacht bei Mohács die Türken noch einmal und befreite damit Ungarn, das 161 Jahre lang von der Landkarte verschwunden gewesen war. Im Jahr darauf befreiten die Truppen des Reiches unter dem Jubel der Bevölkerung Belgrad von den Türken und das heutige Sofia und Pristina.
Die Erfolge des Reiches im Osten setzten den französischen König im Westen unter Zeitdruck. Er musste handeln, solange im Osten noch gekämpft wurde. Zwanzig Tage nach der Befreiung Belgrads brach er den „Regensburger Stillstand“ von 1684, marschierte 1688 ins Rheinland ein und eröffnete damit den Krieg in der Pfalz. Er hatte sich mit dem begnügen sollen, was er bis dahin hatte – welch eine Farce. Kein Herrscher dieses Charakters verfügt über die Fähigkeit, sich zu begnügen. Warum sollte er auch? Er hatte während der zurückliegenden Jahre gute Erfahrungen mit Lug und Betrug beim Raub von Ländereien gemacht. Kein Grund, an dieser Strategie etwas zu ändern. Also marschierte er in die Pfalz ein. Ihm war die Idee gekommen, dass er neben seiner eigenen spanischen Ehe auch in der Ehe seines Bruders mit der Tochter des Kurfürsten aus der Pfalz über einen Hebel für einen Landraub verfügte. Er kehrte einen Verbrüderungsversuch des Kurfürsten Karl I. Ludwig von der Pfalz in sein Gegenteil um. Der Kurfürst hatte seine Tochter Elisabeth Charlotte (Liselotte von der Pfalz) mit dem Bruder des Sonnenkönigs verheiratet in der Hoffnung, das politische Verhältnis zu Frankreich zu verbessern. Der Sonnenkönig, der an sein Motto „Der Staat bin ich“ selber glaubte, hatte aber kein Interesse an einem besseren Verhältnis zu irgendjemandem, schon gar nicht zum Nachbarn auf der anderen Rheinseite, dessen linksrheinische Gebiete er ihm abjagen wollte. Es war die Rheingrenze und immer wieder die Rheingrenze. „Immer daran denken, nie davon reden“ blieb das Credo französischer Politik, das zur Obsession geworden war, von der Golo Mann später schrieb:
„Die Franzosen haben zuerst die Tatsachen der Geschichte mit den Tatsachen der Natur verwechselt und in den 1790-er Jahren von den natürlichen Grenzen ihrer Republik zu reden angefangen; es kam ihnen teuer zu stehen.“2
Wie im spanischen Fall nach dem Tod seines Schwiegervaters beanspruchte der Franzose auch jetzt, nach dem Tod des Kurfürsten, entgegen allen zuvor geschlossenen Verträgen die Kurpfalz als Erbe für sich, und als er sie freiwillig nicht erhielt, überzog er das Land 1688 – vierzig Jahre nach Ende des Dreißigjährigen Krieges und mitten im Krieg des Reiches gegen die Türken – mit einem Krieg, der verharmlosend als pfälzischer Erbfolgekrieg bezeichnet wird und doch in Wahrheit ein wirklicher Raubkrieg war, der neun Jahre dauern sollte und nach Aussagen heutiger Historiker von Frankreich mit einer in der Kriegsgeschichte der Neuzeit bis dahin beispiellosen Brutalität geführt wurde – um eine Erbschaft, die ihm nach keinem Recht der Welt zustand. „Macht die Pfalz zur Wüste“, hatte er seinen Heerführern gesagt, und die taten, was sie konnten. Die Historie berichtet von bestialischen Taten gegenüber der Bevölkerung, ohne dass ein deutscher Soldat dem gegenübergestanden hätte. Nun mussten das Reich und der Kaiser handeln. Der Krieg gegen die Türken war soeben abgeschlossen, da zog die Reichsarmee 1689 mit hunderttausend Mann in den Krieg gegen den Sonnenkönig, der sich aber einer offenen Feldschlacht entzog und stattdessen neun Jahre lang mit ständigen Truppenbewegungen zwischen Köln, Koblenz, Mainz, Heidelberg, Mannheim und Schwaben hin und her zog und überall eine breite Spur der Verwüstung hinterließ, während die kaiserlichen Truppen hinterher eilten, um die Städte vor der Zerstörung zu schützen, letztlich erfolglos. Alle Burgen am Rhein, ungezählte Dörfer, Städte und Schlösser der Kurpfalz wurden zum Teil mehrfach von den französischen Truppen überfallen, geplündert und zerstört. Selbst vor Heiligtümern wie dem Kaiserdom in Speyer machten sie nicht halt. Sie zerstörten ihn, wie auch das Heidelberger Schloss sowie die Stadt Worms, die damals gar nicht zur Pfalz gehörte, aber doch ein prächtiges Opfer abgab und noch heute darunter leidet, dass sie über keine Altstadt mehr verfügt. Dennoch musste er, als 1697 in Rijswijk Frieden geschlossen wurde, alle besetzten Gebiete bis auf das Elsass und Lothringen wieder räumen. Die Kurpfalz, Luxemburg und die Gebiete im Saarland blieben beim Reich.
Die Verlagerung der kaiserlichen Truppen an die Westfront hatten die Türken derweil genutzt, um 1690 Belgrad zurückzuerobern. Auch Prinz Eugen, der Held aus den Türkenschlachten, hatte im Westen für das Reich gegen jenen Landsmann gefochten, der ihn als Soldaten nicht hatte haben wollen. Im Osten hatten derweil seit 1691 andere Heerführer wie Maximilian I. von Bayern und Ludwig Wilhelm I. von Baden („Türkenlouis“) gegen die Türken gekämpft und sie in mehreren Schlachten besiegt. 1697 – als der Krieg gegen Frankreich beendet war – kehrte Prinz Eugen an die Türkenfront zurück und fügte diesen im selben Jahr bei Zenta abermals eine vernichtende Niederlage zu, die 1699 zum Frieden von Karlowitz zwischen dem Reich, Polen und Venedig einerseits und den Türken andererseits führte. Österreich gewann Ungarn, Siebenbürgen und Slawonien und war seither europäische Großmacht – oder war es nicht doch das Heilige Römische Reich Deutscher Nation, dessen kaiserliche Armee aus deutschen Soldaten bestanden hatte? War es wirklich nur dieses relativ kleine südöstliche Randterritorium des Reiches, nur Österreich, nur die Habsburger gar, die die Eroberungen als Erbland ins Privateigentum einstecken konnten und zur Großmacht wurden? Und wenn ja, warum?
An der Westfront dauerte der Frieden nur drei Jahre, dann zog Frankreich 1701 erneut in den Krieg gegen das Reich. Diesmal ging es in der spanischen Erbfolge um die Nachfolge des kinderlosen Karl II., des letzten spanischen Habsburgers auf dem Thron in Spanien. Offensichtlich fühlte Frankreich sich noch immer von den Habsburgern umzingelt. Noch immer hatte der französische Herrscher offensichtlich eine sehr viel höhere Meinung von Macht und Möglichkeiten der Habsburger, als diese selbst von sich hatten. Das Ergebnis des Dreißigjährigen Krieges hätte eigentlich ausreichen sollen, um Einkreisungsängste dieser Art nicht mehr aufkommen zu lassen. Vielleicht war aber auch dieses Mal wieder die Obsession vom Rhein als Grenze Grund für den erneuten Marsch gegen das Reich. Die österreichischen Habsburger verbündeten sich mit England und gründeten die „Haager Große Allianz“ gegen Frankreich und dessen Verbündete. Bayern focht zunächst auf Seiten des Kaisers, wechselte allerdings mitten im Krieg die Fronten zu den Franzosen. Wie schon im Dreißigjährigen Krieg gab es Allianzen kreuz und quer durch das Reich. Und wieder war der Kaiser in Not. Wieder einmal brauchte er dringend Soldaten.
Da traf es sich gut, dass er zur Unterstützung achttausend Mann aus einem deutschen Land erhielt, das es noch gar nicht lange gab, das auch nicht zum Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation gehörte, aber dennoch deutsch war, das war Preußen – ein außerhalb des Reichsgebietes liegendes Stückchen Land, das wie eine Insel im polnischen Umfeld lag und vom Kurfürsten von Brandenburg in Personalunion mitregiert wurde. Dieses Preußen vertrat in diesem Krieg gegen Frankreich keine eigenen Interessen, sondern stellte nur Soldaten. Und die fielen bei der Eroberung der als uneinnehmbar geltenden Festung Geldern durch außerordentliche Tüchtigkeit auf. Dreizehn Jahre schlug man sich. Einen eindeutigen Sieger gab es auch hier nicht, aber Frankreich durfte anschließend einen Bourbonen auf den spanischen Thron setzen, und da sitzen sie heute noch. Geschichtlich betrachtet war diese Entscheidung unbedeutend, verglichen mit dem Auftauchen von Preußen am europäischen Horizont. Aus dieser hintersten, nordöstlichsten Ecke außerhalb des Reiches hatte sich ein Staat auf dem Spielbrett der Nationen gemeldet, dem es in den nächsten zweihundert Jahren gelingen sollte, den Deutschen das zu geben, was alle anderen europäischen Nachbarländer längst hatten: einen König, der weder von der Gnade des Papstes in Rom noch von der seiner Statthalter in Köln, Mainz und Trier abhing und auch nicht vom Kaiser in Wien oder den Kurfürsten. Ein König, der König war aus eigenem Machtpotenzial und ein Haus repräsentierte, das eine extrem andere Ethik und Grundeinstellung zum Wesen des Herrschens hatte als das Haus Habsburg. Von Anfang an waren die Hohenzollern in ihrem Regierungshandeln von praktischer Vernunft geprägt, von rationalen Zielen mit einer deutlichen ökonomischen Ausrichtung und getragen von einer Moral, die sich am Menschenbild ausrichtete und gewiss nicht an einem Haus, das von Jerusalem auf den Flügeln von Engeln ins italienische Loreto getragen worden sein soll. Wo war dieser Staat, den es im ganzen Mittelalter nicht gegeben hatte, so plötzlich hergekommen?
1Wikipedia, Stichwort „Ludwig XIV.“.
2 Golo Mann, Deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 1969, S. 23.
Ein christlicher Orden als Keimzelle Preußens
In ihren tiefsten Wurzeln geht die Gründung Preußens auf die Kreuzzüge zurück. In Palästina zur Zeit der Kreuzzüge gründeten Bremer und Lübecker Kaufleute eine Spitalbrüderschaft, die Pilger und Kreuzfahrer medizinisch versorgte. Sie nannten sie „Orden der Brüder vom Deutschen Haus St. Mariens in Jerusalem“, auch „Deutscher Orden“ genannt. 1198 wurde diese Spitalbrüderschaft zu einem Ritterorden, der die zu den heiligen Stätten pilgernden deutschen Christen schützen sollte.3 Diese Ritter wurden nach dem Motto „Helfen, heilen, wehren“ tätig und waren bald für ihre Disziplin, ihre Opferbereitschaft und ihr Pflichtbewusstsein berühmt. Der polnische Herzog Konrad versuchte in dieser Zeit vergeblich, die baltischen Pruzzen zu christianisieren. Er bat 1225 den deutschen Orden um Hilfe. Die Hilfe sollte zeitlich begrenzt sein. Sie war erfolgreich, fand dann aber kein Ende mehr.
Der Orden suchte ohnehin nach einem Land, in dem er sich dauerhaft etablieren konnte. Der heidnische Nordosten Europas erschien ihm vielversprechend. Der polnische Herzog schenkte ihnen schließlich 1230 im Vertrag von Kruschwitz das Kulmer Land jenseits der Weichsel „auf ewig“, und Kaiser Friedrich II., der Hohenstaufe, der ohnehin lieber in Sizilien weilte und nur seltene Gastrollen in Deutschland gab, entschied, dass der Deutsche Orden alle Eroberungen behalten durfte. Christianisierungen waren in diesen Zeiten Gottesdienst, durch den auch Sünden vergeben wurden, und so gab auch der Papst seinen Segen zur Arbeit des Ordens. 997 hatten die heidnischen Pruzzen den heiligen Adalbert von Prag bei einem Missionierungsversuch erschlagen. Deshalb konnte der Papst nun das Land des Ordens zum Kreuzzugsgebiet erklären.
Den christianisierten Ureinwohnern, den Pruzzen, wurde 1249 im Vertrag von Christburg Gleichberechtigung zugesichert, dennoch scheint ihnen die Glaubensbekehrung nicht bekommen zu sein. 1283, fünfzig Jahre nach Beginn war der Kreuzzug beendet, und die Zahl der Pruzzen hatte sich von 170.000 auf 90.000 halbiert, obwohl die Bekehrung mit dem Schwert offiziell verboten war. Es wird auch nicht die Preisgabe der vorher bei den Pruzzen üblichen Vielweiberei gewesen sein, die mit dem Übergang zum christlichen Glauben den Bevölkerungseinbruch verursacht hatte. Immerhin gibt es Berichte von blutigen Schlachten zwischen den neuen Herren und den Pruzzen. Und es gab subtile Druckmittel, um der Frömmigkeit auf die Sprünge zu helfen. Mitten im Kreuzzug ordnete der Papst 1249 an, dass alle Pruzzen, die sich nicht innerhalb eines Monats taufen ließen, allen Besitz verlören und das Land verlassen müssten. Viele wanderten nach Litauen aus. Auch der Wohlstand ging an ihnen vorbei. Für sie blieben die niederen Arbeiten. Sie verloren ihre Freiheit und schließlich auch ihre eigene Sprache.
Die Ritter des Deutschen Ordens kamen aus allen Teilen Europas und taten das, was sie auch in Palästina zu ihrem Schutz getan hatten: Sie errichteten Ordensburgen im christianisierten Land, zunächst provisorische aus Holz, wenige Jahre später begannen sie mit dem Bau der Marienburg. Sie wurde später zum Ordenssitz, das eroberte Land ein selbständiger Staat in der Hand des Ordens, geführt vom Hochmeister, der als Landesherr auf Lebenszeit vom Generalkapitel des Ordens gewählt worden war, womit hier ähnliche Grundstrukturen einer demokratischen Verfassung realisiert wurden wie auch im Heiligen Reich der Deutschen. Königsberg, die spätere Hauptstadt des Ordensstaates, erhielt ihren Namen nach dem böhmischen König Ottokar II., der genauso an den Kreuzzügen in Pruzzen teilgenommen hatte wie auch polnische Adelige. Wie die Römer – 1.200 Jahre zuvor und ein paar hundert Kilometer weiter westlich an der Nordseeküste –, so eroberten die Ritter jetzt das Land von der Küste der Ostsee her. Dort und in ihrer Nähe gründeten sie im Laufe der nächsten Jahre und Jahrzehnte insgesamt über hundert Städte und 120 Ordensburgen. Das eroberte Land wurde von Siedlern aus Deutschland, aber auch aus Polen und Litauen in Besitz genommen. In langen Trecks kamen sie aus ihren Heimatländern, um – wie ein paar Jahrhunderte später die Siedler in Amerika – ihr Glück in der Ferne eines neuen Landes zu suchen. In einer Zeit, als die Bevölkerungsdichte in Europa nur einen Bruchteil der heutigen ausmachte, die Menschen früh starben und das Volk als arbeitender Produktionsfaktor von außergewöhnlich großer strategischer Bedeutung war, gehörte es zu den normalen Vorgängen, dass regionale Herrscher die Menschen aus benachbarten Ländern zur Besiedlung ihres Landes aufriefen.
Das war auch in Polen schon sehr früh geschehen, wo Herzog Boleslaus I. bereits im Jahre 1175 in der Stiftungsurkunde für das Kloster Leubus angeordnet hatte, dass alle Deutschen, die künftig die Güter des Klosters bebauen würden, für immer vom polnischen Recht befreit sein sollten. Das Typische an der deutschen Ostkolonisation bestand darin, dass die Landstriche – auch dort, wo sie im Zuge der Christianisierung zuvor militärisch erobert worden waren – danach von deutschen Bauern, Handwerkern und Kaufleuten unter den Pflug genommen und bearbeitet wurden. Es war insofern keine Ausbeutung einer unterworfenen Bevölkerung. Auch der ungarische König hatte schon im 12. Jahrhundert deutsche Bauern und Handwerker nach Siebenbürgen gerufen. In Pommern hatten Herzog Barnim I. und in Schlesien Herzog Heinrich I. dasselbe getan. Es war die Zeit der Mongolenstürme gewesen, die mit großer Grausamkeit und Wildheit die Bevölkerung Europas, aber auch Vorderasiens tyrannisiert, ausgeraubt, ermordet und versklavt und ganze Landstriche entvölkert hatten. Sie waren gekommen und verschwunden und kamen erneut, ohne dass jemand ein Rezept gegen sie hatte. Die Aufrufe zur Besiedlung ergingen an alle siedlungswilligen Menschen in Europa. Es kamen Flamen, Dänen, Romanen und auch Slawen, meistens aber Deutsche. Die dabei entstandenen Dörfer und Städte haben ihren deutschen Charakter auch bei wechselnden Herrschern erhalten.
Und wie später in Amerika waren auch die Siedler damals im neuen Land an der Ostsee wirtschaftlich außergewöhnlich erfolgreich. Die Hochmeister als Führer des Ordens hatten die Ordnung ihres militärischen Denkens auf die Organisation des Landes und seiner Verwaltung übertragen, was dem Land in dieser Pionierphase ganz offensichtlich gut bekommen war. Der Ordensstaat hatte nicht nur eine eigene Währung, sondern auch einheitliche Normen für Maße und Gewichte. Der Handel blühte. Man verkaufte Getreide, Gemüse und Holz in alle europäischen Länder bis nach England und Bernstein bis in den Orient. Die Modernität des Ordensstaates wurde damals im Reich bestenfalls von Nürnberg erreicht. Man brauchte auch einen Vergleich mit den prosperierenden Städten Norditaliens nicht zu scheuen. Der Wohlstand des Ordensstaates des Deutschen Ritterordens sprach sich im übrigen Europa herum. Verwaltung und Geldwirtschaft wurden zum Vorbild für andere Staaten. Der Aufsteiger wurde bewundert, und man hatte ihn gern zum Freunde.
Wohlstand gibt Kraft. Kraft dehnt sich. 1308 eroberten die Ritter das zu Polen gehörende Herzogtum Pomerellen und die Stadt Danzig, ein Landstreifen, der sich westlich an das bisherige preußische Gebiet angliederte. Zur Zeit von Tacitus war es von Goten besiedelt gewesen, nach deren Aufbruch zur Völkerwanderung waren slawische Stämme eingewandert, dann Polaner, Wikinger, Dänen und schließlich die baltischen Pruzzen. Der Ordensstaat wuchs weiter mit der Eroberung von Estland und Gotland. Jetzt war das beherrschte Land so groß, dass der Orden 1309 beschloss, seinen Hauptsitz von Venedig auf die Marienburg zu verlagern. Sie wurde ausgebaut – zu einer der prächtigsten Residenzen Europas, die einen Vergleich mit der spanischen Alhambra in Granada nicht zu scheuen brauchte.
3 Klaus Wiegrefe, „Gottesreich an der Ostsee“, S. 39ff., in: Stephan Burgdorff et al. (Hrsg.), Preußen. Die unbekannte Großmacht, Goldmann, München, 2009.
Die Hanse – erste nichtstaatliche Organisation und Großmacht
Der Ordensstaat zog weitere wirtschaftliche Vorteile aus seiner Mitgliedschaft in der Deutschen Hanse. Diese hatte sich als Vereinigung von handeltreibenden niederdeutschen Kaufleuten gegründet und später zu einem Städtebund erweitert. In ihr war der Ritterorden als einziges nichtstädtisches Gremium vollgültiges Mitglied. Ihr Kern umfasste schließlich 72 Städte mit 130 weiteren assoziierten Kommunen, die die Region von Flandern über ganz Norddeutschland, die gesamte Ostseeküste entlang bis hinauf in den Finnischen Meerbusen umfasste. Der Handelsweg über die Ostsee hatte an Bedeutung gewonnen, als auf der Handelsroute von Nowgorod nach Brügge der Weg von Russland zum Schwarzen Meer durch Mongolen und Tartaren gestört war. Deshalb hatten deutsche Kaufleute Mitte des 12. Jahrhunderts in Lübeck die „Gemeinschaft der deutschen Gotlandfahrer“ gegründet. Ihr Anliegen war zunächst, die rechtliche Gleichberechtigung der Lübecker mit den gotländischen Kaufleuten zu erreichen. Dieses Ziel war 1161 im Altenburger Privileg erreicht worden. In der Zeit des Interregnums, als die kaiserliche Macht der Staufer zu Ende gegangen war und es über Jahre hinweg keinen Kaiser gab, war aus der Kaufmanns-Hanse die Städte-Hanse geworden, weil die Kommunen eher für die Sicherheit der Kaufleute sorgen konnten.
Die Mitgliedschaft des Deutschen Ritterordens in der Hanse war eine bedenkenswerte Allianz. Die deutsche Hanse als erste nichtstaatliche Organisation privater Kaufleute aus vielen Ländern rund um die Ostsee hatte sich zu ihrem Schutz mit der ebenfalls nichtstaatlichen Organisation des deutschen Ritterordens zusammengefunden und wuchs so in den Jahren 1350 bis 1400 zu einer nordeuropäischen Großmacht heran, über die Grenzen der seit langem in Staaten organisierten Nachbarländer wie Dänemark, Schweden, Norwegen, Polen und Russland hinweg, ohne einem dieser Länder einen Schaden zuzufügen – im Gegenteil. Jedes dieser Länder kam in den Genuss der Vorteile der Handelsorganisation. Es war eine friedliche Vereinigung im Interesse eines länderübergreifenden Handels. Aber diese Idee war besonders jenen Herrschern fremd, deren Länder sich schon früh staatlich organisiert hatten. So führte Dänemarks 1361 den ersten Krieg gegen die Hanse, um deren Rechte einzuschränken. Die Hanse ging ein Kriegsbündnis mit Schweden und Norwegen ein und gewann diesen Krieg wie auch den von 1420 bis 1435 ebenfalls gegen Dänemark.
1356 hielt die Hanse ihren ersten Hansetag ab, auf dem Themen von gemeinsamem Interesse besprochen und entschieden wurden. Dabei war es erforderlich, dass diese Themen solange diskutiert wurden, bis die Kaufleute aus allen vertretenen Ländern sich zu einer gemeinsamen Entschließung durchgerungen hatten. Das war unumgänglich, weil die Hanse selbst keine Exekutivfunktion hatte, sondern auf die Akzeptanz ihrer Entschließungen in den jeweiligen Heimatländern angewiesen war. Mögliche Einwendungen der auswärtigen Regierungen mussten folglich auf den Hansetagen vorweggenommen, angesprochen und möglichst ausgeräumt werden. Ein Prozedere, das uns heute aus Brüssel vertraut erscheint. Zudem erscheint es als bemerkenswerter Zufall, dass die deutschen Fürsten im selben Jahr, 1356, mit der Goldenen Bulle so etwas wie ein deutsches Grundgesetz schufen, um das Prozedere der Wahl des deutschen Königs und Kaisers festzulegen. Dabei banden sie sich im Verhältnis vier zu drei an den Papst in Rom und seine ebenfalls länderübergreifenden, aber wenig konkret definierbaren Interessen zum Wohle der Menschen im Jenseits, während gleichzeitig im wenig beachteten Norden Deutschlands die Kaufleute daran gegangen waren, eindeutig definierte kaufmännische Interessen ebenfalls länderübergreifend, aber zum diesseitigen Wohl der Menschen zu organisieren. Es scheint, dass die Idee des Länderübergreifenden seit jeher ein Merkmal in der Organisation deutscher Staatlichkeit war – viel mehr als die Konzentration auf das nationale Interesse im Zentrum einer nationalen Machtbasis.
Die Entdeckung Amerikas 1492 veränderte die Welt – nicht nur die der Hanse, sondern auch die der florierenden reichen Städte im Süden des Landes, wie Augsburg, Ulm und Nürnberg. Ihnen allen erwuchs mit den neuen Handelswegen über den Atlantik eine Herausforderung, die eine Verlagerung ihres Tätigkeitsschwerpunktes erfordert hätte. Es war Spanien, das die Gründung einer Hanseatisch-Spanischen Compagnie vorschlug. Dies hätte ein Weg sein können, um die erste nichtstaatliche, überaus erfolgreiche Organisation der Hanse in die neue Zeit hinüberzuretten. Das scheiterte am krankhaft hochentwickelten Machtsensorium des Erzhauses in Wien, das wohl sofort gespürt hatte, dass der dauerhafte familiäre Machterhalt einfacher sein würde, wenn er sich auf die altbekannten, schwammigen und nicht definierten jenseitigen Kriterien des Glaubens stützte, deren Konkretisierung in der Hand des Heiligen Stuhls lag – mit dem man sich jederzeit arrangieren konnte –, als wenn er von zahlenmäßig messbaren Größen kaufmännischen Erfolges abhinge. Die römischen Statthalter in Köln, Mainz und Trier konnten an solch weltlichen Dingen wie Handel und diesseitigem Wohlergehen der Menschen, das nur vom allein wichtigen Jenseitigen ablenkte, ohnehin kein Interesse haben. Die übrigen vier Kurfürsten waren zur Zeit der Entdeckung Amerikas wohl einfach zu weit weg von allem, und Preußen befand sich zu diesem Zeitpunkt noch in statu nascendi. So sagte der Kaiser Nein zur Idee einer Hanseatisch-Spanischen Compagnie.
Als dann der Dreißigjährige Krieg kam, der ja im Kern nichts anderes war als der bis zum Äußersten hochgepeitschte Kampf der Habsburger um ihre Macht, da besiegelte dieser Krieg und der Westfälische Frieden 1648 auch das Ende der Hanse. 1669 gab es einen letzten Hansetag in Lübeck. Was später noch nachkam in den norddeutschen Hansestädten, war nurmehr ein zur schönen Gewohnheit gewordenes Ritual einiger alter Kaufmannsfamilien, das dem menschlichen Bedürfnis nach Tradition entsprang; ein würdevoll zelebriertes Theater, dessen Regeln einigen Kaufleuten auch als Ersatz fürs Religiöse gedient haben mag. Der vom Haus Habsburg entfachte Dreißigjährige Krieg hatte 1648 folglich nicht nur im Religiösen, sondern auch im sehr handfesten kaufmännischen Bereich den Aufbruch in eine neue Zeit verhindert, in der sich die Internationalität der handeltreibenden Völker auf einer rationalen Grundlage hätte entfalten können. Was folgte, waren dreihundert verlorene Jahre und Hekatomben von Blut, bis endlich 1957 mit den Römischen Verträgen zur EWG erneut Schritte in Richtung einer neuen Hanse getan wurden.
Vom Ritterstaat im Land der Pruzzen zum Herzogtum Preußen
Auch der Staat des Deutschen Ritterordens geriet schon früh – früher als die Hanse – in eine bedrohliche Lage. Als sich 1386 der litauische Großfürst Jagiello taufen ließ, war die Pionieraufgabe des Ordens eigentlich erledigt. Es gab niemanden mehr zu bekehren. Der Ordensstaat aber war inzwischen zu einem Staat geworden wie jeder andere auch. Da erinnerte sich der polnische König an den zeitlich befristeten Auftrag, den einer seiner Vorfahren dem Orden erteilt hatte. Er verbündete sich mit den Litauern, um das Land, das in der Zwischenzeit einen so blühenden Aufstieg erfahren hatte, im aufgeputzten Zustand dem polnischen Königreich einzugliedern. Von zwei Seiten attackiert, verlor der Orden 1410 bei Tannenberg erstmals eine wichtige Schlacht. Auf dem Konzil von Konstanz wurde ihm auf Antrag Polens jegliche Missionierung verboten. Im Zweiten Frieden von Thorn verlor der Orden 1466 Pommerellen, das Kulmer Land und die Marienburg. Die Übertragung des Kulmer Landes „auf ewig“ hatte sich damit erledigt, wie sich alle staatlichen Verträge und Friedensschlüsse, die „für die Ewigkeit“ vereinbart werden, meist eher in Nichts auflösen als die Menschen, die diese Verträge unterzeichnet haben. Der Ritterorden musste für sich als Gesamtheit die polnische Lehnshoheit anerkennen, was allerdings die Hochmeister nicht akzeptierten; sie umgingen den Lehnseid. Der Orden verlegte seinen Sitz nach Königsberg.
Die Lage seines Inselstaates blieb heikel. Als der 37. Hochmeister des Ritterordens Albrecht von Brandenburg-Ansbach – nicht identisch mit dem Kurfürsten von Brandenburg – einen Krieg gegen den polnischen König verlor, zeigte sich das Reich wieder von seiner christlich-übernationalen Seite und beschied Hilfeersuchen Albrechts negativ. So gab Albrecht, der wie die Brandenburger Kurfürsten dem Hause Hohenzollern entstammte, sein Amt als Hochmeister des Deutschen Ritterordens auf und verwandelte 1525 den Ordensstaat – auch auf Empfehlung Martin Luthers – in ein weltliches evangelisches Erbherzogtum. Dieses nannte er im Angedenken an die ursprünglich bekehrten Pruzzen „Herzogtum Preußen“ und unterstellte es dem polnischen König Sigismund I., der ein Onkel von ihm war. Albrecht wurde damit der erste Herzog des neuen Staates Preußen. Auf einem Landtag, der kurz darauf nach Königsberg einberufen wurde, erklärten sich alle Stände sowie der Bischof von Samland für die Anerkennung des neuen Herzogs und für die Annahme der Reformation.
Die Unterstellung Preußens unter den polnischen König war etwas, was dem Kaiser im fernen Wien nun doch nicht gefiel. Gewiss, auch Sigismund in Polen war über seine Mutter, die eine Habsburgerin war, mit dem Erzhaus verwandt, aber deshalb gibt man nicht ein Stück Land freiwillig ab, nicht einmal eines, das einem gar nicht gehört hat, auch dann nicht, wenn es sich um ein evangelisches Landstück handelt. Der Kaiser setzte 1527 einen gewissen Walther von Cronberg als Administrator des Hochmeistertums ein, um damit einen Besitzanspruch auf Preußen vorzutäuschen, den es weder für das Reich gab noch für den Habsburger, der zur Entstehung dieses Landes nichts beigetragen hatte. Es war wieder einmal der Griff in die dynastische Trickkiste. Habsburg setzte einen Verwalter ein über Ländereien, die ihm nicht gehörten, täuschte damit eine Zuständigkeit vor, die durch nichts gerechtfertigt war und machte sich im Handumdrehen zum Eigentümer – auch wenn der Kaiser im fernen Wien die Dinge in Preußen nicht im Mindesten beeinflussen konnte. Fünf Jahre später, 1530, folgte der nächste Schritt auf diesem Weg: Der Kaiser ernannte Cronberg zum Hochmeister. Dieser war nun also nicht mehr nur Verwalter des Hochmeistertums, sondern Hochmeister – angeblich. Ein eklatanter Rechtsbruch, weil der Hochmeister – das höchste Amt im Deutschen Orden – vom Generalkapitel, der Vollversammlung aller Ritter und Priester, die Mitglied des Ordens waren, gewählt werden musste. Nun sollte es also Cronberg sein, der – aus der Weltmetropole Bad Mergentheim – die Geschicke Preußens regeln sollte. Dass das unmöglich war, wusste auch der Kaiser. Es war ein Trick. Aber auch aus Tricks können Realitäten entstehen, wenn sie nur dreist genug durchgezogen werden. Auf dem Reichstag in Augsburg im gleichen Jahr beging Ihre Majestät den nächsten dreisten Schritt. Sie belehnte Cronberg mit dem Preußenland, und der verklagte dessen ehemaligen Hochmeister Herzog Albrecht vor dem Reichskammergericht. Der Prozess endete 1531 mit der Verhängung der kaiserlichen Reichsacht gegen Herzog Albrecht sowie der Weisung, dem Orden die angestammten Rechte in Preußen wieder einzuräumen.
Aus Schein war Sein geworden. Das ferne, bisher selbstständige Preußen hatte nun nicht mehr nur den polnischen König zum Lehnsherrn, sondern auch den österreichischen Kaiser. Damit schien Preußen eingegliedert zu sein unter die kaiserliche Befehlsgewalt, ohne Rechtstitel. Dieses Mal nicht durch Heirat, sondern durch einen Akt staatlichen Raubes. Wäre er gelungen, die Urzelle deutscher Unabhängigkeit wäre im Keim erstickt worden. Es sah ganz und gar nicht danach aus, dass aus dieser Hinterlassenschaft der deutschen Kreuzritter einmal eine europäische Großmacht werden könnte. Dass es dennoch geschah, lag daran, dass Herzog Albrecht von Preußen weder den Habsburger Schein noch das darauf gründende scheinbare Sein anerkannte. Er kümmerte sich nicht um die Tricks des Kaisers und nicht um die Reichsacht. Jetzt endlich war es so weit: Wie Heinrich VIII. von England den Bann des Papstes damit beantwortet hatte, dass er die Bindung an Rom kappte und sich durch die Zustimmung des englischen Klerus ein eigenes Fundament schuf, so entschärfte Albrecht die Waffe der Reichsacht durch die Zustimmung der Stände und des für ihn zuständigen Bischofs zu dem, was er getan hatte. Preußen war frei und unabhängig von Exzellenzen und Scheinheiligen in Wien und in Rom. Und dann begann er, Politik im Interesse Preußens zu betreiben, wie man es vom Kaiser in Wien, insbesondere in diesen Jahren zwischen dem Thesenanschlag Martin Luthers 1517 und den Jahren bis zum Beginn des Krieges 1618, auch hätte erwarten können.
Albrechts besonderes Augenmerk lag auf dem Schul- und Bildungswesen. In den Städten gründete er Lateinschulen, 1540 das Gymnasium in Königsberg, 1544 am gleichen Ort die Universität Albertina. Auf eigene Kosten ließ er Schulbücher drucken; Leibeigene, die lernen wollten, wurden in die Freiheit entlassen. Er selbst fixierte seine Überzeugung sowohl auf den Münzen des Landes mit einem Spruch aus dem Galaterbrief, „Iustus ex fide vivit“ (Der Gerechte lebt aus dem Glauben), als auch in einem selbst geschriebenen Kirchenlied mit dem Titel Was mein Gott will, gescheh’ allzeit. Zudem legte er den Grundstock zu einer königlichen Bibliothek. Sie erhielt den Namen „Silberbibliothek“, weil Albrecht die ersten Bände in Silber beschlagen ließ.
Bis zu seinem Tod 1568 regierte er das Herzogtum und setzte den Erfolg der Ordensritter mit anderen, subtileren, zeitgemäßen Mitteln fort. Mit seinen Bildungsinvestitionen aktivierte er einen Produktionsfaktor, dessen Potenzial an anderen Höfen nicht nur nicht gefördert, sondern überall flach gehalten wurde, ängstlich unterdrückt, gedeckelt, damit die Leute nicht aufmüpfig wurden. Er ließ den frischen Wind, den Luthers Widerstand entfacht und Gutenbergs Druckerkünste ermöglicht hatten, in ein Land wehen, das weder der Kirche noch dem Kaiser unterstand; ein jungfräulicher Neuanfang, wie es ihn im Reich nicht hätte geben können, wo die Territorialgewaltigen entweder in der doppelten Fessel von Kirche und Kaiser gefangen waren oder – wenn sie sich zum Protestantismus bekannten – noch immer in der Gefangenschaft des Reiches gebunden waren. Albrecht war frei und verwandelte sein kleines Land in einen protestantischen Musterstaat.4 Da sein Sohn schwer krank war, bestimmte Albrecht den in der Nachbarschaft als Kurfürst von Brandenburg residierenden Hohenzollern als Nachfolger seines Sohnes nach dessen Tod. Der Sohn starb 1618.
Es war ein Zufall, dass sowohl der Deutsche Orden als auch die Mark Brandenburg zu dieser Zeit von Mitgliedern des Hauses Hohenzollern regiert wurden. Deren Stammsitz hatte ursprünglich im Frankenland rund um Nürnberg gelegen. Der deutsche König und spätere Kaiser Sigismund hatte 1415 den tüchtigen Hohenzollern die Markgrafschaft Brandenburg zum Lehen gegeben. Das vorherige Herrschergeschlecht dort war schon 1320 ausgestorben. Anarchische Zustände, ähnlich denen im Reich nach dem Ende der Staufer um 1250, waren in der Mark Brandenburg ausgebrochen, in deren Folge Faustrecht und Raubrittertum um sich gegriffen hatten. Sigismund selbst war von 1378 bis 1388 und noch einmal von 1411 bis 1415 Kurfürst von Brandenburg gewesen. Dann hatte er als Kaiser alle Hände voll zu tun gehabt, um auf dem Konzil von Konstanz den Papstsitz von Avignon zurück nach Rom zu holen und aus drei Päpsten wieder einen werden zu lassen. Zudem hatte die Verbrennung des Kirchenreformers Jan Hus auf dem Konzil zu den Hussitenkriegen geführt, die bis nach Brandenburg hineingetragen worden waren. Er hatte dort jemanden gebraucht, der dauerhaft die Ordnung wiederherstellen konnte.
Das war für die Hohenzollern sehr weit weg von zu Hause und kulturell ein Schock gewesen, aber das Amt war immerhin mit der Kurfürstenwürde versehen. Dennoch war der erste Kurfürst aus dem Hause Hohenzollern aus der Mark Brandenburg zurück nach Franken entflohen und auch dort geblieben. Seine Nachfolger aber kehrten zurück und stabilisierten das Land, reorganisierten die Verwaltung und stärkten die Wirtschaftskraft. Ein Blick über den Zaun ins Land des Deutschen Ritterordens wird ihnen dabei hilfreich gewesen sein. Aber die Mark Brandenburg war klein, und mehr als ein ordentliches Leben war nicht zu organisieren gewesen. Im Glaubensstreit nach Luther hatten sie sich auf die Seite der Protestanten gestellt. 1614 hatte der Kurfürst Johann-Sigismund von Brandenburg durch Heirat die weit im Westen des Reiches gelegenen Gebiete Kleve, Mark und Ravensberg erworben, einige wirtschaftlich starke Ländereien am Niederrhein. Er war es nun, der 1618, nach dem Tod des Sohnes von Herzog Albrecht von Preußen, dessen Nachfolge antrat. Damit war er Herrscher über drei sehr weit auseinanderliegende Gebiete: Preußen außerhalb des Reichsgebietes ganz im Osten, Brandenburg irgendwo in der Mitte und die übrigen drei ganz im Westen.
Als die Furie des Dreißigjährigen Krieges im gleichen Jahr 1618 auch in dieses Gemeinwesen hineinfuhr, hatte sie fürchterlich gewütet, weil es nicht möglich gewesen war, dieses dreigeteilte Land zu verteidigen. Der Große Kurfürst, der 1640 – also acht Jahre vor dem Westfälischen Frieden und noch mitten im Krieg – das Zepter übernommen hatte, zog aus der Katastrophe dieses Krieges zwei Konsequenzen: Das Land musste aufgerüstet werden, wenn es nicht dauernd zum Spielball europäischer Mächte werden wollte, und sein Hoheitsgebiet musste arrondiert werden, damit es verteidigt werden konnte. Die Arrondierung der brandenburgischen Gebiete hätte mit dem Friedensschluss in Münster einen großen Schritt vorankommen können, wenn alles mit rechten Dingen zugegangen wäre. Das tat es aber nicht. Die Folgen fehlender Macht hatten sich gezeigt, als dem Land unanfechtbare Erbansprüche auf das an Brandenburg angrenzende Pommern nicht bewilligt worden waren. Schweden verhinderte die Einlösung dieser Erbschaft und behielt Vorpommern und die Insel Rügen für sich. Nur Hinterpommern ging an die Mark Brandenburg.
Ein schlagkräftiges stehendes Heer sollte deshalb zukünftigen eigenen Ansprüchen und Forderungen größere Durchschlagskraft verleihen. Der Große Kurfürst hatte seine berechtigten Ansprüche auf Vorpommern nicht vergessen. Er wollte sie durchsetzen. Gelegenheit dazu bot sich ihm, als Schweden – als Sieger aus dem Dreißigjährigen Krieg heimgekehrt – den Weg zur Großmacht vollenden wollte und von 1655 bis 1660 in einen Krieg gegen Polen, Russland, Österreich, Dänemark und die Niederlande zog. Der Große Kurfürst focht als Lehnsnehmer auf Seiten Polens gegen die Schweden. Am Schluss erhielt er von allen Kriegsteilnehmern die Anerkennung der Souveränität Preußens als unabhängiges Herzogtum – eine wichtige Voraussetzung für die weitere Entwicklung des Landes. Die polnische Lehnshoheit über Preußen hatte sich damit erledigt. Die vom Kaiser angemaßte Lehnshoheit wurde wenig später vom Habsburger Leopold gegen das Versprechen des Großen Kurfürsten eingetauscht, ihn, Leopold, bei der Königs- und Kaiserwahl zu unterstützen – womit aus einem inszenierten Schein doch noch ein wenig Sein herausgeschlagen worden war. Und im Schein des angemaßten Hochmeistertums des Deutschen Ritterordens sonnt man sich auch im heutigen Österreich noch immer gern auf der einen oder anderen Gedenktafel.
Der Große Kurfürst war nunmehr in Preußen und in Brandenburg Herrscher zweier Staaten, die unabhängig voneinander bestehen blieben, gleichwohl aber von ihm in Personalunion regiert wurden. Mit der Erhebung etlicher Steuern füllte der Große Kurfürst die Staatskasse soweit auf, dass er in der Lage war, ein stehendes Heer zu unterhalten, das im Falle eines Kriegs auf zwanzigtausend Mann aufgestockt werden konnte. Dazu förderte er die Wirtschaft, indem er das Gewerbe und den Verkehr von Beschränkungen befreite, den Binnen- und Seehandel förderte, den Müllroser Kanal bauen ließ und einen eigenen Postdienst einrichtete. Als 1675 die Schweden abermals über die Mark Brandenburg herfielen, erlitten sie, die als unbezwingbar galten, zum Erstaunen ganz Europas eine herbe Niederlage. Sie wurden aus Vorpommern und von der Insel Rügen vertrieben. Damit wäre man der Verbindung der Territorien Brandenburgs und Preußens im Osten einen Schritt nähergekommen, wenn nicht Frankreich das Geschehen in der Ferne kritisch beäugt hätte. Als Friedensgarantiemacht des Westfälischen Friedens bestand es darauf, dass Brandenburg die gewonnenen Gebiete an die zweite Friedensgarantiemacht Schweden zurückgab. Der Kaiser in Wien, der auch in diesen Krieg verwickelt war und wieder einmal gegen Frankreich focht, hatte dabei die Vasallentreue Brandenburgs in Anspruch genommen. Dann aber hatte der Kaiser ihn im Stich gelassen, als er ohne Kenntnis des Kurfürsten und ohne Rücksicht auf die Interessen Brandenburgs Frieden mit Frankreich schloss.5 Der Verrat hatte Methode. Es galt, das Entstehen eines starken protestantischen Fürstentums im Norden des Reiches zu verhindern. Nachteile für das Reich wurden dafür in Kauf genommen. Das war eine bittere Pille für den Großen Kurfürsten. „Aus meinen Gebeinen möge mir ein Rächer erstehen!“, hatte er erbost ausgerufen, nachdem er den Friedensvertrag in Saint Germain unterschrieben und die Feder von sich geworfen hatte. Sein Zorn galt mehr dem Kaiser als den Franzosen. Denen sicherte er zu, bei der nächsten Kaiserwahl seine Stimme Ludwig XIV. zu geben.
Und der Rächer gegen den Kaiser würde kommen, denn es war nun schon das zweite Mal gewesen, dass Preußen durch militärische Glanzleistungen aufgefallen war. Auf Dauer konnte das nicht ohne Folgen bleiben. Der Große Kurfürst fiel – ähnlich wie Albrecht von Brandenburg-Ansbach – in seiner Politik durch ein außergewöhnlich hohes Maß an Toleranz auf. Als der Sonnenkönig im fernen Frankreich das Edikt von Nantes aufhob, durch das den Protestanten in Frankreich Gewissens- und Religionsfreiheit gewährt worden war, hätte der Kurfürst angesichts seiner negativen Erfahrungen mit diesem Land eigentlich keinen Grund zu einer generösen Geste gehabt. Dennoch bot er den französischen Protestanten Asyl an und nahm zwanzigtausend Hugenottenflüchtlinge bei sich auf. Und diese Zuwanderer wirkten dann als zusätzlicher Wachstumsfaktor für die Brandenburgische Wirtschaft.
Sorgen machte dem Großen Kurfürsten aber die Regelung seiner Nachfolge. Der dafür vorgesehene Sohn Karl Emil verstarb noch vor seinem Machtantritt. 1688 musste deshalb nach dem Tod des Großen Kurfürsten der weniger geeignet erscheinende, auch körperlich verwachsene dritte Sohn Friedrich die Nachfolge antreten. Aber dieser „schiefe Fritz“, wie die Berliner ihn nannten, den seine Amme als Baby vom Arm hatte fallen lassen und der dadurch einen bleibenden Schaden an der Schulter davon getragen hatte, entwickelte ein außergewöhnliches Maß an Willensstärke. Glanz und Größe wollte er haben und – eine Königskrone. Die Königswürde war ein Prestigeziel mancher Potentaten im damaligen Reich. Solange sie sich dabei auf ausländische Staaten konzentrierten, hatte der Kaiser kein Problem damit. Der Kurfürst von Sachsen war König von Polen, der Herzog von Hannover erhielt die Königskrone in England. Auch Bayern begehrte die Königswürde und verhandelte mit dem Kaiser darüber – noch immer die bayerischen Verdienste im Auge, die man dem Kaiser beim Vertreiben des Pfälzer Kurfürsten vom böhmischen Königsthron geleistet hatte. „Ihr habt dafür die Oberpfalz erhalten und die Kurwürde obendrein“, wird der Kaiser gesagt und dabei gedacht haben: Niemals werde ich einem deutschen Fürsten die Königswürde geben. Es kann im Reich einen König nur aus einem Hause geben, dem Haus Habsburg, und deshalb können nur wir Kaiser werden. Außerdem sah die Goldene Bulle keinen Königstitel außer dem des deutschen Königs vor.
Nun also war mit dem „schiefen Fritz“ ein weiterer Aspirant auf die Königswürde aufgetreten. Seit 1696 hatte er ergebnislos mit dem Kaiser verhandelt, bis 1701 der Krieg um die Besetzung des spanischen Throns gegen Frankreich ausgebrochen war und die frustrierten Bayern den Kaiser mittendrin im Stich gelassen hatten und auf die Seite der Franzosen gewechselt waren. Es ging um viel in diesem Krieg. Mit der spanischen Krone stand die Hälfte des Habsburgischen Herrschaftsbereichs auf dem Spiel. Es war aber nicht das Wohl der Christenheit in Gefahr, es war eine Frage dynastischer Macht des Hauses Habsburg. Damit war das auch keine Angelegenheit des Reiches, und es kam nach den Regeln des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation auch keine militärische Unterstützung durch das Reich in Frage. Es ist dies ein weiteres Beispiel für die deutsche Fähigkeit, eine Sache um ihrer selbst willen zu tun oder aus Prinzipientreue auch zu unterlassen, selbst wenn man sehr wohl nationale deutsche Interessen als berührt hätte ansehen können angesichts der aggressiven Politik Frankreichs in jenen Jahren. Und es ist ein Beispiel für die Selbstsucht des Hauses Habsburg, für das es um Wichtigeres ging als um das Wohl der Christenheit. Wie zur Zeit des Böhmenkönigs aus der Pfalz achtzig Jahre zuvor und im gesamten Dreißigjährigen Krieg ging es dem Kaiser ausschließlich um die eigene Familie, um das Haus Habsburg.
In dieser schwierigen Lage rückte Brandenburg mit seinen gut trainierten Soldaten ins Blickfeld des Not leidenden Kaisers. Es gab Geheimverhandlungen zwischen ihm und dem brandenburgischen Kurfürsten im Schloss Schönhausen. Am 16. November 1700 gab der Kaiser schließlich im sogenannten Kontraktat grünes Licht und die Zusage, dass der protestantische Kurfürst von Brandenburg die Königswürde erreichen könne, wenn er ihm jetzt helfe. Die Bedingungen lauteten: Der Kurfürst verpflichtete sich, mit achttausend Mann im spanischen Erbfolgekrieg auf Seiten des Kaisers zu kämpfen. Darüber hinaus sollte er zwei Millionen Dukaten an den Kaiser zahlen, zusätzlich 600.000 an den deutschen katholischen Klerus – offensichtlich eine Strafe dafür, dass der Vater des Kurfürsten in Münster die Sache der Protestanten gegen den Papst vertreten hatte; 20.000 Taler gingen zusätzlich an die Jesuiten als Sturmtruppe des Papstes. Diese Bedingungen hätte auch Bayern und jeder andere Kurfürst erfüllen können. Es kam aber eine hinzu, die nur Preußen erfüllen konnte. So sollte die Krönung zum König außerhalb des Heiligen Römischen Reiches stattfinden, der Königstitel sollte nicht auf die zum Reich gehörige Mark Brandenburg, sondern nur auf das jenseits der Reichsgrenzen gelegene Preußen bezogen werden. Und der Kurfürst durfte sich nur „König in Preußen“ nennen, nicht „König von Preußen“, angeblich weil es einen polnischen König gab, der mit den benachbarten Gebieten Ermland und Pomerellen über andere Teile Preußens herrschte und somit ein König auch von Preußen war. Tatsächlich stand bei dieser eigenwilligen Titulatur auch hier vor allem die Angst des Habsburgers vor einem echten deutschen König als Mitbewerber bei der nächsten Königs- und Kaiserwahl im Reich Pate – einem Reich, das zwischenzeitlich so zugerichtet war, dass wahrscheinlich kaum ein Kurfürst bei Verstand den Kaiserposten überhaupt hätte annehmen wollen. Aber das sah der Habsburger anders. Deshalb ließ er sich in diesem Geheimvertrag zusätzlich zusichern, dass der „König in Preußen“ wenn er in Personalunion als Kurfürst von Brandenburg tätig werden würde, bei allen zukünftigen Königs- und Kaiserwahlen seine Stimme dem Habsburger Kandidaten geben werde. Diese geheimen Bestimmungen blieben nicht lange geheim und wurden zum Gespött unter den Kurfürsten gegen den Kaiser.