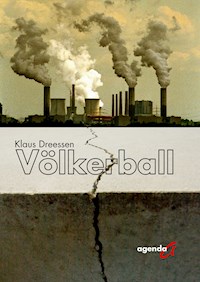Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
„Die Macht Deutschlands ist groß, aber so, dass man sich ihrer nicht bedienen kann“, sagte 1508 Niccolo Macciavelli, der große italienische Machttheoretiker. Gab es ein Zuwenig an nationaler deutscher Machtentfaltung? Warum und bis wann hat das gegolten? Was war heilig, was war römisch, was war deutsch am Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation und warum hieß es nicht einfach „Deutsches Reich“? Was hat die Traumdeutung des Propheten Daniel aus dem Alten Testament mit dieser Namensgebung und dem „himmlischen deutschen Sonderweg“ zu tun? Hat das Haus Habsburg im Dreißigjährigen Krieg das Volk verraten? Warum? Was hat der Ablasshandel der römischen Kirche mit dem Strukturvertrieb heutiger Wall-Street-Derivate gemein? Wurde die Deutsche Hanse auf dem Altar kaiserlicher Romhörigkeit geopfert? Hat der Prophet Daniel die Globalisierung und die heutigen Flüchtlingsströme vorhergesehen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 312
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
»Die Macht Deutschlands ist groß, aber so, dass man sich ihrer nicht bedienen kann.«
Ein deutsches Reich, das römisch sein und heilig werden sollte
Der Modergeruch Roms setzt die Völker in Bewegung
Der Blick eines Giganten auf eine zerfallende Welt
Die Reichsverfassung als Krone auf dem Haupt des Kaisers
Von den frühen Verfehlungen der Päpste
Der Beginn des deutschen Sonderwegs
Die Kirche stiehlt dem Kaiser die Macht
Ein Staatsstreich der Kirche gegen die Welfen
Heinrich der Löwe ist heimlicher König der Deutschen
Die Verlegenheitslösung mit den Habsburgern
Mit der Goldenen Bulle gegen die Willkür der Päpste
Die Mogeleien der Habsburger
Martin Luther bekämpft päpstliche Derivate
Erste Zeugen einer Moderne in Deutschland
Kaiser und Kirche verraten ihr Volk
Dänische Träume
Wallensteins Träume
Schwedische Träume
Frankreichs Träume
Christoffel von Grimmelshausen berichtet als Zeitzeuge
Der Albtraum des Krieges endet nicht im Westfälischen Frieden
Vom Nutzen der himmlischen Staatsverfassung
»Die Macht Deutschlands ist groß, aber so, dass man sich ihrer nicht bedienen kann.«
Niccolò Machiavelli
Man hätte die Katastrophe kommen sehen können, eigentlich müssen, die Deutschland von 1618 bis 1648 überrollte. Die Kurfürsten als die tragenden Säulen des Reiches hätten nur genau hinsehen und auch zuhören müssen, was andere über Deutschland sagten. Ein Italiener, im Jahre 1508 zu Besuch in Deutschland, sah es sofort. Der große Staatstheoretiker Niccolò Machiavelli hielt sich in diplomatischer Mission für seine Heimatstadt Florenz im Reich auf. In seinem Bericht über den »Politischen Zustand Deutschlands« hielt er fest:
»Die Macht Deutschlands ist groß, aber so, dass man sich ihrer nicht bedienen kann.« Einerseits sei es unbestritten, dass »an der Macht Deutschlands […] niemand zweifeln« dürfe, da es »Überfluss an Menschen, Reichtümern und Waffen« habe. Andererseits sah er die große »Uneinigkeit der Fürsten und Städte«, deren Ursache »in dem vielfach entgegengesetzten Streben« liege, »das man in diesem Lande findet«.
Ein großes Maß an Macht und Menschen, Reichtümern und Waffen, derer man sich nicht bedienen kann. Das musste die Nachbarn in Versuchung bringen. Denn von Clausewitz wissen wir heute jedenfalls: Ins Vakuum zieht der Feind ein. Wie konnte es dazu kommen? Warum war das Land so völlig anders organisiert als seine Nachbarn, warum war es so machtlos und die Bevölkerung so hilflos dem Schicksal ausgeliefert?
»Was war heilig, was war römisch, was war deutsch am Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation und warum hieß es nicht einfach "Deutsches Reich"?«
Ein deutsches Reich, das römisch sein und heilig werden sollte
Es waren gewichtige Gründe aus dem Bereich der Religion gewesen, die dazu geführt hatten. Und die Entscheidung darüber lag zur Zeit Machiavellis schon 500 Jahre zurück. Am Beginn des Reiches um das Jahr 900 war sie getroffen worden. Und schon hier in grauer Vorzeit wurden die Grundlagen für das gelegt, was man tausend Jahre später einmal als den deutschen Sonderweg bezeichnen sollte. Eine Prophezeiung des Propheten Daniel, festgehalten im Alten Testament, hat Pate gestanden. Dort steht geschrieben, dass der König Nebukadnezar, der 600 v. Chr. über das Babylonische Reich herrschte, einen Traum hatte, den keiner seiner Weisen im Lande deuten konnte. Da erbot sich der jüdische Prophet Daniel, das zu tun. In diesem Traum war Nebukadnezar ein gewaltiges Standbild erschienen. Es war groß und von außergewöhnlichem Glanz, aber auch furchtbar anzusehen. Das Haupt war aus Gold, Brust und Arme waren aus Silber, der Leib und die Hüfte aus Bronze. Die Beine waren aus Eisen, die Füße teils aus Eisen, teils aus Ton. Dann sah Nebukadnezar, wie ohne menschliches Zutun sich ein Felsbrocken vom Berg löste und dem Standbild auf die eisernen und tönernen Füße stürzte und sie zermalmte. Und nicht nur Eisen und Ton, sondern auch Bronze und Silber und Gold zerfielen zu Staub. Wie Spreu auf dem Dreschplatz wurde er spurlos vom Wind davongetragen. »Der Stein aber, der das Standbild getroffen hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde.« Im Buch Daniel ist zudem aufgeschrieben, wie Daniel dem König diesen Traum deutet. Er sagt zu ihm:
»Du, König, bist der König der Könige; dir hat der Gott des Himmels Herrschaft und Macht, Stärke und Ruhm verliehen.
Und in der ganzen bewohnten Welt hat er die Menschen, die Tiere auf dem Feld und die Vögel am Himmel in deine Hand gegeben; dich hat er zum Herrscher über sie alle gemacht: Du bist das Goldene Haupt.
Nach dir kommt ein anderes Reich, geringer als deines; dann ein drittes Reich, von Bronze, das die ganze Erde beherrschen wird.
Ein viertes endlich wird hart wie Eisen sein; Eisen zerschlägt und zermalmt ja alles; und wie Eisen alles zerschmettert, so wird dieses Reich alle anderen zerschlagen und zerschmettern.
Die Füße und Zehen waren, wie du gesehen hast, teils aus Töpferton, teils aus Eisen; das bedeutet: Das Reich wird geteilt sein; es wird aber etwas von der Härte des Eisens haben, darum hast du das Eisen mit Ton vermischt gesehen.
Dass aber die Zehen teils aus Eisen, teils aus Ton waren, bedeutet: Zum Teil wird das Reich hart sein, zum Teil brüchig.
Wenn du das Eisen mit Ton vermischt gesehen hast, so heißt das: Sie werden sich zwar durch Heiraten miteinander verbinden; doch das eine wird nicht am anderen haften, wie sich Eisen nicht mit Ton verbindet.
Zur Zeit jener Könige wird aber der Gott des Himmels ein Reich errichten, das in Ewigkeit nicht untergeht; dieses Reich wird er keinem anderen Volk überlassen. Es wird alle jene Reiche zermalmen und endgültig vernichten; es selbst wird aber in alle Ewigkeit bestehen.
Du hast ja gesehen, dass ohne Zutun von Menschen ein Stein vom Berg losbrach und Eisen, Bronze, Ton, Silber und Gold zermalmte. Der große Gott hat den König wissen lassen, was dereinst geschehen wird. Der Traum ist sicher und die Deutung zuverlässig.«1
Diese Prophezeiung galt es nun zu deuten. Und die mittelalterlichen Mönche und Weisen um das Jahr 1000 kamen zu folgendem Ergebnis: Das erste von Daniel erwähnte Reich war zweifellos das Babylonische, das zweite musste das Persische und das dritte das Reich Alexanders des Großen gewesen sein. Diese drei Reiche waren – wie von Daniel prophezeit – entstanden und wieder untergegangen. Für die christlichen Weisen war allein dies schon ein untrügliches Zeichen für die Richtigkeit der Prophezeiung. Das vierte von Daniel erwähnte Reich konnte nur das Römische Reich sein. Und dieses sollte zum Teil auf eisernen, zum Teil auf tönernen Füßen stehen, zu einem Teil hart, zum anderen Teil brüchig sein. »Das bedeutet«, sagt der Prophet in der Bibel, »das Reich wird geteilt sein.« Und tatsächlich war das Römische Reich zu seinem Ende hin geteilt gewesen in das Oströmische in Byzanz und das Weströmische in Rom. Und zur Zeit der Könige dieses vierten, mithin Römischen Reiches wird nun also »der Gott des Himmels ein Reich errichten, das in Ewigkeit nicht untergeht; dieses Reich wird er keinem anderen Volk überlassen. Es selbst wird aber in alle Ewigkeit bestehen«. Und wie zur endgültigen Bestätigung der Richtigkeit dieser Prophezeiung hatte der Gott des Himmels genau zur Zeit dieses vierten Reiches seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde entsandt.
Die Aussage war glasklar: Zwischen dem vierten weltlichen und dem ewigen göttlichen Reich gab es keinen Platz für ein weiteres fünftes, weltliches Reich. Stattdessen sollte sich aus dem vierten Reich ein göttliches entwickeln, das dann in alle Ewigkeit bestehen würde. Die Gründung eines deutschen Reiches war im göttlichen Plan mithin nicht vorgesehen. Die deutschen Kaiser waren also gut beraten, wenn sie gar nicht erst versuchen würden, ein solches zu errichten, sondern sich stattdessen einer viel größeren Aufgabe widmeten und als Gottes Diener dem Herrgott bei der Errichtung seines ewigen göttlichen Reiches zur Hand gingen. Das vierte, das Römische Reich, das im Westen im Jahr 480 bereits untergegangen war, in Byzanz aber als Oströmisches Reich noch bestand, musste in der Form eines Heiligen Römischen Reiches in alle Ewigkeit verlängert werden. »Deutsch« fiel dann eben als Name weg. Namen waren ohnehin nur Schall und Rauch. Hier ging es um eine wichtige Angelegenheit. Und um dieser willen musste man Zugeständnisse machen. Das haben die Deutschen dann tausend Jahre lang geübt. Eine Sache um ihrer selbst willen tun, wie Heinrich Heine es als typisch für den Deutschen ansah. Und das darf man getrost als Kompliment betrachten in einer Zeit, in der die Menschen sich in ihrem Verhalten zuallererst am eigenen Nutzen orientieren.
Dieses Konzept musste den deutschen Königen und Kaisern zweifelsfrei als das modernste und zukunftsträchtigste Konzept erscheinen, das denkbar war. Niemals zuvor war ein Reich sozusagen im direkten Auftrage Gottes und auf die Ewigkeit ausgerichtet aufgebaut worden. Die deutschen Kaiser hielten mit dem Zepter gewissermaßen einen göttlichen Regierungsauftrag in Händen. Freilich erforderte diese Aufgabe auch ein hohes Maß an Pflichtbewusstsein und Disziplin sowie einen weitgehenden Verzicht auf Eitelkeiten und auf ein Machtstreben um der Macht und des eigenen Vorteils wegen. Die Macht des Kaisers musste zuvörderst in den Dienst des Heiligen Reiches gestellt werden. Die Historiker geben Beispiele dafür, dass nach diesen Anforderungen auch gehandelt wurde. Die Belange der eigenen Dynastie hatten zurückzustehen hinter den Belangen des Reiches.
Bis in die Zeit der Reformation hinein war die Idee vom heiligen Reich noch in den Köpfen präsent. Von Thomas Müntzer, Reformator und Rebell, wissen wir, dass er in einer Predigt vor seinem sächsischen Landesherrn diesen zum Übertritt zum evangelischen Glauben überreden wollte mit dem Hinweis darauf, dass nunmehr das vierte Reich aus dem Buch Daniel an sein Ende gekommen sei und das fünfte, göttliche begänne. Das war siebenhundert Jahre nach Karl dem Großen. Diese Staatsidee war kein Trick.
Einen Zweifel an der Seriosität dieser Prophezeiung konnte es nicht geben. Auch der Einwand, dass für die Christen das Neue Testament und nicht das Alte gelte, überzeugt nicht, weil für die Christen ursprünglich sogar ausschließlich das Alte Testament die Heilige Schrift gewesen ist. Es hat lange gedauert, bis das Neue Testament, wie wir es heute kennen, von der Kirche überhaupt anerkannt wurde. Alles sprach dafür, dass die Prophezeiung Daniels göttlichen Ursprungs war und deshalb auch in der Heiligen Schrift niedergelegt wurde. Der Umstand, dass die katholische Kirche ihr Zentrum ausgerechnet in Rom errichtete, lässt darauf schließen, dass sie sich mit einiger Wahrscheinlichkeit sogar schon als Teil des prophezeiten ewigen göttlichen Reiches sah.
Allein die Tatsache, dass diese Traumdeutung schriftlich fixiert worden war, gab ihr einen hohen Stellenwert in einer Zeit des Analphabetentums ohne Bücher. In dieser Zeit, in der fast alles nur mündlich überliefert wurde, war der des Schreibens Kundige schon ein Weiser, und das geschriebene Wort erhielt göttlich-überirdische Bedeutung. Vom geschriebenen Wort ging ein Zauber aus, und ihm galt blindes Vertrauen auf seine Richtigkeit. Diese Zauberwirkung des Schriftlichen, zumal wenn es obendrein sehr alt und von weit her aus der Zeit in die Gegenwart gelangt war, hat sich zum Teil bis heute erhalten. Die ältesten schriftlichen deutschen Dokumente aus der Zeit vor der Christianisierung Deutschlands wurden in der Merseburger Domstiftsbibliothek gefunden und stammen aus dem Jahr 750 n. Chr. Sie sind trotz eines auf den ersten Blick eher banalen Inhalts sogleich als »Merseburger Zaubersprüche« etikettiert worden und heißen auch heute noch so. Und wenn der Pfarrer in der Kirche sagt: »Es steht geschrieben«, dann weiß der Gläubige, dies heißt im Klartext: »Dies ist die Wahrheit.«
Zum Zauber des Schriftlichen aus alttestamentarischer Zeit kam die alles dominierende Bedeutung des christlichen Glaubens in jenen Jahren hinzu. In einer dunklen Zeit ständiger Kriege, Hungersnöte, Krankheiten und täglicher Gefahren waren die Schrecken der Völkerwanderung mit den durchziehenden Horden in der kollektiven Erinnerung noch präsent. Da war die Religion mit der Versicherung der Existenz eines gütigen Gottes, der seine Schäfchen im Auge behält und Wohlverhalten durch Nächstenliebe im Himmel belohnt, wie ein Licht in der Finsternis, das den Menschen die Hoffnung geben konnte, dass das Leben nicht sinnlos war. Ein Leben ohne Sinn auf ewige Zeiten wäre ihnen unmöglich gewesen. Deshalb konnte es nicht falsch sein, einem Kaiser zu folgen, der dieser Idee der Nächstenliebe zum Durchbruch verhelfen wollte, auf dass sie nicht wieder untergehen würde im Gewühl animalischer Triebe. Denn die Idee der Nächstenliebe war flüchtig und immer in Gefahr, von den alten Mächten des auf Rache ausgerichteten Kampfes zertreten zu werden, wieder zu versinken, ohne eine Spur zu hinterlassen. Eine Idee stirbt mit dem Letzten, der von ihr wusste. Man musste sie nicht nur in Buchstaben zu Papier bringen, man musste sie in Stein hauen und ihr in Kirchen und Klöstern einen Raum schaffen, in dem jene leben konnten, die diese Idee in sich trugen. Das Römische Imperium bot mit seinen für die Ewigkeit in die Welt gesetzten Bauten und mit seinen zivilisatorischen Fundamenten am ehesten die Voraussetzungen dafür, etwas so Flüchtiges zu domestizieren und seinen Bestand mit dem kraftvollen Schutz durch die weltliche Macht zu sichern.
Für diesen Schutz kam nur der stärkste Arm infrage. Die strategische Devise lautete: Der Kaiser als Garant für die Sicherheit des Lebens auf Erden – der Papst als Garant für die Sicherheit des ewigen Lebens im Himmel. Der Kaiser stellte die Truppen, der Papst lieferte den Segen dazu und arbeitete an der Durchsetzung der göttlichen Idee von der christlichen Güte in den Herzen und Köpfen seiner ihm anvertrauten Schäfchen. Das war eine wunderbare Symbiose von physischer Macht und geistiger Kraft, von Körper und Seele. Es ging für den Kaiser nicht um den Kampf für mehr Land, für zusätzliche Reichtümer, zusätzliche Untertanen, zusätzliche Sklaven und andere Schätze. Es ging um den Erhalt und die Ausweitung des christlichen Lebens in einer wilden Zeit. Das war eine politische, eine militärische und eine religiöse Aufgabe. Freilich war, um das tun zu können, auch die Aufrechterhaltung des eigenen irdischen Reiches der Deutschen eine notwendige Bedingung. Aber noch ahnte niemand, welche Widrigkeiten sich dem Führungspersonal dieses Gebildes auf seinem langen Marsch in die Heiligkeit in den Weg stellen sollten. Zunächst überwog zwangsläufig der Zauber des Neuen, des Guten und des himmlischen Auftrags, ein Reich nach einem göttlichen Plan zu errichten.
Der Zyniker und kaltblütige Machtstratege Machiavelli hätte diese Aufgabe anders angepackt, so viel ist wohl gewiss. Ihm muss es bei seinem Besuch in Deutschland geradezu in den Fingern gejuckt haben, ein solches Potenzial an Macht und Möglichkeiten ungenutzt brachliegen zu sehen. Was hätte er damit anstellen können! Welch ein Reich hätte er damit aufrichten können, wenn einer wie er mit seinen Fähigkeiten im Machterwerb, im Machterhalt auf den Schild gehoben worden wäre. Ein Reich, unabhängig von klerikalen Mitwirkungsrechten geführt; die Macht in seinen Händen gebündelt, vom Vater auf den Sohn vererbt; ein Staat, wie es ihn in Frankreich und England schon gab, nur größer und mächtiger als diese wäre er gewesen. Aber die Deutschen schienen das Mächtige eines solchen Monolithen nicht zu vermissen, solange man sie in Ruhe ließ. Sie kannten es nicht anders, und für eine gute Sache wie das Christentum zu sein hatte auch seinen Reiz, auch wenn die kollektive Erfahrung einer existenziellen Bedrohung in den Jahrhunderten der Völkerwanderung noch in den Köpfen präsent war.
1 Altes Testament, Buch Daniel, 2. Kapitel.
Der Modergeruch Roms setzt die Völker in Bewegung
Es war eine Zeit der Bedrohung durch eine neue, aggressive Religion. Der Islam hatte sich 632 von Arabien übers Mittelmeer auf den Weg nach Europa gemacht. In Spanien hatte er sich festgesetzt. In Frankreich hatte der Merowinger Karl Martell ihn 732 zurückgeschlagen. Sein Enkel Karl machte sich daran, ein Bollwerk gegen diesen Eindringling zu errichten und gegen jeden möglichen anderen auch. Die Zeit des Völkersturms war noch nicht vorüber. Seit zweihundert Jahren schon strömten unvorstellbare Menschenmassen aus dem Osten und dem Norden Richtung Süden. Als hätten ihre Führer den Modergeruch des untergehenden riesigen Römischen Reiches wahrgenommen, strömten sie gen Rom. Niemand wusste, wann das ein Ende nehmen würde. Die meisten dieser Völker waren gekommen, hatten mit Mord und Totschlag Fuß fassen wollen, waren wieder vertrieben worden und schließlich untergegangen. Ein Segen, dass nicht unsere eigenen Altvorderen es waren, die mitgezogen sind. Hätten sie das damals getan, dann säßen wir heute nicht hier, wo wir jetzt sitzen. Es waren die Hunnen aus den asiatischen Steppen, die Vandalen aus dem Raum des heutigen Weißrussland, die Goten von der damals noch nicht deutsch besiedelten Ostsee, die Langobarden, die östlich der Elbe gefroren hatten, als sie sich nach Norditalien auf den Weg machten. Sie alle sind durch das, was heute Deutschland ist, genauso wild mit Mord und Totschlag hindurchgestürmt, wie sie durch Gallien, Italien und Spanien gestürmt sind. Was immer während der Völkerwanderung geschah, unsere auf dem heutigen Gebiet Deutschlands lebenden Vorfahren haben ebenso darunter gelitten wie die Menschen in Gallien und anderswo.
Sie hatten 500 Jahre zuvor die römischen Eindringlinge unter dem Cheruskerfürsten Hermann aus dem Land gejagt, sie hatten auch schon mal Generäle und Heerführer in den römischen Dienst gestellt und ganz zum Schluss sogar den römischen König. Aber das Volk blieb daheim. Es spricht sogar einiges dafür, dass unsere Vorfahren ganz besonders bodenständig waren. Wissenschaftler in Göttingen haben soeben in einer Höhle im Harz in der Nähe von Osterode 39 Skelette aus der Bronzezeit gefunden. 3000 Jahre alt und so gut erhalten, dass sie deren DNA ermitteln konnten. Sie wurde mit der DNA der heute im gleichen Ort lebenden Menschen vom Stamm der Niedersachsen verglichen, und man fand dabei zwei Männer, deren DNA genau mit der der 3000 Jahre alten Höhlenbewohner übereinstimmt. Die beiden Männer verfügen damit über den ältesten Stammbaum der Welt und bezeugen eine Sesshaftigkeit und Ortsgebundenheit, die für Völkerwanderungen gänzlich ungeeignet wäre.
Anders hatte das bei dem Franken Chlodwig ausgesehen, der um das Jahr 500 aus den heutigen Niederlanden mit seinem Stamm der Salfranken nach Gallien aufgebrochen war. Ziel war auch für ihn Rom, Gallien nur als Durchgangsstation gedacht. Sie wollten damals alle nach Rom. Und sie liefen sich fast alle irgendwann und irgendwo bei ihrem Sturm auf diese Stadt über den Weg, zerfleischten sich dann gegenseitig beim Kampf um ein Stück Land, nachdem sie die Ewige Stadt entweder doch nicht erreicht hatten oder wieder hinausgeworfen worden waren. Und gingen dann als Volk unter, wurden assimiliert von der jeweiligen Stammbesatzung. Zum Teil vollbrachten sie auf ihrem Weg über den Kontinent Großtaten, wie die Vandalen, die sich nach ihrem erfolglosen Sturm auf Rom in Südgallien festsetzen wollten, dort aber von den Westgoten vertrieben wurden. Diese hatten sich schon vor ihnen dort niedergelassen, waren auch schon in Rom gewesen, hatten die Stadt erobert und in Angst und Schrecken versetzt. Aber weil kein Volk auf Dauer glücklich wird durch das Verbreiten von Angst und Schrecken, aus einem mobilen Heerlager heraus, in dem die Kinder schreien und die Frauen sich nach Sicherheit und einer Bleibe mit einem Acker hinter der Hütte sehnen, auf dem sie ihr Gemüse ziehen können, hatten sie sich acht Jahre nach ihrem Überfall von den Römern eben dort im Südwesten Galliens ansiedeln lassen, wo nun die Vandalen ankamen.
Aber die Westgoten hatten die Vandalen auf ihrem langen Weg nach Westen schon einmal vor sich hergetrieben, und so vertrieben sie sie nun ein zweites Mal. Und die Vandalen zogen 409 weiter nach Spanien, durchquerten die gesamte Iberische Halbinsel und erreichten 429 Gibraltar. Bis heute weiß kein Mensch, wie es ihnen möglich war, mit schätzungsweise zwanzigtausend Kriegern und sechzigtausend Familienangehörigen die Meerenge zu überqueren und so die reiche römische Provinz Africa zu erreichen. Dass ihnen das gelang, ist unbestritten, denn 439 marschierten sie durch das heutige Marokko und Algerien und eroberten unter ihrem König Geiserich Karthago, das ehemalige Zentrum des untergegangenen Reiches der Phönizier, das römische Provinz geworden war. Dabei fiel ihnen die römische Flotte in die Hände, und so wurden sie eine Seemacht und eroberten Sardinien, Korsika und die Balearen. Schließlich plünderten sie 455 n. Chr. – nachdem sie auf ihrem langen Weg das halbe Mittelmeer umrundet hatten – doch noch Rom, 45 Jahre nachdem die Westgoten das getan hatten.
Nicht schön für die Bevölkerung, aber auch die Römer haben ihr Reich nicht durch gutes Zureden und freiwillige Unterwerfungen geschaffen. Sie haben brutal zugeschlagen, wenn es um ihre Interessen und um die Vergrößerung ihrer Macht oder auch nur um ihren Machterhalt ging. Wer sich ihnen in den Weg stellte, wurde nicht weniger gnadenlos ins Unglück gestoßen. Davon hatten auch die Karthager ein Lied singen können. Der alte Cato hatte alle seine Reden im römischen Senat mit immer demselben Spruch beschlossen – unabhängig vom jeweiligen Thema, immer schloss er seine Rede mit den Worten: »Ceterum censeo Carthaginem esse delendam.« (»Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Karthago zerstört werden sollte.«) Als das 145 v. Chr. schließlich geschah, hatte man die Stadt dem Erdboden gleichgemacht. In den nächsten hundert Jahren gab es dort kein Leben mehr. Erst Cäsar setzte einen Wiederaufbau in Gang, weil Karthago die Kornkammer des Reiches war. Auf den Ruinen Karthagos errichteten dann also die Vandalen ihr Reich. 468 n. Chr. konnten sie eine gemeinsame Attacke oströmischer und weströmischer Truppen abwehren, mussten sich aber 534 n. Chr. bei einem erneuten oströmischen Angriff ergeben. Ihr Reich ging unter.
Und nicht anders erging es den Westgoten in Südgallien. Gegen die Vandalen hatten sie sich durchsetzen können. Gegen den Salfranken Chlodwig gelang ihnen das nicht mehr. Sie waren Chlodwig auf seinem Weg nach Rom im Wege. Diesem war es nicht entgangen, dass 475 Nepos als Kaiser von Rom geflohen, sein minderjähriger Nachfolger mit dem Spitznamen Romulus Augustulus davongejagt und der in römischen Diensten stehende germanische Heerführer Odoaker zum König von Italien gewählt worden war. Das war ein deutliches Signal zum Start auch für Chlodwig gewesen, der ohnehin schon im alten, ehemals römischen Kolonialbereich Gallien gleich nebenan zu Hause war. Er hatte 486 mit seinen Mannen, die später als Merowinger bekannt wurden, Syagrius, den letzten Statthalter römischer Macht in Gallien besiegt, und zwar so vernichtend, dass dieser Gallien aufgab. Für wen auch hätte er die Stellung noch länger halten sollen? Damit hatte Chlodwig sich bereits einen Teil des Römischen Reiches angeeignet. Nun wollte er mehr, auch er wollte nach Rom. Als Zwischenetappe besiegte er 506 noch die Alamannen vernichtend, die ihm auch im Weg waren. Und dann ging es gegen die Westgoten.
Sie, die den ganzen Rom-Hype schon hinter sich hatten und seit ziemlich genau hundert Jahren Gemüse in der Provence anbauten, waren nicht mehr in dem Maße kriegerisch bei der Sache, um den fränkischen Neuling in Sachen Rom zu besiegen. Die Schlacht gegen Chlodwig ging 507 verloren, und dieser herrschte nun über fast ganz Gallien. Der Weg nach Rom schien frei für Chlodwig. Er wäre frei gewesen, wenn nicht in der norditalienischen Nachbarschaft gleich nebenan ein anderer großer Gote ihm den Weg versperrt hätte. Theoderich, der Führer der Ostgoten, hatte sich mit seinem Stamm zunächst in etwa dort, wo zuvor die Hunnen gesessen hatten, im Donauraum, in gefährlicher Nähe zu Konstantinopel festgesetzt. Inzwischen waren die Kaiser in Konstantinopel mächtiger als die Herrscher in Rom. Als dort die chaotischen Zustände ausbrachen – ein Kaiser geflohen, sein minderjähriger Nachfolger als Romulus Augustulus verhöhnt und abgesetzt, der germanische Heerführer Odoaker zum König gewählt –, konnte das dem Kaiser in Konstantinopel nicht gleichgültig sein. Ihn plagten zwei Sorgen: auf der einen Seite die Nähe der Ostgoten mit ihrem Führer Theoderich, von dem man nicht wissen konnte, ob sein Ehrgeiz ihn eines Tages nicht doch in Richtung Konstantinopel treiben würde, und das Chaos in Rom andererseits. Er löste beide Probleme mit dem Auftrag an Theoderich, nach Italien zu ziehen, Odoaker zu töten und sich mit seinem Stamm in Norditalien niederzulassen.
Das war eine Herausforderung, die Theoderich annahm. Er zog mit 20 000 Soldaten und deren Familien gen Westen in der Hoffnung, dort die Nachfolge Odoakers antreten und sich mit seinem Stamm endgültig im schönen Italien niederlassen zu können, so wie die Westgoten das in Gallien auch schon getan hatten. 489 besiegte er Odoaker, der aber fliehen konnte. Um seine Zielvorgabe umzusetzen, lud Theoderich ihn 493 zu einem Versöhnungsmahl ein, das Odoaker aber nicht überlebte. Theoderich tötete ihn eigenhändig. Man darf nicht zimperlich sein, wenn man ein eigenes Reich erobern will. Theoderich wurde Stellvertreter des oströmischen Kaisers und herrschte über ganz Italien. Als »der Große« ist er in die Geschichte eingegangen. Ein gerechter und starker Herrscher sei er gewesen, sagt die Geschichte, und gewirkt habe er wie ein wahrer Kaiser. Ravenna war damals schon seit einiger Zeit Hauptsitz des Weströmischen Reiches. Dort behielt auch Theoderich seinen Regierungssitz als der heimliche Kaiser des Römischen Reiches von Ostroms Gnaden. Das wollte er auch gern bleiben, sah aber seinen Thron wanken, als Chlodwig die Westgoten in Südgallien vernichtend schlug.
Die beiden hatten sich ganz offensichtlich schon eine Weile beäugt und verfolgten die Handlungen des jeweils anderen mit großem Misstrauen. Dabei hatte Chlodwig zunächst strategisch geschickt gehandelt. Im Jahr der Ermordung Odoakers durch Theoderich waren ihm dessen Herrscherqualitäten ganz offensichtlich sehr deutlich geworden, und er hatte ihm noch im selben Jahr 493 seine Schwester zur Frau gegeben – in der sicheren Erwartung, dass Theoderich im Interesse des Familienfriedens seine eigenen Pläne für den Marsch auf Rom nicht stören würde. Er hatte sich geirrt.
Schon nach Chlodwigs Sieg über die Alamannen hatte er dem Frankenführer ein erstes Zeichen gegeben, dass er beobachtet wurde. Die Alamannen waren auf ihrem Weg nach Süden Bundesgenossen der Ostgoten gewesen. Sie waren im Jahr 200 in Böhmen von den auch dort herrschenden Römern vertrieben worden und in Richtung Main und Rhein gezogen. Im Grenzland zwischen den Flüssen und dem Limes waren sie ein weiteres Mal mit den Römern aneinandergeraten. Daraus hatte sich bei dem Versuch, den Limes zu überschreiten, eine Art Dauerkrieg entwickelt. Letztlich waren die Alamannen erfolgreich gewesen. Der Schritt ins besetzte Gallien war ein Sieg über die verhassten römischen Legionäre. Bis nach Rom wollten die Alamannen aber offensichtlich nicht. Dennoch wurde ihre Macht von Chlodwig gebrochen, der nach seinem Sieg brutal mit ihnen umging. Darauf hatte Theoderich sich bei ihm gemeldet und ihn in einem Brief um eine maßvollere Politik gegenüber seinen Bundesgenossen gebeten:
»Euch, unserem hochberühmten Schwager, übermitteln Wir Unsere Glückwünsche zu Eurem Siege: Ihr vermochtet die auf ihren Lorbeeren ausruhenden Franken zu neuen Kämpfen zu begeistern und die Alamannen auf dem Schlachtfeld zu besiegen und zu unterwerfen. […] Der Allgemeinheit jedoch sollte die Schuld der Führer nicht aufgebürdet werden. Wir bitten Euch daher die völlig erschöpften Überlebenden nicht länger mit Eurem Zorn zu verfolgen. […] Höre auf meinen Rat […] Stets siegt nämlich der, der alles mit Maß zu behandeln versteht.«2 Dass es ihm nicht nur um reine Menschlichkeit, sondern um handfeste Machtpolitik ging, machte Theoderich dann deutlich, als Chlodwig 507 die Westgoten besiegt und deren König Alarich II. getötet hatte. Damit war Chlodwig ihm zu nahe auf den Leib gerückt. Um das zu ändern, ging er 508 zu seinen westgotischen Verwandten und ließ sich von ihnen zum Vormund ihres noch unmündigen Königs machen. Damit saß nun er statt Chlodwig auf dem westgotischen Thron und gliederte deren Reich praktisch in sein Ostgotenreich ein. Aus dem Sieg über die Westgoten war für Chlodwig eine Niederlage geworden. Ihm war jetzt nicht nur der Weg nach Rom versperrt, sondern auch die Herrschaft über Südgallien entrissen. Einen Krieg gegen Theoderich wird er sich nicht zugetraut haben. Er musste jetzt ein Reich ohne Rom planen und sich auf Dauer im Rest Galliens einrichten. Tatsächlich folgten die Konsequenzen, die er daraus zog, Schlag auf Schlag innerhalb kürzester Zeit.
Noch im selben Jahr 508 ließ er alle fränkischen Teilkönige in Gallien ermorden und annektierte ihre Reiche. Damit sicherte er sich die zentrale Macht in Gallien. Das imponierte offensichtlich dem oströmischen Kaiser Anastasios I. im fernen Konstantinopel so sehr, dass er noch im selben Jahr Chlodwig als König der Franken anerkannte. Außerdem konnte er Theoderich durch diesen Schachzug zeigen, wer in diesem Machtdreieck Koch und wer Kellner war. Im Jahr darauf erhob Chlodwig 509 Paris zur Hauptstadt seines Frankenreiches. Und weil es nach Süden nun keine Expansionsmöglichkeiten mehr gab, streckte er seine Fühler nach Osten zu den daheimgebliebenen Verwandten, den Rheinfranken, aus. Er, dessen Mutter aus Thüringen und dessen Vater aus Köln stammten, zog im Jahr 510 über den Rhein, eroberte als Salfranke das seit 470 bestehende rheinfränkische Reich derer, die seinerzeit nicht mit ihm gegen die Römer nach Gallien gezogen waren, ließ deren König Chloderich ermorden und sich sodann vom Adel in Köln auf den Schild heben und als König auch hier anerkennen.
Im Jahr 511 ordnete er auf der Synode von Orléans die kirchlichen Verhältnisse in seinem Reich neu, wohl wissend, dass eine halbwegs geordnete Verwaltung ohne die Kirche und die Übernahme des römischen Verwaltungssystems nicht möglich war. Da er sich schon 499 in Reims hatte taufen lassen, wollte er jetzt das weitverzweigte Netz von Klöstern, Kirchen und Pfarreien als Machtinstrument nutzen. Die Gallier waren als Untertanen des römischen Reiches seit der Taufe Konstantins des Großen 337 zum großen Teil zum christlichen Glauben übergetreten. Um seine Macht ausüben zu können, brauchte Chlodwig eine Verfügungsgewalt auch über die Kardinäle, Bischöfe, Äbte, Mönche, Nonnen und Pfarrer, die in diesem Netzwerk arbeiteten. Wichtigster Punkt der Synode in Orléans war deshalb die Festlegung der Investitur der Bischöfe. Auf seinen Vorschlag hin wurde beschlossen, dass der König bei der Einsetzung von Bischöfen ein Bestätigungsrecht erhielt. Das war weit mehr als ihm bisher an Rechten zugestanden hatte. Und es war ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu der von Chlodwig angestrebten fränkischen Reichskirche mit weitgehenden Hoheitsansprüchen des Königs. Damit hatte er sich dauerhaft in Gallien eingerichtet. Ein Jahr darauf, am 27. November 511, starb Chlodwig in Paris.
Zweihundertfünfzig Jahre haben sich die Franken in Gallien im Regierungssattel halten können. Insgesamt 42 Könige haben in dieser Zeit das Reich geteilt oder ungeteilt regiert. Aber mit Ruhm bekleckert haben sie sich nicht in all diesen Jahren. Sie haben sich mehr mit sich selbst beschäftigt als mit den Belangen des Volkes. Sie alle hatten nur eines im Sinn: nicht übergangen zu werden, wenn es ans Erben ging. Ob dabei immer die Bestgeeigneten bei der Besetzung des Chefpostens zum Zuge kamen, muss bezweifelt werden, war aber auch unerheblich im Rahmen einer Erbmonarchie. Es war ein familieninterner Kampf um die Führung ohne wirklichen Kontakt zum Volk, das eine andere Sprache sprach. Diese Kluft wurde noch größer, als sie 575 begannen ihr eigenes Unvermögen dadurch zu überbrücken, dass sie zur Führung der Regierungsgeschäfte und für die Verwaltung von Haus und Hof, später auch zur Kriegsführung, befähigte befreundete Familien mit dem Amt des Hausmeiers betrauten. Sie wählten dafür durchgehend fränkisches Personal aus mit so wohlklingenden Namen wie Gundolf, Otto, Grimoald, Chlodulf, Childebert, Childerich und andere. Später tauchte der etwas ausgefallene Name Pippin als Hausmeier auf. Dieser Name legt zunächst nahe, nicht deutsch, sondern französisch ausgesprochen zu werden – in der Vermutung, Pippin wäre der erste Gallier in der Phalanx der Franken auf dem Stuhl eines Hausmeiers gewesen. Aber die Historiker schwören heilige Eide darauf, dass auch die Pippiniden aus altfränkischem Geblüt mit Grundbesitz nördlich der Ardennen stammten. Die Namen ihrer Kinder untermauern das. Sie lauten allesamt wie die oben erwähnten, ergänzt immer mal wieder durch einen weiteren Pippin. Und wie der Zufall es will, gibt es just in der Nähe von Osterode, dem Ort mit dem 3000 Jahre alten Stammbaum, eine Pippinsburg, die als Fliehburg errichtet worden war.
Nur ihr Ehrgeiz unterschied die Pippiniden von den bisherigen Hausmeiern. Mit ihnen hatten sich die unfähigen Merowingerkönige selbst eine Laus in den Pelz gesetzt. Einer von ihnen zeugte in wilder Ehe mit Chalpaida einen Sohn, den sie Karl nannten. Auch Karl wurde Hausmeier, und in diesem Amte, das inzwischen erblich geworden war, wurde er als Karl Martell zum Retter der Christenheit. Gefahr drohte aus nahezu allen Himmelsrichtungen. Von Süden nahte die neue, jüngere Religion mit aggressivem Sendungsbewusstsein, die plötzlich vor den Toren Europas stand. Als Karl Martell, der Großvater von Karl dem Großen, 732 die arabischen Heere unter Abd ar-Rahman auf ihrem Eroberungszug in Gallien gestoppt und zurückgeschlagen hatte, hätte das der Moment der Erkenntnis sein können, dass etwas grundsätzlich Neues in der Politik geschehen musste. Es war doch ein schrilles Alarmsignal gewesen. Aber noch geschah nichts wirklich Neues. Außer dass der Ruhm die Nachkommen von Karl Martell veranlasste, sich und ihre Dynastie in der Folgezeit nicht mehr Pippiniden, sondern Karolinger zu nennen – ein zugegebenermaßen klangvollerer Name. Das grundsätzlich Neue blieb dem Enkel von Karl Martell vorbehalten. Karl Martell hatte mit seiner Frau Chrotrud zwei Söhne, von denen Karlmann ins Kloster ging, während der andere, wieder ein Pippin, den Hausmeier machte. Und das machte er so gut, dass er schließlich mithilfe seines engsten Ratgebers Fulrod und mit dem Zuspruch des Papstes 751 von den Franken zum König gewählt und der amtierende König Childerich III. abgesetzt wurde.
2 Chronik der Deutschen, Chronik-Verlag, Dortmund 1983, S. 106.
Der Blick eines Giganten auf eine zerfallende Welt
Von den sechs Kindern, die Pippin mit seiner Frau Bertrada zeugte, übernahm Karl 768 das Zepter. Das war jener, der später als Karl der Große und erster Kaiser des Reiches links und rechts des Rheins in die Geschichte eingehen sollte. Karl hat seinen Beinamen »der Große« nicht so sehr wegen der Ausdehnung seines Reiches erhalten, sondern wegen der Vereinigung von Politik und Religion, von militärischer Macht und geistiger Kraft. Es war die Verbindung zweier scheinbar gegensätzlicher Größen im Rahmen einer Staatsidee. Das Diesseits der politischen Macht und das Jenseits des christlichen Glaubens wurden die beiden tragenden Säulen in der Staatskonstruktion seines Reiches. Die Religion erhielt als geistiges Movens menschlichen Handelns neben den alten animalischen Trieben des Kampfes einen festen Platz als Kraftquelle und Richtschnur auch des staatlichen Handelns. Das waren die zwei Klammern, die das Reich zusammenhielten. Die christlich-religiöse Klammer war diejenige, die auch die übernationale Bündelung mehrerer Völker und Nationen unter dem Dach des Reiches ermöglichte.
Aber auch eine solche fast esoterische Staatskonstruktion erforderte militärische Kraft, um sie durchzusetzen. Im Norden Italiens hatten sich die Verhältnisse während der zurückliegenden 200 Jahre abermals verändert. Dort hatte sich nach den Ostgoten ein neuer germanischer Stamm häuslich eingerichtet. Die Langobarden hatten 527 aus dem Raum der Elbe kommend ganz ähnlich wie die Ostgoten zunächst unter oströmischer Oberaufsicht an der Donau ein eigenes Reich errichtet. Als dann im Jahr 568 Theoderich der Große starb, erinnerte man sich in Konstantinopel offensichtlich der Methode des Stellvertreterkrieges und bot den Langobarden an, gemeinsam mit den eigenen Truppen die Ostgoten aus Norditalien zu vertreiben und sich selbst dort niederzulassen. Auch die Langobarden gingen – wie seinerzeit die Ostgoten – auf dieses Angebot ein. Sie besiegten das zerfallende ostgotische Heer, so dass sie dort, wo vor ihnen nun schon die Hunnen, die Westgoten und die Ostgoten durchgezogen waren, für die nächsten 200 Jahre siedeln und der Region ihren heutigen Namen Lombardei geben konnten. Damit war auch das Reich der Ostgoten untergegangen. In den folgenden zweihundert Jahren haben auch die Langobarden Großes an kulturellen Werten in der Lombardei geschaffen, in Städten wie Aquileia und auch in ihrer Hauptstadt, die wenige Jahre nach dem Ende ihres Reiches in Civitas Austriae umbenannt wurde, aus dem heute der Name Cividale geworden ist.
Das Ende ihres Reiches kam dann aber mit dem Franken Karl, als er noch nicht »der Große« war. Dieser hatte zur Absicherung seiner Macht eine ähnliche Idee wie vor ihm Chlodwig. Er knüpfte Familienbande zum Rivalen, indem er die Tochter des Langobardenkönigs Desiderius heiratete. Aber wie zuvor Theoderich versuchte nun auch Desiderius, dem Franken Karl den Weg nach Rom zu versperren; diesmal indem er den Papst bat, seine minderjährigen Enkelkinder zu fränkischen Königen zu salben. Ein Ansinnen, das man mit Fug und Recht als hinterlistig bezeichnen kann. Wäre doch im Falle von Karls plötzlichem Tod das ganze schöne Reich der Franken dem Langobarden in den Schoß gefallen. Der Papst Hadrian I. lehnte aber ab. Erbost über die Hinterhältigkeit des eigenen Schwiegervaters schickte Karl ihm als Erstes die Tochter zurück. Dann sattelte er sein Pferd und ritt mit seinen Mannen zum Schutze des Papstes, der ihn um Hilfe gebeten hatte, über die Alpen gegen seinen Schwiegervater. Den besiegte er am 4. Juni 774 in Pavia. Schon am folgenden Tag erklärte er sich selbst zum König der Langobarden und nannte sich von da an »Rex Francorum et Langobardorum«. Das beeindruckte auch den Papst, der ihn wenig später zum Kaiser krönte. Die Historiker bezeichnen heute das Jahr 774 als das Ende der Völkerwanderung. Aber deren Folgen waren damit nicht beseitigt. Und ob weitere Stämme aus den Tiefen der asiatischen Steppe noch unterwegs waren, wusste auch niemand. Zudem stand der Islam noch immer drohend vor der Tür.