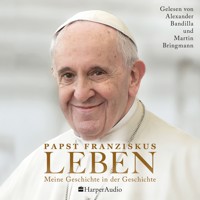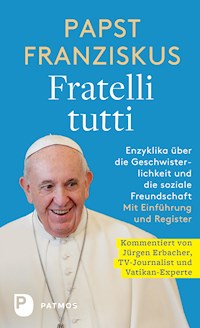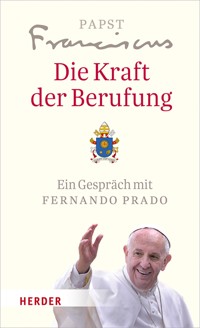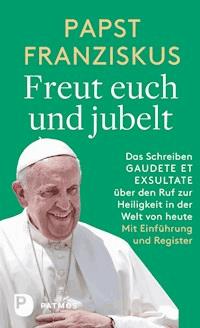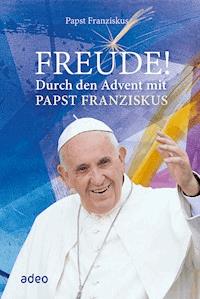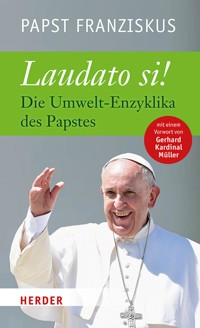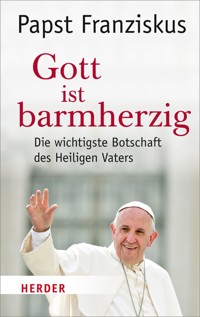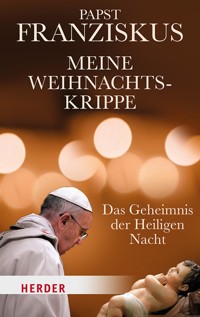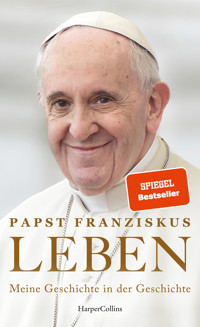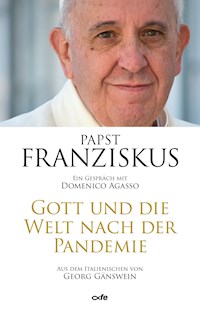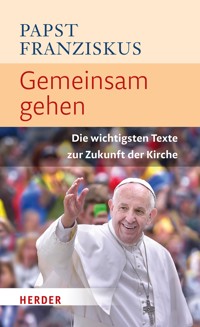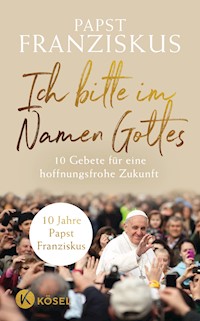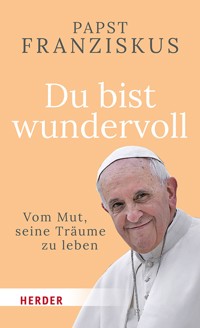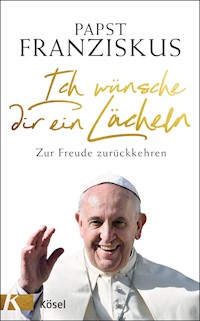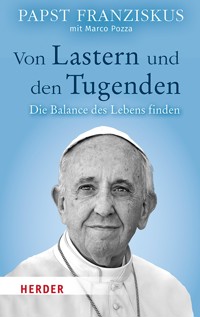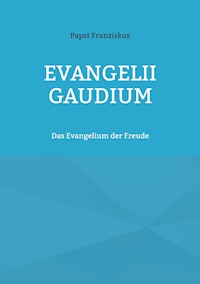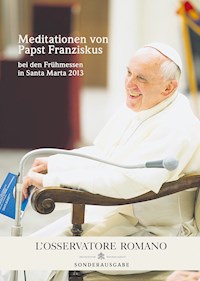20,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kösel-Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Zum ersten Mal in der Geschichte: Die Autobiografie eines Papstes zu Lebzeiten - IN MEMORIAM
Jorge Mario Bergoglio war kein gewöhnlicher Papst: Er war der erste Jesuit auf dem Stuhl Petri, der erste Lateinamerikaner, der erste Franziskus, der Erste, der umfassende Reformen im Vatikan verfolgte. Und er war der erste Papst in der Geschichte, der eine Autobiografie zu seinen Lebzeiten vorlegte. Eigentlich hätte dieses außerordentliche Lebenszeugnis erst nach seinem Tod veröffentlicht werden sollen, aber Papst Franziskus hat sich angesichts der Erfordernisse unserer Zeit und aufgrund des Heiligen Jahres 2025 dazu entschlossen, den Einblick in sein Leben schon jetzt zugänglich zu machen. Denn seine Biografie, seine Erlebnisse spiegeln in unvergleichlicher Weise sein Vermächtnis wider, das er uns allen, dir und mir, und trotz aller Widrigkeiten zuruft: Hoffe!
Das Buch erzählt chronologisch und in Franziskus´ persönlichem Stil seine gesamte Lebensgeschichte, die Anfang des 20. Jahrhunderts mit seinen italienischen Wurzeln beginnt. Es erzählt von der abenteuerlichen Geschichte der Auswanderung seiner Vorfahren nach Lateinamerika, seiner Kindheit dort und den Turbulenzen seiner Jugendjahre. Es berichtet von seiner Berufung und seiner Reifezeit ebenso wie von seinem Pontifikat und der Gegenwart.
Mit großer erzählerischer Kraft holt Papst Franziskus aus und lässt uns teilhaben an seinen intimsten Erinnerungen (und seinen Leidenschaften). Und er geht schonungslos die zentralen Anliegen seines Pontifikats an und wendet sich mutig, nüchtern und prophetisch den wichtigsten Themen unserer Zeit zu: Krieg und Frieden (die Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten), Migration, Umweltschutz, Sozialpolitik, die Stellung der Frau, Sexualität, der technische Fortschritt sowie die Zukunft der Kirche und der Religionen.
Mit vielen Enthüllungen, Anekdoten und aufschlussreichen Überlegungen präsentiert sich diese Autobiografie emotional und gleichzeitig zutiefst menschlich, anrührend und humorvoll. Hier tritt uns einerseits der „Roman eines Lebens“ entgegen und andererseits das moralische und spirituelle Testament seines Verfassers, das Leserinnen und Leser in aller Welt faszinieren wird, weil es das Vermächtnis der Hoffnung für künftige Generationen ist.
Das Buch enthält einige außergewöhnliche, bisher unveröffentlichte Fotografien, auch aus privaten Quellen, die einmal mehr zeigen, wie sehr Papst Franziskus uns an seinem Leben teilhaben lässt.
Papst Franziskus starb am 21.04.2025.
- Die erste Autobiografie eines Papstes in der Geschichte, veröffentlicht noch zu dessen Lebzeiten
- Ein historisch einmaliges Buch
- Bislang unveröffentlichte Fotos aus Papst Franziskus´ (Privat-)Beständen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 493
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Zum ersten Mal in der Geschichte: Die Autobiografie eines Papstes zu Lebzeiten
Jorge Mario Bergoglio ist kein gewöhnlicher Papst: Er ist der erste Jesuit auf dem Stuhl Petri, der erste Lateinamerikaner, der erste Franziskus, der Erste, der umfassende Reformen im Vatikan verfolgt. Und er ist der erste Papst in der Geschichte, der eine Autobiografie zu seinen Lebzeiten vorlegt. Eigentlich hätte dieses außerordentliche Lebenszeugnis erst nach seinem Tod veröffentlicht werden sollen, aber Papst Franziskus hat sich angesichts der Erfordernisse unserer Zeit und aufgrund des Heiligen Jahres 2025 dazu entschlossen, den Einblick in sein Leben schon jetzt zugänglich zu machen. Denn seine Biografie, seine Erlebnisse spiegeln in unvergleichlicher Weise sein Vermächtnis wider, das er uns allen, dir und mir, und trotz aller Widrigkeiten zuruft: Hoffe!
Das Buch erzählt chronologisch und in Franziskus’ persönlichem Stil seine gesamte Lebensgeschichte, die Anfang des 20. Jahrhunderts mit seinen italienischen Wurzeln beginnt. Es erzählt von der abenteuerlichen Geschichte der Auswanderung seiner Vorfahren nach Lateinamerika, seiner Kindheit dort und den Turbulenzen seiner Jugendjahre. Es berichtet von seiner Berufung und seiner Reifezeit ebenso wie von seinem Pontifikat und der Gegenwart.
Mit großer erzählerischer Kraft holt Papst Franziskus aus und lässt uns teilhaben an seinen intimsten Erinnerungen (und seinen Leidenschaften). Und er geht schonungslos die zentralen Anliegen seines Pontifikats an und wendet sich mutig, nüchtern und prophetisch den wichtigsten Themen unserer Zeit zu: Krieg und Frieden (die Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten), Migration, Umweltschutz, Sozialpolitik, die Stellung der Frau, Sexualität, der technische Fortschritt sowie die Zukunft der Kirche und der Religionen.
Mit vielen Enthüllungen, Anekdoten und aufschlussreichen Überlegungen präsentiert sich diese Autobiografie emotional und gleichzeitig zutiefst menschlich, anrührend und humorvoll. Hier tritt uns einerseits der »Roman eines Lebens« entgegen und andererseits das moralische und spirituelle Testament seines Verfassers, das Leserinnen und Leser in aller Welt faszinieren wird, weil es das Vermächtnis der Hoffnung für künftige Generationen ist.
Das Buch enthält einige außergewöhnliche, bisher unveröffentlichte Fotografien, auch aus privaten Quellen, die einmal mehr zeigen, wie sehr Papst Franziskus uns an seinem Leben teilhaben lässt.
Papst Franziskus
Mit Carlo Musso
Hoffe
Die Autobiografie
Aus dem Italienischen von Elisabeth Liebl
Die Originalausgabe von »Hoffe. Die Autobiografie« erscheint 2025 zeitgleich unter dem Titel »SPERA. L’autobiografia« bei Mondadori Libri.
© 2025 Mondadori Libri S.p.A., Milano
Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Alle zitierten Bibelstellen: Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, vollständig durchgesehene und überarbeitete Ausgabe © 2016 Verlag Katholisches Bibelwerk GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten.
Wir haben uns bemüht, alle Rechteinhaber ausfindig zu machen, verlagsüblich zu nennen und zu honorieren. Sollte uns dies im Einzelfall nicht möglich gewesen sein, werden wir uns bemühen, begründete Ansprüche zu erfüllen.
Copyright © 2025 Kösel-Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Cover: Verlagsgruppe Penguin Random House GmbH, München, nach der Originalvorlage von Mondadori Libri
Covermotiv: © Stefano Spaziani
ISBN978-3-641-33304-1V004
www.koesel.de
Inhalt
Einführung
Alles entsteht, um zu erblühen
Vorwort
1Die Zunge soll mir am Gaumen kleben
2Ich muss schon allzu lange wohnen bei Leuten, die den Frieden hassen
3Die Gaben einer gesunden Unruhe
4Fast am Ende der Welt
5Je mehr wir sind, umso besser
6Wie ein gespanntes Seil
7Ich spielte auf seinem Erdenrund
8Das Leben ist die Kunst der Begegnung
9Der Tag geht pfeilschnell vorüber
10Sie erkannten sich von Weitem
11Wie der Mandelzweig
12Sie verschlingen mein Volk, als wäre es Brot
13Niemand findet das Heil allein
14Mit den tiefinnersten Schwingungen gehen
15Der einzige Weg, um ganz Mensch zu werden
16Wie ein Kind auf dem Arm seiner Mutter
17Damit du dich erinnerst und dich schämst
18Alle hinaus und alle herein
19Die Wanderung durch dunkle Täler
20Dein Stock und dein Stab geben mir Halt
21Der Skandal des Friedens
22An der Hand eines unbesiegbaren Mädchens
23Nach dem Ebenbild eines lächelnden Gottes
24Denn die besten Tage liegen noch vor uns
25Ich bin nur ein Schritt
Kurze Bemerkung des Co-Autors
Quellen
Aufrecht und ehrlich – sie sind, wonach sie aussehen: Quadratschädel mit ruhiger Hand und echtem Schneid. Sie sagen nicht viel, wissen aber, wovon sie reden. Und sie kommen weit, auch wenn sie langsam gehen.
Nino Costa
Aber es sprechen viele Anzeichen dafür, dass die Zukunft in solcher Weise in uns eintritt, um sich in uns zu verwandeln, lange bevor sie geschieht.
Rainer Maria Rilke
Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke.
Erster Brief an die Korinther
Einführung
Alles entsteht, um zu erblühen
Das Buch meines Lebens ist die Erzählung von einem Weg des Hoffens, den ich mir nicht vorstellen kann ohne meine Familie, meine Leute und die Kinder Gottes weltweit. Und so treten uns auf jeder Seite, bei jedem Schritt Menschen entgegen, die mich auf diesem Weg begleitet haben, die mir vorangegangen sind und die mir nachfolgen werden.
Eine Autobiografie ist keine Literatur nur für uns, sondern eher eine Art Reisetasche. Die Erinnerung ist nämlich nicht nur das, was uns von früher einfällt, sondern auch das, was uns jetzt umgibt. Und es geht nicht nur darum, was einmal war, sondern auch darum, was sein wird. Die Erinnerung ist eine Gegenwart, die niemals aufhört zu vergehen, wie ein mexikanischer Dichter sagt.
Es scheint das Gestern gewesen zu sein, dabei ist es das Morgen.
Man sagt ja immer, wir sollten »abwarten und hoffen«. Im Spanischen bedeutet das Wort esperar gleichzeitig »hoffen« und »warten«. Doch die Hoffnung ist vor allem die Tugend der Bewegung, der Motor der Veränderung: Sie ist die Spannung, die Erinnerung und Utopie verbindet, damit wir daraus tatsächlich jene Träume verwirklichen können, die uns erwarten. Und wenn ein Traum an Kraft verliert, dann müssen wir zurückkehren, um ihn von Neuem zu träumen, in neuen Formen, sodass wir der Glut der Erinnerung mit unserem Hoffen neues Feuer einhauchen.
Wir Christen müssen wissen, dass die Hoffnung uns niemals täuscht und trügt: Alles entsteht, um in einem ewigen Frühling zu erblühen.
Und am Ende sagen wir nur: Ich kann mich an nichts erinnern, worin Du nicht immer schon gewesen bist.
Vorwort
Es heißt, man habe einen so gewaltigen Stoß verspürt wie bei einem Erdbeben. Die gesamte Reise war begleitet von starken und unheilschwangeren Erschütterungen und »die Schieflage des Schiffes war so stark, dass wir morgens die Tassen mit dem Milchkaffee nicht einfach abstellen konnten, weil sie sonst umgefallen wären«. Aber das war noch mal etwas anderes: Es wirkte eher wie eine Explosion, eine Bombe. Die Passagiere kamen aus den Salons und Kabinen und verteilten sich auf den Decks, weil sie wissen wollten, was da los war. Es war schon spät am Nachmittag und der Bug des Schiffes steuerte auf die Küste Brasiliens zu, auf Porto Seguro. Es war jedoch keine Bombe, sondern ein dunkel grollender Donner. Der Dampfer setzte seine Fahrt fort, aber nur unter großen Schwierigkeiten. Er machte Sprünge wie ein bockendes Pferd, er schlingerte wild hin und her und wurde dabei immer langsamer. Ein Mann, der sich später stundenlang an einem Balken festhalten konnte, erzählte, man habe deutlich gesehen, wie die gebrochene linke Antriebswelle samt Schiffsschraube plötzlich ins Wasser rutschte. In Gänze. Das schlug dem Rumpf eine tiefe Wunde: Das Wasser strömte mit Macht hinein, überschwemmte den Maschinenraum und würde bald den Laderaum erreichen, denn auch die Schotten schienen nicht richtig dicht zu machen.
Man erzählt, dass die Mannschaft versuchte, das Leck mit Metallpaneelen zu schließen. Vergeblich.
Und man berichtet, dass die Orchester den Befehl erhielten, weiterzuspielen. Ohne Unterbrechung.
Das Schiff neigte sich immer stärker, es wurde allmählich dunkel, und das Meer dehnte sich endlos in alle Richtungen.
Als klar wurde, dass die Passagiere sich wohl kaum noch mit Ansagen würden beruhigen lassen, gab der Kapitän den Befehl, die Maschinen zu stoppen. Er ließ die Sirenen laut Alarm geben, und die Funker setzten die ersten SOS-Signale ab.
Diese Signale wurden von mehreren Schiffen aufgefangen, zwei Passagierschiffen und sogar zwei Ozeandampfern, die alle in der Nähe waren. Sie kamen dem Schiff sogleich zu Hilfe, mussten jedoch eine gewisse Distanz halten, weil eine gewaltige weiße Rauchsäule vermuten ließ, dass die Dampfkessel in Kürze explodieren würden.
Der Kapitän stand mit dem Megafon auf der Brücke und versuchte verzweifelt, die Passagiere zur Ruhe zu mahnen und die Platzverteilung auf den Rettungsbooten zu koordinieren. Frauen und Kinder zuerst. Aber als es Nacht wurde und der Neumond kein Licht gab und auch noch die elektrische Beleuchtung auf dem Schiff ausfiel, eskalierte die Lage schnell.
Man ließ die Rettungsboote zu Wasser, aber das Schiff neigte sich mittlerweile zu stark: Einige der Boote gingen auf der Stelle unter, weil sie am Rumpf zerschellten. Andere waren so marode, dass sie ihren Zweck nicht mehr erfüllten: Wasser drang ein, und die Passagiere mussten die Boote mit Hüten ausschöpfen. Wieder andere kenterten in den Wellen oder gingen unter, weil sie überfüllt waren. Viele der Handwerker und Bauern aus Tälern und Ebenen hatten noch nie das Meer gesehen. Sie konnten nicht schwimmen. Gebete und Schreie überlagerten einander.
Panik brach aus. Viele Passagiere fielen oder sprangen ins Meer und ertranken. Einige, so hieß es, hätten sich verzweifelt aufgegeben. Andere, so schrieb später die Lokalpresse, wurden von Haien lebendig verschlungen.
In diesem Inferno kam es zu allerlei Kämpfen, aber auch zu bemerkenswerten Gesten des Mutes und der Opferbereitschaft. Ein junger Mann, der Dutzenden Menschen geholfen hatte, bekam einen Rettungsring und wartete, bis er an der Reihe war, ins Meer zu springen. Da sah er einen alten Mann, der nicht schwimmen konnte und keinen Platz in einem der Boote bekommen hatte: Der bat ihn um Hilfe. Der junge Mann streifte ihm seinen Rettungsring über und sprang mit ihm ins Meer, um das nächste Boot zu erreichen. Er paddelte wie wild, als sich aus den Wellen spitze Schreie erhoben: »Haie! Die Haie!« Der junge Mann wurde angegriffen. Einer seiner Gefährten schaffte es, ihn in eines der Rettungsboote zu ziehen, doch seine Verletzungen waren zu schwer. Kurz darauf starb er.
Als die Überlebenden seine Geschichte erzählten, war ganz Argentinien erschüttert. In seinem Heimatort in der Provinz Entre Ríos benannte man eine Schule nach ihm, dem Sohn eines Migranten aus dem Piemont und einer Argentinierin. Er war gerade einmal zwanzig Jahre alt und hieß Anacleto Bernardi.
Weit vor Mitternacht war das Schiff mit Wasser vollgelaufen. Der Bug stellte sich senkrecht auf und versank mit einem lauten Seufzer, der beinahe klang wie der eines Tieres, in über 1400 Meter Tiefe. Mehrere Augenzeugen berichteten übereinstimmend, dass der Kapitän bis zum Schluss an Bord blieb und die Orchester die Marcia Reale, die damalige italienische Nationalhymne, spielten. Sein Leichnam wurde nie gefunden. Kaum begann das Schiff sinken, war das Knallen von Pistolenschüssen zu hören. Es heißt, die Offiziere, die das Menschenmögliche für die Passagiere getan hatten, hätten beschlossen, einander das Schicksal des Ertrinkens zu ersparen.
Einige Rettungsboote schafften es zu den Schiffen in der Nähe, die ihrerseits Rettungsboote zu Wasser gelassen hatten. Gemeinsam gelang es, mehrere Hundert Personen zu retten.
Das Bergen der wenigen Überlebenden, die nach Kräften versuchten, sich über Wasser zu halten, dauerte bis spät in die Nacht hinein. Als noch vor dem Morgengrauen brasilianische Schiffe am Unglücksort ankamen, wurden keine Überlebenden mehr gefunden.
Dieses Schiff von fast 150 Metern Länge war zu Beginn des 20. Jahrhunderts der Stolz der Handelsmarine gewesen, der prestigeträchtigste Ozeandampfer der italienischen Flotte. Er hatte wichtige Persönlichkeiten über den Atlantik getragen wie Arturo Toscanini, Luigi Pirandello und Carlos Gardel, die Legende des Tango Argentino. Doch diese Zeiten waren lange vorüber. Es hatte einen Weltkrieg gegeben, und Verschleiß, Nachlässigkeit und schlechte Wartung hatten das Ihrige getan. Mittlerweile galt das Schiff wegen seines wackeligen Zustandes als balaína, als Ballerina. Als es zu seiner letzten Reise auslief, hatte es, trotz der Bedenken seines Kapitäns, mehr als 1200 Passagiere an Bord, hauptsächlich Migranten aus dem Piemont, aus Ligurien und dem Veneto. Auch Menschen aus den Marken, der Basilikata und aus Kalabrien.
Laut Aufzeichnungen der damaligen italienischen Behörden verloren bei dieser Katastrophe nur etwa dreihundert Menschen ihr Leben, vor allem Mitglieder der Besatzung. Doch die Zeitungen in Südamerika nannten weit höhere Zahlen, mehr als das Doppelte. Dazu gehörten auch die blinden Passagiere, einige Dutzend Emigranten aus Syrien und mehrere Erntehelfer, die Italien wieder verließen, um den Winter in ihrer südamerikanischen Heimat zu verbringen.
Doch wie sehr das Regime die Katastrophe auch herunterspielen mochte, dieser Schiffbruch war die Titanic Italiens.
Ich weiß nicht, wie oft ich die Geschichte dieses Schiffes gehört habe, das den Namen der Tochter von König Vittorio Emanuele III. trug. Auch sie fand, viele Jahre später, ein tragisches Ende im Lager von Buchenwald, gegen Ende eines zweiten schrecklichen Krieges. Die Principessa Mafalda. Diese Geschichte erzählte man in unserer Familie immer wieder.
Man erzählte sie im Viertel.
Die Lieder der Migranten diesseits und jenseits des Ozeans sangen ihre Geschichte: »Von Italien aus brach Mafalda auf mit mehr als tausend Passagieren … Väter und Mütter umarmten ihre Kinder, die in den Wellen den Tod fanden.«
Meine Großeltern und ihr einziges Kind, Mario, der junge Mann, der mein Vater werden sollte, hatten Fahrkarten für diese lange Überfahrt, für dieses Schiff, das am 11. Oktober 1927 von Genua auslaufen sollte Richtung Buenos Aires.
Aber sie gingen nicht an Bord.
So sehr sie sich auch bemüht hatten, es war ihnen einfach nicht gelungen, ihre Habseligkeiten rechtzeitig zu verkaufen. Schließlich mussten die Bergoglios notgedrungen die Schiffspassage umbuchen und die Fahrt nach Argentinien aufschieben.
Aus diesem Grund bin ich heute hier.
Du kannst dir nicht vorstellen, wie oft ich der Göttlichen Vorsehung noch zu danken hatte.
1
Die Zunge soll mir am Gaumen kleben
Schließlich fuhren sie doch los.
Die Großeltern hatten ihre wenigen Habseligkeiten in Bricco Marmorito im ländlichen Piemont verkaufen können und kamen am Hafen von Genua an, wo sie, ohne Rückfahrkarte, an Bord der Giulio Cesare gingen.
Sie warteten, bis sich die Passagiere der ersten Klasse eingeschifft hatten und man die der dritten Klasse aufrufen würde, für die sie Fahrkarten hatten. Kaum hatte das Schiff das offene Meer erreicht und die Lichter des Leuchtturms, des alten Torre della Lanterna, waren am Horizont verloschen, wussten sie, dass sie Italien nie wiedersehen würden. Sie mussten ihr Leben auf der anderen Seite der Welt neu beginnen.
Man schrieb den 1. Februar 1929. Es war einer der kältesten Winter, die das Jahrhundert erleben sollte: In Turin zeigte das Thermometer 15 Grad unter null, und in anderen Teilen des Landes fiel es sogar bis auf minus 25 Grad. Federico Fellini nannte dieses Jahr in einem seiner Filme »das Jahr des ewigen Schnees« (L’anno del nevone). Ganz Europa lag unter einem dicken Mantel aus Schnee, vom Ural bis zur Mittelmeerküste. Selbst auf der Kuppel des Petersdoms leuchtete weiß der Schnee.
Als das Schiff nach zwei Wochen Fahrt und Zwischenstopps in Villefranche-sur-Mer, Barcelona, Rio de Janeiro, Santos und Montevideo endlich den Hafen von Buenos Aires erreichte, trug meine Großmutter Rosa trotz der feuchten Wärme von fast 30 Grad immer noch den guten Wintermantel, mit dem sie aufgebrochen war. Wie damals üblich, hatte sie einen Fuchspelz als Kragen angenäht. Und eben da, zwischen Stoff und Leder, hatte sie ihren gesamten Besitz eingenäht, alles, was sie hatten. Und sie trug den Mantel weiter, wie eine Uniform, auch nachdem sie von Bord gegangen waren und an der Mündung des Paraná ein weiteres Schiff bestiegen, das sie noch mal 500 Kilometer tiefer ins Landesinnere trug, zu ihrem eigentlichen Ziel. Erst da entschied la luchadora, die Kämpferin, wie man sie nannte, dass sie jetzt nicht mehr auf der Hut sein musste.
Am Zielhafen wurden alle drei registriert als migrantes ultramar, Migranten von jenseits des Ozeans. Großvater Giovanni, der ursprünglich Bauer gewesen war, es aber dann geschafft hatte, ein Café mit Bäckerei zu eröffnen, wurde als comercio, Händler, geführt, seine Frau Rosa als casera, Hausfrau, und ihr Sohn Mario, mein Vater, der zur großen Zufriedenheit seiner Eltern ein Diplom in Buchführung erworben hatte, als contador, Buchhalter.
Unzählige Menschen hatten zusammen mit ihnen diese lange Reise der Hoffnung unternommen. Millionen und Abermillionen zogen im Laufe eines Jahrhunderts von Italien nach La Merica, in die Vereinigten Staaten, nach Brasilien und vor allem nach Argentinien. Allein in den vier Jahren vor dem schicksalhaften 1929 wanderten zweihunderttausend Italiener nach Buenos Aires aus.
Die Erinnerung an den schrecklichen Schiffbruch der Mafalda war noch frisch, dabei war sie noch nicht einmal das einzige Schiff, das seit Ende des letzten Jahrhunderts von diesem Los ereilt werden sollte. Es waren die Jahre des »Mamma mia, dammi cento lire che in America voglio andar«, wie es in dem tausendfach von Migranten gesungenen Volkslied heißt, das ebenfalls von schiffbrüchigen Auswanderern erzählt. In diesen Jahren war auch die saisonale Völkerwanderung besonders stark. Die Menschen brachen im Herbst von Genua aus auf, kaum dass die Erntesaison in Italien vorüber war. Dann verdingten sie sich als Erntehelfer auf der südlichen Hemisphäre, wo der Sommer erst anfing. Häufig kamen sie erst im Frühjahr wieder nach Hause zurück und hatten ein paar Hundert Lire verdient, die jedoch meist in den Taschen der Organisatoren und Vermittler landeten. Wenn diese bezahlt waren, kam noch das Geld für die Überfahrt hinzu, dann blieben den Leuten nur noch wenige Lire übrig als Lohn für vier oder fünf Monate Schwerstarbeit.
Aber auch der Tod war auf der Überfahrt ein häufiger und wenig willkommener Begleiter. So starben auf der Matteo Bruzzo und Carlo Raggio, die 1888 von Genua nach Brasilien unterwegs waren, fünfzig Passagiere infolge von Hunger und Entbehrungen. Auf der Frisca erstickten mehr als zwanzig Passagiere unter Deck. 1893 mussten die Migranten auf der Remo feststellen, dass doppelt so viele Schiffskarten verkauft worden waren, als das Schiff Passagiere aufnehmen konnte. Bald raffte die Cholera unzählige von ihnen hinweg. Die Toten warf man einfach über Bord. Mit jedem Tag wurde die Zahl der Passagiere geringer. Und bei der Ankunft ließ man das Schiff nicht im Hafen anlegen. Und dann war da noch der Schiffbruch der Sirio, bei dem auf dem Weg nach Buenos Aires fünfhundert italienische Migranten ums Leben kamen. In den Volksliedern, die von den Hügeln des Piemont und den Akkordeons im Barrio erschallten, vermischten sich die Tragödien. Aus der Sirio wurde die Mafalda und umgekehrt. Neue Worte schmiegten sich in die Klänge der immer gleichen melancholischen Musik.
Die Sirio, die Frisca, die Mafalda – die Tragödien verschmolzen miteinander.
Und doch machten sich die Menschen immer wieder auf diesen gefährlichen Weg. Meist von der Armut getrieben, manchmal auch vom Zorn. Um das eigene Los zu ändern oder der Tragödie eines Krieges zu entgehen, vor allem kurz bevor sich der Erste und Zweite Weltkrieg ankündigten. Um sich den Einberufungsbefehlen zu entziehen oder nachdem man dem Tod ins Angesicht geblickt hatte. Um die Familie wieder zu vereinen, um nicht mehr Not leiden zu müssen, um ein besseres Leben zu haben. Das ist keine neue Geschichte, es gab sie gestern, es gibt sie heute. »Schlechter als jetzt kann es mir nicht mehr gehen. Allerhöchstens werde ich dort genauso hungern wie hier. Dighio ben?«, sagt ein Emigrant in Edmondo de Amicis’ Buch Auf dem Ozean. »Stimmt es etwa nicht?« Auch er stammte aus dem Piemont, und sein bekanntestes Buch ist vermutlich Herz. Ein Buch für die Jugend.
Wer auswandern wollte, musste meist allerlei Schwierigkeiten auf sich nehmen und Opfer bringen, um sich einschiffen zu können. Fast immer, nachdem die Leute von den Immigrations-Agenten und -Subagenten angeworben wurden. Diese durchstreiften die Dörfer vor allem während der Volksfeste und priesen Amerika als neues »gelobtes Land«, in dem Milch und Honig flossen. Von der Auswanderungsbehörde bekamen sie für jede Familie, die sie überzeugen konnten, ihr Land zu verlassen, eine Prämie. Die Presse jener Zeit verglich sie teils mit Sklavenhändlern. Die Dörfer und Ortschaften wurden überschwemmt von Heftchen und gefälschten Briefen der Leute, die sich bereits aufgemacht hatten auf die andere Seite der Welt. Da wurde geschworen, dass ein Landarbeiter in Amerika, der infolge eines Arbeitsunfalls schwerbehindert war, so viel Entschädigung bekam, dass er sich leicht ein eigenes Stück Land kaufen konnte.
Für all jene, die diesem Lockruf folgten, bestand die erste Herausforderung darin, es überhaupt bis zum Hafen zu schaffen. Man verkaufte das Wenige, das man hatte, um die gierigen und meist skrupellosen Anwerber zu bezahlen, die sich in mehr als einem Fall mit dem Geld aus dem Staub machten, zumindest so lange, bis ein neues Gesetz solchen Machenschaften einen Riegel vorschob.
Der Weg zum Hafen war eine private Pilgerreise, die oft ganze Familien, manchmal sogar ganze Dörfer antraten: Man marschierte in einer langen Prozession, alle gemeinsam zum Klang der Glocken, die häufig auf die Schiffe mitgenommen wurden. Oft kamen die Leute einige Tage vor Ablegen des Schiffes im Hafen an und kampierten auf den Kais.
Einige erreichten das Land ihrer Sehnsucht nie, weil der Ozean sie zurückwarf oder verschlang.
Den vielen aber, die es schafften und in Buenos Aires an Land gingen, schlug die raue Wirklichkeit des Hotel de Inmigrantes entgegen. Es war wie eine Ohrfeige: eine riesige Baracke, in der sie, nachdem man sie untersucht, registriert und desinfiziert hatte, nicht länger als fünf Tage bleiben durften. In dieser Zeit mussten sie Arbeit in der Stadt oder auf den Feldern finden. So berichtet es zumindest der Korrespondent des Corriere della Sera zu Beginn des 20. Jahrhunderts: »In den letzten drei Tagen sind dreitausendachthundert Emigranten hier angekommen, die meisten davon unsere Landsleute. Das ›Hotel der Einwanderer‹ ist halb verfallen. […] Man bezeichnet es als Hotel, dabei erhebt es sich auf der grenzenlosen, schlammigen Ebene, die sich zwischen dem schmutzigen, reißenden Río de la Plata und der Stadt erstreckt. […] Der beißende Geruch der Karbolsäure kann kaum den Übelkeit erregenden Gestank überdecken, den der schmierige, schmutzige Fußboden und die alten Holzwände ausdünsten und der durch die offenen Türen hereindringt. Ein Gestank vom Elend eng aneinander gedrängter Menschenmassen. […] Weiter oben tragen die Bretter die lebendigen Zeichen dieses Leidensweges: Spuren der Seelen, die ihn gegangen sind. Namen, Daten, Liebesbezeigungen, Flüche, Erinnerungen, Obszönitäten, die man in den Lack gekratzt oder mit Stiften aufgemalt oder mit Messern eingeschnitzt hat. Das Bild, das sich am häufigsten wiederholt, ist das Schiff.«
Es ist sicher kein Zufall, dass viele dieser Zeichen von der Vergangenheit künden, dem Heimweh. »Die Zunge soll mir am Gaumen kleben, wenn ich an dich nicht mehr denke«, sagen die Exilanten im Psalm, die sich an Jerusalem erinnern (Ps 137,6). Und auch die Heiligen Drei Könige drücken dasselbe Gefühl aus. Sie haben Heimweh nach Gott. Diese Haltung durchbricht jeden Konformismus und drängt uns zu der Veränderung, die wir ersehnen und brauchen. Das Heimweh ist ein gesundes Gefühl, Heimweh nach den eigenen Wurzeln, denn ein Volk ohne Wurzeln ist verloren und ein Mensch ohne Wurzeln ist krank. Es gibt uns die Kraft, vorwärtszugehen, Frucht zu tragen und zu erblühen. Oder wie Francisco Luis Bernárdez, ein argentinischer Dichter, es ausdrückt: por lo que el árbol tiene de florido vive de lo sepultado. Alles, was am Baum erblüht, lebt von dem, was unter der Erde liegt.
Diese Darstellungen, diese Zeichen, diese Graffiti von gestern verweisen auf das Heute, auf andere Häfen, andere Meere.
Meine Leute hatten mehr Glück. Sie waren nach Buenos Aires gekommen, weil die Brüder meines Großvaters sie hergeholt hatten. Diese waren schon 1922 nach Argentinien gekommen und hatten sich ein schönes Auskommen geschaffen: Sie hatten als Arbeiter angefangen und die Straßen asphaltiert, die vom Hafen am Fluss hinein ins Land führten. Bald darauf gründeten sie ein Straßenbauunternehmen. Und dieses lief sehr gut. Nach ihrer Registrierung nächtigten meine Leute nicht im Hotel de Inmigrantes, sondern brachen sofort auf in die Region von Entre Ríos, bis in die Hauptstadt Paraná, wo sie von meinen Großonkeln sehnlichst erwartet wurden. Sie lebten in einem Haus mit vier Stockwerken, dem Palazzo Bergoglio, den sie selbst erbaut hatten. Es war das erste Haus in der Stadt, das einen Aufzug hatte. Jeder der Brüder bewohnte ein eigenes Stockwerk: Giovanni Lorenzo, Eugenio, Ernest und nun auch mein Großvater Giovanni Angelo. Nur zwei Geschwister meines Großvaters blieben im Piemont: Carlo, der Erstgeborene, und Luisa, die einzige Frau, die nach ihrer Heirat Martinengo hieß. Soweit es eben ging, war die Familie nun wieder vereint, und das war der Hauptgrund, warum meine Leute ausgewandert waren.
Mein Vater, damals ein junger Buchhalter, arbeitete als Geschäftsführer.
Aber nicht lange. Die Weltwirtschaftskrise von 1929 zog immer weitere Kreise. Der Präsident des Unternehmens, mein Großonkel Giovanni (Juan) Lorenzo, erkrankte an Leukämie und entwickelte ein Lymphosarkom. Als er starb, hinterließ er seine Witwe Elisa und drei Kinder. Die Gleichzeitigkeit der Weltwirtschaftskrise und der tödlichen Krankheit erwies sich als verhängnisvoll. 1932 mussten sie alles verkaufen: die Maschinen, das Unternehmen, das Haus, sogar die Kapelle am Friedhof. Meiner Familie blieb nichts mehr, sie verarmte schnell. Oder wie man von Menschen, die alles verloren haben, so sagt: Mit einer Hand vorne und einer hinten (mussten sie ihre Blöße bedecken, da sie kein Stück Kleidung mehr am Leib hatten).
Sie mussten einmal mehr von vorne anfangen, was sie auch taten. Mit der gleichen Entschlossenheit wie beim ersten Mal.
Aber davon ahnten mein Großvater, mein Vater und meine Oma, die in ihrem Wollmantel der Sommerhitze trotzte, noch nichts, als sie an jenem warmen Februarmorgen ihren Fuß zum ersten Mal auf argentinischen Boden setzten.
Ebenso wenig wie die Abertausende und Abermillionen Frauen und Männer, die ihnen auf diesem Weg vorangegangen waren oder ihnen folgen sollten. Handwerker, Holzfäller, Maurer, Bergmänner, Krankenschwestern, Schmiede, Schreiner, Schuhmacher, Schneiderinnen, Bäcker, Mechaniker, Glaser, Maler, Köchinnen, Hausangestellte, Eismacher, Friseurinnen, Steinhauer, Händler und Buchhalter und eine endlose Kolonne von Bauern und Landarbeitern. Sie brachten ihr Unglück mit, ihre Tragödien, die Wunden, die ihnen ihre Lebensbedingungen geschlagen hatten, aber auch ihre Energie, ihren Mut, ihr Durchhaltevermögen und ihren Glauben. Und eine Vielzahl von Talenten, die – wie es im Gleichnis im Matthäus-Evangelium heißt – nur darauf warteten, endlich Frucht tragen zu können. Wo sie die Gelegenheit dazu bekamen, da sollte dieses vom Unglück gezeichnete Heer dazu beitragen, einen großen Teil jener anderen Seite der Welt aufzubauen, und tatsächlich geschah das häufig. Rassa nostrana libera e testarda, sollte es in einem Gedicht von Nino Costa heißen, »unsere Leute, dickköpfig und frei«. Costa war zu jener Zeit einer der wichtigsten Dichter des Piemont, der an gebrochenem Herzen starb, als man seinen Sohn, der sich im Zweiten Weltkrieg mit neunzehn den Partisanen angeschlossen hatte, tötete. Meine Großmutter Rosa bestand darauf, dass ich dieses Gedicht in piemontesischem Dialekt auswendig lernte: »O ihr argentinischen Ebenen, vom Getreide blond, […] spürt ihr denn nie den Hauch des Monferrat? Hört ihr nie den Refrain der Berglieder?«, hieß es in diesem Gedicht, das den italienischen Auswanderern gewidmet war. Manchmal kehrten diese Menschen ja nach Italien zurück, und »das gesparte Geld beschert ihnen ein Haus oder ein Stück Land, auf dem sie ihre Kinder großziehen können«. Andere wiederum »verbannt ein Fieber oder ein Arbeitsunfall in ein ungeschmücktes Grab« auf einem fremden Friedhof, un camp-sant foresté, wie es im Piemonteser Dialekt heißt.
Auch aus diesem Grund hatte ich so viele Jahre später auf meiner ersten Reise, die mich aus dem Vatikan fortführen sollte, das Gefühl, nach Lampedusa zu müssen, diese winzige Insel im Mittelmeer, die zum Vorposten der Hoffnung und Solidarität geworden ist, aber auch zum Symbol für die Widersprüche und Tragödien der Auswanderung wie dem gewaltigen Friedhof des Mittelmeers, der viel zu viele Tote birgt. Als ich wenige Wochen zuvor vom soundsovielten Schiffbruch gehört hatte, ging mir diese Sache nicht mehr aus dem Kopf. Es war wie ein schmerzender Dorn im Herzen. Diese Reise war nicht vorgesehen, aber ich musste sie machen. Auch ich komme aus einer Migrantenfamilie. Mein Vater, mein Großvater, meine Großmutter waren wie so viele andere Italiener nach Argentinien ausgewandert und haben erlebt, wie es ist, wenn man absolut nichts mehr hat. Auch ich hätte zu den Ausgeschlossenen von heute gehören können, daher trage ich im Herzen immer diese eine Frage: Warum sie und nicht ich?
Ich musste nach Lampedusa fahren, um dort zu beten, um ein Zeichen der Nähe zu setzen, um meine Dankbarkeit auszudrücken und den freiwilligen Helfern dort, den Menschen in dieser kleinen Ecke der Welt, ein Signal der Ermutigung zu bringen, denn diese Menschen zeigten anderen eine ganz konkrete Solidarität. Vor allem aber wollte ich unser Gewissen wecken und auf unsere Verantwortung verweisen.
Es gibt eine Komödie des spanischen Dichters Lope de Vega, in der die Einwohner des Dorfes Fuente Ovejuna dessen Statthalter töten, weil er ein Tyrann ist. Und sie stellen es so geschickt an, dass niemand herausbekommt, wer denn nun tatsächlich für seinen Tod verantwortlich ist. Als der vom König geschickte Richter fragt, wer den Statthalter getötet hat, antworten alle: »Fuente Ovejuna, Euer Ehren.« Alle und niemand.
Auch heute stellt sich diese Frage mit aller Eindringlichkeit: Wer ist für dieses Blutvergießen verantwortlich? Niemand! Wir alle geben dieselbe Antwort: Ich nicht, ich habe damit nichts zu tun. Das sind andere, aber ich nicht.
Angesichts dieser Globalisierung der Gleichgültigkeit, die uns alle zu »Ungenannten« macht, wie es in Manzonis Roman Die Verlobten heißt: zu Verantwortlichen ohne Namen oder Gesicht, die wir unsere eigene Geschichte und unser Schicksal vergessen haben und nun mit einer Angst konfrontiert sind, die uns verrückt zu machen droht. Über all dem liegt auf ewig die Frage, die Gott an Kain stellt: »Wo ist dein Bruder? Sein Blut schreit zu mir vom Ackerboden.«
2
Ich muss schon allzu lange wohnen bei Leuten, die den Frieden hassen
Migration und Krieg sind die zwei Seiten derselben Medaille. Wie es geschrieben steht: Die meisten Flüchtlinge gebiert der Krieg. Auf die ein oder andere Weise, denn auch der Klimawandel und die Armut sind zum Teil die schlimme Folge eines brutalen Krieges, den die Menschheit erklärt hat: gegen eine gerechtere Verteilung der Ressourcen, gegen die Natur, ja gegen den ganzen Planeten.
Die Welt von heute scheint jeden Tag elitärer zu werden, und jeder Tag springt mit den Ausgeschlossenen und Übergangenen noch grausamer um. Die Entwicklungsländer werden weiterhin ihrer besten natürlichen wie menschlichen Ressourcen beraubt, und das zugunsten einiger weniger privilegierter Märkte.
Während eine authentische Entwicklung inklusiv und fruchtbar ist, weil sie auf die Zukunft und auf künftige Generationen ausgerichtet ist, macht eine fehlgeleitete Entwicklung die Reichen noch reicher und die Armen ärmer. Immer und überall. Und den Armen verzeiht man nichts, nicht einmal ihre Armut. Sie können sich nicht erlauben, schüchtern oder mutlos zu sein. Sie werden als Bedrohung oder als unfähig wahrgenommen, niemand zeigt ihnen ein Licht am Ende des Elendstunnels. Mittlerweile gibt es in Theorie und Praxis sogar eine armenfeindliche Architektur, damit man sie sich vom Leib halten kann. Ja, man vertreibt sie sogar von den Straßen.
Man errichtet Mauern und versperrt die Eingänge von Häusern mit Gittern, um sich in einer illusorischen Sicherheit zu wiegen – auf Kosten all jener, die draußen bleiben müssen. Aber das wird nicht immer so sein. Der »Tag des Herrn«, von dem die Propheten sprechen (Am 5,18; Jes 2-5; Jo 1-3), wird die Barrieren zerschmettern, die zwischen den Ländern existieren, und an die Stelle der Arroganz der Wenigen die Solidarität der Vielen setzen. Dieser Zustand des Ausgegrenztwerdens, den Millionen Menschen erdulden müssen, kann nicht mehr lange andauern. Ihr Schrei wird lauter und umspannt die ganze Welt. Wie Don Primo Mazzolari schreibt, einer der großen Geistlichen Italiens und das prophetische Gesicht eines strahlenden und »unbequemen« Klerus, der sich nicht auf seine Klerikalität zurückzieht: »Der Arme ist der beständige Protest gegen unsere Ungerechtigkeiten. Er ist ein Pulverfass. Wenn du es ansteckst, fliegt die ganze Welt in die Luft.«
Wir können uns nicht taub stellen gegenüber dem drängenden Ruf, den Gottes Wort an die Armen richtet. Wohin man auch schaut, verweist der Kompass der Heiligen Schrift darauf, wie viele Menschen nicht das zum Leben Nötigste besitzen. Er zeigt auf die Unterdrückten, die auf der Erde liegen, die Waisen, die Witwen, die Fremden, die Migranten. Und Jesus hat keine Angst, sich mit diesem Heer der Unzähligen zu identifizieren: »Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.« (Mt 25,40) Nicht denen, die mir gleich sind, nicht jenen, die zu meiner Schicht gehören, sondern den Niedrigsten, den Hungrigen, Durstigen, Nackten. Wer sich dieser Identifikation verweigert, der verwässert die Offenbarung, der verfälscht das Evangelium, der macht daraus eine folkloristische Schau, ohne die geringste Wahrhaftigkeit. Denn es gibt keine »ersten Plätze« für die Christen, sofern nicht »die Letzten die Ersten« sind. Jene »Letzten«, die den Herrn jeden Tag anrufen und ihn bitten, sie vom Unglück zu befreien, unter dem sie leiden. Die Letzten aus den existenziellen Randbezirken unserer Städte. Die Letzten, die man betrügt und zum Sterben in der Wüste zurücklässt. Die Letzten, die man in den Straflagern foltert, missbraucht und vergewaltigt. Die Letzten, die sich den gewaltigen Wogen eines unruhigen Meeres aussetzen.
Kriege werden heute nur in bestimmten Regionen der Welt geführt, doch die Waffen, mit denen dort gekämpft wird, kommen von überall her. Aus jenen Ländern, die später die Flüchtlinge zurückweisen, die von diesen Waffen in diesen Konflikten überhaupt erst geschaffen wurden.
Was »Krieg« bedeutet, habe ich als Kind von meinem Großvater Giovanni gelernt. Diese leidvollen Geschichten hörte ich direkt aus seinem Mund. Der Krieg, in dem mein Großvater gekämpft hat, spielte sich am Piave ab.
Er war zwanzig Jahre alt und 1,66 Meter groß, mit lockigen Haaren und dunklen Augen, als man ihn wegen »schwach ausgeprägtem Brustkorb« bei der Musterung zunächst zurückstellte: Das war im Juli 1904. Der junge Mann wurde vom dreijährigen Wehrdienst befreit und kehrte nach Hause, nach Portacomaro, zurück. Zwei Jahre später, 1906, verlegte er seinen Wohnsitz nach Turin, wo er zuerst im Stoffgeschäft seines Onkels Carlo als Faktotum arbeitete. Er war einer der Ersten, die den Sprung in die Großstadt wagten, und fand später Arbeit in einem Café. Als »Liquorista«, wie man damals sagte, »Verkäufer von alkoholischen Getränken«. Eine Geschichte wie die vieler anderer junger Leute jener Zeit, die, als die großen Industriezentren entstanden, vom Land in die Stadt flohen, um ein selbstbestimmtes Leben und besser entlohnte Arbeit zu suchen und Not und Entbehrungen hinter sich zu lassen.
Aber jeder Migrant hat einen Ort, an dem seine Seele lebt, und für die Bergoglios war dies der Bauernhof in Portacomaro, zwischen Haselnusssträuchern und steilen Hügeln. Auch aus diesem Grund bin ich im Februar 2001, nur wenige Stunden, bevor Johannes Paul II. mich zum Kardinal von Buenos Aires machte, die Straße nach Bricco Marmorito hinaufgestiegen. Ich habe die Hügel betrachtet, die Weinberge, das große Haus. Ich habe in der Erde gegraben und eine Handvoll mitgenommen. Hier kam mein Großvater zur Welt, hier war sein Vater Francesco gestorben. Hier lagen unsere Wurzeln. Ich würde auch später, als Papst, hierher zurückkehren, um meine Cousine Carla zu besuchen, die damals neunzig wurde. Mit ihr und mit Cousin Elio habe ich Agnolotti gegessen und Grignolino getrunken, den Wein dieser Gegend. Ich rufe sie immer noch manchmal an, und wir reden piemontéis miteinander, die Sprache, die ich als allererste gelernt habe. Und wenn Elio gerade Boccia spielt, dann plaudern wir ein wenig mit allen. Dort bin ich immer noch Giorgio.
Aber es war in der Stadt, wo Giovanni Rosa kennenlernte, meine Großmutter. Rosa Margherita Vassallo war genauso alt wie er und wie er Migrantin. Sie war am Fuße der Wallfahrtskirche von Todocco zur Welt gekommen, in Piana Crixia in der Provinz Savona, an der Grenze zwischen Ligurien und Piemont. Doch sie war schon als Kind nach Turin gekommen, weil sie aus einer großen Familie stammte: Als achtes von neun Kindern wurde sie Rosa übergeben, einer Tante mütterlicherseits. Diese lebte als Hausmeisterin in einem großen Gebäude mitten in der Stadt. Ihr Mann Giuseppe war Schuster. Für die Eltern der kleinen Rosa, Angela und Pietro, meine Urgroßeltern, war das keine leichte Entscheidung gewesen. Sie hatten lange hin und her überlegt, hatten mit dem Priester und der Lehrerin gesprochen, und schließlich fassten sie, weil alle ihnen zurieten, den Entschluss: Dieses kluge, neugierige und intelligente Mädchen, das trotz des schwierigen Lebens auf dem Dorf unbedingt zur Schule gehen wollte, musste die Gelegenheit bekommen, wenigstens die Grundschule abschließen zu können und sich so eine bessere Zukunft zu sichern. Und so trat Rosa mit acht Jahren eine Reise von mehr als 140 Kilometern an. Sie verließ ihr ländliches Zuhause und kam in die große Stadt, in der alle Straßen und Plätze viel zu ausladend erschienen, in der sich die Häuser ohne Lücke aneinanderreihten und das Licht der Lampen niemals auszugehen schien dank einer Pariser Erfindung, die sich Elektrizität nannte. Das war ein Wunder, denn sie ließ die Trambahn fahren, ohne dass die Wagen von Pferden gezogen wurden. Onkel und Tante hatten keine Kinder und waren beide schon über fünfzig: Sie nahmen die Kleine voller Freude bei sich auf, als wäre sie ihr eigenes Kind. Meine Großmutter war ihrer Tante Rosa immer eng verbunden geblieben wie auch den Eltern und den Geschwistern. Selbst auf der anderen Seite der Welt flocht sie die Bande weiter mit Briefen, Karten und Fotografien.
Als mein Großvater Rosa im Turin zu Beginn des 20. Jahrhunderts kennenlernte, war sie ein schlankes Mädchen mit kastanienbraunen Haaren und Augen, die mindestens ebenso groß waren wie ihr Mut. Sie hatte Schneiderin gelernt.
Die jungen Leute verliebten sich und heirateten am 20. August 1907 in der Kirche Santa Teresa. Nur ein paar Schritte weiter würden sie eine Wohnung beziehen, in der am 2. April 1908 ihr Erstgeborener zur Welt kam und getauft wurde: Mario Giuseppe Francesco, mein Vater.
In diesem kleinen barocken Juwel, das für meine Großeltern und meinen Vater so wichtig war, wollte ich bei meinem Pastoralbesuch im Juni 2015 anlässlich der Ausstellung des Turiner Grabtuchs ein Gebet sprechen. Das Taufbecken zu küssen, war für mich, als würde ich nach Hause zurückkehren.
Nun hatte Großvater Giovanni also eine Ehefrau und einen kleinen Sohn. Er und meine Großmutter hatten sich mutig vielen schmerzlichen Erfahrungen gestellt.
Trotzdem entging er nicht dem Ausbruch des Weltkrieges zehn Jahre später. Die Bestie des Krieges forderte ständig neues Fleisch, und so wurden auch die Reservisten eingezogen. Da war mein Großvater dreißig Jahre alt.
La tradotta che parte da Torino
A Milano non si ferma più
Ma la va diretta al Piave
Cimitero della gioventù.
… heißt es im Volkslied: »Der Tross, der von Turin aufbrach und nach Mailand zog, macht da nicht halt, sondern wird direkt an den Piave verschickt, den Friedhof der Jugend.«
Mein Großvater erhielt die Matrikelnummer 15.543. Der Musterungsbeamte beschrieb ihn als jungen Mann mit rundem Kinn (wie das meine) und spitzer Nase, von Beruf »Caffettiere«, Cafetier. Sein Brustkorb hatte sich nicht verändert, schien aber dieses Mal kein Hindernis darzustellen. Anfang Juli 1916 wurde er dem 78. Infanterieregiment zugeteilt, das in Casale Monferrato stationiert war. Von dort aus schickte man ihn im November an die Front am Piave und am Isonzo, an der Grenze zwischen Italien und Slowenien, nördlich von Gorizia, am Monte Sabotino. Dort hatte Don Mazzolari erst vor Kurzem seinen einzigen Bruder verloren, der für das 18. Artillerieregiment kämpfte.
Mein Großvater verbrachte viele Monate im Schützengraben und erlebte immer schwerer werdende Schlachten mit.
Ich habe vieles aus seinen Erzählungen gelernt. Sogar die Spottlieder über die höheren Dienstgrade im Heer beziehungsweise über König und Königin:
Der General Cadorna schrieb der Königin:
»Wenn ihr Triest sehen wollt, schicke ich euch eine Ansichtskarte.«
Bum, bum, bum, so rumpeln die Kanonen.
Der General Cadorna futtert Rindersteak.
Für die armen Soldaten aber bleiben nur trockene Kastanien.
Der General Cadorna isst und trinkt und schläft.
Die armen Soldaten aber ziehen in die Schlacht und kehren nicht zurück.
Der General Cadorna ist der Fuhrmann.
Vittorio Emanuele ist der Esel, der das Fuhrwerk zieht.
Bum, bum, bum, so rumpeln die Kanonen
Und Menschen, die diese Strophen anstimmten, wie es ein junger Unteroffizier aus den Tälern um Bergamo bei einem Heimaturlaub tat, wurden wegen Defätismus und Insubordination zu sechs Jahren im Militärgefängnis verurteilt …
Mein Großvater hat mir die Schrecken des Krieges geschildert, den Schmerz, die Angst, die absurde und unabweisbare Sinnlosigkeit des Krieges. Aber auch von Momenten der Verbrüderung mit den feindlichen Kräften, die ja auf beiden Seiten aus Bauern, Arbeitern und Angestellten bestanden. Einfachen Menschen, die hin und wieder miteinander redeten, mit Mimik und Gesten oder Worten, die sie von der Sprache der andren aufgeschnappt hatten. Manchmal tauschte man auch ein wenig Tabak, ein Stück Brot oder ein anderes ärmliches Geschenk: Auf diese Weise erfand man winzige Atempausen, um der Last und der Entfremdung in den Schützengräben für einen Augenblick zu entgehen. Natürlich immer heimlich, denn die Vorgesetzten reagierten auf diese zutiefst menschlichen Gesten mitunter mit großer Brutalität. Mit Erschießungen oder, noch schlimmer, indem man die Artillerie gegen die eigenen Leute richtete, auf die eigenen Schützengräben, um so den Kontakt zu den feindlichen Soldaten zu unterbinden, denen man schon seit Monaten oder Jahren gegenüberstand. Mit der Zeit begriffen die meisten, dass die Feinde, aus der Nähe betrachtet, von Auge zu Auge, keineswegs die missgestalteten Ungeheuer waren, als die sie von der Kriegspropaganda gezeichnet wurden. Sie waren arme Schweine, genau wie die auf der anderen Seite. Alle krochen sie durch denselben Dreck und wurden auf dieselbe Weise bestraft. Von »gleicher Gesinnung wie du, nur trug seine Uniform eine andere Farbe«, wie Fabrizio De André singt, einer der großen Liedermacher der italienischen Sprache.
Was bleibt nach einem Krieg? Vor allem dessen makabre Bilanz. Am Ende zählte man nur im Regiment meines Großvaters, dem 78., 882 Tote, 1573 Verschollene und 3836 Verletzte: Kommilitonen, Gefährten, Freunde.
»Die Kommandos kamen uns vollkommen irrsinnig vor«, schrieb ein anderer Infanterist aus dem Piemont, ein Leutnant, der mit dem 68. Regiment an der Front am Isonzo kämpfte. »Vorwärts! Es geht nicht! Wen kümmert’s? Trotzdem vorwärts. Es war ein einziges Gemetzel. Wer die Befehle erteilte, war nicht anwesend. Und das Spektakel der vorrückenden Infanterie war, durch das Fernglas betrachtet, sicher erhebend. Aber die Generäle waren nicht mit uns. Einen Drahtverhau sahen sie höchstens auf den Karten in ihren Büros.«
»Die Munition, die nie fehlt, sind unsere Männer«, bemerkte General Cadorna mit brutalem Zynismus. Ein anderer hoher Offizier meldete der Regierung: »Am Isonzo sterben ganze Ströme von Menschen.«
Der weltweite Konflikt forderte Millionen Menschenleben. Von den mobilisierten Soldaten wurde gut die Hälfte erschossen, schwer verletzt oder blieb verschollen. Nimmt man Zivilisten und Militär zusammen, dann ergibt das mindestens 15 Millionen Kreuze, und das sind vorsichtige Schätzungen. Doch diese Zahl vervierfacht sich, wenn man die Opfer der Spanischen Grippe hinzurechnet, die sich im Krieg ungehemmt ausbreiten konnte und mit ihm zusammen einen Totentanz begann, wie dies auch heute noch häufig während kriegerischer Auseinandersetzungen der Fall ist.
Alles in allem war es tatsächlich ein »sinnloses Blutbad«, wie Papst Benedikt XV. in seinem mahnenden Schreiben an die Regierungsoberhäupter der kriegführenden Nationen sagte. Er sprach vom Selbstmord eines ganzen Kontinents.
Mein Großvater konnte sich retten. Nachdem er dem 9. Regiment der Bersaglieri di Asti zugeteilt wurde, konnte er das Regiment lebend verlassen. Im Dezember 1918 wurde er auf Lebenszeit ohne Einschränkung freigestellt, bekam zum Abschied noch »gute Führung« bescheinigt und 200 Lire in die Hand gedrückt. Was heute mehr oder weniger 300 Euro entspricht: sein Lohn dafür, dass er sich nicht hatte erschießen lassen. Nach insgesamt drei Jahren durfte er wieder zu seiner Familie zurückkehren. »Ich muss schon allzu lange wohnen bei Leuten, die den Frieden hassen.« (Ps 120,6) Wie viele andere Großväter aus Italien und Europa kehrte er zweifach ins Leben zurück: zuerst als Veteran und Überlebender, dann als Zeuge zum Nutzen seiner Kinder und Enkelkinder.
Was aber bleibt noch nach einem Krieg? Ungerechtigkeit, die sich auf Ungerechtigkeit türmt.
Da fallen einem sofort die Worte von Don Lorenzo Milani ein, seines Zeichens Priester und als Lehrer revolutionärer Reformer der Bildungspädagogik. Er schrieb Folgendes: »Wir haben also unsere Bücher genommen und um gut hundert Jahre zurückgeblättert, weil wir einen ›gerechten Krieg‹ suchen wollten. Es liegt nicht an uns, dass wir keinen solchen gefunden haben. […] Als wir selbst noch zur Schule gingen, haben unsere Lehrer – Gott möge ihnen vergeben – uns auf infame Weise betrogen. Und einige arme Kerle glaubten wahrhaftig an das, was sie sagten: Sie haben uns betrogen, weil sie selbst schon betrogen worden waren. Andere wussten zwar, wie sie uns betrügen konnten, aber sie hatten doch Angst. Die meisten jedoch waren nur einfach oberflächlich. Wenn man sie so reden hörte, waren alle Kriege ›für das Vaterland‹. Unsere Lehrer hatten vergessen, uns auf eine Binsenweisheit aufmerksam zu machen, nämlich dass die Heere immer dem Befehl der herrschenden Klasse unterstehen. […] Und ich kann nicht anders, ich muss meine Schüler darauf hinweisen, dass ihre armen Väter Leid ebenso erfahren wie verursacht haben, um die Interessen einer kleinen Klasse (zu der sie nicht gehörten) zu verteidigen, und nicht die Interessen des Vaterlandes. […] Manch einer beschimpft mich, ich würde das Andenken der Gefallenen beschmutzen. Das ist nicht wahr. Ich empfinde höchsten Respekt für die unglücklichen Opfer. Aber gerade aus diesem Grund kommt es mir vor, als würde ich sie beleidigen, wollte ich jene loben, die sie in den Tod geschickt und sich selbst in Sicherheit gebracht haben. […] Außerdem kann die Achtung für die Toten mich nicht meine Kinder vergessen machen, die noch leben. Ich will nicht, dass auch sie dieses tragische Schicksal erleiden. Wenn sie eines Tages ihr Leben opfern wollen, wäre ich stolz auf sie, aber dann sollte es für die Sache Gottes und der Armen sein, nicht für das Haus Savoyen oder Herrn Krupp.«
Was bleibt am Ende nach einem Krieg? Üblicherweise die Saat für einen neuen Krieg, für weitere Gewalt, weitere Irrtümer und Schrecken. Viele Historiker konnten zeigen, dass selbst das Naziregime und der Ultranationalismus in verschiedenen Regionen Europas in gewisser Weise ein Produkt des vorherigen Krieges sind. Und auch heute schaffen das Wettrüsten, die Ausweitung der eigenen Einflussbereiche und die aggressive und gewaltbereite Politik keinerlei Stabilität. Nie. Es gibt keinen intelligenten Krieg: Kriege bringen nur Elend und Not, Waffen nichts weiter als den Tod. Krieg ist immer dumm. So schrieb schon Albert Einstein: »Ich denke immerhin so gut von der Menschheit, dass ich glaube, dieser Spuk wäre schon längst verschwunden, wenn der gesunde Sinn der Völker nicht von geschäftlichen und politischen Interessen […] korrumpiert wäre.«
Giovanni Angelo Bergoglio, Eltern Francesco Giuseppe und Maria Brugnano, Klasse 1884, geboren am 13. August in Bricco Marmorito di Portacomaro Stazione, meinem Großvater, bescherte der Krieg, jener, in dem er gekämpft hatte, und jener, der sich gerade zusammenzubrauen begann, eine tief verwurzelte Abneigung gegen die Monarchie, die er für den Rest seines Lebens nicht mehr ablegen sollte. »Es ist nicht richtig«, sagte er. »Es ist nicht richtig, dass das Volk die faulen, intriganten Brotfresser erhält und mit seiner Haut all die Privilegien und Schicksalsschläge bezahlt! Sollen sie doch arbeiten gehen!« Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie glücklich er war, als im Juni 1946 beim Referendum über die Monarchie die Monarchisten verloren und Italien zur Republik erklärt wurde, eine Volksabstimmung, in der übrigens zum ersten Mal in der Geschichte auch Frauen wählen durften. Nur Prinzessin Mafalda gegenüber, von den Kriegsveteranen und Auswanderern sarkastisch nur »Malfait«, »Missgeburt«, genannt, kam sein anti-savoyardischer Widerstand zum Erliegen: Nein, sie nicht. Sie hatte viel gelitten. »Sie hat für alle bezahlt«, sagte er.
Nachdem er nach Argentinien emigriert war, machte Maria, die Mutter meines Großvaters, sich zwei Mal auf die anstrengende Reise, um ihn und seine Brüder zu besuchen. Sie war eine gütige Frau. Und beim zweiten Mal wurde sie, die 1862 in San Martino Alfiere, nur wenige Kilometer von Asti entfernt, zur Welt gekommen war, in Argentinien vom Tod ereilt. Das war zu Beginn der 1930er-Jahre. Es geschah in der Provinz von Santa Fe de la Vera Cruz, wo ihre Söhne gerade einen Teil der Ruta, der langen Fernstraße, asphaltierten. Und so begrub man sie in Argentinien.
Den Toten ein ehrendes Andenken zu bewahren, ist etwas, das in unserer Familie immer hochgehalten wurde, und deswegen hatte ich lange Jahre das Gefühl, dass etwas Wichtiges fehlte. Fünf Jahre nach der Beerdigung meiner Urgroßmutter musste man ihre sterblichen Überreste exhumieren und in einen kleineren Sarg umbetten. Und ich weiß noch gut, mit welcher Hingabe und Liebe meine Mutter diese fromme Pflicht erfüllte. Sie reinigte die Knochen sogar mit Alkohol. Ich jedenfalls hatte das Gefühl, dass meine Urgroßmutter fehlte. Bis ich schließlich vor ungefähr zwanzig Jahren herausfand, wo sie beerdigt war, sodass ich ihre Gebeine in unser Familiengrab überführen lassen konnte, dorthin, wo ihre Kinder und alle übrigen Verwandten lagen. Nun ruht sie bei der Familie ihres Sohnes Eugenio auf dem Cimitero Inglese di José C. Paz. Im Jardin de Paz wurde ihr Sohn Giovanni, mein Großvater, begraben, der diese Welt am 30. Oktober 1964 im Alter von achtzig Jahren verließ, als ich in Santa Fe lehrte. Er starb im italienischen Krankenhaus an einem Tumor der Gallenwege.
Ich hatte den Ersten Weltkrieg durch die Erzählungen meines Großvaters kennengelernt. Vom Zweiten erfuhr ich in Buenos Aires durch die Berichte der Migranten, die nach dieser neuen Schlächterei hier ankamen oder vor ihr fliehen wollten. Millionen und Abermillionen … Italiener, Deutsche, Polen … Viele Polen fanden Arbeit in einer Fabrik, in der auch mein Vater tätig war. Indem wir diesen Männern und Frauen zuhörten, begriffen wir Kinder, was da geschah, die Bomben, die Verfolgungen, die Deportationen, die Konzentrationslager, die Gefängnisse. So haben wir von diesem neuen schrecklichen Konflikt erfahren. Aus diesem Grund weiß ich, wie wichtig es ist, dass die jungen Leute die Auswirkungen der zwei Weltkriege im letzten Jahrhundert erfahren: Die Erinnerung daran ist ein schmerzhafter, aber nützlicher Schatz, weil er unser Gewissen formt.
Ein Schatz, der letztlich sogar die italienische und europäische Kunst hat wachsen lassen.
Unsere Eltern haben uns ins Kino mitgenommen, damit wir die Filme sehen konnten, die damals liefen: Rossellini, De Sica, Visconti, all die großen Regisseure des Neorealismo. Damals zeigte man drei Filme nacheinander, einen Hauptfilm und zwei kürzere. Man nahm sich ein belegtes Brot mit in die Vorführung, und schon war der Tag gelaufen. Ich bin zutiefst überzeugt, dass das italienische Kino der Nachkriegszeit, des Neorealismo, eine großartige Schule der Menschlichkeit ist. I bambini ci guardano ist ein Film, in dem De Sica jene Zeit einfing. Eigentlich müsste man ihn bei jedem Traugespräch den angehenden Eheleuten zeigen. Wenn ich ein Paar in den Stand der Ehe gebe, rede ich tatsächlich über diesen Film. Aber auch Roma città aperta mit der großartigen Anna Magnani und Aldo Fabrizi wird mir immer im Gedächtnis bleiben. Sie waren unsere Lehrer: des Kampfes, aber auch der Hoffnung und der Weisheit. Ich zitiere häufig einen Satz, den die Magnani am Set ihrem Maskenbildner sagte: »Lass mir meine Falten. Du schminkst mir nicht eine weg. Ich habe ein ganzes Leben gebraucht, um sie mir zuzulegen.« Nannarella, wie ihr Kosename lautete. Auch sie war weise.
Und dann war da noch Fellini. Fellini, den ich in meiner Jugendzeit und bis zu La dolce vita innig geliebt habe. Und mit La strada – Das Lied der Straße konnte ich mich sogar identifizieren. Damals war ich gerade mal achtzehn Jahre alt.
In einer entscheidenden Szene erzählt der junge Akrobat Matto, der vielleicht die franziskanischste Gestalt des Regisseurs ist, der naiven Posaunenspielerin Gelsomina, gespielt von Giulietta Masina:
»Du wirst es mir nicht glauben, aber alles, was es auf der Welt gibt, ist zu irgendwas gut. Sieh mal, dieser Stein hier zum Beispiel …«
»Welcher?«
»Irgend so ein Stein, der hier herumliegt. Auch der ist zu irgendetwas gut. Dieser kleine Stein …«
»Wozu denn?«
»Mein Gott, was weiß ich denn. Wenn ich das wüsste, weißt du, wer ich dann wär?«
»Wer?«
»Der Herrgott, der alles weiß. Wann man geboren wird, wann man stirbt. Das kann doch nur er wissen. Nein, ich weiß nicht, wozu dieses Steinchen gut ist, aber irgendeinen Zweck hat es auch. Wenn das keinen Sinn hat, ist alles sinnlos. Auch die Sterne. Ich glaube wenigstens. Ja, auch du. Auch du bist zu etwas gut. Du mit deinem komischen Rettichkopf.«
Es steckt viel vom heiligen Franziskus in dieser Szene. Zum einen die Steine. Wir, die einfachen Steine auf dem Erdboden, aber: »Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, er ist zum Eckstein geworden.« (Mt 21,42) Und er verleiht allem einen Sinn, auch dem, was wir nicht verstehen. Und in den spirituellen Worten des Ignatius von Loyola: »Gott in allen Dingen suchen und finden.«
Ich weiß, dass diese Filme – vor allem La dolce vita – seinerzeit in manchen Milieus scharf angegriffen wurden, auch von kirchlicher Seite. Aber jede Epoche hat ihre eigenen Formen der Bigotterie, denen es mitunter das Wort verschlägt angesichts einer extravaganten Frau, die in der Fontana di Trevi badet.
Und dann ist da die Substanz, eine starke Substanz, die in die Tiefe geht, was für echte Kunst typisch ist.
Pier Paolo Pasolini sagte über diesen Film, er wage sich vor in »die Beziehung zwischen Sünde und Unschuld« und dass wir es hier mit einem großen und absoluten Produkt eines zeitgenössischen Katholizismus zu tun hätten. Der Jesuitenpater Nazareno Taddei sprach von einer »großen christlichen Spiritualität«. Und ein anderer Jesuit, Pater Virgilio Fantuzzi, der mit dem Regisseur befreundet war, schrieb: »Jedes Werk dieses Regisseurs ist inspiriert vom geheimnisvollen Atem eines verborgenen Gottes.«
In gewisser Weise haben alle drei recht. Diese Filme sind vor allen Dingen Schätze, aus denen wir schöpfen sollten. Es handelt sich um eine Pädagogik für unsere Zeit.
Aber auch das argentinische Kino jener Jahre – zum Beispiel der Film Los Isleros von Lucas Demare – ist zutiefst menschlich. Es war ein wichtiger Teil der Kultur der Familie und Ausgangspunkt für moralische Überlegungen in den täglichen Gesprächen mit uns Kindern. Auch das argentinische Kino war großartig und hatte ein sehr hohes Niveau.
Es ist ungeheuer wichtig, dass die jungen Leute die Erinnerungen ihrer Großeltern, ihrer Väter und Mütter erzählt bekommen. Das verleiht ihnen Wurzeln, sodass sie nicht in der Luft hängen oder Gefahr laufen, die gleichen alten Fehler zu wiederholen. Dass sie erfahren, wie zum Beispiel ein verzerrter Populismus entstehen kann, ein Nationalismus, der sich hinter Gräben verschanzt und sich isoliert: Man muss nur an die Wahlen denken, die 1932 und 1933 in Deutschland stattfanden, und an Adolf Hitler, den Fußsoldaten, der besessen war von der Niederlage im Ersten Weltkrieg und von der »Reinheit des Blutes«. Er hatte den Deutschen eine großartige Zukunft versprochen, nachdem wieder eine Regierung gescheitert war. Daher ist es wichtig, dass die jungen Leute verstehen, wie der Populismus beginnt. Und wie er enden kann. Die Versprechungen, die sich auf Angst gründen, vor allem auf die Angst vor dem Anderen, gehören üblicherweise zu den Predigten der Populisten. Sie sind der Beginn der Diktatur und der Kriege. Denn für deine Mitmenschen bist du der Andere.
Ich hatte die Worte meines Großvaters Giovanni noch in den Ohren und im Herzen, als ich im September 2014 zum Militärfriedhof Sacrario di Redipuglia hinaufstieg, in der Provinz Gorizia. Dort liegen die sterblichen Überreste von 100 000 italienischen Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg, 60 000 davon unbekannt: Ihnen wurde alles geraubt, sogar ihr Name, sogar die Möglichkeit für ihre Eltern und Verwandten, sie am Grab zu beweinen. Nur wenige Tage zuvor war ich in Fogliano gewesen, wo 15 000 »feindliche« Soldaten aus fünf verschiedenen Nationen begraben sind. Auch von ihnen ist nur ein kleiner Teil identifiziert worden.
Gerade hatte ich noch die überwältigende Schönheit der Landschaft bewundert, Männer und Frauen, die mit ihrer Arbeit ihre Familie ernähren, spielende Kinder und versonnen dreinblickende alte Menschen … und nun bewegte ich mich inmitten Tausender und Abertausender Gräber, die alle gleich aussahen. Die Steine trugen die Daten junger Männer. Während ich an diesem Ort die Messe hielt, zusammen mit Bischöfen und Priestern aus allen Ländern, die am damaligen Konflikt beteiligt waren, war alles, was ich sagen konnte: Der Krieg ist Wahnsinn! Ich hatte ja dessen plastischen Ausdruck vor Augen, einen Beweis von brutaler Eindrücklichkeit. Während Gott seine Schöpfung voranbringt und uns alle aufruft, an seinem Werk teilzuhaben, zerstört der Krieg einfach alles. Sogar das, was Gott an Allerschönstem geschaffen hat. Den Menschen. Der Krieg reißt alles auseinander, sogar die Bande zwischen Geschwistern. Der Krieg ist Wahnsinn, und die einzige wahnhafte Entwicklung, die er mit sich bringt, ist Zerstörung. Über dem Eingang zum Friedhof schwebte das höhnische Motto jedes einzelnen Krieges: »Was geht mich das an?« Wie sagte Kain doch zu Gott: »Bin ich der Hüter meines Bruders?« (Gen 4,9) Die Antwort eines Menschen, der niemandem ins Gesicht schaut: nicht den Alten, nicht den Kindern, Müttern, Vätern …
An jenem Tag auf dem Militärfriedhof von Redipuglia weinte ich.
An jenem Tag in Redipuglia weinte ich. Das Gleiche geschah mir, als ich 2017 den amerikanischen Soldatenfriedhof in Nettuno besuchte und durch eine geradezu endlose Ebene mit weißen Kreuzen ging, die für die Toten der Schlacht von Anzio standen. Kreuze, die ganz genauso aussahen wie jene, die in der Normandie errichtet worden waren, für die Teilnehmer der Alliiertenlandung. Wir waren zum Gedenken an den 75. Jahrestag der Landung vor Ort: Tausende von Soldaten waren an einem einzigen Tag gefallen in ihrem Kampf gegen die Barbarei der Nazis. Von den zivilen Opfern gar nicht zu sprechen. Und von den 10 000 deutschen Soldaten, die gekämpft hatten, weil sie einem Regime mit einer mörderischen Ideologie Gehorsam schuldeten. Alle Menschen, die unter diesen Steinen lagen, hatten Pläne, Träume, Talente, die erblühen und Frucht tragen sollten. Aber die Menschheit hat ihnen wohl einfach gesagt: »Was geht das mich an?«
Dasselbe geschieht heute wieder, wegen neuer und alter Interessen, wegen verrückter geopolitischer Pläne, aus Geld- und Machtgier heraus. Auch heute tragen die Planer des Schreckens, die Organisatoren der Kämpfe und die Waffenhersteller dasselbe Motto im Herzen: »Was geht das mich an?« Ein Satz, der alles verseucht und instrumentalisiert. Selbst das, was uns am heiligsten ist. Selbst Gott. Es gibt keinen Kriegsgott: Wer Krieg führt, ist böse. Gott ist Frieden. Daher haben wir im Dokument über die Brüderlichkeit aller Menschen, das ich und der Großimam von Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb im Februar 2019 in den Vereinigten Arabischen Emiraten unterzeichnet haben, gebeten, man möge »aufhören, die Religionen zu instrumentalisieren, um Hass, Gewalt, Extremismus und blinden Fanatismus zu entfachen. Wir bitten, es zu unterlassen, den Namen Gottes zu benutzen, um Mord, Exil, Terrorismus und Unterdrückung zu rechtfertigen. Wir bitten darum aufgrund unseres gemeinsamen Glaubens an Gott, der die Menschen weder dazu geschaffen hat, damit sie getötet werden oder sich gegenseitig bekämpfen, noch dazu, damit sie in ihrem Leben und in ihrer Existenz Qual und Demütigung erfahren. Denn Gott, der Allmächtige, hat es nicht nötig, dass wir ihn verteidigen; und er will auch nicht, dass sein Name missbraucht wird, um die Menschen zu terrorisieren.« Gott als Rechtfertiger der eigenen Sünden und Verbrechen anzurufen, ist eine der schlimmsten Gotteslästerungen.
Wir müssen uns in jedem Fall bemühen, dem Wettrüsten und der immer weiteren Verbreitung von Waffen auf der Welt ein Ende zu setzen, sowohl auf individueller wie auf staatlicher Ebene, sowohl im Kontext eines Krieges als auch in unseren Städten. Vor allem aber in den wirtschaftlich entwickelten Ländern, wo es um einen vergänglichen Konsens und ein trügerisches Gefühl der Sicherheit geht. Wer glaubt, das Böse mit dem Bösen bekämpfen zu können, schafft unweigerlich das noch Schlimmere. Jene politischen Führer, die dieser Gesinnung das Wort reden, die nicht fähig sind, Dialoge und Diskussionen zu führen, die ihr Amt nicht mit der Demut dessen ausfüllen, der gewählt wurde, um Bande des Miteinanders zu knüpfen, sondern stattdessen auf Arroganz setzt, jene Führer werden ihrem Volk weder Frieden noch Gerechtigkeit und Wohlstand bieten können. In der Regel führen sie es nur an den Abgrund und in den Ruin.