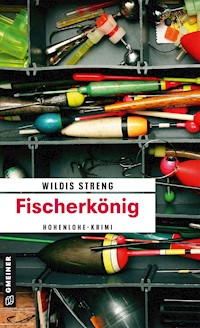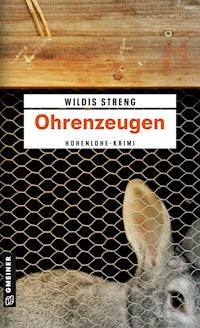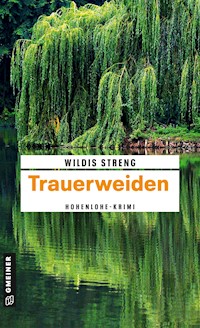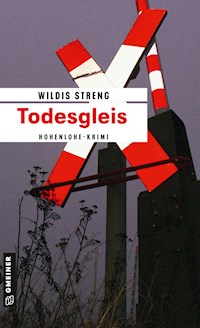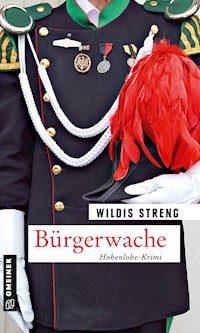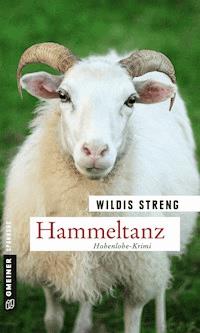3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Der Sommer ist doch einfach die schönste Jahreszeit in Hohenlohe! Grund genug, in den drei anderen Jahreszeiten vom Hohenloher Sommer zu träumen. Die Crailsheimer Autorin Wildis Streng jedenfalls träumt davon - mit kleinen Geschichten, Erzählungen, Überlegungen und Gedichten. Von früher und von heute.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 49
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Hohenloher Kindheit
Heu machen
Zehnereis
Träubles essen
Süßkirschen von Opa
Äpfel klauben
Märchenhaftes Hohenlohe
Die Quelle bei Satteldorf
Rotkleidchen in Wildentierbach
Am Heinzenmühlen-Wehr
Die Gröninger Froschkönigin
Sommerliebe
Libellenliebe
Sommersonnwende
Hohenloher Fantasien
Die Versteinerung
Kokosnuss im Freibad
Hypothesen am Degenbachsee
Hohenloher Betrachtungen
Wolkenboote
Sommerregen
Das Gerstenfeld
Am Schweinemarktplatz
Sommernächte
Der Komet
Glühwürmchen
Katze in der Nacht
Die Perseiden
Silbernacht
Hohenloher Kindheit
Heu machen
Ende Juli oder im frühen August haben wir immer Heu gemacht. Nun ist meine Familie keine Bauernfamilie, sondern meine Mutter Bankkauffrau und mein Vater Oberstudienrat. Aber meine Oma hatte ein Äckerle, das von meiner Mutter heute immer noch bestellt wird und das der moderne Mensch eher als „Feld“ bezeichnen würde. Ebenso haben wir eine Wiese, die wirtschaftlich keinen echten Wert darstellt. Ein paar Birnbäume und ein Walnussbaum stehen auf ihr, auf dem oberen Plateau einige Nadelbäume, die wir manchmal als Weihnachtsbaum verwendet haben. Sie liegt am Hang, die Wiese, und ist in Westgartshausen. Gegenüber einem Grundstück mit einer rätselhaften Tanne, die einmal drei Stämme besessen hat, durch Blitzeinschlag jedoch zu einer normalen Tanne degradiert worden ist. Obwohl sie in ihrem Inneren sicherlich noch eine besondere Tanne ist, davon bin ich überzeugt. Jedenfalls war meine Familie immer anständig genug, um das Heu, welches auf der Wiese wuchs, nicht verkommen zu lassen. Denn immerhin hatten wir einen Abnehmer – mein Onkel Alfred war zeitlebens „Hobbylandwirt“, wie auf dem Schild zu lesen war, das er beim Volksfestumzug immer an seinem Wagen montiert hatte. Gezogen wurde der Wagen meist von einem seiner Haflinger. Sein erstes Pferd hieß „Nastor“, und für mich als Kind war der mir riesig erscheinende Nastor das imposanteste und schönste Pferd der Welt. Ich durfte nie das Reiten lernen, weil meine Mutter immer Angst hatte, dass ich herunterfallen würde. Umso Ehrfurcht gebietender und schöner erschien mir „der Naschdor“ mit seinem karamellfarbenen Fell und der cremeweißen Mähne. Und die Wiese gefiel mir, ich kannte viele Blumen beim Namen und spielte oft Elfe oder Wiesenkönigin oder irgendetwas in der Art. Dabei baute ich mir Nester im hohen Gras, das mich damals noch überragte. Während der Heuernte wurde ich allerdings geschumpfen, wenn ich das Gras „zsammhoggte“, denn so ließ es sich weniger gut mähen. Mein Onkel und mein Vater erledigten das mit der Sense, in einem ersten Durchgang. Das bedauerte ich einerseits, denn dann hatte ich keine Nester mehr. Andererseits roch das frisch geschnittene Gras einfach wunderbar, frisch und grün, nach Leben und nach Natur. Ein paar Tage später fuhr man dann wieder nach Westgartshausen, zum Heu wenden, das ging jedoch vergleichsweise schnell. Und die ganze Zeit über hoffte man, dass das Wetter hielt, dass es keines dieser berüchtigten Sommergewitter geben würde, das das Heu womöglich verderben würde. Die eigentliche Heuernte war dann der schönste Tag. Meine Mutter richtete frühmorgens einen Korb mit dick belegten Paprikalyonerbroten und Getränken. Dann fuhr man wieder nach Westgartshausen, die ganze Familie. Oma, Mama, Papa und, seit ich sechs war, auch meine Schwester. In den ersten Jahren verlief die Ernte noch ohne Ballenpresse, in den späteren Jahren mit so einem Gerät, vor dem ich einen heiden Respekt hatte. Weil ich mir immer vorstellte, wie es wäre, wenn man da aus Versehen den Arm „neibringa“ würde. Und ich geriet nur selten in die Reichweite des unheimlichen, mir gleichsam lebendig erscheinenden Monstrums. Denn auch meine Mutter erkannte die Gefahr, die die Ballenpresse speziell für Kinder darstellte. Und so fütterten die Erwachsenen, mein Onkel, meine Eltern und meine Oma das Monster, das mit großem Rattern nach einer Weile fertige Heuballen, die mit schwarzem Plastikband umwickelt waren, ausspuckte. Die duftenden Ballen wurden dann auf einen Ladewagen geladen, vor dem in frühen Jahren Nastor gespannt war. Nach seinem Tod durch eine Kolik ersetzte ein weinroter Bulldog das Pferd. Und es gab nichts Schöneres, als nach getaner Arbeit ein Picknick auf der nun leeren Wiese zu machen. Die Sommergrillen zirpten, die heiße Luft flirrte, und wir aßen die Paprikalyonerbrote und tranken Sprudel dazu. Und waren stolz auf das Heu, das Onkel Alfred dann in seiner Scheune im Spitalgarten, der eigentlich mitten in einem Wohngebiet liegt, lagerte (die Sache mit dem Wohngebiet war meinem Onkel immer egal). Vor allem aber waren wir froh, dass das Heu nicht verkam, denn das wäre sehr, sehr unanständig gewesen.
Zehnereis
Zum Sommer gehört natürlich Speiseeis. Und damals in den Achtzigern gab es „Nucki Nuss“, „Nucki Erdbeer“, „Ed von Schleck“, „Bumbum“, „Himbi“, „Nogger“ und „Flutschfinger“. Das billigste Eis war „Caretta“, welches eigentlich nur gestreckter, überzuckerter gefrorener Orangennektar war. „Caretta“ war dementsprechend am unbeliebtesten, aber natürlich auch am billigsten, es kostete nur 60 Pfennige. 60 Pfennige waren damals nicht viel Geld. Für einen Grundschüler mit zwei, drei Mark Taschengeld pro Woche allerdings schon ein ziemlicher Posten. Und all diese Eissorten gab es sowieso eher in den Kiosks und Restaurants, in denen dann Eistruhen für die Kinder standen, wo man sich dann nach dem Essen manchmal noch eines kaufen durfte. Natürlich gab es diese „Eise“ auch in den Tante-Emma-Läden der Region, und auch bei der „Lilli“ in Tiefenbach. Aber die Lilli hatte noch ein anderes Eis im Angebot, nämlich das „Zehnereis“. Falls man sich damals die Mühe gemacht hätte, die weiße Schrift auf dem Klarsicht-Plastikschlauch, in dem das Zehnereis angeboten wurde, zu entziffern, so hätte man dort „Bussi Schleck Drink“ lesen können, dazu das Bild eines irgendwie seltsam aussehenden Bärchens, das etwas von einem Lemuren hatte. Aber so nannte kein Mensch bzw. kein Kind das Zehnereis. Vielmehr hatte es seinen Namen von seinem Preis – ein Zehnereis kostete zehn Pfennige, also ein „Zehnerle“. Praktischerweise befand sich Lillis Laden, der fast immer geöffnet hatte - (außer, wenn ein Papp-Schild mit der Aufschrift „Bin gleich zurück“ dranhing) - direkt