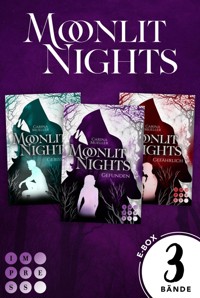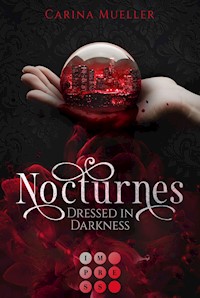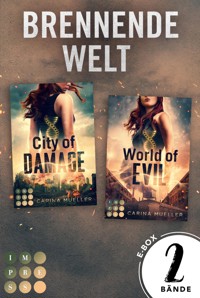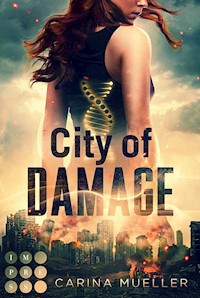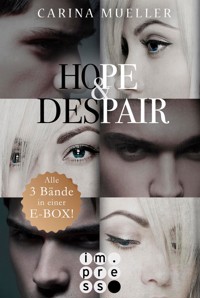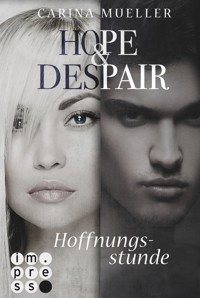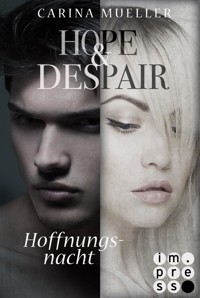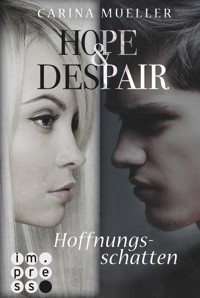
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
**Wahre Gegensätze finden immer zueinander** Sie sind buchstäblich ein Geschenk des Himmels: Zum Dank für die heimliche Rettung eines schiffbrüchigen Ufos bekam die amerikanische Regierung einst zwölf übermenschliche Babys geschenkt. Sechs Mädchen und sechs Jungen – jeweils für die guten und die schlechten Gefühle der Menschen stehend. Dies ist genau siebzehn Jahre her und die Babys sind nicht nur groß geworden, sondern wurden auch voneinander getrennt. Während Hope und die anderen fünf Mädchen sich als Probas dem Guten im Menschen verpflichten, verhelfen die männlichen Improbas dem kriminellen Untergrund zu Geld und Macht. Bis zu dem Tag, an dem die Improbas ihre Gegenspielerinnen aufspüren und nur Hope entkommen kann. Mit ihrem Gegenpart Despair dicht auf den Fersen… //Textauszug: Bei einem weiteren Blick in den Rückspiegel trafen sich unsere Blicke, so schien es mir, und kalte, schwarze Augen starrten mir finster entgegen. Ja, definitiv. Dieser Improba hatte nur ein Ziel, welches er fokussierte: Mich. Ich entfernte mich immer weiter von unserem Stützpunkt, mein Herz schlug mir bis zum Hals. Was sollte ich jetzt tun? Wo sollte ich hin?// //Alle Bände der packenden Science-Fantasy-Reihe: -- Hope & Despair 1: Hoffnungsschatten -- Hope & Despair 2: Hoffnungsnacht -- Hope & Despair 3: Hoffnungsstunde -- Hope & Despair: Alle Bände in einer E-Box// Die »Hope & Despair«-Reihe ist abgeschlossen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung, können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
In diesem E-Book befinden sich eventuell Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Carlsen Verlag GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Im.press Ein Imprint der CARLSEN Verlag GmbH © der Originalausgabe by CARLSEN Verlag GmbH, Hamburg 2016 Text © Carina Mueller, 2016 Lektorat: Konstanze Bergner Umschlagbild: shutterstock.com / © AS Inc / © Meyer George Umschlaggestaltung: formlabor Gestaltung E-Book-Template: Gunta Lauck Schrift: Alegreya, gestaltet von Juan Pablo del Peral
Für alle, die Hoffnung brauchten, brauchen und brauchen werden. Denkt stets daran:
1. Kapitel
»Hope! Beeil dich! Wir müssen weg! Sofort!«, schrie Barry ins Telefon, so dass ich erschrocken zusammenzuckte. Dann legte er auf.
Noch während ich mein Handy in die Hosentasche gleiten ließ, wurde mir heiß und kalt. Adrenalin pumpte durch meinen Körper und ließ mich erzittern.
Oh mein Gott! Heute war also der Tag, von dem ich mir wünschte, dass er niemals kommen würde.
Ohne eine Erklärung nahm ich die Chips, die ich gerade hier im Laden bezahlen wollte, wieder von der Theke und stellte sie zurück ins Regal. Dann hastete ich hinaus.
Was hätte ich dem Verkäufer auch sagen sollen? Sorry, aber ich muss schnell weg, weil mich jemand umbringen will?
Es schüttelte mich bei diesem Gedanken. Wie absurd das klang – leider nur dem Wortlaut nach. Inhaltlich war genau das mein Problem: ein Mann, der nach meinem Leben trachtete.
Dabei hatte ich ihn noch nie gesehen oder gar mit ihm gesprochen. Aber dennoch … Er wollte meinen Tod. Und noch mehr als das. Denn wenn ich von ihm nur den Tod hätte befürchten müssen, hätte er mir nicht solche Angst gemacht. Doch das, was er mit mir vorhatte, war tausendmal schlimmer.
Warum das alles? – Ja, das war kompliziert …
***
»Gott, Hope! Du bist wie immer die Letzte!«, fuhr Barry mich an, als ich endlich an unserem Stützpunkt eintraf. »Ich versteh ja, dass du aufgrund deiner Ausbildung generell nicht sonderlich besorgt bist oder sein kannst, aber dennoch muss es doch auch in dein Hirn reingehen, dass das hier kein verdammtes Spiel ist, oder?«
Ich schnaubte entrüstet. »Natürlich ist mir das klar!
»Und warum brauchst du dann immer am längsten? Love, Loyalty, Honesty, Modesty und Mercy: Sie sind alle schon da!«
Alarmiert blickte ich mich um. Ich registrierte zwar tatsächlich die Anwesenheit aller meiner Schwestern, doch ich bemerkte auch, dass keine von ihnen den Anschein machte, jeden Moment aufbrechen und sich aus dem Staub machen zu wollen.
»War das etwa wieder nur ein Scheißprobealarm?« Ich funkelte Barry wütend an, welcher daraufhin die Augen zusammenkniff, meinem Blick jedoch problemlos standhielt.
»Ja, war es. Und solange du dich nicht ein wenig beeilst, wird es davon noch einige geben.«
»Ich dachte, du wolltest keine mehr machen?!« So schnell gab ich mich nicht geschlagen.
Barry sah mich an, als wüsste er nicht, worauf ich hinauswollte.
»Wie war das? Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, und wenn er auch die Wahrheit spricht?«, versuchte ich ihm auf die Sprünge zu helfen.
Doch Barry schüttelte nur den Kopf und ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. »Wie gesagt: Solange du nicht schneller wirst, müssen wir das auf diese Weise üben.«
»Und da wunderst du dich, dass ich deine – nebenbei utopische Zeit nicht schaffe? Wozu auch? Es ist ja eh nie Ernst«, beschwerte ich mich.
»Sei froh, dass es bis jetzt noch kein Ernstfall war. Wenn dich die Improbas in die Finger bekämen –«
»Werden sie nicht«, unterbrach ich ihn und schenkte ihm ein überzeugtes Lächeln. Mein Herzschlag hatte sich wieder etwas beruhigt.
»Als ich diesen Job damals angenommen hatte, war mir nicht klar, wie schwer das werden würde«, seufzte Barry. »Manchmal würde ich echt gern alles hinschmeißen.«
Da trat Mercy zu ihm. »Sag so etwas nicht, Barry. Du weißt doch, dass wir dich brauchen.« Mitfühlend tätschelte sie seinen Arm.
Barry schnaubte belustigt. »Sei mir nicht böse, Mercy. Aber wenn ausgerechnet du diese netten Sachen sagst, verliert es irgendwie an Wertigkeit …«
Mercy lächelte nachsichtig. Dennoch wirkte sie ein wenig geknickt dabei.
»Mercy hat Recht, Barry. Wir brauchen dich«, versuchte ich die Situation zu entspannen und klopfte unserem Aufpasser auf die Schulter.
»Und Hope kann ja nichts dafür, dass sie den Ernst der Lage nicht immer erkennt«, kicherte Mercy.
Doch Barry blickte mich ernst an. »Tut mir leid, Hope, aber es ist nicht immer leicht mit euch. Ihr seid alle so voll mit euren Pros, dass ich manchmal den Eindruck habe, alles andere prallt einfach an euch ab.«
Ich nickte verständnisvoll. So ganz Unrecht hatte Barry damit nicht. Wir sahen zwar aus wie ganz normale Mädchen, doch jede von uns war von Kinderbeinen an auf eines dieser sogenannten Pros trainiert worden – ein Überbegriff für die positiven Charaktermerkmale und Eigenschaften, die wir in den Menschen verstärken sollten. Davon abgeleitet nannte man uns selbst Probas.
Und gemäß unseren Namen sorgte meine Anwesenheit auf der Erde für Hoffnung, Loves für Liebe, Loyaltys für Loyalität, Honestys für Ehrlichkeit, Mercys für Mitleid und Modestys für Bescheidenheit.
Jedoch verstärkten unsere erlernten Pros nicht nur das Positive im Menschen, sondern auch bei uns selbst. So war es mir beispielsweise fast unmöglich, irgendetwas negativ zu sehen. Für mich gab es immer Hoffnung und ich verstand schon, dass Barry das manchmal zur Weißglut trieb.
»Na ja, beim nächsten Mal bist du dann bitte ein bisschen mehr auf Zack, okay?«, zeigte sich dieser nun versöhnlich.
Ich nickte, wusste allerdings jetzt schon, dass ich mich garantiert nicht dazu aufraffen könnte. – Wie gesagt: Die Hoffnung starb zuletzt und obwohl ich Angst hatte, war ich mir sicher, dass sich früher oder später alles zum Guten wenden würde.
Barry schien meine Gedanken zu erraten, denn er fasste mich am Arm und sah mir eindringlich in die Augen.
»Hope, hör mir gut zu: Wir können es uns nicht leisten, dass du oder eines der anderen Mädchen den Improbas in die Hände fallt. Glaube mir, was ihr da erleben werdet, könnt ihr euch in euren schlimmsten Albträumen nicht ausmalen.«
Ich seufzte und meine Gedanken schweiften ab.
Die Improbas: ein weiteres düsteres Kapitel meines Lebens. Doch um das erklären zu können, musste man schon etwas weiter ausholen.
Im Jahr 1997 ereignete sich hier in Phoenix etwas, dass von den Medien »Phoenix Lights« getauft wurde. Es handelte sich dabei um eine dieser Ufo-Sichtungen, doch wie so oft hatte es die amerikanische Regierung geschafft, den unzähligen Augenzeugen eine Sinnestäuschung einzureden und somit war das Ereignis offiziell bald vergessen.
Warum ich das erzähle? Weil es eben keine Sinnestäuschung war. Punkt.
Das Ufo, oder besser: Raumschiff, kam von meinem Heimatplaneten Sensimos und musste in Phoenix notlanden. Als Dank dafür, dass die amerikanische Regierung die ganze Sache vertuschte und meinen Urvätern half, wieder auf ihren Planeten zurückzukehren, schenkten die Sensianer, also die Bewohner von Sensimos, ihnen zwölf Säuglinge, die ein Jahr später hinunter auf die Erde geschickt wurden. Es handelte sich dabei um sechs Mädchen, von denen ich eines war, und sechs Jungen, allesamt ausgestattet mit besonderen Fähigkeiten.
Als hehres Ziel sollten wir auf unsere Pros trainiert werden, um durch unsere Anwesenheit die Weltbevölkerung zu unterstützen und mit neuer Energie und neuem Lebensmut zu versorgen – was theoretisch auch kein Problem gewesen wäre. Die Kraft, die jeder einzelne von uns ausstrahlte, reichte, um die entsprechenden Pros in jedem Menschen auf der ganzen Welt zu aktivieren und ihn dadurch auf den rechten Weg zu bringen. Das bedeutete im besten Falle: nie wieder Kriege, nie wieder Hungersnöte, nie wieder Leid.
Doch leider waren nicht alle Regierungsmitglieder ein Sinnbild von Loyalität und so kam es, dass wir bereits als Babys gestohlen wurden. Glücklicherweise konnten wir Mädchen gerettet werden, doch die Jungs verschwanden auf Nimmerwiedersehen …
Spätere Nachforschungen ergaben, dass man aus ihnen Improbas gemacht hatte, welche so ziemlich das Gegenteil von uns verkörperten. Ihre Welt war schlecht und grausam, und genau das ließen sie auch die Menschen der Erde spüren. Sie streuten Hass, Verzweiflung, Habgier, Lügen, Verrat und Unbarmherzigkeit.
Da wir ihnen nun in gleicher Anzahl gegenüberstanden, hätte man annehmen können, das natürliche Gleichgewicht ließe sich durch unsere Fähigkeiten aufrechterhalten, doch so einfach war das leider nicht: Die männlichen Sensianer waren stärker als die weiblichen und da ihnen ihre ohnehin schon größere Macht nicht ausreichte, versuchten sie alles, um uns in ihre Gewalt zu bringen. Ihr einziger Lebensinhalt schien es zu sein, uns auf negative Impros umzutrainieren und somit alles Positive auf der Erde auszulöschen.
Mal ganz davon abgesehen, dass es für eine von uns sowieso nie in Frage käme, sich bereitwillig »umpolen« zu lassen, erklärte Barry uns auch, dass der Vorgang mit höllischen Qualen und Schmerzen verbunden war und nicht selten im Tod endete. Zumindest hatten das unsere Urväter bei den Anweisungen, wie ein Sensianer korrekt aufzuziehen und zu trainieren sei, warnend hinzugefügt. Und bei diesen Aussichten konnte ich noch viel besser darauf verzichten …
Laut Barry war es aber zum Glück auch so, dass nicht jeder Improba uns umtrainieren konnte. Damit wir für die Prozedur ausreichend geschwächt werden konnten, musste es schon der passende Gegenpart sein. Und was ist das Gegenteil von Hoffnung? – Verzweiflung, richtig.
Mein persönlicher Widersacher hieß also Despair. Schön …
»An was denkst du nur wieder, Hope?«, riss Mercy mich aus meinen Gedanken. Sie stand immer noch dicht bei mir, während sich die anderen Mädchen etwas zurückgezogen hatten und unbeschwert miteinander plauderten.
»Ich? Äh … an nichts weiter.«
»Machst du dir Sorgen?« Ihr mitfühlender Blick streifte mich.
»Soll das ein Witz sein?« Ich grinste. »Hallo? Ich bin Hope. Ich machte mir nie Sorgen. Ihr erinnert euch? Alles wird gut …«
Mercy schüttelte leicht den Kopf. »Ich meine ja nur …«
»Mach DU dir mal lieber keine Sorgen. Uns passiert nichts. Ich weiß es.«
Ich lächelte sie aufmunternd an und wandte mich dann erneut an Barry. »Und jetzt? Steht noch was an oder darf ich zurück in den Laden, um mir meine wohlverdienten Chips zu kaufen?«
»Fahr ruhig. Aber sei das nächste Mal … schneller.« Barry zwinkerte mir zu.
Ich bemaß ihn mit einem schiefen Grinsen und sah zu, dass ich wegkam.
***
Nachdem ich endlich eine köstliche Tüte Paprikachips in den Händen hielt, riss ich sie gierig auf und stopfte mir nonchalant eine Handvoll nach der anderen in den Mund. – Ja, an so ein Menschenleben konnte man sich durchaus gewöhnen … Dann machte ich mich mit meinem Auto auf den Weg ins Krankenhaus.
Schon länger hatte ich festgestellt, dass ich Menschen eine Extraportion Hoffnung mit auf den Weg geben konnte, wenn ich sie direkt berührte. Und wo konnte ich diese Gabe besser einsetzen, als auf der Palliativstation?
Anfangs hatte ich ziemliche Gewissensbisse, dass ich diesen armen Leuten Hoffnung schenkte und sie plötzlich alles ganz positiv sahen, obwohl ich doch wusste, dass sie ein paar Tage später trotzdem für immer die Augen schließen würden. Doch Barry hatte mich in meinem Vorhaben bestärkt, ihnen möglichst unbeschwerte letzte Tage zu gewähren. Genauso sah ich das jetzt, deswegen machte es mir, auch wenn es paradox klang, große Freude, todkranke Menschen – speziell Kinder – in solchen Krankenhäusern zu besuchen.
Zeit hatte ich ohnehin genug. Auf eine normale Schule brauchte ich nicht zu gehen. Die Regierung hatte uns Probas eine Privatschule zur Verfügung gestellt, an der neben dem regulären Unterrichtsstoff vor allem auch unsere Pros geschult wurden. Da ich aber mittlerweile schon siebzehn Jahre alt war und unsere Pros im Alter von sechszehn Jahren voll entwickelt waren, besuchte ich die Schule nur mehr sporadisch.
Um einen Job musste ich mich ebenfalls nicht bemühen. Seit ich ein Säugling war, bekam ich mein Geld ganz offiziell von der Regierung – für »Beratertätigkeiten« … Oder wenn wir diesen ganzen Geheimhaltungskram mal vergaßen, einfach dafür, dass ich auf diesem Planeten wohnen blieb und den Menschen Hoffnung schenkte. Aber das Geld interessierte ohnehin niemanden. Wenn die Regierung in der Lage war, einen kompletten Ufoabsturz zu vertuschen, war ein Beratergehalt für einen Säugling wohl ein Klacks.
Zudem hatte ich keinerlei Ambitionen, auf meinen Heimatplaneten zurückzukehren. Erstens wusste ich sowieso nicht wie, und zweitens fehlte mir ehrlicherweise auch das Interesse. Sensianer besaßen keine klassischen Familienstrukturen wie Menschenkinder sie in der Regel hatten. Von klein auf wurde mit einem harten Training begonnen, um die jeweiligen Fähigkeiten bestmöglich entfalten zu können. Nichts ging über eine wohlstrukturierte Gemeinschaft, in der jeder seine Aufgabe besaß und damit zum Allgemeinwohl beitrug. Es wimmelte also nur so von Hopes und Loves und Mercys – um nur ein paar der Eigenschaften zu nennen, die unseren Planeten auszeichneten. Zumindest erzählte Barry uns das immer.
Die Vorstellung von solch einem friedvollen Miteinander hatte zwar durchaus ihre Reize, dennoch … Hier war Barry mein Vater und die anderen Probas meine Schwestern. Und auch, wenn wir alle – rein biologisch betrachtet – nicht miteinander verwandt waren, nannte ich sie so. Denn sie waren einfach meine Familie.
Mit diesem Gedanken und einem Lächeln auf den Lippen bog ich auf den Parkplatz des Phoenix Childrens's Hospital ein und versuchte mich nun wieder ganz auf meine bevorstehende Aufgabe zu fokussieren: Hoffnung schenken.
Ich wollte gerade aussteigen, als mein Handy erneut klingelte. Ich sah auf das Display. Barry. Was wollte er denn schon wieder?
»Hey Barry«, begrüßte ich ihn. »Kann es sein, dass dir heute langweilig ist?«
»Hope, du musst sofort kommen! Dies ist keine Übung!«
»Denk dir bitte mal etwas Neues aus …«, reagierte ich gelassen.
»Nein, Hope. Diesmal nicht. Du musst –«
»Barry? BARRY?« Das Tuten des Handys zeigte an, dass er aufgelegt hatte.
Etwas ratlos saß ich nun hinter dem Steuer. War es dieses Mal wirklich sein Ernst gewesen? Vorhin schien doch alles in bester Ordnung.
Ich überlegte einen Moment lang, ob ich nicht einfach ins Krankenhaus gehen sollte, doch mein Gewissen ließ mich den Motor erneut starten.
Widerwillig machte ich mich auf den Weg zurück zu unserem Stützpunkt – Barrys Haus, wo im Übrigen auch alle anderen Probas lebten. Alle, außer mir, wohlgemerkt.
Es war also kein Wunder, dass meine Schwestern immer vor mir da waren. Zumal sie ohnehin kaum das Anwesen verließen und lieber in Barrys Nähe blieben.
Ich konnte das nicht so ganz verstehen. – Klar: Das Haus samt umliegendem Areal, von der Regierung eigens für den Zweck unserer Ausbildung zur Verfügung gestellt, hätte größentechnisch jeder Hollywood-Villa Konkurrenz machen können, auch wenn es von außen eher unauffällig wirkte. Doch immer nur daheim rumzuhocken war mir viel zu langweilig. Zudem befand sich das Anwesen auf einem ehemaligen Army-Gelände. Willkommen in der Einöde! Weit und breit nichts außer einem dichten Wald und einem meterhohen Zaun drumherum. Dazu mehr oder minder grimmig dreinschauende Soldaten, die neben Barry für unsere Sicherheit zu sorgen hatten.
Ohne Frage: Ich liebte meine Familie und wir verstanden uns alle prima, doch ich wollte etwas sehen von der Welt, wollte etwas erleben und vor allem neue Leute kennenlernen. Und weil es eine gute Stunde dauerte, bis man von hier aus in der Zivilisation war, hatte ich mit sechzehn Jahren ein kleines Appartement in der Stadt bezogen. Barry gefiel das natürlich überhaupt nicht und deshalb veranstaltete er seitdem regelmäßig diese dummen Probealarme.
Er sagte, es wäre nur zu meiner eigenen Sicherheit, doch insgeheim nahm ich an, dass er mich damit mürbe machen wollte. Mürbe genug, dass ich wieder bei ihnen einzog und er einen besseren Blick auf mich hatte. Doch da konnte er lang warten …
Nichtsdestotrotz ließ ich Barry seinen Spaß, auch wenn mir nicht klar war, wie mich ein Probealarm vor den Improbas schützen sollte. Sie hatten uns schon auffallend lange nicht mehr versucht anzugreifen, es war ohnehin nicht einfach, in unser festungsartiges Haus einzudringen. Doch Barry war felsenfest davon überzeugt, dass sie ihre erstarkenden Kräfte bündelten und wir schon bald mit einem neuen Angriff zu rechnen hatten. Die berühmte Ruhe vor dem Sturm sozusagen.
Nun, ich würde dem Sturm hoffnungsvoll trotzen.
***
Ich fuhr die Einfahrt zum Stützpunkt hinauf und parkte direkt vor der Haustür.
Kurz sah ich mich um. Jay und Ice, zwei Soldaten, die links und rechts neben dem Eingang positioniert waren, nickten mir zur Begrüßung zu. Theoretisch schien alles in bester Ordnung, aber nur theoretisch. Für gewöhnlich veranstalteten die beiden nämlich ein Heidenspektakel, wenn ich kam. Sie verhielten sich nur dann so ruhig, wenn Barry irgendeine Laus über die Leber gelaufen war.
Langsam stieg ich aus, ging zur Haustür und wollte gerade aufschließen, als diese bereits geöffnet wurde.
»Ist das deine Auffassung von schneller?!«, empfing Barry mich unfreundlich.
Ich hatte also Recht gehabt.
Mit hochgezogenen Augenbrauen sah ich ihn an. »Willst du etwa damit sagen, dass das schon wieder –«
Doch Barry unterbrach mich. »Ja, Hope. Von mir aus üben wir es bis zum Erbrechen. Im Ernstfall zählt jede Sekunde!«
»Was erwartest du? Soll ich mich etwa über sämtliche Verkehrsregeln hinwegsetzen, Menschenleben riskieren?«, verteidigte ich mich angesäuert. Ich hatte mir nichts, aber auch gar nichts zu Schulden kommen lassen. Und ich wusste, dass Barry das auch wusste. Hier ging es offenbar nur ums Prinzip. Oder um Schikane.
»Würde meine Urgroßmutter noch leben, wäre sie garantiert mit wehenden Fahnen an dir vorbeigezogen. Verdammt, Hope! Selbst ein roher Schinken ist schneller als du!«
»Was bitte hat ein roher Schinken mit Schnellsein zu tun?!« Barry und seine idiotischen Vergleiche, die schlimmer hinkten als ein angeschossenes Speckschwein.
»Das Gleiche wie du. Nämlich nichts!«
Prompt fingen Jay und Ice an zu kichern.
»Sehr witzig.« Ich verdrehte die Augen und ging zurück zu meinem Auto, als Barry erneut das Wort ergriff:
»Hope, du bist siebzehn Jahre jung. Als ich noch in deinem Alter war, wäre ich sicher in Rekordzeit hier gewesen.«
Das glaubte ich sogar. Als alter Elitesoldat hatte er bestimmt auch nichts Besseres zu tun, als jede Sekunde auf einen Befehl zu warten.
Kommentarlos öffnete ich die Autotür.
»So träge bist du doch gar nicht«, foppte Barry weiter.
Pfft! Als müsste ich mir das sagen lassen. Barry wusste ganz genau, dass ich bei allen sportlichen Aktivitäten die anderen Probas weit in den Schatten stellte.
»Stimmt. Als Beste im Fechten, im Judo und im Selbstverteidigungskurs, ruhe ich mich immer gern aus«, konterte ich und schaute Barry herausfordernd an.
»Dann scheinst du wohl nur momentan ein wenig eingerostet zu sein.« Barry hatte den Satz noch nicht zu Ende gesprochen, als er hinter mich trat und versuchte, mich mit einem Schultergriff auf den Boden zu werfen.
Doch ich hatte damit gerechnet. Blitzschnell packte ich seinen Arm und drehte ihn mit einer der Judotechniken auf seinen Rücken.
»Lass mich los«, knurrte Barry, während Jay und Ice noch lauter kicherten.
»Fragt sich, wer von uns beiden hier eingerostet ist«, antwortete ich spöttisch, doch ich gehorchte sofort. Obwohl ich gestehen musste, dass es mir in diesem Moment ein kleines bisschen Genugtuung bereitete, den starken, jedoch mittlerweile leicht ergrauten Barry so hilflos zu sehen. Muskeln waren eben nicht alles. Barry selbst hatte uns das immer wieder gepredigt.
»Bleib beim nächsten Mal einfach in der Nähe deines Autos. Dann bist du auch schneller«, wies er mich an.
»Ich hab sogar noch im Auto gesessen und bin direkt losgefahren, nachdem du aufgelegt hattest. Ich weiß wirklich nicht, was du von mir willst.«
»Dann entferne dich nicht so weit von unserem Stützpunkt. Es ist doch alles nur zu deinem Besten.«
Barry rieb sich den Arm, doch sein Blick war wieder versöhnlicher geworden, geradezu väterlich.
»Bitte, Hope: Wir können es uns nicht leisten dich zu verlieren.«
Er wies Jay und Ice an, eine Runde zu patrouillieren. Nachdem die beiden außer Sichtweite waren, fasste er mich an den Händen und senkte die Stimme. »Ich will ehrlich zu dir sein. Ich habe schon seit längerem das Gefühl, dass die Improbas stärker werden.«
Fragend blickte ich ihn an.
»Man sieht es ständig in den Nachrichten. Und man kann es auch fühlen. Egal, ob beim Einkaufen oder beim Sport. Dazu die hasserfüllten Kommentare in den sozialen Netzwerken. Die Leute werden immer aggressiver, egoistischer, arroganter und missgünstiger. Keiner ist mehr bereit, etwas für den anderen zu tun. Viele spinnen Lügen zusammen und versuchen so ihre Mitmenschen schlecht darzustellen, anstatt an den eigenen Defiziten zu arbeiten. Von Nächstenliebe keine Spur mehr.« Barry schloss für einen Moment die Augen – um mich dann umso eindringlicher anzusehen. »Du, Hope, bist die wichtigste Proba von allen. Wenn du nicht mehr da wärst, um diesem Gesinnungswandel durch dein Pro entgegenzusteuern … Wo sollte das alles nur enden?« Er machte eine kurze Pause, während ich schuldbewusst meine Augen senkte. Dann setze er erneut an und drückte mit dem Daumen mein Kinn nach oben, so dass ich zu ihm aufblicken musste.
»Ohne Hoffnung gibt es keine Zukunft, Hope. Es ist sehr wichtig, dass du das begreifst.«
Ich nickte und schluckte schwer. Vielleicht war mein Job doch nicht ganz so easy, wie ich es mir immer einredete? Natürlich war er von der Arbeit her nicht schwierig. Ich brauchte ja nichts zu tun – außer am Leben zu bleiben. Doch die damit verbundene Last, die auf meinen Schultern lag, und die Verantwortung, die ich hatte – für diesen ganzen verdammten Planeten! waren geradezu erdrückend.
»Ich weiß, dass es schwer ist, Hope. Aber aus großer Kraft folgt große Verantwortung, du weißt doch.«
Ich lächelte, da ich das Zitat aus Spiderman erkannte. Ich liebte alle Superheldenfilme, hatte sie schon so oft geschaut, dass ich mitsprechen konnte.
Es mochte vielleicht eingebildet klingen – wobei ich das wirklich nicht war –, aber manchmal fühlte ich mich selbst wie eine Art Superheld. Zwar besaß ich keine supercoolen Laseraugen und konnte mich auch nicht unsichtbar machen, aber dennoch hatte ich die Menschheit in gewisser Weise zu beschützen. Und wenn mir das nur damit gelang, dass ich mich selbst beschützte, sollte ich nicht so egoistisch sein und mein Leben leichtfertig aufs Spiel setzen.
»Barry?«, fragte ich kleinlaut.
»Ja?«
»Ich werde in Zukunft so schnell wie möglich hier sein, wenn du angerufen hast, versprochen. Aber du musst auch ein bisschen mehr Verständnis für mich zeigen. Wenn ich aus der Stadt komme, dauert es eben seine Zeit«, lenkte ich bereitwillig ein.
Da nahm mich Barry in seine Arme. »Danke, Kleines. Ich werde mich bemühen, etwas geduldiger zu sein.«
Ein Räuspern ertönte und ließ uns aufhorchen. Modesty stand am Türrahmen gelehnt und blickte uns mit einem merkwürdigen Gesichtsausdruck an.
»Hey Modesty«, begrüßte ich sie.
»Hey«, entgegnete sie nur, was für eine Proba merkwürdig kalt klang.
Verdutzt schaute ich erst Barry, dann sie an.
»Alles in Ordnung mit dir?«, fragte ich vorsichtig.
Modesty lächelte und nickte. »Klar. Ich wollte nur sehen, wo Barry so lange bleibt. Es gibt gleich Essen. Magst du auch was?«
Obwohl die Frage wieder total normal geklungen hatte – freundlich und nett, typisch Proba eben –, schüttelte ich etwas verunsichert den Kopf. »Nein Danke, Modesty. Ich wollte noch kurz bei den Kindern vorbeischauen und dann nach Hause fahren.« Fragend blickte ich Barry an. «Wenn das in Ordnung ist?«
Er nickte. »Wenn dir was verdächtig vorkommt, rufst du an, okay?«
»Okay.« Damit verabschiedete ich mich von den beiden und machte mich erneut auf den Weg ins Kinderkrankenhaus. Irgendwie schien ich heute alle Wege doppelt nehmen zu müssen.
***
Am nächsten Morgen klingelte bereits um sechs Uhr mein Handy. Verschlafen schaute ich auf das Display. Barry. Na der hatte vielleicht Nerven. Ich war zwar beileibe keine Langschläferin, doch da ich keine wirklichen Verpflichtungen hatte, gönnte ich mir schon bis halb oder um acht meinen Schönheitsschlaf.
»Was willst du?«, gähnte ich ins Telefon. »Nein. Warte. Lass mich raten: Probealarm?!«
»Nein, nein … Ich wollte dich fragen, ob du Lust hast, heute Abend zum Essen zu kommen?«
»Und deswegen rufst du mich um diese Uhrzeit an?«, entgegnete ich ungläubig und zugleich verständnislos. Das war nun wirklich nichts, was man nicht auch hätte später klären können …
»Na ja, ich dachte, ich gebe dir so früh wie möglich Bescheid. Damit du dir nichts anderes vornimmst.«
Ich konnte es zwar nicht sehen, doch ich wusste genau, was Barry nun für ein Gesicht machte. Etwas beschämt, doch mit einem frechen Glitzern in den Augen. Ich war mir sicher, dass er seine Mutter mit dieser Tour früher auf die Palme gebracht hatte. Und ich war mir auch sicher, dass er sich einiges hatte erlauben können, ohne jemals wirklich Ärger dafür zu bekommen. – Genau wie jetzt.
»Mmh, mmh«, machte ich daher nur als Antwort.
»Also kommst du so gegen sieben Uhr? Es gibt dein Leibgericht. Gemüsepizza.«
»Gemüsepizza? Bist du sicher? Modesty hasst Gemüsepizza«, gab ich zu bedenken.
»Da ich der Koch bin, wird sie sich wohl damit abfinden müssen. Außerdem wird sie es schon nicht umbringen und wenn du schon mal zu Besuch kommst …«
»Wir sehen uns fast täglich, Barry.«
Er erwiderte nichts.
»Okay, wie du meinst. Ich bin um sieben da.«
»Klasse! Ich freue mich!«
»Bis dann«, verabschiedete ich mich, legte auf und zog mir noch einmal die Bettdecke über den Kopf. Wie gesagt, ich war wirklich keine Langschläferin, aber ich konnte mir schönere Dinge vorstellen, als quasi mitten in der Nacht von meinem Vaterersatz wegen einer solchen Kleinigkeit geweckt zu werden.
Nachdem ich mich noch eine Viertelstunde erfolglos im Bett herumgewälzt hatte, stand ich auf und begann meinen Tag wie immer. Ich backte mir ein paar Croissants auf, machte mir einen Karamelltee, fütterte Streuner, meinen Stubentiger, und studierte danach gemütlich die Tageszeitung.
Hm … Barry hatte gar nicht so Unrecht. Seite für Seite las man nur noch über Gewalt, Attentate und Kriege. Aber war das schlimmer geworden? Standen mehr negative Schlagzeilen in der Zeitung als noch vor fünf Jahren? Ich wusste es nicht. Doch Barrys Urteilsvermögen war zweifelsohne zu trauen. Immerhin beobachtete er schon seit Jahren jede noch so kleine Veränderung in der Welt und nahm von allen Geschehnissen, die auch nur ansatzweise etwas mit den Improbas zu tun haben könnten, genauestens Notiz. Eigentlich hatte ich ihn lange Zeit als geradezu besessen abgestempelt, doch wenn ich das hier so las, hätte man schon auf unschöne Gedanken kommen können … – Und das allein bei der Tageszeitung von Phoenix.
Hatten die Improbas wirklich etwas mit dem gesellschaftlichen Wandel zu tun oder waren das lediglich Mutmaßungen, geschürt von Angst und Unsicherheit unseres menschlichen Beschützers?
Seufzend legte ich die Zeitung beiseite, trank meinen Tee aus und machte mich kurzentschlossen auf den Weg ins Kinderkrankenhaus. Gestern hatte ich wegen des zweiten Probealarms nicht so viel Zeit wie geplant mit den kleinen Patienten verbringen können, und das wollte ich nun nachholen.
***
Pünktlich um zehn vor sieben fuhr ich bei unserem Stützpunkt vor. Doch anstatt mich wie immer direkt vor die Haustür zu stellen – was Barry stets auf die Palme brachte –, parkte ich auf einem der etwas abgelegeneren Parkplätze, um mich heute von meiner besten Seite zu zeigen. Und um Barry nicht schon wieder einen Schritt weiter in Richtung Herzinfarkt zu treiben.
Ich stieg aus und marschierte forschen Schritts auf die Eingangstür zu. »Hey Jay, hey Ice«, begrüßte ich die beiden Wachsoldaten.
Wie auf Kommando schauten sie auf ihre Armbanduhren.
»Wahnsinn, Hope!«
»Ultra! Du bist pünktlich!«, zogen sie mich auf.
»Hört schon auf, Jungs«, erwiderte ich, doch konnte mir selbst ein Grinsen nicht verkneifen.
»Der helle Wahnsinn! – Hey Alter, hast du gesehen? Hope ist mal pünktlich«, sagte Jay zu Ice.
»Krasser Scheiß! Ich fass es nicht! Hope, wie hast du das geschafft?«
Ich schüttelte gespielt tadelnd den Kopf. »Jungs, ihr seid Mitte dreißig. Wird's nicht langsam mal Zeit, erwachsen zu werden?«
Ice sah Jay an. »Hast du das gerade auch gehört?«
Jay machte ein fassungsloses Gesicht und rieb sich die Ohren. »Ohne Witz, Mann. Ich hab das auch gehört.«
»Und jetzt?« Ice boxte Jay gegen die Schulter.
»Keine Ahnung, Alter. Hier geht irgendetwas nicht mit rechten Dingen zu. Erst ist Hope pünktlich, dann denkt sie auch noch, sie sei erwachsener als wir …«
»'Ne Ahnung, wie wir sie wieder zur Besinnung bringen können?«
»Vielleicht sollten wir sie mit Gemüsepizza einreiben. Ich hab gehört, die gibt es heute. Extra für sie.«
Ice und Jay warfen sich vielsagende Blicke zu.
»Ich warne euch, Jungs«, drohte ich und versuchte meine strenge Miene aufrechtzuerhalten. Doch binnen kürzester Zeit musste ich lachen.
»Wir scheinen ja sehr furchteinflößend zu sein«, stellte Jay niedergeschlagen fest und Ice machte ein beleidigtes Gesicht, was mich jedoch nur noch mehr zum Lachen brachte. Die beiden hätten Zwillinge sein können: einer bescheuerter als der andere, aber auf ganz liebenswürdige Art und Weise.
»Ich muss jetzt rein. Sonst komm ich wegen euch doch noch zu spät.«
»Sehr wohl, Mylady«, säuselte Jay hoheitsvoll.
»Mitnichten würden wir das riskieren wollen«, stimmte nun auch Ice ein, während sich beide unisono verbeugten und Platz vor der Tür machten.
»Manchmal habt ihr echt 'ne Macke«, befand ich kopfschüttelnd und öffnete schnell die Haustür.
»Deswegen magst du uns doch so.« Jay grinste mich frech an.
»Da kann ich Jay nur beipflichten. Das stellt uns alle auf eine Stufe.«
Ich verdrehte die Augen und betrat das Haus.
»Hey, Hope. Du bist ja pünktlich!«, empfing Barry mich gut gelaunt.
»Du bist nicht der Einzige, der das festgestellt hat«, entgegnete ich leicht pikiert. »Ist das echt sooo ungewöhnlich?«
»Schon, ja«, sagte Love, die in dem Moment um die Ecke kam und mich herzlich an sich drückte. »Aber schön, dass du da bist.«
Love war eben die Beste.
»Seht ihr? Das möchte ich hören, wenn ich zu Besuch komme. Alles klar?«, fragte ich in die Runde, während ich mit Love und Barry das Esszimmer betrat.
Meine Schwestern lachten und gaben sich einverstanden.
Alle, bis auf eine.
Modesty.
»Hey, Modesty. Alles klar?«, fragte ich sie direkt.
»Es gibt Gemüsepizza«, kam als Antwort.
»Kein Grund, so schlecht drauf zu sein, Modesty«, neckte Loyalty sie, doch Modesty schaute sie mit einem merkwürdigen Ausdruck in den Augen an. Beinahe ebenso kalt und berechnend, wie sie mich letztens angeblickt hatte.
Ich sah mich in der Gruppe um, ob eine meiner Schwestern das auch registrierte, doch sie alle waren zu sehr mit der Pizza beschäftigt, die Barry gerade auf den Tisch stellte, als dass es einer aufgefallen wäre. Vielleicht irrte ich mich ja auch …
Hungrig setze ich mich dazu und schnitt mir ein extragroßes Stück ab. Wenn es schon mal selbstgemachte Gemüsepizza gab, musste ich das schließlich nutzen. Außerdem hatte ich den ganzen Tag so gut wie nichts gegessen und mir meinen Appetit für den jetzigen Moment aufgehoben. Hatte ich schon erwähnt, dass Gemüsepizza mein absolutes kulinarisches Highlight war?
Nachdem wir alle satt und zufrieden waren und ich Barry beim Aufräumen half, flüsterte er mir ins Ohr:
»Kommst du gleich mal kurz mit vor die Haustür?«
»Wa –«, doch bevor ich weitersprechen konnte, hatte Barry mir schon den Zeigefinger auf den Mund gelegt und mich damit zum Schweigen gebracht. Sein Blick bedeutete mir, dass das wohl nicht für die Allgemeinheit gedacht war.
Also trocknete ich fertig ab und huschte danach unbemerkt nach draußen.
Barry war noch nicht hier. Was er wohl wollte?
Ich suchte nach Jay und Ice, um sie derweil ein bisschen zu ärgern, doch konnte die beiden nirgendwo entdecken. Vermutlich waren sie gerade auf Patrouille. Schade. Doch bevor ich das weiter bedauern konnte, trat Barry auch schon zu mir.
»Was gibt's?«, fragte ich und konnte meine Neugier dabei kaum verbergen. Etwas suspekt war mir die ganze Sache schon. Wir hatten schließlich nie Geheimnisse vor den anderen Probas.
Barry zog mich am Arm mit sich. »Komm, wir laufen ein Stück.«
»Du machst es aber spannend«, erwiderte ich, ging jedoch bereitwillig mit.
Nachdem wir uns ein paar Meter entfernt hatten, drehte Barry sich zu mir um. »Ich weiß nicht, ob es dir schon aufgefallen ist, Hope, aber irgendetwas ist –«
»Halt die Fresse, du dumme Sau!«
»Wie bitte? Klappt's noch, du kleiner, vulgärer Hosenscheißer?!«
»Deine Mutter ist ein Hosenscheißer!«
»Ey! Mach keine Witze über meine Mutter!«
»Sonst?«
»Sonst fick ich deine!«
»Fick dich selbst, Alter!«
»Fick du dich doch!«
Erschrocken schauten Barry und ich uns an. Das waren Jay und Ice! Was war denn in die gefahren?! Die beiden waren doch sonst ein Herz und eine Seele!
Barry und ich liefen gleichzeitig in die Richtung, aus der die Pöbeleien kamen. Wenig später hatten wir die Streithähne erreicht, doch sie waren nicht mehr nur dabei sich verbal zu bekriegen. Nein, sie lagen auf dem Boden und wälzten sich herum, wobei immer der, der gerade obenauf war, dem anderen mit ganzer Kraft ins Gesicht schlug.
»Seid ihr noch ganz bei Trost?« Barry versuchte Jay und Ice zu trennen, doch als er dazwischenging, bekam er ebenfalls eine Faust ins Gesicht.
»Misch dich nicht ein, alter Bastard!«, warf Jay ihm an den Kopf, wofür er von Ice direkt die nächste Schelle kassierte.
»Jungs! Was ist denn nur los?«, schrie ich dazwischen, da die beiden so im Wahn waren, dass meine normale Stimme sicher untergegangen wäre.
»Shut up, Blondie!«, kam es von Ice, während er wieder über Jay hing und auf ihn einprügelte.
Hilflos sah ich zu Barry, der offensichtlich auch nicht genau wusste, was hier passierte und was er tun sollte. Doch gerade, als Barry ein Licht aufzugehen schien, hörten wir Schreie aus dem Haus.
»Oh, mein Gott! Das ist Love!«, rief ich entsetzt. Ohne zu überlegen rannte ich so schnell ich konnte los.
»Hope! Warte auf mich!«, brüllte Barry hinter mir her, doch er war mir einfach zu langsam.
»Geht nicht! Irgendetwas stimmt mit Love nicht!«
Als ich die sperrangelweit offene Haustür passierte, blieb ich wie angewurzelt stehen. Zwei große, stämmige Typen hielten Love fest, die sich mit Händen und Füßen zu wehren versuchte, jedoch keine Chance gegen ihre Widersacher hatte. Sie schrie und strampelte, bis einer der zwei ausholte und ihr so fest ins Gesicht schlug, dass sie in den Armen des anderen bewusstlos zusammensackte.
Vor Schreck stand ich wie versteinert da und brachte keinen Ton heraus.
Dann sah ich, wie ein Weiterer Mercy die Arme auf den Rücken drehte, um sie gefügig zu machen, und sie in Richtung Terrassentür schob.
Oh mein Gott! Was war hier nur los?
Plötzlich langte von rechts eine Hand nach mir und ich schrie entsetzt auf, doch als ich mich umdrehte, schaute ich in Modestys verheultes Gesicht. Ich wollte sie festhalten, sie stützen, doch zeitgleich griffen starke Männerhände nach ihren Haaren und rissen sie brutal daran zurück.
Modesty wimmerte: »Hilf mir, Hope!«
Ich versuchte, sie an ihrem Arm festzuhalten, doch da wurde ihr Angreifer auf mich aufmerksam.
»Despair?! Komm wieder runter! Deine Bitch ist hier unten!«, brüllte er die Treppe hinauf, während er Modesty gegen ihren Willen von mir wegzerrte.
Ich wollte ihr helfen, ging ihr nach, doch da packte mich jemand fest an meinen Oberarmen.
Ohne zu überlegen schlug ich erst einmal wild um mich, bis jemand mein Gesicht festhielt und mich zwang, ihn anzusehen. Es war Barry.
»Wir müssen weg! Sofort!«
Bevor ich das bejahen oder verneinen konnte, zog er mich zurück in Richtung Haustür.
»Aber die anderen«, protestierte ich und wollte wieder zurück, doch Barry hatte fest zugepackt und ließ mir keine Chance, zu entkommen.
»Steckt dein Schlüssel?«
»Was?«, fragte ich, vollkommen verwirrt und überfordert von den ganzen Geschehnissen.
»Ob dein Schlüssel steckt! Auto?!«
Ich nickte, während Barry mich weiter im Laufschritt zu meinem Wagen hinmanövrierte.
»Was ist –«, begann ich, doch Barry schnitt mir das Wort ab.
»Jetzt nicht.«
»Aber wir müssen den anderen helfen«, wehrte ich mich.
»Werden wir!«
»Aber –«
»Kein Aber!«
Am Auto angekommen riss Barry die Beifahrertür auf und stieß mich in den Wagen – just in dem Moment, als an der Haustür ein großer, dunkelhaariger Mann auftauchte. Sein schwarzes Shirt und seine schwarze Jeans legten sich eng um seinen muskulösen Körper, ein Körper, der von hartem Training zeugte und dadurch geradezu einschüchternd wirkte.
Ich blickte ihm entgegen und schlagartig überfiel mich eine eisige Kälte, die an meinem gesamten Körper Gänsehaut hinterließ. Kurz schienen wir beide wie in Trance, bis der Kerl sich von meinem Blick losriss und aus der Haustür heraus auf uns zustürzte.
»Bring dich in Sicherheit, Hope! Sie dürfen dich nicht kriegen!«, schrie Barry mich an und versuchte die Autotür zuzuschlagen, doch ich hielt dagegen.
»Und was ist mit dir?«, fragte ich verzweifelt.
»Ich werde sie ablenken! Wichtig ist, dass erst mal du in Sicherheit bist!«
»Wieso kommst du nicht mit?«
»Frag nicht, sondern fahr endlich los!«
»Aber wenn er dich kriegt! Er wird dich bestimmt foltern! Oder sogar töten!«
»Hoffen wir, dass er glaubt, dass er das kann …« Barry rang sich ein Lächeln ab, doch ich sah sofort, dass es nicht ehrlich war.
Der Typ kam derweil näher und näher.
»Und wenn –«
»Wird er nicht, Hope. Ich bin ein ausgebildeter Soldat einer Spezialeinheit. Ich komme klar!«, versicherte mir Barry noch einmal mit Nachdruck.
»Aber …«, setzte ich erneut an, doch er wollte das nicht hören.
»Du hilfst mir am besten, wenn du überlebst! Erinnere dich daran, was ich dir gesagt habe! DU bist wichtig, Hope! Du allein! Und jetzt fahr endlich!«
Barry zückte seine Waffe und blickte hektisch in die Richtung, aus der der Improba auf uns zugespurtet kam.
»Barry, ich …«
Da richtete er die Waffe plötzlich auf mich.
»Es wird Zeit! Tue, was ich dir sage!«, brüllte er mich an und in diesem Augenblick spürte ich die ganze Last, die auf seinen Schultern ruhte. Trotz meiner Gegenwart schien sich Verzweiflung in ihm breit zu machen, als ob es kein Morgen mehr gäbe und alles für immer verloren wäre.
Ein flaues Gefühl breitete sich in meinem Magen aus und ließ mich erschauern. »Spinnst du?!«, krächzte ich, doch anstatt irgendetwas darauf zu erwidern, entsicherte er die Waffe und hielt sie weiter an mein Gesicht.
»Wird's bald?« Eine Träne stahl sich aus seinem Augenwinkel.
Völlig verdattert ließ ich den Motor an und trat wie befohlen auf das Gaspedal.
Ich hatte keine Ahnung, wo ich hinfahren sollte. Ich wusste nur, ich musste weg. Weit weg.
Im Rückspiegel sah ich, wie Barry noch mit einem gewissen Vorsprung in den Wald entkommen konnte, was jedoch daran lag, dass der Improba sich keineswegs für Barry zu interessieren schien. Er würdigte ihn nicht mal eines Blickes. Stattdessen rannte er – zumindest ein paar Meter meinem Auto hinterher.
Bei einem weiteren Blick in den Rückspiegel trafen sich unsere Blicke, so schien es mir, und kalte, schwarze Augen starrten mir finster entgegen.
Ja, definitiv. Dieser Improba hatte nur ein Ziel, welches er fokussierte: Mich.
Ich entfernte mich immer weiter von unserem Stützpunkt, mein Herz schlug mir bis zum Hals.
Was sollte ich jetzt tun?
Wo sollte ich hin?
Sollte ich versuchen, Barry zu finden? Oder wäre das zu riskant?
Ich hatte ihm schließlich versprochen mich in Sicherheit zu bringen und genau das würde ich jetzt tun!
2. Kapitel
Despair
Verdammt! Sie war mir schon wieder entwischt! Ich würde sie nie bekommen! Niemals!
Der Gedanke schnürte mir regelrecht die Kehle zu.
»Lass dich nicht von der Verzweiflung verschlucken, Despair. Verwandele sie in Wut!«, mahnte ich mich selbst. Eigentlich machte ich das automatisch, doch in dieser Extremsituation musste ich es mir noch einmal vor Augen führen.
Zornig schlug ich in unserem Quartier gegen die nächstbeste Wand und trat noch einmal dagegen, um meine aufkeimende Verzweiflung entsprechend zu kanalisieren. Schon früh hatte ich mir ein Ventil suchen müssen, um nicht vollends den Verstand zu verlieren.
Die Verzweiflung war unvorstellbar mächtig. Wie ein Strudel, der einen immer tiefer nach unten zog. Weg vom Licht. Hinein in die Dunkelheit. Bis man schließlich von einem großen, schwarzen Nichts verschluckt wurde. Wer einmal drin war, kam nie wieder heraus.
Zum Glück hatte ich gelernt, die Verzweiflung mit Hilfe von Wut zu beherrschen. Wenn auch sehr zum Ärger meines Obersts, der stets befürchtet hatte, dass das Einfluss auf meine eigentliche Ausbildung nehmen könnte. Doch wie sich nach meinem erfolgreichem Abschluss herausstellte, war das total unbegründet.
Die Verzweiflung war ein so übermächtiges Impro. Keines könnte ihr jemals gefährlich werden.
Ich setzte mich auf unsere Couch, legte missmutig die Stirn in Falten und grübelte darüber nach, wie ich dieses elende Miststück endlich in die Finger kriegen konnte. Sie war schwerer zu fangen als ein Fisch im Wasser! Mit bloßen Händen!
Ich schluckte schwer. Das würde unserem Oberst gar nicht gefallen …
»Hey Alter, was ist los?«
Ich blickte kurz auf und sah das dämliche Grinsen von Hate, welcher gerade versuchte, Greeds Hausratte mit einem Stück Käse über eine heiße Herdplatte zu locken. Was für ein elender Wichser!
»Was tust du da, Hate?«, fragte ich angewidert.
Mein Gegenüber jedoch lachte nur, platzierte den Käse so, dass die Ratte die Platte überqueren musste, wenn sie ihn haben wollte, und kam zu mir.
»Ich übe schon mal. Jetzt, wo ich Love habe.«
Ich nickte langsam. In mir sah es anders aus. Auch wenn die Probas für ihre Taten keine Gnade verdient hatten, konnte Love einem schon ein wenig leidtun. Hate war echt krank. Vollkommen durchgeknallt.
»Im Gegensatz zu dir war ich ja erfolgreich«, begann er prompt zu sticheln.
Er hatte gut lachen. Love zu fangen war auch nicht sonderlich schwer gewesen. Durch ihr Pro war sie zutraulicher als ein kleiner Hundewelpe. Wie einen reifen Apfel hatte Hate sie quasi nur pflücken und mitnehmen müssen. Ihre hilflosen Abwehrversuche waren ebenfalls lachhaft gewesen.
Generell hatte es den Anschein gemacht, als hätten die Blondchen wie auf dem Präsentierteller auf ihre Entführer gewartet. – Alle, bis auf eine natürlich.
Warum konnte sie verdammt noch mal nicht einfach mit an diesem beschissenen Tisch sitzen?!
»Jetzt zieh nicht so eine Fresse. Irgendwann wirst du auch Erfolg haben und deine kleine Bitch kriegen.«
Ich warf Hate einen bösen Blick zu. Dieser überhebliche Widerling! Ich wusste, dass es keinesfalls aufmunternd von ihm gemeint war. Nein, so war Hate nicht. Er war einfach gehässig. Durch und durch. Es freute ihn, dass ich als einziger meinen Auftrag nicht erfüllt hatte und mir mein Gegenstück durch die Lappen gegangen war. Dabei hatte uns der Oberst schon von klein auf eingetrichtert, dass Hope die höchste Priorität galt.
Hate war meiner Meinung nach einfach nur neidisch, dass sein Impro nicht das Wichtigste war, aber ich hatte auch keinen Bock, mich deswegen mit ihm anzulegen. Nicht heute.
Durch unser tägliches Training und die Kampfsimulationen war ich zwar bestens in Form, doch gegen den Muskelprotz Hate würde es sicher ein hartes Stück Arbeit werden. Nicht, dass wir es schon mal ausprobiert hätten. Dabei würde ich nichts lieber tun, als ihm sein großes Maul einmal ordentlich zu stopfen, doch der Oberst sah solche Streitigkeiten untereinander nicht gern, hielten sie uns doch von dem Wesentlichen ab: die Probas zu finden und zu brechen.
»Halt's Maul, Hate«, fuhr ich ihn einfach nur an, nahm einen Tennisball vom Tisch und begann, ihn immer wieder gegen die Wand zu werfen. Das machte ich öfter, wenn ich nachdenken musste.
»Awww … Ist unser kleines Prinzesschen etwa eingeschnappt? Oder hat unser Bubu-Bärchen schon Angst, weil es gleich Haue-Haue bekommt?«, stichelte Hate indes weiter und begab sich wieder zu der Ratte.
Ja, er war ein riesengroßes Arschloch! Zudem wusste ich selbst, dass mir für mein Versagen noch eine unangenehme Strafe blühte. Das musste er mir nicht noch unter die Nase reiben. Andererseits war es mir auch egal. Schließlich hatte ich nichts zu erwarten, was ich nicht schon von klein auf in irgendeiner Form kannte.
»Du sagst ja gar nichts mehr? Überlegst du gerade, ob du lieber Schläge, Schnitte oder Brandwunden haben willst?« Hates kalte Augen blitzten höhnisch.
Ich versuchte ihn zu ignorieren und warf den Ball weiter gegen die Wand.
»Ach nein, jetzt weiß ich's. Du willst lieber schwimmen, hab ich Recht? Ich glaube, ich werde das unserem Oberst als erzieherische Maßnahme für dich vorschlagen. Das magst du doch so gern …« Anzüglich wackelte er mit den Augenbrauen.
»Haaate …«, erhob ich mahnend die Stimme, doch Hate wäre nicht Hate, wenn er sich von mir – oder irgendeinem anderen, der nicht unser Oberst war – einschüchtern ließe.
»Lass dir ein paar Titten wachsen. Das passt eher zu dir. Versager!«
Ich fing den Tennisball wieder auf und warf ihn mit voller Wucht gegen Hates Kopf.
»Was zum –«, polterte dieser los, doch ich unterbrach ihn:
»Fick dich doch!«, brüllte ich ihn an und allein von dem Blick, den ich ihm dabei zuwarf, hätte er elendig verrecken müssen. Zugegeben, das Ganze war nicht besonders geistreich, aber es waren die einzigen Worte, die Hate wirklich etwas ausmachten.
Als wir damals auf unsere Impros trainiert wurden, hatten wir alle schlimme Dinge durchmachen müssen und speziell dieses Verb hatte für Hate seitdem eine ganz besondere Bedeutung, rief es doch Erinnerungen in ihm wach, die er in seinem hasserfüllten Herzen sorgsam verschlossen hielt.
Eigentlich hatten wir uns alle geschworen, nach Beendigung unserer Ausbildung niemals wieder ein Wort darüber zu verlieren, doch der Einzige, der diesen Schwur immer wieder brach, war Hate selbst. Vermutlich, weil es ihn selbst zu stark belastete – und ich musste zugeben, dass das nicht ganz unbegründet war. Sein Impro-Training war sehr schlimm gewesen, wahrscheinlich sogar das schlimmste von allen. Bevor wir alle in unsere eigenen Wohnungen gezogen waren, hatte ich manchmal mitbekommen, dass er nachts aus seinen Albträumen hochschreckte und wie ein kleiner Junge zu weinen begann. Dann empfand ich tatsächlich so etwas wie Mitleid für ihn.
Doch keinem von uns ging es wirklich besser. Keines der Trainings war für den betreffenden Improba leicht gewesen, keiner wollte sich freiwillig daran erinnern.
Die Trainings waren an Perversion und Grausamkeit nicht zu überbieten, lediglich in der Art der Durchführung unterschieden sie sich. Doch sie hatten uns auch stark gemacht. Stark gegen das, was die Probas der Welt antaten …
Nur, dass wir hier alle im selben Boot saßen, schien Hate immer wieder zu vergessen. Und so ergötzte er sich, wann immer er die Möglichkeit dazu hatte, an den Quälereien, die wir eigentlich weit hinter uns lassen wollten.
»Was hast du gesagt?«, fuhr er mich an, doch ich zeigte ihm lässig den Mittelfinger.
»Fick dich«, wiederholte ich noch einmal eisig.
Hate machte ein paar Sätze auf mich zu und holte aus. Glücklicherweise machten ihn seine schweren Muskelpakete dementsprechend langsam, so dass ich schnell aufspringen und ausweichen konnte.
Doch plötzlich wurden mir von hinten die Arme auf den Rücken gedreht und ich konnte mich nicht mehr wehren.
Hate kam mit einem süffisanten Grinsen auf mich zu.
»Treason, du Judas!«, schrie ich und versuchte mich loszumachen, doch er hatte mich fest im Griff und lachte nur. Ihm als Verräter gefiel natürlich alles, was mit seinem Impro zu tun hatte, und dabei war ihm egal, ob es sich bei seinen Opfern um »Freunde« oder Fremde handelte.
Hate baute sich vor mir auf und schlug mir mit aller Kraft mehrfach in die Magengegend. Ich versuchte durch das Anspannen meiner Bauchmuskeln den Schmerz zu reduzieren, doch seine Schläge waren wie ein Dampfhammer. Stählern und kraftvoll.
»Was zum Teufel macht ihr Idioten da?«, dröhnte eine tiefe Stimme durch das ganze Wohnzimmer, und noch bevor wir unseren Oberst sehen konnten, taten wir alle so, als wäre nichts geschehen.
»Ihr sollt euch nicht gegenseitig angreifen, wie oft soll ich euch Trotteln das noch sagen! Hebt euch das für die Probas auf!«
»Sehr wohl, Oberst«, antworteten wir alle im Chor und jeder ging wieder seines Weges.
Unser Oberst hasste es, wenn wir uns stritten, gleichwohl das eigentlich an der Tagesordnung war. Bei uns galt: jeder gegen jeden. Doch genauso schnell, wie wir uns in den Haaren hatten, vertrugen wir uns auch wieder. – Wenn man das denn so nennen konnte. Ich bezeichnete es eher als einen kurzfristigen Waffenstillstand.