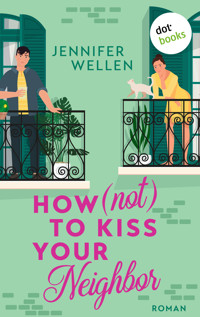
5,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Keine Zeit für die Liebe – aber für einen Nachbarschaftskrieg? Oh ja! Ein Blick in die Augen ihres neuen (und unverschämten) Nachbarn und Marie spürt ein seltsames Kribbeln im Bauch. Das kann nur allerhöchste Abneigung sein … Als Marie aus Versehen mit dem Fahrrad einen streunenden Kater anfährt, nimmt sie ihn kurzerhand bei sich auf. Schließlich weiß niemand, wo der kleine »Scruffy« hingehört. Auch der charmante Tierarzt Darius kann nicht weiterhelfen, aber immerhin ist er das genaue Gegenteil von Maries neuem Nachbarn – denn Nikolas ist ein Frauenheld, wie er im Buche steht und an Unreife kaum zu übertreffen. Denkt zumindest Marie, aber ausgerechnet Scruffy scheint ihren Männergeschmack nicht zu teilen: Immer wieder schleicht er sich auf den Balkon von Nikolas … der plötzlich auch noch zum Retter in der Not wird und Marie mit einem Kuss aus einer brenzligen Situation befreit. Ein Kuss, der ganz und gar nichts zu bedeuten hat! Witzig, sexy, clever – für alle Fans von Ali Hazelwood, Elena Armas und Beth O'Leary's »The Flatshare«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 300
Ähnliche
Über dieses Buch:
Als Marie aus Versehen mit dem Fahrrad einen streunenden Kater anfährt, nimmt sie ihn kurzerhand bei sich auf. Schließlich weiß niemand, wo der kleine »Scruffy« hingehört. Auch der charmante Tierarzt Darius kann nicht weiterhelfen, aber immerhin ist er das genaue Gegenteil von Maries neuem Nachbarn – denn Nikolas ist ein Frauenheld, wie er im Buche steht und an Unreife kaum zu übertreffen. Denkt zumindest Marie, aber ausgerechnet Scruffy scheint ihren Männergeschmack nicht zu teilen: Immer wieder schleicht er sich auf den Balkon von Nikolas … der plötzlich auch noch zum Retter in der Not wird und Marie mit einem Kuss aus einer brenzligen Situation befreit. Ein Kuss, der ganz und gar nichts zu bedeuten hat!
Über die Autorin:
Jennifer Wellen lebt mit ihrer Familie im Ruhrgebiet und arbeitet als Dozentin im Pflegebereich. Wenn sie neben ihrer Tochter, den drei Katzen und ihrem Hund noch Zeit findet, schreibt sie mit Begeisterung witzige Romane für Frauen, die wissen, wie das Leben spielt.
Die Autorin im Internet:
www.jenniferwellen.com
www.instagram.com/jenniferwellen_autorin/
Jennifer Wellens »Hollywell Hearts«-Reihe erscheint bei dotbooks im eBook und bei Saga Egmont als Printausgaben und Hörbücher:
»Hollywell Hearts – Die kleine Farm am Meer«
»Hollywell Hearts – Die Glückspension am Meer«
»Hollywell Hearts – Der Strickladen am Meer«
Ihr Roman »Drei Küsse für ein Cottage« erscheint bei dotbooks als eBook- und Printausgabe und bei Saga Egmont als Hörbuch.
Ihre »Schottische Herzen«-Trilogie ist bei dotbooks im eBook erhältlich und bei Saga Egmont im Hörbuch:
»Das Rosencottage am Meer«
»Das Veilchencottage am Meer«
»Das Magnoliencottage am Meer«
Bei dotbooks veröffentlichte Jennifer Wellen auch ihre Liebesromane »Honigkuchentage« und »Sternschnuppenwünsche«.
***
Aktualisierte eBook-Neuausgabe November 2024
Dieses Buch erschien bereits 2014 unter dem Titel »Katerfrühstück mit Aussicht« bei LYY, verlegt durch EGMONT Verlagsgesellschaften mbH.
Copyright © der Originalausgabe 2014 bei EGMONT Verlagsgesellschaften mbH
Copyright © der aktualisierten Neuausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock und © Adobe Stock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)
ISBN 978-3-98952-633-4
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Jennifer Wellen
How (not) to kiss your Neighbor
Roman
dotbooks.
Kapitel 1Was für ein Scheißtag
Wie genau ich in der Hecke gelandet bin, kann ich gar nicht sagen. Ich weiß nur, dieses blöde Katzenviech ist schuld daran. Es war einfach auf die Straße gehüpft.
Ächzend rappele ich mich hoch, sortiere meine Knochen und klopfe den Staub von meiner Jeans.
In Ordnung. Obwohl meine Beine zittern und das Herz hämmert, scheint bis auf mein schmerzendes, rechtes Knie alles an mir ganz geblieben zu sein. Anschließend greife ich zu meinem Fahrrad. Auf den ersten Blick erscheint auch daran alles funktionstüchtig. Glück im Unglück würde ich sagen.
Kurzerhand schwinge ich mich wieder auf den Sattel. Wird Zeit, dass ich endlich nach Hause komme, um diesen katastrophalen Tag zu beenden. Und dass der Tag eine einzige Katastrophe war, daran gibt es nun wirklich keinen Zweifel mehr. Gleich morgens habe ich ein wichtiges Experiment versaut, was mich drei Monate in meiner Doktorarbeit zurückwirft. Kurz darauf folgten ein heftiger Streit mit dem Chef, mehrere Excel-Dateien, die sich nicht öffnen ließen, und die Entdeckung des riesigen Tintenflecks in meinem Laborbuch. Aber der Salto mit dem Rad eben ist das i-Tüpfelchen auf meinem Lieblingssatz heute: Was für ein Scheißtag.
Ich setze meinen Fuß auf das Pedal und will mich eben mit dem anderen Bein abstoßen, als mein Blick auf zwei leuchtende Augen fällt, die unter einem geparkten Auto das Licht der Straßenlaterne reflektieren. Das ist sicher die Katze, der ich den ungewollten Freiflieger zu verdanken habe.
Blödes Vieh!
Doch schlagartig fühle ich den Anflug eines schlechten Gewissens. Immerhin war ich ziemlich flott unterwegs und in Gedanken bereits bei der Planung meines neuen Experiments. Wenn ich aufmerksamer gewesen wäre, hätte ich den Sturz vielleicht verhindern können.
Ich stoße einen Seufzer aus. Na gut. Vielleicht sollte ich mich vergewissern, dass es der Mieze ebenfalls gut geht. Das ist das Mindeste, was ich tun kann.
Behände steige ich vom Rad, schiebe es zur anderen Seite rüber und stelle es auf den Bürgersteig. Langsam nähere ich mich der Autoreihe am Straßenrand und gehe in die Hocke. Aha. Da hinten ist sie ja.
Ich stehe auf, laufe ein Stück weiter und lege mich vor einem roten Golf auf den Bauch. Der Unfallverursacher sitzt darunter.
»Miez, miez«, versuche ich die Katze anzulocken. Aber sosehr ich mich auch bemühe, das Vieh will einfach nicht hervorkommen. Zehn Minuten lang rede ich auf es ein und versichere ihm, dass ich, obwohl ich Biologin bin, keinesfalls vorhabe, es für illegale Tierversuche zu missbrauchen. Doch da könnte ich wohl genauso gut versuchen, Bakterien davon zu überzeugen, dass sie sich nicht teilen dürfen.
Schließlich gebe ich es auf, rapple mich hoch und laufe zurück zu meinem Rad. Wie hat Opa immer so schön gesagt? Wer nicht will, der hat schon. Und ich will jetzt endlich nach Hause.
Als ich entschlossen den Ständer meines Rades zurückklappe, höre ich ein leises Maunzen hinter mir. Ich blicke über die Schultern und sehe, wie die Katze unter dem Auto hervorkriecht. Sie macht einen Schritt in meine Richtung, bleibt kurz darauf aber abrupt wieder stehen. Anscheinend traut sie mir immer noch nicht über den Weg.
Stocksteif verharre ich in meiner Position. Minutenlang starren wir uns an.
Plötzlich schnellt Miezes verfilzter Schwanz in die Höhe, und sie läuft mit sieben Tippelschrittchen auf mich zu. Aber ihr Gang sieht merkwürdig aus. Irgendwie steif und asymmetrisch.
Ich überlege krampfhaft, was an dem Bild nicht stimmt, komme aber einfach nicht drauf. Im nächsten Augenblick plumpst es mir jedoch wie Hornhautzellen von den Glubschern - die Mieze tippelt nicht, sie humpelt.
Mit der Katze auf dem Arm laufe ich durch den Hausflur zu meiner Wohnung hoch. Kurzerhand habe ich mich dazu entschieden, die humpelnde Mieze mitzunehmen, da sie sonst womöglich Freiwild wäre. Außerdem fühle ich mich indirekt für ihre Verletzung verantwortlich, und es ist wohl besser, sie an jemanden zu übergeben, der sich damit auskennt - wie das Tierheim zum Beispiel. Vielleicht können die sogar ihren Besitzer ausfindig machen.
Ich steige die zehn Stufen zur ersten Etage hinauf. Die beiden Zungenakrobaten, die dort stehen, kann ich schon vom Eingang aus sehen. Sie lehnen so eng umschlungen im Türrahmen, dass nicht mal mehr eine menschliche Zelle zwischen sie passen würde. Seine Hände umfassen ihren üppigen Po, während sie seine dunkelblonden Haare zerwühlt. Leidenschaftlich küssen wäre eine untertriebene Beschreibung dessen, was die beiden da tun. Mandeln massieren trifft es sicher besser.
Typisch Nikolas! Der Kerl, der seine Zunge in den Hals der Sexbombe schiebt, ist mein Nachbar.
Wer sie ist? Keine Ahnung. Die Frauen geben sich hier die Klinke in die Hand. Allerdings nur, wenn sie aussehen wie Barbie. Also – das genaue Gegenteil von mir.
An sich könnte es mir egal sein, wenn die Wohnung meines Nachbarn und meine nicht direkt aneinandergrenzen würden und die Wände die Stärke von 120 Gramm schwerem Papier hätten. Ein paar Mal war ich sogar versucht, mir eine neue Bleibe zu suchen. Da aber meine jetzige nur einen Kilometer vom Uniklinikum entfernt und saugünstig ist, kommt ein Umzug nicht infrage. Ich habe nur ein Stipendium und bin sowieso immer knapp bei Kasse.
Ich laufe an den beiden Mundhöhlenakrobaten vorbei. Es ärgert mich tierisch, bereits im Hausflur mit Nikolas’ Frauengeschichten belästigt zu werden. »Siehst du, auch unter den Menschen gibt es welche, die kein Zuhause haben«, erkläre ich der Mieze auf meinem Arm unüberhörbar.
Die Stupida löst sich von meinem Nachbarn, und ich meine dabei sogar ein leises Schmatzgeräusch zu vernehmen. Ich bezeichne Nikolas’ Frauenbekanntschaften gern als Stupida vulgaris. »Vulgaris« bezieht sich auf die Häufung einer Gattung in einem bestimmten Areal – in diesem Fall natürlich Nikolas’ Appartement.
Kopfschüttelnd wende ich mich meiner Haustür zu und stecke den Schlüssel ins Schloss. Es hakt ein wenig, aber es gibt einen gewissen Drehpunkt, den ich mit viel Feingefühl meist problemlos finde.
»Was ist, Marie Kürie, bist du etwa neidisch?« Nikolas’ Bariton dröhnt durch den Hausflur und lässt mich zusammenzucken. Seine ärgerlichen Blicke durchbohren mich wie kleine, spitze Dolche.
In Ordnung. Ich habe ihn beim Knutschen gestört. Aber der Idiot soll zum Fummeln gefälligst in seine Wohnung gehen. »Sorry, Nikolausi. Ich wüsste nicht, worauf ich neidisch sein sollte«, gebe ich zurück, in der Hoffnung, dass er sich nun wieder seiner Stupida widmet. Vergeblich versuche ich den Schlüssel herumzudrehen.
Nikolas beobachtet mich.
»Nikki, ich muss nach Hause.« Seine Stupida drückt ihm einen letzten Kuss auf den Mund.
»In Ordnung, die Kopie von dem Bild schicke ich dir dann zu, ja?«
»Danke dir«, haucht die Stupida ihm zu und hüpft die zehn Stufen hinab. Ihr üppiger Busen Marke Doppel D wippt dabei im Takt.
Hektisch ruckle ich meinen Schlüssel hin und her. Dabei zähle ich in Gedanken die Anzahl der Versuche mit. Sechzehn, bevor er sich endlich umdrehen lässt. Zählen ist so eine dumme Angewohnheit von mir, die ich nicht lassen kann. Wenn ich aufgeregt bin, ist mein Tick ganz besonders ausgeprägt. Da zähle ich zur Not sogar Haare.
Nikolas betrachtet erst mich abschätzend, dann gleitet sein Blick weiter zu meinem Schützling. »Was hast du denn da für einen verfilzten Wischmopp auf dem Arm?«
Ich rolle mit den Augen. Sieht ganz so aus, als hätte Nikolas nicht vor, sich in seine eigenen vier Wände zurückzuziehen, jetzt da seine neueste Eroberung weg ist. Ich presse das zitternde Fellbündel an meine Brust, stoße die Tür zu meiner Wohnung auf und setze die Katze auf dem gekachelten Dielenboden ab. Pfötchen für Pfötchen tritt sie in mein Singlereich ein.
»Bist du etwa schon so einsam, dass du dir ein Vieh aus dem Gebüsch ziehen musst?«, ätzt mein Nachbar herablassend.
»Du weißt doch, Nikolausi: Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Felsbrocken werfen.«
Seine Augen verengen sich zu schmalen Schlitzen. »Und das soll heißen?«
»Dass Männer ihre Einsamkeit häufig mit wechselnden Beziehungen kompensieren.« Das habe ich zumindest mal in der InStyle gelesen.
An der Art, wie er seine Augen aufreißt, erkenne ich, dass ich voll ins Schwarze getroffen habe.
»Dann haben wir ja was gemeinsam, nicht Kürie?«
Jetzt bin ich baff. Mit einer Bestätigung hätte ich niemals gerechnet.
Ein paar Sekunden lang herrscht Schweigen, und wir beide taxieren uns mit hasserfüllten Blicken, bis das Licht im Hausflur erlischt.
Meine Hände tasten nach dem Schalter. Als ich ihn finde, drücke ich ihn, und die weiße Deckenleuchte vertreibt die Dunkelheit und sogar Nikolas, der gerade grußlos in seiner Wohnung verschwindet.
Als ich in die Küche komme, sitzt die Mieze auf der Anrichte und beschnuppert eine offene Packung Butterkekse. »Du hast Hunger, was?« Ich werfe einen Blick in den Kühlschrank und entdecke eine halb volle Packung Mortadella. Für einen Snack sollte das ausreichen. Während ich die Wurst in kleine Streifen schneide, muss ich aufpassen, dass ich der Katze nicht aus Versehen in Zunge oder Pfoten säble. Immer wieder versucht sie ein Stückchen zu klauen, obwohl ich mich echt bemühe, sie mit einem Arm auf Abstand zu halten.
Kaum steht der Teller mit den Häppchen vor ihr, dauert es nur zehn Sekunden, bis alles verschlungen ist. Als Nachschlag bekommt sie Milch, die mit rund achtzig Zungenschlägen pro Minute dorthin befördert wird, wo sich bereits die Mortadella befindet. Nachdem der Teller aussieht, als sei er frisch gespült, springt die Mieze von der Anrichte und humpelt zur Couch. Mit einem Satz hechtet sie auf die Sitzfläche, um sich in Ruhe die Pfötchen sauber zu lecken.
Insgesamt sieht das Tier eher schäbig aus, da hat Nikolas ausnahmsweise recht. Das Fell ist lang, knotig verfilzt und hat die Farbe von eingetrocknetem Schlamm. Das seltsam platte Gesicht zusammen mit den Unterkiefereckzähnen, die wie Strommasten aus dem Maul herausragen, erinnert mich an eine englische Bulldogge. Ehrlich gesagt ist die Mieze so hässlich, dass ich sie schon fast wieder süß finde. Insbesondere ihre Augen sind ein echter Hingucker. Sie sind nicht gelb oder grün wie bei den meisten Katzen, sondern himmelblau.
Als sich die Mieze mit abgespreizten Beinen das Fell unter dem Bauch schleckt, beantwortet sich auch die Frage nach dem Geschlecht – und ich muss meine erste Vermutung revidieren.
Im Anschluss an den artistischen Putzakt rollt sich der Kater wie ein Kringel Fleischwurst zusammen. Mir scheint, er will pennen, was ich selbst eine ziemlich gute Idee finde.
Deshalb verschwinde ich kurz ins Bad. Im Spiegel sehe ich drei rote Kratzer auf meinen Armen sowie einen ziemlich hässlichen Bluterguss am Knie. Na ja, hätte schlimmer kommen können. Bettfertig schleppe ich mich ins Schlafzimmer und lasse mich seufzend in die Kissen fallen.
Seit einer Stunde schallen von nebenan diverse Hardrockklänge herüber. Nicht laut, aber laut genug, um zu verhindern, dass ich einschlafen kann. Der Störenfried ist mal wieder Nikolas, der Blödmann. Wer sonst?
Ich schnelle im Bett hoch. Meine Decke rutscht herunter, und der Lattenrost meines Futons ächzt unter der plötzlichen Gewichtsverlagerung. Mit geballten Fäusten hämmere ich dreimal gegen die Wand. »Mach endlich die Musik leiser, du Spinner.«
Was ich dann höre, lässt meine Wut explosionsartig ansteigen. Nikolas hat die Musik lauter gedreht!
Ich hasse laute Musik.
Ich hasse Hardrock.
Ach, was sage ich da? Ich hasse meinen Nachbarn.
»Du blöder Arsch!«, schreie ich und greife zu meinem Kopfkissen, um es mir auf die Ohren zu pressen.
Das Kissen schluckt zwar die Musik, aber einschlafen kann ich so trotzdem nicht. Deshalb nehme ich mein Bettzeug und wandere auf die Couch, von der der schnarchende Kater die Hälfte beansprucht. Ich bin froh, wie tiefenentspannt er hier liegt, obwohl er fremd ist. Seufzend schalte ich den Fernseher ein und zappe durchs Programm. Bei einer Doku auf BBC, über das Leben eines Künstlers auf einer einsamen Insel, bleibe ich hängen. Könnte mein Nachbar nicht einfach auch auf eine einsame Insel auswandern?
Irgendwann muss ich dann wohl doch eingeschlafen sein, denn als ich wach werde, steht der Kater vor der Balkontür und jammert. Im ersten Moment bin ich verwirrt, frage mich ganz kurz sogar, wie er in meine Wohnung gekommen ist. Aber dann erinnere ich mich an jedes einzelne Detail des gestrigen Scheißtages. Hoffentlich läuft es heute besser.
Ich stehe auf, lasse den Kater raus auf den Balkon, koche mir einen Kaffee und hüpfe unter die Dusche. Weil ich bei meinem Umzug vom Schlaf- ins Wohnzimmer meinen Wecker vergessen habe, bin ich ziemlich spät dran, zumal ich mir vorgenommen habe, das Vieh noch vor der Arbeit wegzubringen. Das Albert-Schweizer-Tierheim befindet sich in Altenessen an der Grillostraße, was zu weit weg ist, um mit dem Rad hinzufahren. Außerdem wüsste ich ohnehin nicht, wie ich den Kater darauf transportieren sollte. Da ich kein Auto habe, bleiben also nur Bus und Bahn übrig. Weil ich in jedem Falle später als sonst auf der Arbeit erscheinen werde, sollte ich den Chef vorab informieren. Deshalb wähle ich die Durchwahl vom Labor.
Nach dem zweiten Klingeln nimmt jemand ab. »Deiters?«
»Hey, Soni, ich bin’s.«
Soni, beziehungsweise Sonja, ist meine Arbeitskollegin. Wir beide mühen uns in der Neurologie der Essener Uni mit dem Streben nach den zwei magischen Buchstaben des Doktortitels ab. Wir sind in derselben Arbeitsgruppe und haben uns inzwischen auch privat angefreundet.
»Ich wollte dir nur sagen, dass ich heute etwas später komme.« Mir fällt ein, dass ich noch eine geeignete Transportmöglichkeit für den Kater brauche. Mit Sonja am Ohr laufe ich ins Schlafzimmer, um etwas Passendes zu suchen. Mein Schlafzimmerschrank ist eine wahre Fundgrube. Da ich nur diesen einen Schrank besitze, stopfe ich beim Aufräumen alles hinein.
»Wieso, was ist los?« Soni klingt besorgt.
»Mir ist gestern Abend ein Kater zugelaufen. Ich bringe ihn jetzt schnell noch ins Tierheim!« In den unergründlichen Tiefen meines Schranks wühle ich mich durch Klamottenberge und Schuhe, den Rest mag ich gar nicht nennen, und werde fündig. Na wer sagt’s denn? Ein Karton. Letzten Monat habe ich mir doch einen neuen Drucker gekauft. »Kannst du dem Chef Bescheid sagen?« Ich trage die Kiste ins Badezimmer und lege eines der Handtücher hinein, die neben dem Waschbecken hängen.
»Kein Problem, aber der ist eh noch auf Visite.«
Unser Vorgesetzter, Professor Hagedorn, ist der Leiter der Neurologischen Klinik. Er legt großen Wert auf Pünktlichkeit. Und da ich als Doktorandin von seiner Gunst abhängig bin, will ich ihn nur ungern verärgern, zumal ich ja gestern erst Stress mit ihm hatte. »Falls er nach mir fragt, sag einfach, ich bin kurz beim Dekanat.«
»Klar, mach ich. Also, hau rein.«
Kurz darauf höre ich ein Knacken in der Leitung. Sonja hat aufgelegt. Eine Eigenschaft, die ich an ihr liebe - sie quatscht nicht viel.
Ich nehme den Karton mit dem Handtuch und begebe mich auf den Balkon, wo der Kater zuletzt auf einem meiner Bistrostühle gesessen hat. Jetzt ist er allerdings nicht mehr dort. Ich sehe mich um. Ob er vielleicht vom Balkon runtergesprungen ist? Ich verwerfe den Gedanken gleich wieder. Mit seinem verletzten Bein wird er das nicht tun. Wahrscheinlich ist er zurück in die Wohnung gegangen.
Ich kehre ins Wohnzimmer zurück und rufe nach ihm. Der Kater lässt sich jedoch nicht blicken, geschweige denn etwas von sich hören. Er ist weder unter dem Bett noch in der Küche und auch nicht im Bad.
Zum Schluss werfe ich noch einmal einen letzten, verzweifelten Blick auf den Balkon. Vielleicht habe ich ihn in der Eile übersehen, so groß ist er ja auch nicht … Und tatsächlich! Einen Moment lang halte ich die Luft an. Der dreiste Kater hockt auf dem Balkon der Wohnung nebenan. Er hat es sich auf einem der vier schicken Rattanstühle dort gemütlich gemacht und lässt sich die Sonne auf den Pelz scheinen.
Warum muss dieses blöde Vieh ausgerechnet auf den benachbarten Balkon hüpfen? Der gehört nämlich dem Sexgott. Streit ist zwangsläufig vorprogrammiert, wenn Nikolas meinen Wischmopp in seinen geheiligten Gefilden findet. Unsere Balkongeländer sind nur circa dreißig Zentimeter voneinander entfernt. Nikolas und ich wohnen also nicht nur Tür an Tür, sondern auch Balkon an Balkon. Während meiner jedoch nach unaufgeräumter Besenkammer aussieht, gleicht der von Nikolas einer von Tine Wittler höchstpersönlich liebevoll kreierten Sommeroase. Und genau in dieser Landschaft aus teuren Möbeln und exotischen Pflanzen räkelt sich das schmuddelige Vieh auf den sandfarbenen Stuhlauflagen.
»Kater, hierhin!«, zische ich. Den Karton werfe ich auf den Bistrotisch neben mir. Ich beuge mich über die Brüstung aus verschnörkeltem, schwarzem Metallgitter. Aber meine Arme sind zu kurz. Ich reiche nicht bis an den Rattanstuhl mit dem Kater heran. Zu allem Überfluss kratzt das Mistvieh jetzt auch noch mit seinen Krallen am dunkelbraunen Korbgeflecht.
»Verdammt, lass das.« Obwohl der Abstand zwischen den Balkonen für einen ausgewachsenen Kater sicher ein Kinderspiel ist, wäre ich niemals auf die Idee gekommen, dass er über die Brüstung hüpfen könnte. Aber was weiß ich schon, wie so ein Tier tickt? Sonst arbeite ich schließlich nur mit Mikroorganismen oder lebenden Zellen.
»Los! Komm endlich hier hin!« Meine Stimme klingt nun um einiges wütender.
Der Kater steht auf, macht einen Buckel und streckt sich. Dabei schaut er gähnend zu mir herüber, bevor er langsam seine Krallen in die Stuhlauflagen bohrt.
Mich durchzuckt es. Selbst von hier aus kann ich die acht kleinen Löcher sehen, die er im Baumwollstoff hinterlässt. Auweia.
Nachdem sich der Kater ausgiebig gedehnt hat, springt er vom Stuhl herunter. Er läuft auf mich zu, macht einen Satz und hockt, mit dem Schwanz um Gleichgewicht ringend, auf Nikolas’ Geländer. Mit einem zweiten Sprung landet er elegant neben mir.
Ich atme auf und packe ihn am Nackenfell, um ihn ordentlich durchzuschütteln. »Hör mal, Stinker, da drüben hast du nichts zu suchen. Okay?« Allerdings wundert es mich, wie gut er mit seinem lädierten Bein hüpfen kann. Ob die Verletzung gar nicht so schlimm ist? Na, mal sehen, was die Leute im Tierheim dazu sagen. Ich hieve den Kater in den Druckerkarton. Der Missetäter wehrt sich nicht einmal.
Gerade als ich meine Balkontüre schließe, wird nebenan die Tür geöffnet. Glück gehabt, das war keine Millisekunde zu früh. Vorsichtig ziehe ich meine Gardine vor und riskiere einen Blick hindurch.
Mein Nachbar tritt mit einem Kaffeebecher in der Hand nach draußen. Seine Haare sind verwuschelt. Außerdem trägt er lediglich Boxershorts und ein T-Shirt, was mich annehmen lässt, dass er eben erst aus dem Bett gekrabbelt ist. Zugegeben, Nikolas ist schon ein attraktives Kerlchen. Selbst im morgendlich zerknitterten Zustand. Sonst würde er vermutlich nicht immer so viele Frauen abschleppen. Die Figur ist schlank, durchtrainiert, mit Muskeln an genau den richtigen Stellen. Aber da er nicht nur ein Frauenheld ist, sondern auch charakterlich ein völliger Fehlgriff, nützt einem die hübsche Verpackung nichts. Welche Frau kauft schon einen schönen Schuh, wenn sie darin nicht laufen kann?
Ein klägliches Miauen aus dem Karton reißt mich aus meinen Gedanken. Den kleinen Unruhestifter habe ich darüber beinahe glatt vergessen. Wird Zeit, dass ich ihn endlich loswerde.
Kapitel 2The day after
»Er ist weder gechipt noch tätowiert, und ein Halsband hat er auch nicht um. Aber er ist kastriert«, erklärt mir die Angestellte des Tierheims Frau Sowieso. Frau Sowieso heißt nicht wirklich so, nur habe ich mir ihren Namen nicht merken können.
Sie greift zu einem Formular in einer Ablage. »Vermutlich wurde er ausgesetzt.«
Vor einer Stunde bin ich mit der Bahn zum Tierheim gefahren, um meinen Findling dort abzugeben. Alles in allem eine anstrengende Tour. Der Druckerkarton war unhandlich und der Kater durch sein ständiges Maunzen nervig. Jetzt stehe ich in einem Behandlungsraum. Neben mir auf dem Tisch hockt der Jammerlappen.
»Wir müssen ihn als Fundtier melden, da sonst rechtliche Probleme entstehen.« Frau Sowiesos Kugelschreiber fliegt mit Überschallgeschwindigkeit über die zwölf Zeilen des Formulars. Sicher kann sie es sogar mit verbundenen Augen ausfüllen.
»Rechtliche Probleme?«, hake ich nach.
Der Kater robbt näher an mich heran und legt ein Pfötchen auf meinen Arm.
»Wenn das Fundtier ordentlich gemeldet wurde, hat der Besitzer ein halbes Jahr Anspruch. Danach verliert er ihn und wir können den Kater vermitteln.« Während Frau Sowieso mir die Sachlage erklärt, füllt sie nebenbei die restlichen Zeilen aus. »Halten wir uns nicht an die Vorschriften, kann der Besitzer jederzeit sein Recht einfordern.« Sie schiebt mir den rosa Wisch zu. »Mit ihrer Unterschrift bestätigen Sie, wo und wann Sie das Tier aufgefunden haben.«
Ohne den Zettel genauer anzusehen, setze ich meinen Friedrich-Wilhelm darunter.
»Sobald sich ein Besitzer gefunden hat, werden wir uns bei Ihnen melden.«
»Das ist nett von Ihnen. Aber warum bei mir?«
Der Gesichtsausdruck von Frau Sowieso wechselt von freundlich-aufmunternd zu erstaunt-fragend. »Wollen sie den Kater denn nicht mitnehmen?«
»Äh, eigentlich nein!« Wie kommt die Frau bloß auf die Idee, dass ich dieses Fellbündel behalten will? Warum sonst wäre ich wohl hier, wenn nicht, um ihn loszuwerden?
»Manche Leute erklären sich bereit, das Tier vorübergehend in Pflege zu nehmen. Wir sind ziemlich überfüllt, müssen Sie wissen. Aber wenn Sie natürlich nicht möchten …«
Selbst ich, ein Mensch, der das Zwischen-den-Zeilen-Lesen nicht beherrscht, höre den vorwurfsvollen Unterton heraus. Aber das ist mir egal. Das Vieh gehört nicht mir und damit basta.
Frau Sowieso steht vom Drehhocker auf und öffnet den schmalen Schrank hinter sich. Darin kann ich jede Menge Zubehörartikel sehen. Sie greift zu einem grauen Plastikkorb, der am Boden der Schranks steht, und hebt ihn auf den Tisch. Der Korb hat seitlich acht schmale Lüftungsschlitze und ist nach vorne durch ein schwarzes Gittertürchen begrenzt. Geschickt öffnet sie die zwei rechten Schrauben, woraufhin das Gitter seitlich aufschwingt. Nachdem das geschafft ist, packt sie den Kater am Nackenfell und zieht ihn ruckartig über den Tisch.
Im ersten Moment scheint der Gute perplex, doch kurz darauf höre ich, wie seine Krallen über die glatte Oberfläche des Tisches schrappen. Direkt vor dem Korb stemmt der Kater mit aller Kraft seine vier Pfoten gegen das Türchen und faucht.
Ich bin überrascht von dem ganzen Szenario, halte sogar für einige Sekunden die Luft an.
»Na, komm schon, ich will dir nicht wehtun.«
Der Kater versucht, Frau Sowieso in die Hand zu beißen. Die Geräusche, die er dabei macht, sind vergleichbar mit dem schrillen Kreischen einer Kreissäge.
Wenn ich ehrlich bin, würde ich der Frau das Tier am liebsten aus der Hand reißen und abhauen. Aber dann hätte ich es ja an der Backe. Und genau das will ich nun mal nicht.
Als er mit seinen Hinterpfötchen an dem nackten Unterarm der Frau kratzt und sie ihn erschrocken loslässt, freue ich mich. Geschieht ihr recht.
Der Kater kommt zu mir, kuschelt sich an mich und maunzt. Ich nehme ihn auf den Arm und fühle sein Herzchen pochen.
»Vielleicht versuchen Sie ihn mal in den Transportkorb zu setzen, ich glaube zu Ihnen hat er Vertrauen«, schlägt Frau Sowieso resigniert vor und schiebt mir das wenig einladende Ding rüber.
Für einen Moment zögere ich. Ich bin unsicher, ob ich hier wirklich das Richtige tue. Aber mit nach Hause nehmen kann ich den Kater nicht. Ich bin den ganzen Tag aus dem Haus. Manchmal bis zu zwölf Stunden. Freigang könnte ich ihm wegen der ersten Etage auch nicht gewähren, und ob ich in meiner Wohnung Haustiere halten darf, ist ebenfalls nicht sicher.
Ich setze den Kater auf dem Tisch ab und greife beherzt zu dem Plastikkorb. Mit einem sanften Schubs zeige ich dem Kater die richtige Richtung. Er humpelt mit drei Schritten in das Körbchen, ohne einen einzigen Laut von sich zu geben.
Bevor ich mich von ihm verabschieden kann, schlägt Frau Sowieso mir das Türchen vor der Nase zu und verriegelt es. Sollte das Tierheim mal dichtmachen, könnte sie sicher auch gut als Schließerin in einer JVA arbeiten.
Frau Sowieso trägt den Korb aus dem Raum, und ich kann im Vorbeigehen einen letzten Blick aus blauen Katzenaugen erhaschen. Eindeutig identifizieren, ob dieser nun traurig oder vorwurfsvoll ist, kann ich jedoch nicht. Mit einem Schlag setzt das schlechte Gewissen ein. Ich fühle mich wie eine Verräterin, wie die böse Biologin, die Bakterien echten Lebewesen vorzieht. Doch mein Verstand gewinnt die Oberhand über mein Herz.
Kurze Zeit später kehrt Frau Sowieso mit leeren Händen zurück.
Mir brennt noch eine letzte Frage auf der Seele. »Was passiert denn jetzt mit ihm?«
»Der Kater kommt auf die Quarantänestation. Dort wird er geimpft, entwurmt und gechipt. Erst dann werden wir ihn ins Katzenhaus lassen«, antwortet sie knapp.
Diese Informationen beruhigen mich nicht im Geringsten. »Und wie sehen Sie seine Chancen, vermittelt zu werden?«
Frau Sowieso greift zu einem Desinfektionsmittel, um den Tisch damit einzusprühen. »Soll ich ehrlich zu Ihnen sein?« Mit einem Lappen wischt sie die zerkratzte Oberfläche wieder trocken.
»Klar. Sonst würde ich wohl kaum fragen, oder?« Hat sie etwa wirklich erwartet, ich würde Nein sagen?
»Die meisten Leute schauen mehr nach Katzenkindern.« Sie legt den Lappen beiseite und wäscht sich die Hände. »Und wenn sie sich für einen erwachsenen Kater entschließen, dann eher für ein schöneres Tier.«
Für einen Moment stehe ich auf der Leitung. »Soll das etwa heißen, der Kater ist hässlich?«
Frau Sowieso sieht mich mit einem entschuldigenden Blick an. »Ihrer hat diesen Unterbiss und das unschöne Fell …« Die restlichen Worte schweben ungesagt im Raum.
Die Tierheimtante wird mir von Minute zu Minute unsympathischer. Erst der rüde Umgang mit dem Kater - und jetzt das. Sicher gibt es noch Unattraktivere als meinen. »Werden Sie wenigstens versuchen, den alten Besitzer ausfindig zu machen?«
Frau Sowieso schüttelt den Kopf und trocknet ihre Hände ab. »Wenn sich der Besitzer nicht gerade hier meldet, weil er ihn sucht, haben wir kaum eine Chance zu erfahren, wo der Kater herkommt.«
Sie reicht mir den Durchschlag des Formulars.
»Danke, dass Sie ihn vorbeigebracht haben. Nicht jeder Mensch ist so verantwortungsbewusst wie Sie.«
Ich nehme das Papier und interpretiere ihren letzten Satz als höflichen Rausschmiss. Und auch wenn immer noch das schlechte Gewissen an mir nagt, gibt es für mich tatsächlich nichts mehr zu tun. Stattdessen sollte ich endlich zur Arbeit fahren. Ohne ein weiteres Wort flüchte ich aus dem Behandlungsraum.
Der Weg Richtung Ausgang führt mich am Katzenhaus vorbei. Durch die Glasscheibe kann ich die Tiere sehen. Ich zähle sie durch. Sechsundzwanzig. Zusammengepfercht sitzen sie in Körbchen oder auf Kratzbäumen, und unten rechts liegt in einer Holzkiste eine Mutter mit vier Kindern. Ziemlich harte Konkurrenz für den Kater, wenn es stimmt, was Frau Sowieso gesagt hat.
Ich zwinge mich, weiterzulaufen und daran zu denken, dass es dem Kater hier gut gehen wird. Zumindest besser, als allein bei mir zu Hause. »Tschüss«, verabschiede ich mich an der Rezeption knapp. Draußen vor der Tür atme ich tief durch. Verdammt. Niemals hätte ich gedacht, dass es mir so schwerfallen würde, den Kater hierzulassen. Der letzte Blick, den er mir durch das Gittertürchen zugeworfen hat, will mich nicht mehr loslassen, egal, wohin ich blicke.
Arbeit. Genau. Arbeit wäre jetzt sicher eine gute Abwechslung. Sie wird mich auf andere Gedanken bringen. Aber ob ich mich überhaupt auf meine Experimente werde konzentrieren können? Egal. Alles ist in diesem Moment besser, als an den Kater zu denken.
Mein Handy vibriert, und ich hole es aus dem Rucksack. Sicher Sonja, die wissen will, wo ich bleibe. Recht hat sie, ich hätte schon längst im Labor sein sollen. Aber ein Blick auf das Display reicht aus, um meinen Magen innerhalb von Sekunden auf Erbsengröße zusammenschrumpfen zu lassen. Es ist nicht Sonja. Stattdessen steht dort Neue Nachricht von Mike.
Mike ist mein Exfreund, mein Exverlobter, um genau zu sein. Umgehend stellt sich mir die Frage, was er will. Schon seit zwei Jahren habe ich nichts mehr von ihm gehört. Zumindest nicht persönlich. Was will er also jetzt von mir?
Neue Nachricht von Mike. Zwanzig Zeichen, die mir gerade vorkommen wie die Büchse der Pandora. Soll ich sie wirklich öffnen? Vielleicht wäre es besser, die Nachricht einfach ungelesen zu löschen. Die Entlobung damals hat mich ziemlich aus der Bahn geworfen.
Mit zitternden Händen drücke ich schließlich doch auf den Button Nachricht lesen.
Vielleicht ist es ja wichtig.
Vielleicht will er hören, wie es mir geht.
Vielleicht will er sich sogar bei mir entschuldigen.
Aufgeregt starre ich auf die geschriebenen Zeichen und lese: Stell dir vor, ich werde mich verloben.
Wieder krampft sich mein Magen zusammen.
Mit Anna.
Ich krümme mich vor Schmerz.
Deswegen brauche ich den Ring zurück.
Tränen schießen mir in die Augen. Ein erstickter Laut entrinnt meiner Kehle. Dieser Dreckskerl. Noch nicht einmal ein Hallo wie geht es dir? oder Was machst du so? bin ich ihm wert. Enttäuscht lese ich den Rest der Nachricht, obwohl ich mir denken kann, was jetzt folgt.
Wann kann ich ihn mir abholen kommen?
Meine Finger haben sich um das Telefon gekrampft, sodass meine Knöchel weiß hervortreten. Der Ring. Es geht ihm einzig und allein um diesen blöden Ring. Ich schlucke und schlucke, aber der Kloß in meinem Hals will einfach nicht herunterrutschen. Am liebsten würde ich auf der Stelle losflennen, aber hier vor dem Tierheim herrscht reger Publikumsverkehr. Also versuche ich mich zu beruhigen, die Tränen zu verdrängen und meine wirren Gedanken zu sortieren.
Ich zähle eine Zeit lang die Autos, die am Tierheim vorbeifahren. Bei dreiundvierzig ebbt der Schmerz im Inneren langsam etwas ab.
Mit allem habe ich gerechnet, nur nicht damit. Unsere Verlobung hat er damals gelöst, weil er angeblich nicht »reif« für die Ehe war. Jetzt will er sich mit meiner ehemaligen Studienkollegin verloben. Also von wegen, nicht reif für die Ehe … Bis heute bereue ich es, Anna an der Uni kennengelernt und Mike überhaupt vorgestellt zu haben. Außerdem frage ich mich immer noch, wie mir entgehen konnte, dass sie hinter meinem Rücken mit meinem Verlobten angebandelt hatte. Den Ring verbannte ich damals in mein Schmuckdöschen. Eigentlich wollte ich ihn Mike wiedergeben, weil er seiner Großmutter gehört hatte. Aber ich habe mich nie überwinden können, meinem Ex gegenüberzutreten.
Alles ist besser, als an den Kater zu denken? Nein! Alles ist besser, als an Mike zu denken. Während er sich verlobt hat, fühle ich mich einsamer als je zuvor. Fünf Jahre meines Lebens habe ich in diesen Betrüger investiert. Und wofür? Um am Ende wieder alleine dazustehen.
Plötzlich kommt mir ein Gedanke. Vermutlich fühlt sich der Kater gerade genauso im Stich gelassen wie ich damals. Immerhin habe ich ihn auch abgeschoben.
Auf der Stelle mache ich kehrt und marschiere wieder ins Tierheim. Vorne an der Pforte steht Frau Sowieso neben einem gut aussehenden Kerl in grüner OP-Kleidung. Als sie mich bemerkt, sehe ich Fragezeichen in ihren Augen aufpoppen. Noch bevor sie etwas sagen kann, sprudle ich schon los. »Bis sich sein eigentlicher Besitzer gefunden hat, möchte ich den Kater doch in Pflege nehmen. Können Sie ihn mir bitte einpacken?«
»So, so, sie heißen Marie Kürie?«, sagt der Tierarzt und zwinkert mir zu.
Eigentlich gefiel er mir auf Anhieb. Groß, schlank, attraktiv und ein äußerst sympathisches Lächeln. Soni würde sagen: ein echtes Sahneschnittchen. Aber jetzt, da er meinen Namen genau wie alle anderen verhunzt, sinkt er in meiner Beurteilungsskala von der Höchstnote zehn auf fünf nach unten.
Frau Sowieso hat mich vorhin an ihn verwiesen, damit er sich das verletzte Bein des Katers anschaut.
»Kurie. Mit ›u‹ und nicht mit ›ü‹. Außerdem bin ich Biologin und nicht Physikerin.«
Die zwölf Worte kommen wütender aus mir heraus, als ich es ursprünglich beabsichtigt habe. Aber auf diesen Vergleich reagiere ich allergisch. Jeder Zweite kommt mir mit diesem blöden Kürie - und das nervt. Weder heiße ich Kürie, noch bin ich mit Marie Curie verwandt. Wieder ein Grund für mich, eine feste Beziehung anzustreben. Wenn ich heirate, werde ich auf jeden Fall diesen bescheuerten Namen ablegen.
Überrascht über meinen Zornesausbruch sieht mich Dr. Wildner, so heißt der Tierarzt, an. Wildner klingt wesentlich besser als Kurie. »Oh Entschuldigung, ich wusste nicht, dass Sie das mit dem Namen derart stört.«
In Ordnung, vielleicht ist er nicht ganz so übel. Zumindest ist Dr. Wildner einer von denen, die sich bei mir entschuldigen.
»Schon gut«, wiegle ich ab. »Können wir uns jetzt um den Kater kümmern? Ich muss gleich arbeiten.«
Der Tierarzt wendet sich dem Tragekorb auf dem Tisch zu. Er öffnet das schwarze Türchen. Sofort kommt mein Pflegekind rausgeschossen und springt mir in die Arme.
»Sie haben ihn gefunden?« Wildner mustert mich.
»Nein. Ich habe ihn mit dem Rad angefahren. Er humpelt hinten rechts.« Ich drücke den Kater beschützend an mich, doch der Doc nimmt ihn mir ab und setzt ihn auf den Tisch zurück. Zuerst schaut er dem Kater in die Augen, tastet an seinem Bauch herum und hört ihn mit einem Stethoskop ab. Danach befühlt er das Bein und dehnt es. Von vorne nach hinten, von rechts nach links, von oben nach unten. Es sieht aus, als wolle er einen gordischen Knoten hineinmachen, wisse nur nicht wie.
Der Kater gibt keinen einzigen Mucks von sich.
Als Wildner ihn das Bein auf den Tisch setzen lässt, sehe ich eine seltsame Zehenspitzenhaltung.
»Vermutlich ist es ein falsch zusammengewachsener Bruch. Aber erst wenn wir das Bein geröntgt haben, kann ich das mit Sicherheit sagen. Schmerzen hat der Kater jedenfalls keine, und gesund scheint er auch zu sein«, erklärt mir Doktor Wildner.
»Ein alter Bruch?« Ich bin irritiert. »Das kann dann aber nicht von mir sein, oder?«
»Wahrscheinlich nicht.«
Erleichtert atme ich auf und tätschele dreimal liebevoll den verfilzten Katerhintern.





























