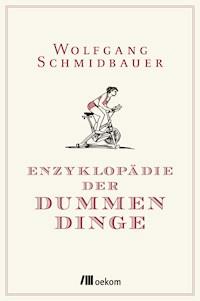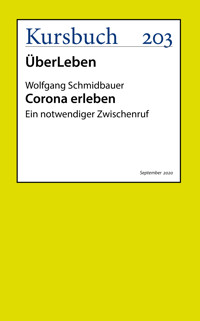9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die seelischen Folgelasten in den Kriegs- und Nachkriegsgenerationen sind das Thema des prominenten Gesellschafts- und Psychoanalytikers Wolfgang Schmidbauer. Im geschützten Raum der Therapie hört und beobachtet er den Nachhall jener verheerenden Gewaltexplosionen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, an denen Millionen von Menschen gelitten haben. An ihren Folgen tragen auch ihre Kinder und Enkel noch heute. Auf extreme Belastungen – an der Front, auf der Flucht, im KZ – reagieren Erwachsene durch «psychische Zentralisation». Mit diesem Begriff faßt Schmidbauer die seelischen Folgen für Menschen, deren normaler Reizschutz längere Zeit überfordert wird. Ihre Phantasie- und Gefühlstätigkeit wird eingeschränkt auf das lebensnotwendige Minimum. Die Anstrengungsbereitschaft und das Interesse für alles, was nicht mit dem unmittelbaren physischen Überleben zu tun hat, nehmen ab. Vergangenheit und Zukunft werden belanglos. Im Krieg ist chronische Traumatisierung die Regel. Posttraumatisch führt die Zentralisation zu seelischen Verhärtungen, die verhindern sollen, daß schmerzhafte Erlebnisse das Ich erneut überschwemmen. Wolfgang Schmidbauer beginnt mit zwei erschütternden Fallgeschichten aus seiner Praxis. Er diskutiert daran die verschiedenen psychischen Deformationen durch Traumatisierung im Krieg und ihre oft rätselhaft verschlüsselten Folgen für die Nachkommen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 340
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Wolfgang Schmidbauer
«Ich wußte nie, was mit Vater ist»
Das Trauma des Krieges
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Die seelischen Folgelasten in den Kriegs- und Nachkriegsgenerationen sind das Thema des prominenten Gesellschafts- und Psychoanalytikers Wolfgang Schmidbauer. Im geschützten Raum der Therapie hört und beobachtet er den Nachhall jener verheerenden Gewaltexplosionen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, an denen Millionen von Menschen gelitten haben. An ihren Folgen tragen auch ihre Kinder und Enkel noch heute.
Auf extreme Belastungen – an der Front, auf der Flucht, im KZ – reagieren Erwachsene durch «psychische Zentralisation». Mit diesem Begriff faßt Schmidbauer die seelischen Folgen für Menschen, deren normaler Reizschutz längere Zeit überfordert wird. Ihre Phantasie- und Gefühlstätigkeit wird eingeschränkt auf das lebensnotwendige Minimum. Die Anstrengungsbereitschaft und das Interesse für alles, was nicht mit dem unmittelbaren physischen Überleben zu tun hat, nehmen ab. Vergangenheit und Zukunft werden belanglos.
Im Krieg ist chronische Traumatisierung die Regel. Posttraumatisch führt die Zentralisation zu seelischen Verhärtungen, die verhindern sollen, daß schmerzhafte Erlebnisse das Ich erneut überschwemmen.
Wolfgang Schmidbauer beginnt mit zwei erschütternden Fallgeschichten aus seiner Praxis. Er diskutiert daran die verschiedenen psychischen Deformationen durch Traumatisierung im Krieg und ihre oft rätselhaft verschlüsselten Folgen für die Nachkommen.
Über Wolfgang Schmidbauer
Wolfgang Schmidbauer, geboren 1941 in München, studierte Psychologie und promovierte 1968 über «Mythos und Psychologie». Tätigkeit als freier Schriftsteller in Deutschland und Italien. Ausbildung zum Psychoanalytiker. Gründung eines Instituts für analytische Gruppendynamik. Psychotherapeut und Lehranalytiker in München.
Inhaltsübersicht
Für Gudrun
1 Einleitung: Traumatisierte Eltern und die «zweite Generation»
Der Krieg ist der Vater
aller Dinge.
Heraklit (550–480)
Als Gymnasiast lernte ich einen griechischen Satz kennen, ein Beispiel für die Aussagen der Vorsokratiker, die nach der Wurzel des Seins suchten und Ur-Elemente beschrieben: das Wasser, die Erde, das Feuer. Heraklit nannte den Krieg. Es schien mir übertrieben und doch eindrucksvoll, die Kraft der Zerstörung als Zeugungsmacht anzusehen, und es ist ein Zeichen für die Beharrlichkeit dieser früh erworbenen Fragmente, daß ich jetzt diesen Satz einer Untersuchung voranstelle, die sich mit der Verarbeitung von Geschichte im Alltag befaßt.
Vielleicht prägte sich mir die Verbindung von Vater und Krieg ein, weil mein eigener Vater als Soldat gefallen war. Ich nahm das als kleines Kind ohne bewußte Trauer zur Kenntnis, mit jenem Respekt vor Tatsachen, den Kinder haben. Die Fotografie eines lächelnden Mannes mit schmalen Lippen und Achselstücken stand immer auf dem Schrank im Wohnzimmer. Das war mein Vater, und ich bemühte mich manchmal, durch angestrengtes Starren auf das Bild eine mimische Reaktion zu erhalten, wie mein Bruder und ich es vor dem Einschlafen bei der Goethebüste auf dem Bücherschrank versucht hatten, die bald grämlich, bald heiter auf uns herabzublicken schien.
Wir waren in München ausgebombt worden. Seit 1944 standen unsere Gitterbetten – meines und das eines zwei Jahre älteren, 1939 geborenen Bruders – in der Bibliothek des Großvaters in Passau. Die Goethebüste aus weißem Alabaster hob sich von den bronzenen Nachgüssen etruskischer Krüge ab, die auf einem schwarzen Schrank gruppiert waren.
Wir sagten «He, Kröte-Goethe», und er verzog voller Vorwurf den Mund. Solches Sakrileg hätten wir bei unserem Vater nicht gewagt. Es gab keinen Schatten, der auf ihn fiel. Mit einer verworrenen Klugheit überlegte ich öfter, daß ein wirklicher Vater, gemessen an diesem idealen, doch auch Nachteile gehabt hätte, denn es war gewiß schwerer, mit zweien dieser uneinsichtigen Erwachsenen umzugehen als mit nur einer, meiner Mutter, die ich rasch als letzte Instanz in allen Dingen erkannt hatte.
Meine eigene Erfahrung mit den Folgen des Krieges auf die nächste Generation ist eine des Verlustes, der Idealisierung und einer heftigen Angst vor Entwertung. Sie mag typisch sein für die Gruppe der Kriegs(halb)waisen. Sicherlich habe ich als kaum Zweijähriger in einer vorbewußten Weise mitbekommen, daß mein Vater gefallen, die Familie unvollständig geworden war. Als ich zu meiner Ausbildung selbst eine Psychoanalyse absolvieren sollte, suchte ich mir einen Mann, der vom Alter mein Vater hätte sein können und den Krieg in Rußland ebenso wie dieser kennengelernt, aber überlebt hatte. Wir dachten darüber nach, inwieweit eine heftige Trauerreaktion meiner Mutter verantwortlich sein könnte für Angstzustände, die bei mir im Zusammenhang mit Situationen auftraten, in denen ich mich zugleich ohnmächtig und verantwortlich fühlte, mich weder entziehen noch das Chaos um mich ordnen konnte. Später vermutete ich noch, daß meine schon früh bemerkbare Leidenschaft für das Schreiben damit zusammenhing, daß auf diese Weise, wenn schon nicht die Dinge, so doch die Wörter geordnet werden können.
Damit hörten die Folgen des Krieges auf, mich zu beschäftigen. Ich nahm sie zur Kenntnis, wenn ich davon hörte. Zuhören wurde schließlich neben dem Schreiben mein Beruf. Aber ich fragte nicht weiter nach und erschloß mir keine Zusammenhänge, wie ich es bei den Themen tat, die mich fesselten, den narzißtischen Störungen der beruflichen Helfer etwa oder der Nähe-Angst. Ich erinnere mich noch an einen Klienten, einen Arzt, der wegen seiner Depressionen und Kontaktprobleme in die Therapie kam. Er litte sehr darunter und konnte doch nicht anders, als sich tagelang gekränkt aus seiner Ehe zurückzuziehen, wenn seine Frau ein falsches Wort sagte. Immer noch schien er mit seinem Vater zu hadern, der – wie er berichtete – «verroht aus dem Kriege zurückkam». Das Wort «verroht» fiel mir auf, aber es dauerte noch einige Jahre, ehe sich solche Eindrücke allmählich zu einem Bild kondensierten.
Andere Eindrücke kamen hinzu. Einer war das Gespräch mit einem Landarbeiter, der den Olivenhain meines Nachbarn in der Toscana pflegte. Er faßte sein Leben in den melancholischen Satz: «La guerra mi ha rubato la gioventù.» Der Krieg in Abessinien, Libyen und vor allem die Gefangenschaft hatten ihm die Jugend gestohlen. Er war als Achtzehnjähriger ausgezogen, kam als Fünfundzwanzigjähriger zurück, von Verwundungen gezeichnet, erschöpft. Er hatte nichts gelernt, als zu überleben. Das Leben sollte jetzt beginnen, aber es schien ihm immer schwer, sich zu freuen. «Im Krieg habe ich das Lachen verlernt», pflegte ein anderer dieser Heimkehrer zu sagen, den ich nicht persönlich, sondern aus den Berichten seines Sohnes kennenlernte, in denen sich Furcht, Haß und eine verschüttete Verehrung mischten.
In einer der Fallgeschichten zur Nähe-Angst griff ich das Thema der psychologischen Folgen solcher Traumatisierungen der Väter für die Töchter auf. Ich beschrieb unter dem Titel «Kriegskind und Friedensschwester» Zweitgeborene, die von Heimkehrern gezeugt worden waren.[*] Die Mutter hatte sich während der Trennung vom Ehemann eng an ihre erstgeborene Tochter gebunden. Als der heimgekehrte Vater eine zweite Tochter zeugte, hatte die Mutter dieses scheinbar begünstigte Friedenskind aus Pflichtgefühl angenommen und versorgt. Der Vater aber begegnete ihm in einer brisanten Mischung aus überhitzter Aufmerksamkeit und verborgenem Sadismus.
Das Kind stand anscheinend für die ihm geraubte Jugend. Es verköperte sie, solange es genau so war, wie er es sich wünschte. Aber es wurde zum Räuber, zum Dieb, wenn es anders war, als er es sich vorstellte. Zärtlichkeit und Zynismus, Verführung zu großer Nähe und brutale Kränkung, Bewunderung und bösartige Kritik wechselten in verwirrender, für die Töchter undurchschaubarer Folge. Ich habe solche Beziehungen zwischen Kriegsheimkehrern und ihrer Tochter inzwischen mehrfach untersuchen können. Es gab eine charakteristische Abfolge von früher Verehrung und späterem Haß, der sich manchmal wieder milderte, oft aber bis zur Psychoanalyse oder bis zum Tod des Vaters die Beziehung bestimmte.
Immer tauchte die Begeisterung, mit der sich der Vater dem kleinen Mädchen zuwandte, das auf seinen Schultern reiten und den Schaum von seinem Bier trinken durfte, in der Analyse erst nach geraumer Zeit auf. Viel prägender war die Roheit geworden, mit der er den autonomen Strebungen des Kindes begegnete. Dieser Vater konnte nicht ertragen, daß ein Kind heranwuchs und seine Lebensaufgabe nicht darin sah, ihn für die verlorene Jugend zu entschädigen, sondern die eigene Jugend auszuleben.
Daher war vom Beginn der Pubertät an bei diesen Töchtern die einst zärtliche Vaterbeziehung in einen Kampf mit sadomasochistischen Zügen entgleist; der Vater strafte eine Tochter, deren Lebenslust ihn provozierte; die Tochter verknüpfte in ihren Provokationen den Wunsch nach Eigenständigkeit mit einem geheimen Schuldgefühl. Es schien, als könne sie sich nur von dem bösen, nicht aber von dem guten Vater lösen. Dahinter stand eine instabile Identifizierung mit der Mutter, die wohl den frühen Störungen dieser Beziehung geschuldet war.
Weil sich das kleine Mädchen geweigert hatte, den stummen Vorbehalt der Mutter gegen den roh aus dem Krieg heimgekehrten Mann zu unterstützen, konnte die heranwachsende Frau jetzt in ihr keine Vertraute finden, die ihr half, sich vom Vater abzulösen. Sie stürzte sich in eine verfrühte Selbständigkeit. Die Identität, die sie aufbaute, war eher intellektuell, den eigenen Gefühlen entfremdet, von einer Überanpassung an Leistungsforderungen gestützt. Das ebnete ihre berufliche Karriere, erschwerte jedoch Liebesbeziehungen. Es schien, als ob diese Frauen mit den Partnern ihrer intimen Beziehungen immer neu inszenieren würden, was sie von ihren Vätern erlitten hatten. Sie bewunderten kurz und kritisierten bald erbarmungslos, was sie bewundert hatten.
Der Krieg wird vor allem von den Männern in den Frieden getragen. In der Kindheitssituation der meisten Menschen spielen Frauen aber eine größere Rolle. Der traumatisierte Soldat prägt das Familienklima nicht allein. Die Mutter kann seine Wirkungen neutralisieren, auffangen, zumindest eine Gegenposition beziehen. Sein Einfluß bleibt groß, denn eine vom Vater im Stich gelassene oder gar mißhandelte Mutter kann den Kindern nur noch wenig Halt geben, selbst wenn sie sich darum bemüht und sich nicht ihrerseits an sie als Ersatzpartner und narzißtische Stützen klammert. Darüber hinaus können Kriegsfolgen wie Vertreibung, Vergewaltigung, Verlust naher Angehöriger auch die Mütter in einer Weise belasten, die unter den sicheren Lebensumständen der letzten fünfzig Jahre kaum mehr denkbar erscheint.
Erst als ich viele einschlägige Szenen aus der Kindheit meiner Analysandinnen und Analysanden gesammelt hatte, entdeckte ich, daß auch ich als Kind Zeuge einer Familiengeschichte wurde, die von einem Kriegstrauma bestimmt war. Es verwirrte mich, das Naheliegende übersehen zu haben, und erschien mir doch vertraut, denn auch meinen Patienten war es kaum je spontan eingefallen, Merkwürdigkeiten ihrer Väter mit deren Kriegserlebnissen zu verbinden.
Als meine Mutter mit ihren beiden Söhnen ausgebombt wurde und in den Haushalt der Passauer Großeltern zurückzog, kam ich in eine Familie, die unter den Traumatisierungen des Ersten Weltkriegs litt. Meine Großmutter war eine energische, in einem Lyzeum erzogene Dame, die französisch sprach und nach jedem Hochamt kritische Bemerkungen über die Qualität der Predigt fallenließ. Sie hatte kurz nach der Jahrhundertwende einen ehrgeizigen, lustigen Amtsrichter geheiratet, «nur» einen Beamten, zum Ärger ihrer großbürgerlichen Familie, in der Kaufleute oder Unternehmer mehr galten als Federfuchser. Mein Großvater, einer von vielen Kindern des Besitzers einer kleinen Klavierbaufabrik, war ein schwungvoller Tänzer, ein fanatischer Leser, ein gutaussehender Mann. Es muß eine hartnäckige Verliebtheit gewesen sein, die beide zusammenschweißte gegen ihre Eltern, die von der Mesalliance – zu allem Überfluß auch noch einer Katholikin mit einem Protestanten – nichts wissen wollten.
Wenn ich meine eigene Beziehung zu meinem Großvater betrachte, finde ich eine Brücke, um die Kinder traumatisierter Eltern besser zu verstehen. Vor allem wird mir begreiflich, wie wenig Kinder in der Lage sind, solche Veränderungen zu verstehen, ihnen Einfühlung, Rücksicht oder Mitleid entgegenzubringen. Ich fand schon sehr früh, daß der Opa merkwürdig war. Nach einigen unangenehmen Erlebnissen entschloß ich mich, ihm aus dem Weg zu gehen und nur in Notfällen Kontakt aufzunehmen. Diese Haltung behielt ich bei, als ich herangewachsen und im Prinzip durchaus zu einer intellektuellen Klärung von Situationen fähig war.
Es interessierte mich nicht, warum er so war, wie er war, und er drängte sich nicht auf. So gesehen, war er einer der verstummten, zugemauerten Traumatisierten, und da ich ihn innerlich in weiten Abstand gerückt hatte, versuchte ich auch nie, mit ihm in ein Gespräch zu kommen, was ich heute bedauere.
Mein Großvater konnte keinen Lärm ertragen, was deshalb merkwürdig schien, weil er schwerhörig war. Er fürchtete sich vor Aufregungen und war lächerlich besorgt um seine Verdauung. Beim Stöbern im großelterlichen Schlafzimmer fand ich viele leere Flaschen, die einst Sanddorn und Knoblauchextrakte enthalten hatten und nun, zwanghaft gereiht, eine Gesundheit bewachen sollten, die wiederherzustellen ihnen nicht gelungen war. Zugleich geistesabwesend und jähzornig beteiligte er sich an Gesprächen nur da, wo es darum ging, etwas Schlechtes vorauszusehen oder eine Anklage gegen die Verwandtschaft der Großmutter vorzubringen, die versucht habe, sie um ihr Erbe zu betrügen. Manchmal brach etwas von einer Burschenherrlichkeit aus ihm, er rollte den Hemdsärmel hoch und zeigte seinen Bizeps, der erstaunlich kräftig schien unter der schlaffen, weißen Haut.
Während die Großmutter mit uns schwimmen oder wandern ging, kam der Großvater nie mit. Er verließ das Haus nur zweimal jede Woche, immer an denselben Tagen, um in die Apotheke und in die Buchhandlung zu gehen. Dazu trug er eine Schirmmütze, eine Gletscherbrille, um seine Augen zu schützen, und auch im Sommer Mantel und Schal.
Der Erste Weltkrieg, das waren für meine 1913 geborene Mutter friedliche Jahre mit ihrer Mutter und ihrer großen Schwester; nur das Brot wurde immer schlechter. Dann kam der Vater aus dem Krieg, und der Familienhimmel verdüsterte sich.
Der Mann war gebrochen, er tanzte nicht mehr, er hatte seinen Sinn für Humor verloren, alles war ernst, bedrohlich, der Kampf hörte nie auf, es gab keine Ruhe. Er war in eine so unerträgliche Spannung geraten, daß ein quälendes Ohrgeräusch einsetzte. Dieses bildete später den Mittelpunkt einer kreisförmigen Argumentation, in der die Hörstörung für die Nervosität und die Nervosität für die Hörstörung verantwortlich gemacht wurden. Der Krieg war damit als Ursache ausgeschlossen, es war nicht nötig, über ihn zu sprechen.
Menschliches Leid kann nie aufgerechnet werden. Wer sich einfühlend mit dem Trauma und seinen Folgen beschäftigt, ist – ganz gleich, um wessen Trauma es geht – in jedem Fall ein Antipode bedenkenloser Täter. Eine psychoanalytische Untersuchung, in der es um das nicht normierte, nicht von kriegerischen Forderungen unterdrückte Ich geht, schafft immer einen Gegensatz zu jeder Ideologiebildung. Wer versucht, das ihm Fremde nicht abzuwerten, sondern es zu erforschen und sich in es hineinzuversetzen, widersteht dem Faschismus nach meiner Überzeugung in jedem Fall wirksamer als jemand, der ihn durch Abwertung und moralischen Imperativ bekämpft.
Manchmal habe ich mich gefragt, ob die Qualität der «Verrohung» als zentrale Folge des Traumas nicht zu vordergründig ist. Vielleicht sind andere Störungsbilder bedeutsamer, die darauf hinauslaufen, daß Menschen «schwinden»[*], wie das Bild des Muselmanns aus den KZ-Erfahrungen lehrt (vergleiche S. 103f.). In diesen Fällen ist die Spur, die der traumatisierte Vater in der Familie hinterläßt, nur durch Erlebnisse aufzufinden, daß etwas fehlt. Die faßbaren Störungen scheinen eher in der Unzufriedenheit, Klagsamkeit, Erbitterung, Überforderung der Mutter auf. Sie hat in diesen Familien eine überlastete Omnipotenz. Der Vater ist nur ruhebedürftig, ihm ist alles zuviel, er liegt auf dem Sofa, ist krank, reagiert nicht, spritzt sich Opiate, trinkt, nimmt Schlafmittel. Er hat keine Meinung, keinen beruflichen Ehrgeiz, kann mit Mühe oder gar nicht seinen Arbeitsplatz behalten. Wenn er einmal etwas sagt oder sich in irgendeiner Weise auf das Kind bezieht, ist dieses verblüfft, als sei es in ein Sterntaler-Märchen geraten.
Opfer und Täter
Angesichts des Traumas der Kriege ist das Einzelschicksal unser wesentlichster Zugang. Aber auch dieser bleibt zu einem großen Teil verschlossen und wird der Gesamtsituation merkwürdig ungerecht, denn alle erzählten Geschichten sind Geschichten über die Geretteten, während die Untergegangenen, die es angesichts des Todes müde wurden weiterzuleben, ohne Geschichte bleiben.[*] Aber die Tatsache ihrer massenhaften Vernichtung ist es, die uns am meisten erschreckt, weil sie unsere Vorstellungs- und Darstellungskraft übersteigt.
Wer sich als Psychoanalytiker mit dem Schicksal der Familien befaßt, die in den Strudel solcher Beschädigungen geraten, beschäftigt sich vor allem mit der Traumatisierung von Kindern durch traumatisierte Eltern. Das führt zu einer Neigung, Ereignisse gleichzusetzen, die in ihren historischen Grundzügen extrem unterschiedlich sind.
Meine Arbeit mit den Kindern jüdischer KZ-Überlebender hat meine Aufmerksamkeit für die traumatischen Störungen in deutschen Familien geschärft, obwohl ich bei späterer, kritischer Lektüre meiner eigenen Vergleiche unsicher wurde und nun ein neues Verständnis der großen Unterschiede erwarb. Wenn eine vielleicht 1959 geborene Besucherin der Gedenkstätten von Auschwitz oder Buchenwald Tränen vergießt und nachts vor Alpträumen nicht schlafen kann, ist sie wahrscheinlich die Tochter von Opfern. Und wenn die Frau neben ihr die Szene mit touristischem Interesse betrachtet und schließlich einige wohlerwogene Sätze von sich gibt, wie schrecklich, einzigartig und im vereinten Europa unwiederholbar der Holocaust gewesen sei, dann ist sie vielleicht die Tochter oder Enkelin von Tätern.[*]
Metaphern, welche zum Beispiel die Grabenkämpfer des Ersten Weltkriegs mit den KZ-Häftlingen verglichen (vgl. S. 103f.), übersahen entscheidende Qualitäten der Vernichtungslager. Eine militärische Führung, welche die eigenen Leute ausrotten will, ist nirgends historische Realität gewesen. Zwar wurde das Massensterben des «Kanonenfutters» von manchen – gewiß nicht allen – Generälen in Kauf genommen, um den Feind zu zermürben und den eigenen Ehrgeiz zu pflegen. Aber es gab nie soziale Systeme, die ausschließlich zu dem Zweck geschaffen und perfektioniert wurden, Menschen ihrer Würde zu berauben.
Die seelischen Belastungen, die durch das Leid an der Verfolgung entstehen und nach den Angehörigen, den «Kindern des Holocaust»[*], greifen, sind schwerer abzuschütteln als die Belastungen für die Kinder der Täter.[*] Sie führten in Extremfällen zu ebenso extremen Reaktionen – ich denke an die Auseinandersetzung von Niklas Frank mit seinem Vater –, aber insgesamt bestätigt die Beobachtung immer wieder, daß es für den KZ-Mörder, der viele Menschen grausam getötet hat, für den KZ-«Unternehmer», der vom Tod Tausender hilfloser und verlassener Arbeiter profitiert hat («die stellte mir die SS zur Verfügung»), viel leichter ist, Schuld zu verleugnen, Skrupel zu verdrängen, ein normales Familienleben zu führen und ein von seinen Kindern geachteter Vater zu sein.
Die Traumatisierung der Opfer trotzt den normalen Abwehrmechanismen. Während die Täter meist keine Mühe haben, sich nur davor zu fürchten, daß sie ertappt und verurteilt werden, kämpft der Überlebende der Todeslager mit dem Schuldgefühl, davongekommen zu sein, und überträgt es auf seine Kinder, ob er das nun will oder nicht. Denn die Furcht, daß sich das Schreckliche wiederholen könnte, gebietet auch, sich seiner zu erinnern. Diese Erinnerung ist schrecklich und geht über das hinaus, was normalerweise Menschen ertragen können; wird sie aber verdrängt, sind die Kosten ebenfalls schrecklich und gehen über das hinaus, was der Verdrängungsmechanismus normalerweise leisten kann.
Dem Opfer können Verdrängung und Verleugnung weniger Schutz bieten, als sie es beim Täter vermögen. Die Täter sind in ihrem Reizschutz längst nicht so radikal verletzt wie die Opfer. Sie konnten sich in den Schrecken hinein- und aus ihm herausbewegen, sie konnten sich mit einem Sinn des Schreckens identifizieren, immer wieder Ruhepausen einlegen, einen Schein von Normalität aufrechterhalten und alles, was geschah, auf Befehl und Umstand zurückführen.
Der Täter verwirklichte sich in seiner Tat; das Opfer wurde in allem, was es verwirklichen wollte und will, durch diese Tat gestört. Daher ist auch der Bezug des Täters zu seinen Kindern vermutlich weniger gestört als der des Opfers. Denn während das Opfer sich von seinen Nachkommen wünscht, daß ihnen die Störung ihrer Lebensentwürfe unbedingt erspart bleiben müsse, die er so bitter erfuhr, kann der Täter unbekümmert seinen Kindern vertrauen: Mögen sie eine veränderte Welt so zurichten, wie er es mit der seinen tat, es wird schon weitergehen!
Es scheint ebenso ungerecht wie unvermeidbar, daß die Opfer, die unschuldig sind an dem Geschehenen, stärker von seinen Auswirkungen verfolgt werden als die Täter. Unserem Wunsch nach emotionaler Gerechtigkeit würde es entsprechen, wenn die Tochter der Täter Tränen vergösse und sich die Tochter der Opfer über den schlechten Komfort der Gedenkstätte beklagen könnte.
Eine weitere wesentliche Frage ist die nach der Einseitigkeit des klinischen Blicks. Dieser vertieft viele Eindrücke, aber er hat auch die unvermeidbare Tendenz, nur die Verläufe zu erkennen, die irgendwann in Hilfsbedürftigkeit eingemündet sind. Das heißt, daß die gesunden Traumatisierten und ihre gesunden Kinder diesem Blick nicht auffallen. Charakteristisch für den klinischen Beobachter ist auch, «gesund» in Anführungszeichen zu setzen, als würde er davon ausgehen, daß einfach alle Traumatisierten Störungen haben und nur einige so stark (verleugnend, verdrängend) sind, daß sie unauffällig bleiben.
In solchen Fehlleistungen artikuliert sich die von Omnipotenzvorstellungen getragene Welt der therapeutischen Professionen, die mit gutem Gewissen und breitem Rückhalt unter den Kollegen ausgerüstet ist. Nur widerwillig nehmen wir zur Kenntnis, daß zum Beispiel die Angehörigen der «zweiten Generation» sich nicht selten von unseren hilfreich gemeinten Erkenntnissen verfolgt und pathologisiert fühlen. Da die meisten ausgebildeten Therapeuten ihre Methode auch am eigenen Leib erproben müssen, wissen sie im Grunde, wie latent aggressiv jede – auch die wohlmeinende – Deutung eines Sachverhaltes durch eine andere Person sein kann.
2 Nachkriegskindheiten
Der Pelzkragen
Ein Vater reißt seinem vierzehnjährigen Sohn Wilhelm, der mit der Mutter vom Einkaufen zurückkommt und ihm stolz den soeben erworbenen ersten eigenen («erwachsenen») Wintermantel zeigt, erst bleich, dann rot werdend, immer stumm, den Pelzkragen von diesem Mantel, zerknüllt diesen und steckt ihn zum fassungslosen Schrecken der Familie in den Zimmerofen.
Wir vollziehen eine ganz bestimmte Geste, wenn wir versuchen, diese Handlung zu verstehen. Es ist eine Geste der Ohnmacht. Wer mächtig wäre, würde dem Täter in den Arm fallen und den Pelzkragen retten. Auch eine Geste des Versuchs, durch Verständnis Wut und Trauer zu überwinden, die durch diesen sinnlosen Raub ausgelöst worden sind. Dadurch kann die Welt wieder jenen tröstlichen, wenngleich (wie gerade auch dieses Beispiel lehrt) illusionären Anschein gewinnen, sie sei vorhersehbar und in ihren Ursache-Wirkungs-Verbindungen zu berechnen. Der Vater kann später nicht mehr sagen, warum er sich so vergriffen hat. Er behauptet, es nicht zu wissen, es sei ihm eben so eingefallen, er habe das tun müssen. Die restlichen Familienmitglieder dringen nicht weiter in ihn, denn jede Frage mehr gefährdet den kostbaren Seelenfrieden des Vaters um Stunden, ja Tage länger.
Vermutungen:
1. Der Vater findet Pelzkragen weibisch. Einst unterdrückte Wünsche nach einem Tausch der Geschlechtsrollen werden wach. Er muß am Sohn bekämpfen, was er selbst ersehnt, redet sich dabei ein, sein Vorbild energisch handelnder Männlichkeit würde den Jungen davon abbringen, ein Muttersöhnchen zu werden, das sich von der Mama ausstaffieren läßt wie eine Tunte.
2. Der Vater hält die Mutter für eine Verschwenderin. Ein Pelzkragen für einen Buben, das ist abartig, da muß ein Exempel statuiert werden; nicht er ist schuld an dem Eklat, nicht der Sohn ist das Opfer, die Geste gilt der Mutter, die nicht weiß, wo die Grenze sparsamen Wirtschaftens liegt.
3. Der Vater wünscht sich selbst einen Mantel mit Pelzkragen, mit dem er aussieht wie Dürer auf seinem Selbstporträt. Aber niemand kauft ihm einen. Weshalb soll es dem Jungen besser gehen als dem Hausherrn? (Dies ist eine materialistische Variante der Mutmaßungen unter Nummer 1.)
4. Der Vater gehört einer weltanschaulich festgelegten Gruppe an, die es grundsätzlich ablehnt, sich mit etwas zu ernähren, zu bekleiden, zu schmücken, das durch den Tod eines lebenden Wesens erkauft ist – er ist Pythagoreer, Buddhist, Tierschützer, Vegetarier.
5. Der Vater will erproben, wie weit er bei seinem Sohn gehen kann. Er sucht einen Kampf, sei es eine Prügelei oder ein gemeinsames Besäufnis, nach dem man sich in die Arme sinken kann. Er provoziert den Halbwüchsigen, weil er spürt, wie fern ihm dieser rückt, wieviel mehr er den Kontakt mit seiner Mutter wünscht und ihn, den Vater, außen vor läßt.
6. Irgendwo in einem kalten Land hatte der Vater einmal Zahnschmerzen und Hunger. Er mußte mit den Zähnen Stücke von zu Eisklumpen gefrorenen Kartoffeln abbeißen, um nicht zu verhungern. Er hätte zehn Jahre seines Lebens für einen warmen Pelz zum Schutz der kranken Backe gegeben. Aber nur die Wachsoldaten trugen Pelzkragen.
Für den kleinen Wilhelm war der Vater ein Gerücht, eine Gestalt wie aus den Sagen von Dietrich oder Siegfried, in denen Drachen erschlagen, Ambosse gespalten und Riesen besiegt wurden, um einen goldenen Helm zu gewinnen oder eine Jungfrau. Er war fern und tapfer, er hatte gekämpft und gesiegt, war weit vorgedrungen in das Land der Feinde, das groß war wie ein Drache gegenüber dem kleinen gepanzerten Ritter, so weit, daß er den Rückweg nicht mehr fand und gefangengenommen wurde.
Die Mutter erzählte mit feuchten Augen vom Krieg, von Siegen, von der Erschöpfung des Landes durch ein Übermaß an Fronten. Sie seufzte: «Ob er jemals zurückkommt? Sibirien.» Dann drückte sie Wilhelm an sich, und er wußte, er war wichtig, er als einziger neben den beiden Schwestern konnte nach Sibirien gehen und zurückkommen, wenn die Zeit reif war.
Schließlich kam der Morgen, an dem er den Brief im Kasten fand und der Mutter brachte. Alle schienen sich zu freuen, daß der Vater endlich zurückkam, und auch Wilhelm hätte glücklich sein müssen. Was war nur verkehrt mit ihm? Nichts sah heute aus wie immer, der abgegriffene Teddy schaute stumm aus seinen hellbraunen Knopfaugen, er versuchte ihn zu streicheln, aber es war nichts, er zog das Federwerk der Lokomotive auf und setzte sie auf den Schienenkreis, aber sie schnurrte nichtssagend ihre Runden, bis er sie zum Entgleisen brachte.
Dann weinte er, untröstlich und länger als je zuvor, einen ganzen Nachmittag lang, weil er nun etwas verloren hatte und dem Ungewissen nicht traute, das ihm da entgegenkam, ohne daß er ausweichen konnte. «Es war zuviel für ihn», sagte die Mutter, «er merkt erst jetzt, wie sehr er den Vater entbehrt hat.» Er schluckte und nickte dankbar, daß sie so wohlwollende und zukunftsgläubige Worte fand für seinen Gram, denn in Wahrheit hatte ihm der Vater seines Wissens nie gefehlt, er war manchmal sogar eher erleichtert gewesen, wenn er sah, wie seine Spielkameraden in ihren Vätern etwas ausgeliefert waren, das nicht mit sich reden ließ wie eine Mutter, sondern befahl, ohne daß es Einwände gab.
Als dann die Mutter den Blick von ihm wandte und zu dem Eichenschrank ging, wo neben der Kienzle-Uhr in einem schmalen Silberrahmen das Foto des ernsten Mannes mit den Rangabzeichen stand, wußte er: Sie nahm seine Tränen mit zu ihm, zu dem Fremden, sie war es, die er einbüßen würde, und mit ihr sein Bild des fernen, großen, starken Helden, der in Sibirien war.
Manchmal, wenn sich die anderen Gefangenen in den schmutzigen Schnee legten und nicht wieder aufstanden, war auch dem Vater so elend, daß er alle Kräfte anspannen mußte, um an etwas anderes zu denken als an die Kälte, das nächste Stück Brot, die Frostbeulen und die Wunden im Zahnfleisch, die keinen, der hier überleben wollte, daran hindern durften, von den steinhart gefrorenen Kohlstrünken und Kartoffeln kleine Stücke im Mund aufzutauen und zu essen. Dann erinnerte er sich an Maria, an die beiden Mädchen und an den kleinen Wilhelm, den er noch nie gesehen hatte.
Nur ein Foto hatte in einem der letzten Briefe gelegen, die in den Kessel kamen: ein Säugling, der viel zu ernst blickte, aber sonst gesund aussah. Das Foto war fort, es war in dem Mantel mit dem Pelzkragen geblieben, dem kostbaren Wintermantel eines russischen Offiziers, den er für seine Zigarettenration und zwei Flaschen Schnaps eingetauscht hatte und den sie ihm gleich nach der Gefangennahme vom Leib rissen.
«Das ist also der Wilhelm», sagte der ausgemergelte, hohläugige Mann, auf den die Mutter erst zögernd, dann ganz schnell zugegangen war, als er aus dem Bus stieg. Er hob den Jungen hoch, wollte ihn in die Luft werfen, wie er es mit den Mädchen auf Fronturlauben gemacht hatte – sie jauchzten und kuschelten sich in seine starken Arme, wenn er sie wieder auffing. Aber Wilhelm war zu schwer oder der Heimkehrer zu schwach für dieses Spiel, er rutschte durch Hände, die nicht kraftvoll genug zupacken konnten, plumpste halb auf den Boden und fing an zu weinen. «Mein Gott, bist du schon groß», stammelte der Vater. «Hör auf mit dem Geheule, es gibt wirklich Schlimmeres, dort, wo ich herkomme.»
«Er hat schon den ganzen Nachmittag geweint, es ist einfach zuviel für ihn», sagte die Mutter. Jetzt war der Fremde erst drei Minuten hier, und schon hatte sie ihren Sohn zum ersten Mal verraten. Der Mann sah dem Bild nicht ähnlich, das auf dem Schrank im Wohnzimmer stand, er war weniger als das Foto und hätte doch viel, viel mehr sein müssen, wie es Wilhelm sonst erlebt hatte, wenn er etwas wirklich sah, was er bisher nur von Bildern kannte, den Elefanten im Zoo oder das Flugzeug, das beim letzten Burgfest gelandet war.
Kümmerte sich ein Krieger denn darum, daß seine Kinder Spinat- und Püreereste vom Tellerrand kratzten? Schalt er die Mutter, wenn sie im Flur das Licht brennen ließ, damit die Mädchen den Schimmer durch die Türritze sahen? Ein Held rannte nicht wie ein kleiner, kläffender Köter durchs Haus, der überall bellte, wo nicht genug gespart wurde, und von allen wichtig genommen werden wollte, die doch bisher gut ohne ihn ausgekommen waren.
Der Vater arbeitete jetzt ohne Feierabend und Wochenendausflug, um das Ledergeschäft in der Kleinstadt zu neuem Glanz zu erwecken, das während des Krieges und der Zeit nachher unansehnlich geworden und geschrumpft war. Die Mutter hatte es geführt, solange er als Soldat und Kriegsgefangener ausgefallen war. Das mußte ein Ende haben. Die Frau sollte es gut haben und zu Hause bleiben, wie es sich gehörte, nur manchmal, im Schlußverkauf und zu Weihnachten, durfte sie ein wenig aushelfen.
Wilhelm und seine Schwestern warteten von jetzt an im Wohnzimmer mit dem Essen, bis der Vater aus den Ladenräumen im Erdgeschoß gekommen war. Dort stand der mit Unterdecke, Tischdecke und Häkelwerk behangene Eßtisch neben dem Steinway-Flügel, auf dem der Vater einmal im Jahr «Stille Nacht» und «O Tannenbaum» spielte. Er fuhr nur Mercedes, auch als er ihn sich noch nicht leisten konnte, in diesem Punkt war er eigen.
Die letzte Ohrfeige bekam Wilhelm, als er zwei Stunden nach Mitternacht diesen Mercedes (den dritten der Familie) vor dem Haus parkte und leise in sein Zimmer gehen wollte. Das waren zwei Stunden Warten und Angst für den Vater gewesen. Damals schlug Wilhelm nicht zurück, aber er sagte, es sei jetzt nicht mehr die Zeit, sich schlagen zu lassen, worauf sein Vater verstummte und sich ins Schlafzimmer zurückzog.
Um diese Zeit hatte sich die Familie schon daran gewöhnt, daß kein Stück altbackenes Brot weggeworfen werden konnte, ohne daß es der Vater im Müll fand und der Mutter drohte, das Haushaltsgeld zu kürzen. Auch daran gewöhnt, daß er in keiner Menschenschlange warten konnte.
Die Depression
Sie wußte nicht, warum ihr das Leben keine Freude machte. Die Tage kamen auf sie zu wie Regenwolken, am Morgen tiefgrau. Sie erstickten fast den Blick in angesammelten Bedrängnissen. Wenn sie dann doch aufgestanden war, doch der Kleinen das Frühstück gemacht und sie in die Schule entlassen hatte, doch angefangen hatte, die Küche aufzuräumen und die Waschmaschine zu füllen, war alles immer noch grau, und es gab keine Hoffnung. Aber die nackte Verzweiflung hatte einem Gefühl Platz gemacht, am Fließband zu stehen, eine Stunde nach der anderen abzuhaken, Pflichten zu erledigen, die allmählich, eine nach der anderen, verschwanden. Am Abend, wenn die Tochter im Bett lag und der Mann vor dem Fernseher döste, waren doch etwas wie ein Aufatmen und eine Erleichterung da, eine entspannte, wohlige Müdigkeit, die sich über Nacht wieder in das Empfinden verwandelte, sie sei inwendig mit Blei ausgegossen und könne sich nicht aufraffen.
Auch die Analysestunde war etwas, das abgehakt wurde, ohne Hoffnung, eine weitere Pflichterfüllung. Sie tat es ihrem Mann zuliebe und ihrer Mutter. Ganz langsam wurde deutlicher, wann das angefangen hatte. Sie erinnerte sich nicht, ob sie jemals ein Kind gewesen war. Es mußte ja sein, aber ihre Mutter wußte alles soviel besser: wie brav und stillvergnügt sie gewesen, wieviel weniger eine Plage als der aufrührerische und anspruchsvolle Bruder, der – obwohl er schon fast alle Aufmerksamkeit der Mutter hatte – nur mit Mühe gehindert werden konnte, die kleine Schwester mitsamt ihrem Wickelkissen in die Backröhre des Küchenofens zu schieben, um sie zu braten. Von nichts wußte sie, alles war schon immer so gewesen, der Vater weit weg, sprachlos und zynisch, die Mutter ganz dicht, ängstlich plappernd, von jeder Kleinigkeit aufgescheucht und nicht mehr zu beruhigen.
Sie sollte sich interessieren? Wie die Eltern so geworden seien, wie sie schon immer waren? Sie wußte nichts. Doch, es gab schon einige Fetzen. Sinnlose Fragmente. Die Mutter konnte heute noch nicht von der Heimat reden. Ihr kamen die Tränen. Sie hatte alles verloren. Im Sudetenland war sie eine reiche Partie gewesen, ihr Vater Fabrikdirektor und ihre Mama die Gauleiterin der NS-Frauenschaft. Im Auffanglager war sie eine armselige Lazarettpflegerin, das Gymnasium abgebrochen, die Mutter verhaftet, der Vater verhungert.
Sie bemühte sich, zu vergessen, daß eine Fabrikantentochter aus dem Sudetenland etwas anderes verdiente als den Sohn eines Landarbeiters. Ihre Mutter war stumm geworden. Sie hatte ihre Ansprüche verloren, denn davon reden hieß von der Vergangenheit sprechen, und das mußte vermieden werden, es gab keine Vergangenheit.
Er sah gut aus. Er verdiente ein wenig mehr als sie während ihrer Ausbildung in einem Modegeschäft. Er wollte die Meisterprüfung anpacken und sich selbständig machen. Er spürte in ihr, wenn sie über eines der Dinge urteilte, nach denen er sich aus einer hilflosen Ferne sehnte, eine Sicherheit, die er für sich haben wollte. Sie sagte ihm, welche Anzüge schick waren und welche spießig, sie wußte, welche Theaterstücke man besuchen durfte und welche trivial waren, sie erklärte ihm, worum es in der Oper ging, in die er gerne mit ihr ging. Er hätte keinem seiner Kollegen sagen können, was gut daran war, und lauschte ihren Erklärungen mit überheblicher Andacht.
Sie heirateten. Er machte sich selbständig: Gas- und Wasserinstallationen. Sie arbeitete halbtags in dem kleinen Modeladen, den sie mit einer früheren Kollegin führte. Es gab genug Aufträge, er stellte Gesellen ein, bildete Lehrlinge aus. Nur der Sonntag, der war heilig, den verbrachte die Familie zusammen. Warum hatte sie diese Zeit einer zwangsglücklichen Kindheit vergessen, in der die Familie doch in zäher Mühe den Schutzwall aufgebaut hatte, in dem sich dann – so erinnerte sie es – alle nur gefangen fühlten und keiner beschützt?
Sie hatte keine Bilder davon, es gab keinen Vater, der liebevoll war und mit einem Kind spielte, keine Mutter, die ruhig und friedlich in der Küche saß und Teig rührte oder Gemüse schnitt, es gab nur Streit und Schreie, den zornroten Bruder, den noch röteren, dann aber eiskalten Vater, die aufgeregte Mutter, wie ein gackerndes Huhn, die auf alle einredete und am Ende doch dem Vater steckte, was ihr vorgeblich im Vertrauen gesagt worden war. Seit sie denken konnte, war es so, der Vater war immer jähzornig, zurückgezogen, er polterte, brüllte.
«Du interessierst dich für nichts», sagten die Eltern, wenn sie stumm und brav das Nötigste für die Schule machte, um allen Nachfragen zu entgehen. Und jetzt warf ihr der Analytiker vor, sie interessiere sich nicht einmal für sich selber. Wie sollte sie auch! Der redete leicht daher! Sie lieferte überall ihre Pflichterfüllungen ab, spazierte durch diesen Zoo und warf jedem seinen Brocken in den Käfig, aber sie ließ sich von keinem fassen, keiner sollte wissen, was sie brauchte. Brauchte sie überhaupt etwas? Sie wollte nur ihre Ruhe. Aber gerade die ließ ihr der Vater nicht. Er riß das Lederband ab, an dem das kleine goldene Schloß hing, und las ihr Tagebuch. Dann schrie er sie an, wer diese Männer seien, deren Name da stehe, und sie schrie zurück, daß ihn das nichts angehe, und er schlug sie, und sie schlug zurück, und es war ein rotes Toben, in dem sie aus dem Haus stürzte, in das Polizeipräsidium fuhr, ihn anzeigte und nie wieder zurückkommen wollte.
Man brachte sie in ein Heim, eine Ärztin fotografierte ihre Blutergüsse, am nächsten Tag kam die Mutter und redete der Siebzehnjährigen so lange zu, bis sie wieder nach Hause kam. Der Vater ging stumm aus dem Zimmer, wenn sie nicht schon vorher, ebenso stumm, hinausgegangen war. Er hatte alle seine Gesellen und Lehrlinge entlassen und arbeitete jetzt allein; dann gab er seinen Betrieb auf und half im Geschäft der Mutter, das gerade die zweite Filiale eröffnete. Einmal kam sie zufällig vorbei, als er drinnen gerade eine Kundin in ihrem Alter bediente. Sie sah, wie er die Fremde anlächelte und sich verbeugte und ihr geschickt in eine Kostümjacke half.
Der Analytiker sagte ihr öfter, daß sie nicht nütze, was er ihr anbiete: Zeit und Aufmerksamkeit und Interesse, zu verstehen, warum war, was war. Sie sagte dann trotzig, was biete er denn schon, und wie noch viel weniger habe sie zu bieten, sie sei es eben gewohnt, immer die gute Fee zu spielen und sich selbst hinter das zurückzuziehen, was für andere gut sei, und ihr Vater sei eben ein grausamer Mensch gewesen, kein Wunder, daß sie auch dem Analytiker nicht traue, das nenne man Vaterübertragung, aber damit sage sie ihm gewiß nichts Neues und es sei ihr verständlich, wenn er sich langweile und wolle, daß sie mehr Vertrauen habe und interessantere Dinge erzähle, mit denen etwas anzufangen sei.
Er meinte dann, was sie wie einen Einwand ausdrücke und wohinter er Trotz spüre, das sei doch im Grunde die Bestätigung, daß sie sich ihm zu Diensten gestellt fühle und sich nicht ausmalen könne, wie er ihr zu Diensten sein könne, obwohl es doch ihre Stunden seien. Sie schlichen umeinander herum und quälten sich ein wenig. Sie kam immer pünktlich, und er wartete auf sie und gab der leise Widerstrebenden zur Begrüßung und zum Abschied die Hand, die sie nicht drückte. Sie versuchte nach ihrer Art, ihn abzuwerten und dahin zu bringen, daß die Analysestunden genauso wie Regenwolken auf ihn zukamen, grau und hoffnungslos. Er hielt aus, bis alle Erwartungen unerfüllt waren und sich niemand mehr daran störte, daß nichts weitergegangen war.
So kam sie eines Tages, lag nicht mehr gefaßt da und berichtete einen Traum, zu dem ihr nichts einfiel außer säuberlich Geordnetem, sondern weinte, sie, die noch nie geweint hatte, und erzählte schluchzend, daß der Bruder ihres Vaters am Verhungern sei. Sie wisse nicht, ob ihr Vater es ertrage, und sie würde ihm gerne helfen, aber sie könne es nicht, denn sie wisse nicht, wie er reagieren würde, und wisse weiterhin nicht, wie sie ihn trösten solle, es sei so schrecklich.
Dann erzählte sie von dem Onkel, der schon lange keine Freude am Leben mehr gehabt habe, außer zu trinken und zu rauchen. Als sein Husten gar nicht mehr aufhören wollte, ging er irgendwann doch zum Arzt; der Lungenkrebs war bis zur Speiseröhre vorgedrungen. Es gab die Wahl, operiert zu werden und bald zu sterben oder nicht operiert zu werden und noch früher zu sterben. Der Onkel schloß sich in die Wohnung ein, er wollte in kein Krankenhaus.
Als er das Telefon nicht mehr abhob, alarmierte eine Schwester die Polizei, der Hausmeister schloß die Tür auf, der Kranke wurde, fast zum Skelett abgemagert, in der Intensivstation künstlich ernährt, der Vater besuchte ihn täglich, und die Mutter sagte, er sehe schrecklich aus und ihre Tochter solle es sich ersparen, ihn noch einmal zu sehen.
Der Analytiker sagte nur wenig in dieser Stunde, außer vielleicht, daß sie eine erwachsene Frau sei. Jemanden zu trösten sei eher eine gefühlsbestimmte als eine planbare Aktion. Wenn sie sich etwas wünsche, könne sie entscheiden oder die Entscheidung der Mutter überlassen.