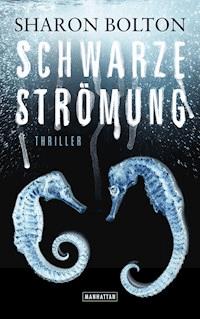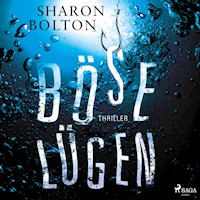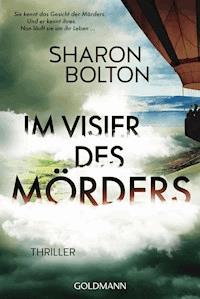7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Manhattan
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Lacey Flint
- Sprache: Deutsch
Fünf tote Jungen in fünf Wochen. Und der Blutdurst
des Killers ist noch nicht gestillt …
Barney weiß, dass der Killer bald wieder zuschlagen wird. Das Opfer wird wieder ein Junge sein wie er. Er wird ihm die Kehle durchschneiden, ihn verbluten lassen und die Leiche am Ufer der Themse ablegen. Die Polizei wird keinen Hinweis auf den Täter finden und keine Warnung, wen es als nächstes treffen könnte. Doch der elfjährige Barney hat etwas gesehen – und nun sammelt er akribisch jeden Hinweis, um den Fall zu lösen. DC Lacey Flint, Ermittlerin in Sonderurlaub, könnte den Fall guten Gewissens ihren Kollegen überlassen. Wenn Barney Roberts nicht ausgerechnet ihr Nachbar wäre …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 620
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Buch
Ein Kindermörder hält London in Atem. Fünf tote Jungen in fünf Wochen. Die Bevölkerung ist panisch. Auf einer obskuren Facebook-Seite zur Mordserie wird die Stimmung weiter angeheizt. Einer der User ist der elfjährige Barney, der allein mit seinem Vater lebt. Barney hat ein besonderes Talent dafür, verloren geglaubte Dinge wiederzufinden. Er erkennt Muster, wo anderes nichts sehen. Er weiß, dass die Opfer immer kleine Jungen sind, in seinem Alter. Er weiß, dass die Leichen an prominenten Stellen des Themse-Ufers auftauchen. Und er weiß, dass der Killer schon ganz bald wieder zuschlagen wird. Gemeinsam mit seinen Freunden geht Barney den Dingen nach, und bald macht die Clique auf einen grausigen Fund. Doch da ist noch etwas, ein Verdacht, der mit Barneys Vater und dem Tod von Barneys Mutter zu tun hat und der so schrecklich ist, dass der Junge mit niemandem darüber reden kann. Doch dann fasst er Vertrauen zu der Frau, die im Nachbarhaus wohnt: DC. Lacey Flint. Als sie dem Killer endlich auf die Spur kommt, ist es fast schon zu spät…
Autorin
Sharon Bolton wurde im englischen Lancashire geboren, hat eine Schauspielausbildung absolviert und Theaterwissenschaft studiert. »Todesopfer«, ihr erster Roman, wurde von Lesern und Presse begeistert gefeiert und machte die Autorin über Nacht zum neuen Star unter den britischen Spannungsautorinnen. Ihrem ersten Triumph folgten mittlerweile fünf weitere Thriller, mit denen Sharon Bolton ihr brillantes Können immer wieder unter Beweis stellte. So wurde »Schlangenhaus« als bester Thriller des Jahres mit dem Mary Higgins Clark Award ausgezeichnet. Die Autorin lebt mit ihrem Mann und ihrem Sohn in Oxford.
Mehr zur Autorin und ihren Büchern unter www.sjbolton.com
Sharon Bolton
Ihr Blut so rein
Thriller
Aus dem Englischenvon Marie-Luise Bezzenberger
GOLDMANN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die Originalausgabe erschien 2013 unter dem Titel»Like This, For Ever«bei Bantam Press, an imprint of Transworld Publishers, London
Manhattan Bücher erscheinen imWilhelm Goldmann Verlag, München, einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH
Deutsche Erstveröffentlichung Mai 2014Copyright © der Originalausgabe 2013 by Sharon BoltonCopyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2014by Wilhelm Goldmann Verlag, München,in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 MünchenDie Nutzung des Labels Manhattan erfolgt mit freundlicherGenehmigung des Hans-im-Glück-Verlags, MünchenUmschlaggestaltung: UNO WerbeagenturUmschlagmotiv: plainpicture/Elektrons 08Redaktion: Martina Klüver Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-12312-3V003
www.penguin.de
Für Hal, der aus jedem Kind in diesem Buch hervorlugt, und für seine Freunde, die tapfer mitgespielt haben.
»Wissen Sie nicht, dass, wenn die Uhr heute Mitternacht schlägt, alle bösen Dinge in der Welt freien Lauf haben?«
Bram Stoker, Dracula
Prolog
»Es heißt, wenn man in junges Fleisch schneidet, ist das wie in warme Butter.«
Die Therapeutin schwieg einen Moment lang. »Und, stimmt das?«, fragte sie.
»Nein, das ist völliger Blödsinn.«
»Und wie ist es dann?«
»Na ja, zugegeben, der erste Teil ist leicht. Die Haut aufschlitzen, der erste Schwall Blut. Das macht das Messer praktisch von selbst, solange es scharf genug ist. Aber danach muss man sich ganz schön anstrengen.«
»Kann ich mir vorstellen.«
»Zum einen wehrt sich der Körper. Er will von Anfang an wieder heilen. Das Blut fängt an zu gerinnen, die Arterie oder die Vene, oder was immer man auch aufgeschnitten hat, versucht, sich zu verschließen, und die Haut produziert dieses eklige gelbe Zeug, aus dem dann Schorf wird. Es ist wirklich nicht leicht weiterzumachen.«
»Es scheint Ihnen vor allem ums Schneiden zu gehen, kann man das so sagen?«
Die Patientin nickte zustimmend. »Auf jeden Fall. Kurz bevor das Messer die Haut berührt, ist der Krach in meinem Kopf fast unerträglich – ich hab das Gefühl, als ob mir jeden Moment der Schädel platzt. Aber dann kommt der erste Blutstropfen, und dann der nächste, und dann läuft es einfach raus.«
Die Patientin hatte sich eifrig vorgebeugt, als sei das Geständnis, einmal begonnen, nicht mehr aufzuhalten.
»Ich sage Ihnen, wie das ist – es ist, wie wenn es im Winter zum ersten Mal richtig schneit, und plötzlich ist alles wunderschön, und die Welt verstummt. Also, Blut macht genau dasselbe wie Schnee. Plötzlich bedeutet der Schmerz nichts, der ganze Lärm in meinem Kopf ist weg. Irgendwie bin ich durch diesen ersten Schnitt ganz woanders. Irgendwo, wo endlich Frieden herrscht.«
Sanft, fast wie um Verzeihung bittend, klappte die Therapeutin ihr Notizbuch zu. »Wir müssen jetzt Schluss machen«, sagte sie. »Aber ich danke Ihnen, Lacey. Ich glaube, jetzt kommen wir endlich weiter.«
Teil 1
1
Donnerstag, 14. Februar
Die Traurigkeit war immer in ihm drin. Ein dumpfer Druck auf der Brust, ein bitterer Geschmack im Mund, ein zurückgehaltener Seufzer bei jedem Atemzug. Die meiste Zeit konnte er so tun, als sei sie nicht da, und im Laufe der Jahre hatte er sich an sie gewöhnt. Doch sobald er sich auf etwas Wichtiges konzentrierte, war sie sofort wieder da, wie ein Ungeheuer, das unter dem Bett lauerte. Tiefe, beständige Traurigkeit.
Barney wartete, bis Big Ben den vierten Glockenschlag von acht Uhr tat, ehe er den Brief in den Briefkasten warf. Die Traurigkeit ließ ein wenig nach; er hatte alles richtig gemacht. Diesmal könnte es klappen.
Nachdem diese wichtige Aufgabe ausgeführt war, spürte er, wie er sich entspannte und ihm wieder alles Mögliche auffiel. Irgendjemand hatte ein Plakat am nächsten Laternenpfahl befestigt. Das Foto der vermissten Jungen, der zehn Jahre alten Zwillinge Jason und Joshua Barlow, nahm den größten Teil der DIN-A4-Papptafel ein. Beide hatten dunkelblondes Haar und blaue Augen. Ein Zwilling lächelte auf dem Foto, die neuen bleibenden Zähne in seinem Mund unbehaglich groß. Der andere war der ernstere der beiden. Die beiden waren eins vierzig groß und schlank. Sie sahen genauso aus wie Tausende anderer Jungen in South London. Genauso wie die zwei, möglicherweise auch drei, die vor ihnen verschwunden waren.
Irgendjemand beobachtete ihn. Barney merkte es immer, wenn das passierte. Er bekam dann so ein Gefühl – nichts Greifbares, nie ein Prickeln zwischen den Schulterblättern oder kaltes Eisbrennen im Nacken, einfach nur die überwältigende Ahnung, dass noch jemand da war. Jemand, dessen Aufmerksamkeit allein ihm galt. Meistens wenn er das fühlte, schaute er auf, und da war sein Dad, mit jenem merkwürdigen nachdenklichen Lächeln, als betrachte er gerade etwas Wunderbares, Faszinierendes, und nicht bloß seinen elfjährigen Sohn. Oder Mrs Green, seine Klassenlehrerin, mit hochgezogenen Augenbrauen, die besagten, dass er mal wieder in einen von seinen Tagträumen versunken gewesen war.
Barney drehte sich um und sah durch das Schaufenster des Zeitungsladens, wie Mr Kapur auf seine Armbanduhr tippte. Er stieß sich ab und rollte in einem einzigen langen Schwung bis zur Ladentür.
»Bist ja ganz schön spät noch draußen, Barney«, meinte Mr Kapur, so wie er es sich im Laufe der letzten Wochen angewöhnt hatte. Barney öffnete den Kühlschrank und griff nach einer Cola.
»Fünfzig Pence, minus zehn Prozent Mitarbeiterrabatt«, verkündete Mr Kapur wie immer. »Macht fünfundvierzig Pence, bitte.«
Barney reichte ihm das Geld und steckte die Dose in die Tasche. »Du gehst doch jetzt gleich nach Hause, oder?«, fragte Mr Kapur. Seine letzten Worte wurden von der Klingel übertönt, als Barney die Tür aufzog.
Barney lächelte den alten Mann an. »Bis morgen, Mr Kapur«, sagte er, während er den Reißverschluss seiner Jacke ein wenig weiter zuzog.
Ein heftiger Wind blies vom Fluss herauf, als Barney auf seinen Rollerblades losschoss und in Richtung Osten über Gehsteige rollte, die noch immer vom Regen glänzten. Der Wind roch nach Diesel und Feuchtigkeit, und wie immer hatte Barney das Gefühl, der Fluss würde die Arme nach ihm ausstrecken. Er stellte sich vor, wie das Wasser aus der Enge seiner Ufer ausbrach, unterirdische Gänge, Gullys und Abwasserrohre fand und unter der Stadt dahinfloss. Nie konnte er in der Nähe des Flusses sein, ohne an schwarzes Wasser zu denken, das sich unter den Straßen ausbreitete, eine so subtile, so behutsame Invasion, dass niemand außer ihm etwas merken würde, bis es zu spät war. Einmal hatte er seinem Dad von seinen Ängsten erzählt, und der hatte gelacht. »Ich glaube, du übersiehst da ein paar ganz grundlegende physikalische Naturgesetze, Barney«, hatte er gesagt. »Wasser fließt nicht bergauf.«
Barney hatte nicht wieder davon gesprochen, doch er wusste sehr gut, dass Wasser manchmal doch bergauf floss. Er hatte Bilder des überfluteten London gesehen, hatte Berichte gelesen, wie hohe Sturmfluten im Frühjahr mit stromabwärts rauschendem Hochwasser zusammentrafen, so dass das Flussbett die Wassermassen nicht mehr hatte halten können. Das Wasser hatte die Chance zum Ausbrechen genutzt, war aus seinen Ufern gesprungen und hatte sich wie ein zorniger Mob brüllend einen Weg durch London gesucht.
So was könnte passieren. In den Chiltern Hills hatte es geschneit. Der Schnee würde schmelzen, das Tauwasser würde durch die kleinen Bäche fließen und die Themse erreichen, die immer voller und schneller werden würde, während sie auf die Hauptstadt zuströmte. Barney legte an Tempo zu und fragte sich, wie schnell er wohl skaten müsste, um einer Flut zu entkommen.
Als Barney am Gemeindezentrum ankam, sah das Gebäude verlassen aus. Kein Licht, also war selbst der Hausmeister weg, was bedeutete, dass es nach neun war. Mit einem mittlerweile vertrauten Gefühl der Furcht schaute er auf die Uhr. Kurz nach acht hatte er sich von Mr Kapur verabschiedet. Der Zeitungsladen war auf Skates etwa zehn Minuten von hier entfernt. Es war wieder passiert. Auf unerklärliche Weise war ihm Zeit verloren gegangen.
Eine Stimme jenseits der Mauer, das Geräusch von Rollen auf Stahl. Die anderen warteten im Hof auf ihn, aber plötzlich wollte Barney nach Hause. Früher oder später – und zwar früher, wenn er schlau war, und das war er doch, oder etwa nicht? Alle waren sich einig, dass Barney clever war, manchmal ein bisschen komisch, aber klug – würde er jemandem von den Stunden erzählen müssen, die ihm immer wieder abhandenkamen.
Ein leises Lachen. Er glaubte, seinen eigenen Namen zu hören. Barney drängte die Beklommenheit in seinem Kopf ganz nach hinten und fuhr weiter, um die Ecke. Das Gemeindezentrum war früher mal eine kleine Fabrik gewesen. Es gab noch diverse Schuppen und Wirtschaftsgebäude sowie einen asphaltierten Hof, und das Ganze war von einer hohen Backsteinmauer umgeben, mit einem Eisengitter obendrauf. Im Hauptgebäude gab es eine Bibliothek, eine Kindertagesstätte, einen Hort für Schulkinder und einen Jugendclub. Barney und seine Freunde hingen ein paar Abende die Woche im Jugendclub ab, doch erst wenn das Zentrum abends schloss, machten sie es zu ihrem Privatspielplatz.
In der Gasse, die hinter dem Hof an das Gelände grenzte, streckte Barney die Hände nach der losen Eisenstange aus, um sich an der Mauer hochzuziehen.
In dieser Stadt sieht einen immer jemand.
Was hatte das denn gerade jetzt in seinem Kopf zu suchen? Warum fiel ihm ausgerechnet jetzt der Vortrag ein, den die Polizistin in der Schule gehalten hatte? Sie hatte davon gesprochen, dass jeder Londoner davon ausgehen könne, ein paar hundert Mal am Tag von einer Überwachungskamera gefilmt zu werden. Doch Barney wusste ganz genau, dass es hier in der Gasse und in den umliegenden Straßen keine Kameras gab und dass auch keine das Gemeindezentrum überwachten. Das war einer der Gründe, warum seine Gang hier abhing.
Er ließ den Blick über die Häuserreihe gegenüber wandern, hielt Ausschau nach dem erleuchteten Fenster, den offenen Vorhängen, dem Augenschimmern, das bestätigen würde, was er bereits wusste – dass jemand ihm zusah. Nichts.
Nur schaute eben doch jemand zu, und mit dieser Gewissheit ging ein Klopfen in seiner Brust einher, als hätte sein Herz plötzlich einen Gang hochgeschaltet. Okay, hier war er also, in einer Stadt, wo fünf Jungen in seinem Alter innerhalb ebenso vieler Wochen verschwunden waren. Allein, in genau dem Viertel, in dem sie gewohnt hatten – und jemand, den er nicht sehen konnte, beobachtete ihn jetzt gerade.
Barney krabbelte hastig durch die Lücke im Gitter, die Skates noch an den Füßen. Ihm war klar, dass das blöd war, aber Adrenalin und wilde Entschlossenheit sorgten dafür, dass er nicht kopfüber abschmierte. Er rollte vorwärts. Okay, auf welcher Seite der Mauer befanden sich die Augen? Auf der Straßenseite oder auf der Fabrikseite? Durch drei Meter festes viktorianisches Mauerwerk und ein Eisengitter von ihm getrennt, oder mit ihm hier drin? Der Inhalt seines Magens verwandelte sich in kaltes Blei oder so etwas Ähnliches, als er begriff, dass er vielleicht gerade den größten Fehler seines Lebens gemacht hatte.
Er konnte die anderen nicht mehr hören. Im Augenblick gab es hier nur einen elfjährigen Jungen, eine sehr hohe Mauer und ein paar unsichtbare Augen.
Direkt vor ihm, zwischen Barney und dem eigentlichen Hof, befand sich das Indianerdorf: fünf kleine Wigwams, in denen die kleineren Kinder tagsüber spielten. Selbst an einem ganz normalen Abend konnte Barney die Dinger nicht ansehen, ohne sich vorzustellen, wie jemand – vielleicht ein von zerstreuten Eltern zurückgelassenes Kleinkind – aus der Schwärze zu ihm hinausspähte. Er ging abends nie gern in die Nähe des Indianerdorfs, auch ohne dass … Barney überprüfte nacheinander das dunkle Innere jedes Wigwams. Nichts.
Nichts, was er hätte sehen können.
Gleich hinter den Wigwams war eines der Wandgemälde auf der Innenseite der Mauer. Piraten in roten Jacken, den Blick fest auf ferne Schätze gerichtet, klammerten sich an die Reling einer Galeone in rauer See. Tagsüber war das Wandgemälde verblasst, hier und da blätterte die Farbe ab. Während der dunklen Stunden jedoch erweckte das orangegelbe Licht der Straßenlaternen die Szene zum Leben. Der grüne Wald neben dem Tor bekam Tiefe, und man hatte das Gefühl, dass dort Geheimnisse hinter riesigen Bäumen lauerten. Der Sternenhimmel hinter der Skateboardrampe schien endlos. Ohne das harsche Licht der Sonne schienen sogar die Piraten ihn zu beobachten.
Endlich konnte er von der Ecke des Fabrikgebäudes aus in das Rechteck des Hofes spähen. Die Erleichterung tat fast weh. Oben auf der Skateboardrampe saßen vier regungslose Gestalten. Sein bester Freund Harvey, dann Sam und Hatty, beide aus Harveys Klasse, und schließlich Lloyd, der war ein paar Jahre älter. Vor dem Hintergrund des Laternenlichts sah es aus, als wären sie ganz in Schwarz gekleidet. Barney sah Augen glänzen, als einer von ihnen sich umblickte. Außerdem konnte er das winzige rote Glühen einiger Zigaretten erkennen. Beim Anblick seiner Kumpels, die genau das taten, was sie immer machten, beruhigte auch Barney sich allmählich. Ausnahmsweise hatten seine Instinkte Fehlalarm gegeben.
Ein plötzliches Geräusch, laut und schrill, gellte direkt über seinem Kopf auf. Dann sprang jemand auf ihn herab und packte ihn an der Kehle.
2
Die Kinder waren wunderschön. Zusammengekrümmt lagen sie auf der Seite, eng aneinandergeschmiegt. Die Finger des Jungen, der vorn lag, sahen aus, als würden sie gleich zucken und sich strecken, weil das Sonnenlicht und seine innere Uhr ihm sagten, dass es Zeit zum Aufwachen sei. Selbst im matten Licht des Zeltes sah er nicht tot aus. Und sein Bruder auch nicht, von hinten an ihn gekuschelt und einen Arm achtlos über die Brust seines Zwillings gelegt.
»Boss!«
Dana fuhr zusammen. Ihre behandschuhte Hand streckte sich nach der Stirn des Jungen, der ihr am nächsten lag. Eine feuchte Haarsträhne war nach vorn gefallen. Sie war drauf und dran gewesen, sie ihm aus den Augen zu streichen, so wie eine Mutter es tun würde. Und sie wollte es immer noch tun – ihm das Haar nach hinten streichen, den beiden die Decke über die Schultern ziehen und die kühle Nachtluft von ihnen fernhalten. Sich hinunterbeugen und ihre weichen Wangen mit den Lippen berühren.
Bescheuert. Sie hatte keine Kinder, hatte in ihrem ganzen Leben noch nie mütterliche Gefühle gehegt. Dass diese sich ausgerechnet jetzt melden sollten, dass zwei tote Zehnjährige so etwas ihn ihr auslösten, war ihr neu.
»Boss«, wiederholte der zweite lebendige Mensch im Zelt, ein untersetzter Mann mit schütterem rotem Haar und schwammiger Kinnlinie. »Die Flut kommt, und zwar schnell. Wir müssen sie hier wegschaffen.«
Detective Inspector Dana Tulloch von der Abteilung für Schwerverbrechen, ließ sich von Detective Sergeant Neil Anderson aufhelfen. Sie traten aus dem Polizeizelt in jenen Dunst von Salz, verrottenden Pflanzen und Benzindämpfen hinaus, der an der Themse als Nachtluft galt. Die wartende Menschenmenge auf der Tower Bridge zappelte erwartungsvoll. Licht blitzte auf, als irgendjemand sie fotografierte.
Als sie und Anderson zur Seite traten, nahmen andere rasch ihren Platz ein. In wenig mehr als einer halben Stunde würde dieses Areal einen guten Meter unter Wasser stehen. Die beiden Detectives gingen auf die Ufermauer zu.
»Direkt unter der Tower Bridge«, stellte Dana fest und schaute zu dem gewaltigen Stahlbauwerk empor. »Eines der bedeutendsten Wahrzeichen von London, mal ganz abgesehen davon, dass hier auch mit am meisten los ist. Was denkt der Kerl sich eigentlich?«
»Ist ’n ganz schön freches Arschloch«, brummte Anderson.
Dana seufzte. »Wer war zuerst am Fundort?«
»Pete«, antwortete Anderson und sah sich um. »Eben war er noch hier.«
Dana sah zu, wie weitere Beamte von der Spurensicherung vorsichtig die Horselydown Old Stairs hinunterstiegen, die glitschige Treppe, die den einzigen Zugang zu diesem Teil des Ufers bot.
»Er bringt sie früher um, Neil«, sagte sie. »So schnell haben wir sie noch nie gefunden.«
»Ich weiß, Boss. Da ist Pete.«
Detective Constable Pete Stenning, einunddreißig Jahre alt, hochgewachsen und gut aussehend, mit dunklen Locken, kam leichtfüßig die Stufen zu ihnen herunter.
»Was können Sie uns sagen, Pete?«, fragte sie, als er nahe genug war.
»Die beiden wurden um Viertel nach acht entdeckt, von einem Blumenhändler, der hier um die Ecke sein Geschäft hat. Ich war bis eben bei ihm. Er hatte reichlich zu tun, wo doch Valentinstag ist, und morgen muss er eine große Hochzeit beliefern, also haben er und ein paar Gehilfinnen Überstunden gemacht. Er brauchte eine Zigarette, und Rauchen auf der Straße wird nicht gern gesehen, also geht er dann immer die Treppe hier runter. Er findet es entspannend, dem Fluss zuzusehen, sagt er, und außerdem kann man sich unter die Brücke stellen, wenn’s anfängt zu pissen. Seine Worte, nicht meine.«
»Und da hat er sie gesehen.«
»Es war gerade genug Licht, von der Brauerei hinter ihm und der Brücke vor ihm, sagt er, allerdings war er sich nicht ganz sicher, was der da vor sich hatte, bis er zum Uferstreifen runter ist. Und ehe Sie fragen, sonst hat er nichts weiter gesehen. Die beiden Frauen im Laden bestätigen seine Geschichte.«
»Und wie könnten die beiden hierhergeschafft worden sein?«, erkundigte sich Anderson.
»Mit ’nem Boot vielleicht«, meinte Stenning, »aber ich persönlich bezweifle das. Ist ’ne verdammt schwierige Stelle, um hier anzulegen, außer bei totalem Hochwasser.« Er deutete zum Flussufer. »Da drüben sind die Reste von der alten Promenade, ganz dicht unter der Wasseroberfläche«, fuhr er fort. »Wenn man mit dem Boot da draufkracht, egal mit welcher Geschwindigkeit, dann säuft man höchstwahrscheinlich ab.«
»Also von der Straße aus?«, meinte Dana.
»Ist wahrscheinlicher«, erwiderte Stenning. »Eins sollten Sie sehen«, fuhr er fort. »Nur ein Stückchen weiter unter der Brücke.«
Dana und Anderson folgten Stenning in den Schatten unter der Tower Bridge und versuchten, nicht auf die gereckten Hälse und die neugierigen Blicke ein paar Meter über ihnen zu achten. Dann wandten sich alle Augen von den Polizeibeamten ab und richteten sich auf die beiden kleinen schwarzen Säcke, die aus dem Polizeizelt getragen wurden. Die Jungen wurden fortgeschafft. Ein paar entrüstete Rufe wurden laut, als seien die Polizisten am Flussufer schuld daran, was den Kindern zugestoßen war.
Unter der Brücke suchten Streifenpolizisten mit Taschenlampen das schmale Uferstück ab, das noch begehbar war. Ein kleiner Bereich war mit Polizei-Absperrband eingezäunt worden. Stenning leuchtete mit seiner Taschenlampe darauf.
»Fußabdrücke?«, fragte Anderson.
»Ein großer Stiefel, so ’ne Art Gummistiefel«, verkündete Stenning. »Scheint dasselbe Profil zu sein wie bei denen, die wir in Bermondsey gefunden haben. Die Sache ist nur, er hätte gar nicht hierherzukommen brauchen. Schauen Sie.«
Er deutete zu den Stufen zurück.
»Er trägt sie die Treppe runter und dann ein paar Meter am Ufer entlang, dahin, wo wir sie gefunden haben. Bestimmt will er das doch so schnell wie möglich hinter sich bringen. Und trotzdem geht er das ganze Stück bis hier rüber, ein Umweg von … von so um die acht Meter, um einen Fußabdruck zu hinterlassen.«
»Auf dem einzigen Sandflecken, den ich hier am Ufer sehe«, bemerkte Dana.
»Genau das dachte ich auch, Ma’am«, sagte Stenning. »Auf den Steinen und dem Schotter hätte er keine Spuren hinterlassen. Also geht er zu einem Stück mit Sand, das sich günstigerweise unter der Brücke befindet und vorm Regen geschützt ist. Der will, dass wir ihn finden.«
»Dreistes Arschloch«, knurrte Anderson.
»Wer, Sarge? Der Täter oder ich?«
»Beide. Können Sie die Leichen begleiten, geht das in Ordnung?« Stenning bestätigte, dass das in Ordnung ginge, und machte sich dann auf, um dem Wagen der Gerichtsmedizin zu folgen, der die Leichen der Jungen abtransportierte.
»Ich leiere dann mal die Befragung von Haus zu Haus an, wenn’s Ihnen recht ist«, meinte Anderson.
Dana nickte. Während einer Ermittlung wurde Anderson immer ganz hibbelig, vor allem wenn er gezwungen war, länger als ein paar Minuten still zu stehen.
»Irgendjemand hat bestimmt was gesehen«, fuhr er fort. »Auch wenn er’s jetzt noch nicht weiß.« Er wandte sich zum Gehen, dann drehte er sich noch einmal halb um. »Was ist los, Boss?«
Sie sollte nichts sagen, sollte antworten, es wäre alles in Ordnung. Es war wichtig für das Team, dass bei ihr alles klar war.
»Diese Geschichte macht mir Angst, Neil.«
Sie sah, wie sein Kopf zurückruckte, wie seine Augen schmal wurden. »Sie sind der DI, der den Ripper geschnappt hat«, sagte er. »Ich setze eher darauf, dass der Täter Angst vor Ihnen hat.«
Anderson war dafür bekannt, dass er kein Blatt vor den Mund nahm. Auch wenn das, was dabei herauskam, ganz offenkundig ein Mordsklischee war.
»Mark und Lacey haben den Ripper geschnappt«, erwiderte sie. »Ich habe nur die Lorbeeren abgesahnt. Und vor dem Ripper hatte ich nie solche Angst wie vor diesem Kerl hier. Vier tote Jungen innerhalb von zwei Monaten. Ein weiterer wird noch immer vermisst. Und er gibt Gas. Er entführt sie schneller hintereinander und bringt sie früher um. Wie viel Zeit haben wir bis zum nächsten?«
3
Als sich lange Finger um seinen Hals schlossen, ließ Barney seine Coladose fallen. Die Rollen seiner Skates rutschten weg, und er wäre beinahe hingefallen. Zwei starke Hände hielten ihn aufrecht.
»Immer locker bleiben, Barney-Boy. Mach dir nicht ins Hemd.«
Oh, Scheiße-Scheiße-Scheiße! Während jeder einzelne Nerv kribbelte und ihm am ganzen Körper der Schweiß ausbrach, überlegte Barney, ob recht gehabt zu haben ein Trost dafür war, wie ein absoluter Volltrottel dazustehen. Was zum Teufel zog Jorge hier ab?
»Idiot«, brachte er hervor.
Jorge, der große Bruder seines besten Freundes und der unumstrittene Anführer der Gang, hatte sich auf dem Dach des Fahrradschuppens versteckt. Damit niemand sah, dass er bestimmt knallrot im Gesicht war und dass er Schleim ausgerotzt hatte, bückte sich Barney und hob die nunmehr verbeulte Coladose auf. »Wie lange hast du da oben gesessen?«, fragte er, nachdem er sich die Nase am Ärmel abgewischt und sich aufgerichtet hatte.
»’n paar Minuten.« Jorge versuchte gar nicht erst, sich das Grinsen zu verkneifen. »Hab dich schon drüben an der Ecke gesehen.«
Okay, tief durchatmen. Es war dunkel, also würde vielleicht niemand den Schweiß auf seiner Stirn bemerken. In die Hose hatte er sich nicht gemacht, Gott sei Dank. »Hattest du ’ne Probe?«, erkundigte er sich und versuchte, ganz normal zu klingen.
Jorge nickte. »Mum hat gesimst, ich soll auf dem Nachhauseweg Harvey abholen. Komm.«
Jorge sprang auf sein Skateboard, stieß sich ab und sauste auf die anderen zu. Barney hatte den Eindruck, als lasse er jede Menge aufgestauter Energie in seinem Kielwasser zurück, was selbst für Jorge ungewöhnlich war. Harvey hatte sich in letzter Zeit öfter beschwert, dass sein Bruder immer völlig überdreht sei, wenn er von seinen Theaterproben kam. Dass er mehrere Stunden brauche, bloß um wieder runterzukommen. Wenn er regelmäßig solche Nummern abzog wie eben, konnte Barney verstehen, dass Harvey genervt war.
Der Rest der Gang sah zu, wie zuerst Jorge und dann Barney die Rampe heraufkamen.
»Deine Haare sind ja ganz grün«, bemerkte Hatty.
Jorge warf den Kopf zurück und strubbelte sich durch die normalerweise silberblond gebleichten kurzen Stachelhaare. »Die von der Maske wollten’s mal ausprobieren«, als wäre es vollkommen normal, dass »die von der Maske« sich für das Haar eines Vierzehnjährigen interessierten. »Grüne Haare, passend zum grünen Kostüm. Die wollen da auch noch Blätter reinstecken. Die beiden anderen sind voll angepisst, die haben nämlich dunkle Haare, und bei denen sieht das einfach nicht so geil aus.«
Jorge wollte Schauspieler werden. Vor ein paar Monaten hatte er mit Erfolg für ein Stück im West End vorgesprochen. Zu seinem Ärger jedoch musste er sich die Rolle mit zwei anderen Jungen teilen, weil er erst vierzehn war. Zwei Jungen, die angeblich nicht mal einen Bruchteil seines Talents besaßen.
»Hab ich was verpasst?«, wollte Barney wissen. Ihm war klar, dass er schon vor einer Stunde hier hätte eintrudeln sollen.
»Nö«, antwortete Harvey. »Lloyd hat das Darts-Turnier gewonnen, aber dann hat Sam mit einem von den Dingern nach Tom Rogers Arsch geworfen, und wir sind freundlich aufgefordert worden, doch bitte zu gehen.«
»Euch kann man echt keine fünf Minuten allein lassen«, bemerkte Jorge.
»Habt ihr Hausverbot gekriegt?«, wollte Barney wissen.
»Die haben gesagt, sie wollen uns den Rest der Woche nicht mehr hier sehen«, erklärte Lloyd, ein dunkelhaariger Junge mit großen Augen, der mit Jorge in eine Klasse ging. »Und dass wir gleich nach Hause gehen und nicht noch draußen rumhängen sollen.«
»So wie jetzt?«, fragte Barney.
»Ja«, bestätigte Lloyd. Seine braunen Augen waren weit aufgerissen und sehr ernst. »So hier rumzuhängen wie jetzt, das wäre echt verkehrt.«
Hatty erhob sich wortlos und flitzte die Rampe hinunter; sie war die beste Rollerskaterin der Gang, vielleicht mit Ausnahme von Barney. Sie schoss an der anderen Seite der Rampe hinauf und fing sich an der Barriere ab. Lloyd, Sam und die beiden Brüder betrachteten eine verbogene Rolle an Harveys Skateboard. Nur Barney sah, wie Hatty den Kopf hob wie ein Hund, der gerade etwas gewittert hat. Sie schaute auf etwas, das ein Stück entfernt war. Nachdem sie ein paar Sekunden lang dorthin gestarrt hatte, machte sie kehrt und kam zu den Jungen zurückgefegt.
»Ratet mal, wer wieder da ist«, sagte sie mit gedämpfter Stimme.
Die anderen drehten sich allesamt um, einige sahen Hatty an, die anderen versuchten auszumachen, was sie gesehen hatte.
»Wo denn?«
»Du hast mal wieder geträumt, Hats.«
Barney blickte an den Wirtschaftsgebäuden der Fabrik vorbei, die jetzt als Lagerräume dienten, über die Mauer und das Eisengitter hinaus in die Straßen von South London. Auf der anderen Straßenseite standen Reihenhäuser, dahinter ragte das riesige leere Haus mit dem verzierten Mauerwerk und den leeren, schwarzen Fenstern auf. Er hörte auf zu blinzeln, hörte auf, nach irgendetwas Bestimmten Ausschau zu halten, und wartete, ließ zu, dass sich der Fokus seines Blicks veränderte, bis er nicht mehr die Umrisse der Gebäude sah, den Verlauf der Bürgersteige, die Skyline. Wie er es vorher gewusst hatte, fingen die Dinge vor ihm an, sich aufzulösen, ihre Struktur zu verlieren und sich auf ihre simpelsten Formen zu reduzieren. Er wartete darauf, dass etwas ganz Bestimmtes zum Vorschein kam. Und tatsächlich – dort war sie. Das Gesicht hob sich blass von der Backsteinmauer ab, ihr dunkler Mantel war glatter, reflektierte das Licht stärker als ihre Umgebung. Er fragte sich, wie lange sie diesmal schon dagestanden hatte und ob er dieses Gefühl des Beobachtetwerdens nur wegen Jorge gehabt hatte. Er blinzelte, und das, was er sehen konnte, wurde wieder normal.
»Sie steht hinter dem roten Auto«, sagte er. »Man kann ihren Kopf sehen und ihre Schultern.«
»Die spinnt doch!«
»Was will die überhaupt?«
»Das ist ’ne verdammte Perverse, spioniert Kindern hinterher. Ich finde, wir sollten die Bullen rufen.«
»Sie ist ein Bulle«, erwiderte Barney. »Sie ist Detective.«
Schweigen, dann fragte Jorge: »Bist du sicher?«
Barney nickte. »Sie wohnt bei uns nebenan«, sagte er. »Sie heißt Lacey, glaube ich.«
»Und was macht sie da? Auf dich aufpassen?«
»Wir kennen sie kaum«, wehrte Barney ab. Er wusste, dass er Riesenärger kriegen würde, wenn Lacey seinem Dad erzählte, wo er abends hinging.
Jorge stand auf und reckte den Hals, starrte die Polizistin unverwandt an. Sie schaute weiter zu ihnen hinüber. Allmählich verzog sich Jorges Oberlippe höhnisch.
»Scheiße!«, stieß Hatty mit schriller Stimme hervor.
»Was ist denn?« Die anderen wandten sich von der Polizeibeamtin ab und sahen das Mädchen in ihrer Mitte an.
»Hab meinen Ohrring verloren.« Hatty strich sich das Haar zurück, um ihre winzigen Ohren zu zeigen. In einem Ohrläppchen steckte ein kleiner Zierstecker in Gestalt eines Blatts. Das andere war leer.
»Halt mal still«, sagte Barney und streckte die Hand aus. Etwas so Weiches wie Harrys Haar hatte er noch nie angefasst, außer vielleicht das Fell der Angorakaninchen in der Tierhandlung. Bei der Berührung zuckte ein scharfes Gefühl geradewegs in seine Magengrube, so dass er sich am liebsten gewunden hätte. Da! Das winzige Stück Gold klemmte zwischen seinen Fingern, und er ließ es in Hattys ausgestreckte Hand fallen. Kein Ohrring, bloß ein wichtiger Teil davon.
»Das ist bloß der Verschluss«, sagte Hatty. »Scheiße, das Ding könnte überall sein.«
»Hüpf mal ein bisschen auf der Stelle«, schlug Jorge vor. »Ist wahrscheinlich irgendwo hängen geblieben.«
Während Hatty hopste, so dass der Stahl unter ihnen dröhnte und ächzte, stand Barney auf und rollte die Rampe hinunter. Den Blick hartnäckig gesenkt, fuhr er ein paarmal hinauf und hinunter. Keine Spur von dem verlorenen Ohrring.
»Ich muss nach Hause«, verkündete Sam. »Hab diese dämliche Zusammenfassung vom Schulausflug noch nicht geschrieben.«
Hatty sagte, sie würde ebenfalls gehen.
»Ich und Harvey bringen dich nach Hause«, entschied Jorge, während die Brüder die Rampe hinunterrollten und sich zu Barney gesellten. »Hier treibt sich ’n Perverser rum, schon vergessen?«
»Ein Perverser, der Jungs umbringt«, entgegnete Hatty, deren Miene wegen des verschwundenen Ohrrings noch immer düster war. »Was soll das Theater also.«
»Und welchen Teil von ›bring deinen Bruder sofort nach Hause‹ hast du nicht verstanden?«
Die ganze Gang schrak zusammen. Sie waren so sehr auf die Detective-Polizistin fixiert gewesen, die sie von der anderen Seite des Tores her beobachtete, dass sie die andere Frau gar nicht bemerkt hatten, die im Hof aufgetaucht war, ohne dass irgendjemand sie gesehen hätte, nicht einmal Barney.
»Wie bist du denn hier reingekommen?« Harvey drehte sich zum Tor um.
»Jorge wiegt mehr als ich«, antwortete die kleine, silberhaarige Frau, »und ist drei Zentimeter größer. Wenn der sich durch eine Lücke im Gitter quetschen kann, schaffe ich das auch.« Sie sah sich auf dem Hof um, betrachtete die hohe Mauer, die dunklen Gebäude, das Tor. »Wieso hab ich das Gefühl, ihr dürftet eigentlich gar nicht hier sein?«
»Du hast doch gesagt, du arbeitest«, sagte Jorge.
Die Mutter von Jorge und Harvey war freischaffende Fotografin. Manchmal blieb sie die ganze Nacht weg, war im Büro einer Nachrichtenagentur in Rufbereitschaft, und Harvey und Jorge wurden der Obhut ihrer alten Großmutter überlassen. Ihr Dad, der Kriegsberichterstatter für die BBC gewesen war, war gestorben, bevor Harvey geboren worden war.
»Der Job ist zu Ende«, erwiderte seine Mutter. »Und diese kleine Party hier auch. Gute Nacht zusammen. Und jetzt ab nach Hause.«
Die Brüder und Hatty verabschiedeten sich, ehe sie hinter Jorges und Harveys Mum her über den Hof zottelten.
»Kommst du auch?«, fragte Lloyd Barney.
Barney nickte. »Mein Dad macht einen Riesenstunk, wenn ich mich noch mehr verspäte«, meinte er. »Ich such bloß noch mal schnell nach Hattys Ohrring. Bis dann.«
Allein drehte Barney eine letzte Runde über den Hof. Der Regen von vorhin war auf eine schmale Abflussrinne zugeflossen, die sich am Rand des Hofes entlangzog. Barney fuhr ganz langsam und folgte dem Verlauf des Regenwassers, bis die Rinne unter der Erde verschwand; ein Eisenrost hielt sämtliches Treibgut zurück. Dort hörte er auf zu blinzeln und ließ seine Augen wieder jeglichen Fokus verlieren. Nachts dauerte das immer länger, doch nach einem Moment oder vielleicht auch zwei trat etwas ganz Bestimmtes hervor. Und da war er. Klebte an einem Mars-Papier. Er bückte sich, pflückte das Schokoladenpapier aus dem Abfluss und rettete Hattys Ohrring.
Strahlend schaute Barney sich um; einen Augenblick lang hatte er völlig vergessen, dass die anderen gegangen waren. Er war noch nie allein hier gewesen. Ihm war gar nicht klar gewesen, wie hoch die Mauern waren oder wie dunkel die Schatten darunter wurden, wenn niemand da war und ihn ablenkte. Er blickte direkt in das gemalte Gesicht eines Mädchens mit langen Haaren an der Mauer gegenüber. Sie saß mitten im Meer auf einem Felsen. Das Mädchen lächelte ihn an, und zwar nicht auf freundliche Weise, und ihre merkwürdigen grünen Augen schienen zu sagen, dass sie ein Geheimnis kannte und dass sie bloß den richtigen Moment abwartete, bevor sie es ausplauderte.
Ein plötzliches Rascheln hinter ihm ließ Barney zusammenfahren. Der Wind, der normalerweise von der Mauer abgehalten wurde, blies eine Chipstüte über den Boden. Zeit zu gehen. Er verließ den Hof und skatete zur Hauptstraße hinüber. Vielleicht würde er ja Gelegenheit haben, Hatty den Ohrring zurückzugeben, wenn sie allein waren. Er würde die Hand ausstrecken und ihn ganz sanft in das Loch in ihrem linken Ohrläppchen schieben.
»Barney!«
Wieder zuckte er zusammen, als wäre er angeschossen worden. Er hatte gar nicht gemerkt, dass die Polizistin näher gekommen war, hatte sie vollkommen vergessen.
»Hi«, sagte sie, als sie vor ihm stand. »Willst du nach Hause?«
Er nickte.
»Wir sollten zusammen gehen«, meinte sie. »Ist ganz schön dunkel.«
»Okay.« Er konnte im Schritttempo skaten, wenn er wollte, obwohl er fairerweise sagen musste, dass sie echt gut zu Fuß war. Sie war größer als er und dünn, mit langem, zum Pferdeschwanz nach hinten gezerrtem Haar. Es schien ihr nie wichtig zu sein, wie sie aussah. Andererseits schien sie immer ziemlich gut auszusehen.
»Sind Sie im Dienst?«, fragte er, nachdem sie die Straße schon halb hinuntergegangen waren.
»Nein«, antwortete sie. »Im Moment arbeite ich nicht, ich bin krankgeschrieben.«
Verstohlen schielte er zu ihr hinüber. Sie sah gar nicht krank aus. Zum einen ging sie jeden Morgen laufen; er hörte, wie sie das Haus verließ, wenn er sich für den Zeitungsladen fertig machte, und oft kamen sie gleichzeitig wieder nach Hause. Manchmal hatte er sie mit dem Fahrrad wegfahren sehen, mit einer Sporttasche über der Schulter. Und abends verließ sie oft zu Fuß das Haus und kam erst Stunden später zurück.
Sie hatten die Straßenecke erreicht, und Barney empfand ganz kurz Dankbarkeit, dass er nicht allein war. Das hier war das Stück des Nachhauseweges, das ihm zu schaffen machte. Er ging nicht gerne an dem alten Haus vorbei. Trotz des Gitterzauns, und obwohl sämtliche Türen und Fenster im Erdgeschoss mit Brettern vernagelt waren, kam er nicht gegen das Gefühl an, dass da jemand drin sein könnte, der jeden Augenblick hervorgestürzt kommen konnte.
»Das Haus ist echt unheimlich«, bemerkte er.
»Du solltest es erst mal von innen sehen«, erwiderte sie. »Bevor die Fenster richtig zugenagelt wurden, sind da immer Jugendliche und Obdachlose eingebrochen. Wir sind ziemlich oft hierherbeordert worden.«
Sie bogen um die Ecke und ließen das Haus hinter sich zurück.
»Barney, ich weiß, eigentlich geht mich das nichts an«, sagte sie. »Aber ich weiß nicht, ob es im Moment für dich und deine Kumpels so ganz ungefährlich ist, sich draußen rumzutreiben, wenn es dunkel ist.«
»Wir bleiben doch zusammen«, wandte Barney ein. »Wir passen aufeinander auf. Und Jorge und Lloyd sind schon fast fünfzehn.«
Er wartete darauf, dass Lacey ihn darauf hinwies, dass er allein gewesen war, als sie ihn getroffen hatte, und machte sich innerlich bereit zu erwidern, dass er echt schnell sei. Dass niemand ihn zu Fuß einholen könne, wenn er erst mal in Fahrt sei.
»Fünf Jungen in deinem Alter sind vor Kurzem verschwunden«, fuhr sie fort. »Keiner von ihnen hat weit von hier gewohnt.«
»Was ist mit ihnen passiert?«, wollte er wissen. »Im Fernsehen wird nie gesagt, wie sie umgekommen sind. Glauben Sie, die Barlow-Zwillinge sind auch tot?«
»Ich hoffe nicht«, antwortete sie mit einer Stimme, die ihm verriet, dass sie sich ziemlich sicher war, dass die beiden tot waren.
4
Allein auf dem schnell kleiner werdenden Uferstreifen ging Dana zum Wasser hinunter. Vor etwas mehr als einem Jahr, als sie aus ihrer Heimat Schottland nach London gezogen war, hatte sie sich in den Fluss bei Nacht verliebt. Sie fand es wunderbar, wie er sich wie eine glatte schwarze Schlange zwischen den Gebäuden hindurchwand und nur widerspiegelte, was an der Stadt schön war – ihre Lichter, ihre Architektur, ihre Farben. Jetzt würde die Tower Bridge sie immer an zwei kleine, blasse Leichname erinnern, an zwei Jungen, die johlend diesen Uferstreifen hätten entlangrennen und nicht in Leichensäcken von hier abtransportiert werden sollen. Sie holte ihr Handy aus der Tasche.
»Hey«, sagte eine tiefe Männerstimme mit South-London-Akzent.
»Hi. Wo bist du gerade.«
Pause. »Einfach nur im Auto. Geparkt, ich fahre nicht. Was gibt’s?«
»Sie waren es. Die Barlow-Zwillinge. Wie wir es wohl geahnt hatten.«
Ein geflüsterter Fluch. »Alles okay?«
»Ich bin unterwegs zu den Eltern. Mark, ihre Mutter …«
Wieder eine Pause. »Soll ich mitkommen?«
Dana lächelte in sich hinein und schüttelte den Kopf. »Nein«, sagte sie. »Das kriege ich schon hin. Was treibst du denn gerade?«
Ein Seufzer rauschte durch die Leitung. »Dana, es gibt Dinge, die du lieber nicht wissen solltest.«
»Damit ist ja wohl genug gesagt.«
Schweigen.
»Was ist los?«
»Eigentlich sollte ich das nicht sagen«, meinte Dana. »Und ich würde es auch zu niemandem sonst sagen. Ich habe nicht den geringsten Be…«
»Dana, sag’s einfach.«
»Ich glaube, es ist eine Frau.«
Einen Herzschlag lang Schweigen, dann: »Ach ja?«
»Kein sexueller Missbrauch. Keinerlei Misshandlungen, außer der tödlichen Wunde. Ihre Leichen sind vollkommen unversehrt, und wir finden sie zusammengekuschelt, als würden sie schlafen. Wenn man sie einfach nur ansieht – ach, ich kann’s nicht erklären, sie wecken so viel Liebe in einem. Ich weiß, das hört sich blöd an, aber ich glaube, die Täterin liebt sie, auf ihre eigene Art und Weise. Ich glaube, sie will ihnen eigentlich gar nicht wehtun, ich glaube, sie kann einfach nicht anders. Ich glaube, sie hat vielleicht ihren eigenen Sohn im selben Alter verloren, und irgendetwas bringt sie dazu, das an anderen immer wieder durchzuspielen.«
»Gibt’s irgendwas, das darauf hinweisen würde, abgesehen von dem, was dein Bauch dir sagt?«
»Nichts.«
»Dann ist es doch möglich, dass das die ganz normale Reaktion einer Frau in deinem Alter ist, die mit toten Kindern konfrontiert wird, und dass du das auf den Mörder projizierst.«
»Ja, aber …«
»Ich bin noch nicht fertig. Andererseits ist das als Theorie gar nicht so völlig daneben. Du kannst ja mal überprüfen, wie viele Jungen in diesem Alter in den letzten Jahren in London gestorben sind. Ob irgendeiner davon aufgrund eines massiven Blutverlusts umgekommen ist, ob eine von den Müttern sich extrem schwergetan hat, damit fertigzuwerden. Ist auf jeden Fall eine Spur.«
»Ja, das kann ich noch heute Abend anleiern. Hör zu, ich muss Schluss machen. Danke, Mark.«
Dana brach die Verbindung ab und hörte ein Plätschern zu ihren Füßen. Während der einen Minute oder so, die sie hier gestanden und telefoniert hatte, war das Wasser näher herangekrochen. Sie machte einen Schritt rückwärts und stolperte, dann machte sie kehrt und ertappte sich dabei, wie sie schneller ausschritt, als klug war. Die Lampen der Spurensicherung waren abgebaut worden, die meisten Leute waren vom Ufer und von der Brücke verschwunden, und sie musste wirklich aufpassen, wo sie hintrat. Rutsch spätabends auf so einem Uferstreifen aus, schlag dir den Kopf an, während die Flut auflief, und das konnte dann dein Ende sein.
Erst als sie die erste Stufe erreichte, die nicht von Algen verkrustet war, spürte Dana, wie ihr Herzschlag sich allmählich verlangsamte. Sie wandte sich ein letztes Mal um. Inzwischen war es unmöglich zu erkennen, wo der Uferstreifen endete und der Fluss begann. Doch sie konnte das Wasser immer noch hören, das leise, wispernde Geräusch, das es machte, als es auf sie zugekrochen kam.
5
»Bearbeiten Sie die Morde, wenn Sie wieder zum Dienst gehen?«, fragte Barney, als sie in die Straße einbogen, in der sie beide wohnten. Lacey blickte auf den Jungen hinab, der nur wenige Jahre davon entfernt war, ein Mann zu werden, und dessen Gesicht doch so frisch war, dessen Haut so glatt und dessen Gedankengänge so ungeheuer offenkundig waren. Er dachte, sein Ansehen bei seiner Gang würde gewaltig steigen, wenn er einen heißen Draht zu einem Mordfall hatte. Vor allem zu einem, bei dem es um Kinder ging. Die Menschen interessierten sich unweigerlich mehr für Morde, wenn sie selbst potenzielle Opfer waren.
Fast tat es ihr leid, ihn zu enttäuschen. »Nein, ich bearbeite keine Morde«, antwortete sie. »Mein Job ist lange nicht so aufregend.«
Sie konnte sehen, dass er sie beobachtete, darauf wartete, dass sie ihm erzählte, was genau ihr Job sei, und hoffte, sie wäre beim Drogen- oder Sittendezernat, oder vielleicht beim Überfallkommando. Doch wie konnte sie einem Jungen, den sie kaum kannte, erklären, dass sie nicht glaubte, dass sie jemals wieder als Polizistin arbeiten würde?
»Du und deine Kumpels, ihr seid echt gut«, sagte sie. »Ich hab euch jetzt schon ein paarmal zugesehen. Wenn das Licht euch genau richtig erwischt, vor allem vor den Bildern auf der Mauer, dann sieht’s aus, als würdet ihr fliegen.«
»Meine Kumpels haben Angst vor Ihnen.«
Die Worte schienen sie beide völlig zu überrumpeln. Barneys Lippen waren fest zusammengekniffen, und er warf ihr einen Oh-Scheiße-Blick zu.
»Und du?«, fragte sie ihn.
»Nein«, sagte er nach kurzem Zögern. »Aber ich hab Sie ja auch schon vorher gekannt.«
Vorher. Dieses Kind, mit dem sie sich weniger als ein Dutzend Mal unterhalten hatte, erinnerte sich, wie sie vorher gewesen war. Großer Gott, nicht mal sie selbst konnte sich daran erinnern.
Barney war stehen geblieben. »Er ist wieder da.« Seine Stimme war tiefer geworden, eine Andeutung der Männerstimme, die sich in ein paar Jahren einstellen würde, und irgendetwas an seinem Tonfall versetzte sie in volle Alarmbereitschaft. Sie hielt ebenfalls an.
»Wer ist da?«, fragte sie. Zwei Frauen mittleren Alters gingen ein Stück weiter die Straße hinauf, von ihnen weg. Vor Barneys Haustür stand niemand.
»Der Mann, der Sie beobachtet.«
Lacey staunte über die Komplexität des menschlichen Herzens, das gleichzeitig Furcht, Kummer und Freude empfinden konnte. Alles aus ein und demselben Grund. »Was denn für ein Mann?«, fragte sie, obwohl sie es ganz genau wusste.
»Der, der immer vor Ihrem Haus im Auto sitzt«, antwortete der Junge. »Der so oft bei Ihnen anklopft.«
»Wo ist er?«, wollte sie wissen. »Nicht zeigen oder hinschauen, sag’s mir einfach.«
Der Junge war klug, genau das tat er. »Er sitzt in einem grünen Auto auf der linken Straßenseite, ungefähr sechs – nein, sieben Autos von hier.«
Sie war so stark, die Versuchung, nach dem Wagen Ausschau zu halten, sich zu vergewissern, dass er recht hatte. »Wie in aller Welt hast du das bemerkt?«
Barney zuckte die Achseln und machte ein unbehagliches Gesicht. »Ich seh eben alles Mögliche.«
»Wie meinst du das, du siehst eben alles Mögliche? Ich hätte nicht mal mitgekriegt, dass da so weit die Straße runter ein grünes Auto steht, aber du siehst nicht nur das Auto, du siehst auch einen Mann da drinsitzen, und das im Dunkeln.«
Er seufzte. »Die Farben von den Autos spiegeln sich im Wasser auf der Straße«, erklärte er. »Da stehen ein silbernes, ein schwarzes, ein rotes, noch mal zwei silberne, ein weißer Lieferwagen, und dann das grüne.« Er konnte die Reihe der parkenden Autos nicht sehen; sie versperrte ihm die Sicht. Wenn er recht hatte, war das unglaublich. Ein unfassbares Wahrnehmungs- und Erinnerungsvermögen.
»Die Straßenlaternen leuchten durch die Autos durch«, fuhr er fort. »Durch die meisten fällt das Licht einfach glatt durch, aber in dem grünen ist ihm etwas im Weg. Ein dunkler, fester Umriss, das können nur ein ziemlich großer Kopf und Schultern sein. Ein Mann in einem grünen Auto. Eindeutig.«
»Ich glaube, wir müssen dich für die Polizei anwerben«, bemerkte Lacey.
Seine Gesichtszüge wurden weicher. »Ich konnte immer schon gut Sachen finden«, sagte er. »Als Kind hab ich immer vierblättrige Kleeblätter im Gras gefunden. Meine Mum hat sie für mich gesammelt, in einer Schachtel. Die hab ich immer noch. Wenn Sie mal was verlieren – Sie wissen schon, Schmuck oder so –, dann rufen Sie einfach an. Ich find’s dann wahrscheinlich wieder.«
»Ich habe nur sehr wenig Schmuck«, meinte Lacey. »Aber ich könnte ein vierblättriges Kleeblatt gebrauchen, wenn du das nächste Mal eins findest.«
»Die sehe ich eigentlich nicht mehr.« Er nahm sie ernst. »Das hab ich ausgewachsen. Jetzt sehe ich andere Sachen. Verlorene Sachen.«
Sie überquerten die Straße und blieben vor Barneys Haustür stehen. Beide hatten sich nicht nach dem grünen Auto umgeschaut, doch Barneys Augen kamen nicht zur Ruhe. »Machen Sie sich Sorgen wegen dem da hinten?«, wollte er wissen.
Sie schüttelte den Kopf. »Nein, in gewisser Weise arbeiten wir zusammen. Ehrlich gesagt ist er mehr ein Freund.«
Etwas, das für einen Elfjährigen viel zu frühreif war, erschien in seinem Gesicht. Ein Freund? Der vor ihrer Wohnungstür herumhing, an ihre Tür hämmerte, weil sie nicht ans Telefon ging, wenn er anrief?
»Er macht sich Sorgen um mich«, fuhr sie fort. »Verstehst du, ich war krank. Ich will nur einfach im Moment mit niemandem reden.«
Der viel zu erwachsene Gesichtsausdruck wich einem, der ganz und gar kindlich war. »Außer mit mir«, sagte er und lächelte sie an.
Es war verblüffend leicht zurückzulächeln. »Ja, außer mit dir.«
Lacey wollte gerade Gute Nacht sagen, als ihr der Gedanke kam, einen Blick zu dem Haus hinaufzuwerfen. Sämtliche Fenster waren dunkel. Nicht einmal im Flur brannte Licht.
»Ist dein Dad zu Hause?«, fragte sie ihn. Es war nach halb zehn. Kinder seines Alters, frühreif oder nicht, sollten so spät nicht allein sein. Wenn jemand dergleichen auf dem Revier gemeldet hätte, wäre sie verpflichtet gewesen, der Sache nachzugehen.
»Wahrscheinlich«, antwortete Barney. »Vielleicht ist er mal kurz raus. Oder er ist in seinem Arbeitszimmer. Das geht nach hinten raus, deshalb kann man nicht sehen, ob da Licht an ist.«
Der Junge konnte ihr nicht mehr in die Augen sehen. Er log. Er wusste ganz genau, dass sein Vater nicht da war.
»Möchtest du mit zu mir kommen, bis er zurückkommt?«, fragte sie und wusste, dass das den Insassen des grünen Autos noch ein wenig länger fernhalten würde. Vielleicht würde er sogar aufgeben und nach Hause fahren.
Barney schüttelte den Kopf. »Ich komm schon klar«, versicherte er. »Wahrscheinlich ist er ja da. Ich geh einfach gleich ins Bett.«
»Hast du ein Handy?«
Er zog es aus der Tasche und hielt es ihr hin. »Hast du dich geschnitten?«, wollte sie wissen, ohne das Handy zu nehmen. Ein Ausdruck der Panik, so scharf und unverhofft wie eine Ohrfeige, zuckte über sein Gesicht. Rasch blickte er auf seine Hand hinab und bemerkte zum ersten Mal, dass seine Finger mit etwas verschmiert waren, das sehr nach Blut aussah.
»Iiih!« Mit extrem angewiderter Miene rieb er die Hand an seiner Jacke. Dann schauderte er. »Nein. Hab bestimmt nur irgendwas angefasst.«
Lacey lächelte, nahm das Handy und tippte sowohl ihre Mobil- als auch ihre Festnetznummer in sein Kontaktverzeichnis. »Für den Fall, dass du mich mal brauchst«, sagte sie. Er nickte, schloss die Haustür auf und wandte sich um, um Gute Nacht zu sagen.
»Wasch dir die Hände, bevor du irgendwas isst«, riet sie ihm. Er schaute über ihre Schulter zu der Reihe parkender Autos auf der Straße hinüber.
»Der klopft bestimmt bald wieder an«, sagte er, ehe er im Haus verschwand.
6
Im Haus herrschte wie üblich ein Riesendurcheinander. Barney blickte sich um, sah die Reste vom Abendessen auf der Arbeitsplatte aus Granit, das schiefe Rollo, den Pullover seines Vaters auf einem Hocker. Zwei Schubladen waren nicht ganz zu, eine Küchenschranktür stand sperrangelweit offen. Irgendwie galt die Regel, dass Erwachsene ihren Kindern hinterherräumen sollen, im Haus der Roberts nicht.
Er drehte den Heißwasserhahn auf und ließ das Wasser über seine Hände laufen. Geschnitten hatte er sich nicht, da war er sich ziemlich sicher, aber dieses eklige Zeug da an seinen Händen hatte ganz kurz wie Blut ausgesehen. Er seifte sie mehrere Male ein und spülte sie ab, ehe er sich über die Küche hermachte. Ordnung war seiner Mum wichtig gewesen; das war eines der wenigen Dinge, die er von ihr noch wusste.
Am Spülbecken zog Barney das Rollo hoch, um es geradezurücken. Licht im Garten nebenan verriet ihm, dass Lacey im Wintergarten ganz hinten in ihrer kleinen Wohnung war.
Lacey könnte ihm helfen, seine Mum zu finden.
Der Abwasch war gemacht. Barney ließ das Wasser ablaufen. Er konnte gar nicht verstehen, wieso er nicht schon früher daran gedacht hatte. Die Polizei fand doch andauernd irgendwelche Vermissten. Aber wenn er irgendjemandem erzählte, was er tat, dann würde das Unglück bringen, und es würde nicht gelingen. Irgendwie wusste er das genau. Er durfte es niemandem erzählen. Und überhaupt – was wäre, wenn sie es seinem Dad sagte?
Als alles weggeräumt war und alle Arbeitsflächen wieder sauber waren, stieg Barney zwei Treppen ins oberste Stockwerk hinauf. Unterwegs schaltete er die Rufumleitung aus, die sämtliche eingehenden Anrufe auf sein Handy weiterleitete. Eigentlich durfte er nicht raus, wenn sein Dad nicht zu Hause war.
Im zweiten Stock des Hauses befanden sich Barneys Schlafzimmer, sein Bad und sein Arbeitszimmer. An einer Wand des Wohnzimmers hing ein riesiges Poster, das das Sonnensystem zeigte, an der anderen eine große Künstlerimpression eines Schwarzen Lochs. Er interessierte sich nicht besonders für Astrologie, die beiden Poster waren lediglich die größten gewesen, die er bei Amazon hatte auftreiben können. Er zog die acht Heftzwecken heraus, die sie an der Wand hielten und rollte sie zusammen. Darunter hingen seine Ermittlungen. Die erste befasste sich mit den Jungen, die umgebracht worden waren. Ihre Fotos, die er von Nachrichten-Websites hatte, waren ganz oben aufgereiht. Darunter hatte er eine Karte des Flusses befestigt, auf der kleine farbige Aufkleber die Stellen markierten, wo ihre Leichen gefunden worden waren. Barney hielt es nicht für sehr wahrscheinlich, dass sein Dad seine Nachforschungen entdecken würde – er kam fast nie in dieses Zimmer –, doch er hatte für alle Fälle einen Plan parat. Er würde sagen, die Aufzeichnungen wären für ein Schulprojekt über die Arbeit der Londoner Polizei.
Mit dem Finger zog er den Lauf des Flusses nach, fing ganz weit stromabwärts in Deptford an, wo der erste Leichnam gefunden worden war. Der Mörder arbeitete sich den Fluss hinauf; er kam näher. Barneys Finger verweilte dicht bei der Tower Bridge.
An der Wand gegenüber hing ein zweiter großer Stadtplan, diesmal von sämtlichen Bezirken Londons. Im Augenblick war Haringey an der Reihe. Die Briefumschläge, die er vorhin eingeworfen hatte, enthielten jeder einen Anzeigentext für den Haringey Independent und den Haringey Advertiser.BARNEYRUBBLE, Barney Geröllheimer, lautete die fette Überschrift, denn so hatte seine Mum ihn immer genannt, als er klein war, nach der Figur aus Fred Feuerstein. Das war der Hingucker. Die Nachricht darunter hatte er oft geändert, weil er noch immer nicht sicher war, was am besten funktionieren würde. Manchmal lautete sie einfach nur: VERMISSTDICH. Dann wieder in ganz formlosem Plauderton: WÜRDEDICHGERNMALWIEDERSEHEN. Einmal hatte er es mit STIRBTOHNEDICHJEDENTAGEINBISSCHEN versucht, doch das hatte er bereut, sobald er den Brief eingeworfen hatte. So etwas sagte man einfach nicht in der Zeitung, nicht einmal anonym. Nicht einmal, wenn es stimmte.
Die Anzeigen endeten jedes Mal mit einer E-Mail-Adresse, mit der, die er heimlich eingerichtet hatte und die er jeden Morgen aufrief, weil, dies konnte ja der Tag sein, an dem seine Mum sich endlich meldete.
Nächsten Monat würde er sich Islington vornehmen. Mit dreizehn hätte er dann das ganze Londoner Stadtgebiet abgegrast und würde mit den angrenzenden Grafschaften anfangen müssen.
Eigentlich spielte es keine Rolle, ob sein Dad diesen Stadtplan fand. Er würde nie darauf kommen, um was es hier ging. Es war ihm irgendwie einfach nur wichtig, das Ganze für sich zu behalten.
Barney hängte die Astronomie-Poster wieder auf und ging zu seinem Computer. In seinem Postfach waren ein paar Mails von Schulfreunden, eine von seinem Sportlehrer Mr Green, wegen einer Veranstaltung an diesem Wochenende, und eine lange Liste Benachrichtigungen, dass jemand auf einen Comment-Stream geantwortet hatte, zu dem er auf Facebook etwas geschrieben hatte. Streng genommen war Barney gar nicht alt genug, um auf Facebook zu sein, aber die meisten aus seiner Klasse hatten ihre eigene Seite. Sie hatten einfach ein falsches Geburtsjahr angegeben. Er schaute auf die Uhr, ein paar Minuten hatte er noch, bevor er ins Bett gehen sollte.
Auf Facebook ging er geradewegs zu der »Missing Boys«-Seite, die vor ein paar Wochen eingerichtet worden war, als Ryan Jackson verschwunden war, der zweite Junge aus South London. 5673 Personen waren inzwischen Follower der Seite, und wie immer war jede Menge gepostet worden, von vernünftigen bis zu schlichtweg lächerlichen Beiträgen.
Ein Typ war der Ansicht, die Jungen würden für irgendwelche schrägen medizinischen Experimente benutzt, in einem geheimen Forschungszentrum irgendwo am Flussufer.
Manche Kommentare schienen tatsächlich von Freunden der Jungen zu stammen, andere von Fremden, die ihnen eine sichere Heimkehr wünschten. Nicht alle waren freundlicher Natur, und die üblichen Leute empörten sich darüber, dass eine Social-Media-Site dem »Sich-Suhlen im Unglück anderer« Vorschub leistete.
Schließlich näherte sich Barney dem Ende des Threads. Mann, manche Leute waren echt schräg drauf. Und dieser Peter Sweep war wahrscheinlich der Abgedrehteste von allen. Zum einen schon mal kein Profilbild, nur ein Foto von ein paar blutroten Rosen. Und auch keinerlei persönliche Angaben, obwohl das bei Kids auf Facebook gar nicht so ungewöhnlich war. Er hatte fast fünfhundert Freunde, doch das schienen alles Leute zu sein, die die »Missing Boys«-Seite ebenfalls gelikt hatten. Das Ganze sah aus, als wäre die Seite einzig und allein für Kommentare über die Morde eingerichtet worden. Barney saß da und starrte auf Peters jüngsten Beitrag, der letzte im Thread.
Voll der Hammer – schon zwei Tote. Und jetzt vielleicht noch zwei!
Der Thread updatete, und Barney las voller Interesse weiter. Wieder Peter Sweep.
Neues von den Barlow-Zwillingen. Die Polizei von Lewisham hat heute Abend zwei Leichen vom Themseufer geborgen. Offizielle Bekanntmachung demnächst zu erwarten. RIP, Jason und Joshua, nunmehr bekannt als die Himmlischen Zwillinge.
Peter Sweep war einer der treuesten Kommentatoren der Seite. Seine Beiträge begannen stets tatsachenbezogen, klangen fast offiziell, und anfangs hatte mehr als ein Follower spekuliert, dass Peter irgendwie mit den polizeilichen Ermittlungen zu tun hatte. Was er postete, stellte sich jedenfalls immer als richtig heraus. Doch dann fügte er am Schluss immer so abartige kleine Bemerkungen hinzu. Das machte es wiederum sehr unwahrscheinlich, dass er Polizist war.
In den paar Sekunden, seit Peter gepostet hatte, war eine Flut von Kommentaren eingegangen. Barney entdeckte Lloyd, der in den Austausch eingestiegen war, und gleich darauf Harvey. Wie gewöhnlich waren die Leute ganz scharf auf mehr Informationen, einschließlich der, wie Peter an diese sensationelle Neuigkeit gekommen war. Wie gewöhnlich antwortete er nicht.
Aus dem Nichts kam Barney ein Gedanke. Wenn er verschwinden sollte, wenn sein Gesicht jeden Abend im Fernsehen wäre, in den Zeitungen, auf Plakaten und Flugblättern, würde seine Mum es dann sehen? Würde das ausreichen, um sie zurückzubringen? Es konnte Jahre dauern, sich geduldig durch sämtliche Regionalzeitungen zu wühlen. Er würde jeden Penny ausgeben, den er besaß, und keinen Schritt weiterkommen. Doch wenn er verschwände, dann würde er auf einen Schlag landesweit bekannt sein. Das müsste doch funktionieren, oder? Dann müsste sie doch zurückkommen.
Barney stand auf; plötzlich hatte er die Facebook-Seite satt, mit ihren Followern, die Mitgefühl für Emotionen vortäuschten, die sie selbst niemals empfinden würden. Wie viele von denen hatten auch nur die leiseste Ahnung, wie es sich anfühlte, jemanden mehr zu lieben als alles andere auf der ganzen Welt, und nicht zu wissen, wo dieser Jemand war?
Er hatte schon wieder dieses Gefühl, das Gefühl, dass er am liebsten etwas kaputt machen, etwas Zerbrechliches gegen die Wand pfeffern oder einen Stuhl aus dem Fenster schmeißen würde. Tinte auf den Teppich kippen. Tief durchatmen. Auf vier ein, auf vier aus. Wo war das Kästchen? Barneys Atem machte nicht mit, er konnte ihn nicht kontrollieren. Auf vier ein, auf vier aus. Er ging ins sein Schlafzimmer. Das schlichte, viereckige Rosenholzkästchen stand auf seinem Nachttisch, exakt in der Mitte. Darin lagen kleine, vertrocknete Blätter auf Seidenpapier. Sieben Stück alles in allem, seine Vierblättrige-Kleeblätter-Sammlung.
Er war gerade erst zwei gewesen, als er das erste gefunden hatte. Er und seine Mum waren mit einer Gruppe anderer Mütter und Kleinkinder im Park gewesen. An den genauen Hergang erinnerte er sich nicht mehr, aber er wusste noch, wie seine Mum ihm später davon erzählt hatte. »Ich habe mich mit einer von den anderen Müttern unterhalten, und du hast gekräht, um mich auf dich aufmerksam zu machen, so wie du’s immer gemacht hast. Und dann hast du mir die Hand hingehalten und gesagt: ›Mummy, vier. Nich grei. Vier.‹ Und da war es, in deiner kleinen Patschhand, das erste vierblättrige Kleeblatt, das ich in meinem ganzen Leben gesehen hatte.«
Im Laufe der nächsten paar Jahre war er wie besessen von dem Gedanken gewesen, vierblättrige Kleeblätter zu finden. Er schaute auf den Boden und sah die Muster im Gras und im Klee. Die mit vier Blättern sprangen ihn geradezu an. »Wie machst du das?«, hatte seine Mutter immer gefragt. Mit fast vier, in dem Alter, in dem er gewesen war, als seine Mutter weggegangen war, hatte er das letzte gefunden. Er wusste nicht mehr, ob sie es noch gesehen hatte oder nicht.
Barneys Atem hatte sich beruhigt. Er schloss das Kästchen und stellte es wieder neben sein Bett. Tränen traten ihm in die Augen. Er konnte vierblättrige Kleeblätter finden. Er konnte alles Mögliche finden, was verloren gegangen war. Warum konnte er seine Mum nicht finden?
7
Die Tür des Reihenhauses wurde von der Polizistin geöffnet, die für die Betreuung der Angehörigen zuständig war. Sie sah Danas Gesicht und trat rasch zurück, so dass sie eintreten konnte, weg von den Reportern, die die letzten zwei Tage vor dem Haus der Barlows Posten bezogen hatten. Im Innern des Hauses konnte Dana Stimmen im Fernsehen hören und Musik im Obergeschoss.
»Wo sind sie?«, fragte sie.
»Wohnzimmer«, antwortete die Polizistin. Sie wusste Bescheid. Sie wussten immer Bescheid.
Dana ließ sich von der Beamtin den Flur entlang und durch eine Tür zur Rechten führen. Das Zimmer war lang und schmal, es erstreckte sich beinahe über die ganze Länge des Hauses. Die Familienmitglieder saßen in den Sesseln und taten so, als sähen sie fern. Die Mutter, der Vater, eine der Schwestern der Mutter, die untereinander anscheinend einen Einsatzplan abgesprochen hatten, und Jonathan, der vierzehnjährige Bruder der Zwillinge. Ihre sechzehnjährige Schwester war in ihrem Zimmer, nach der Musik zu urteilen, die die Treppe hinuntertrieb.
Als er Dana erblickte, erhob sich Mr Barlow und machte den Fernseher aus. Dann blieb er daneben stehen und wartete. Seine Frau schien auf dem Sofa zur Salzsäule erstarrt zu sein.
»Ich habe Neuigkeiten«, sagte Dana, und ihr Blick huschte von der Mutter zum Vater. »Möchten Sie lieber allein mit mir reden?« Ihr Blick wanderte zum Sohn des Ehepaares. Er begriff sofort, was sie meinte und rutschte das Sofa hinunter, so dass er neben seiner Mum saß. Dann ergriff er ihre Hand; er sah verängstigt aus und viel jünger als vierzehn.
»Nur zu«, sagte der Vater. Er wusste auch Bescheid. Sie wussten alle Bescheid. »Raus damit.«
»Es tut mir sehr leid, aber wir haben heute Abend die Leichen zweier Jungen gefunden. Wir glauben, dass es sich um Jason und Joshua handelt. Es tut mir schrecklich leid.«
»Zwei?«, fragte der Vater. »Alle beide?«
Dana fragte sich, ob das Klagegeheul der Mutter wohl tatsächlich ein Loch in ihren Kopf bohren könnte, wenn sie es nur lange genug hörte.
8
Das Klopfen hatte aufgehört. Er war seinem üblichen Muster gefolgt. Dreimal kräftig klopfen, laut genug, dass man es im Garten hören könnte, aber nicht so laut, dass es aggressiv oder bedrohlich gewirkt hätte. Dann noch zweimal dasselbe. Neunmal waren seine Knöchel auf das Holz ihrer Wohnungstür getroffen. Sie hatte ihn die Treppe nicht wieder hinaufgehen hören.
Früher hätte er mit einer Kreditkarte in ihre Wohnung einbrechen können. Die Hightech-Sicherheitsschlösser, die er selbst hatte anbringen lassen, verhinderten das jetzt. Eigentlich komisch. Sie hatten sie vor einem Mörder schützen sollen, jetzt schützten sie sie vor ihm.