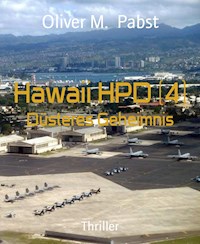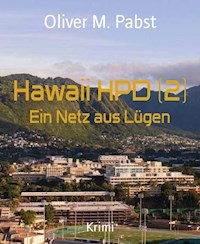3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Während der Napoleonischen Kriege um 1808 wird der britische Kapitän John Travis auf eine geheime Mission in die Karibik geschickt, um einen Aufstand in den spanischen Kolonien zu entfachen. Nach der langen Überfahrt erreicht er mit seiner HMS Pollux die Küste von Venezuela. Nichts ahnend, dass sich Spanien mit Britannien inzwischen verbündet hat, unterstützt Travis die südamerikanischen Rebellen im Kampf gegen die spanischen Herrscher. Als der Kapitän von der Allianz erfährt, will er seinen Fehler gutmachen und die Aufständischen stoppen, obwohl er die Schwester des Gouverneurs von Jamaika an Bord hat...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 388
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Im Auftrag der Krone
BookRix GmbH & Co. KG80331 MünchenVorwort des Autors
Die Handlung des Romans ist eine Erfindung des Schriftstellers. Alle im Buch vorkommenden Charaktere sind, bis auf wenige historische Personen, fiktiver Natur. Irgendwelche Ähnlichkeiten mit lebenden Personen ist reiner Zufall.
Copyright-Hinweis: Sämtliche Inhalte, Fotos und Texte sind urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne schriftliche Genehmigung des Verfassers weder ganz noch auszugsweise kopiert, verändert, vervielfältigt oder veröffentlicht werden. ©Oliver M. Pabst
Das Buch
Während der Napoleonischen Kriege um 1808 wird der britische Kapitän John Travis auf eine geheime Mission in die Karibik geschickt, um einen Aufstand in den spanischen Kolonien zu entfachen. Nach der langen Überfahrt erreicht er mit seiner HMS Pollux die Küste von Venezuela. Nichts ahnend, dass sich Spanien mit Britannien inzwischen verbündet hat, unterstützt Travis die südamerikanischen Rebellen im Kampf gegen die spanischen Herrscher. Als der Kapitän von der Allianz erfährt, will er seinen Fehler gutmachen und die Aufständischen stoppen, obwohl er die Schwester des Gouverneurs von Jamaika an Bord hat...
Landkarte
Venezuela - Südamerika
HMS Pollux
Die Fregatten der Leda-Klasse waren eine erfolgreiche Klasse von 47 britischen Segelkriegsschiffe der Royal Navy mit 38 Kanonen, die zwischen 1805 und 1832 gebaut wurden. Basierend auf einem französischen Design wurde diese Klasse in fünf Hauptgruppen eingeteilt, die sich alle geringfügig voneinander unterschieden. Während ihrer Karriere kämpften sie in den Napoleonischen Kriegen und im Krieg von 1812. Von den 47 gebauten Schiffen wurden 45 schließlich verschrottet. Zwei existieren noch heute.
Die HMS Pollux war ein wurde im Oktober 1806 in den Chatham Dockyards gebaut und im Januar 1807 in den Dienst gestellt. Sie war 150 Fuß 1 Zoll lang (Deck), 39 Fuß 11 Zoll breit, hatte einen Tiefgang von 12 Fuß 9 Zoll und eine Tonnage von 1,076 (Builder's Measurement). Die Bewaffnung bestand aus einer Hauptbatterie von 28 18-Pfündern auf dem Unterdeck, 8 9-Pfünder und 14 32-Pfünder-Karronaden auf dem Achterdeck sowie 2 9-Pfündern und 2 32-Pfünder-Karronaden auf der Back. Die Besatzung war 284 bis 330 Mann stark.
Kapitel 1
Es war ein herrlicher Abend im Jahr 1808. Die Sonne ging gerade im Osten nieder und übergoss die Häuser von Plymouth mit einem leichten Rosa, als die HMS Pollux, ein Kriegsschiff des fünften Ranges seiner britischen Majestät, auf den Hafen zulief und von ein paar Landoffizieren heimgesucht wurde, die dafür zu sorgen hatten, dass die Stadt von ansteckenden Krankheiten verschont blieb. Langsam glitt die Pollux unter Marssegeln durch die Bucht. Kapitän John Travis hatte sie noch gut in Erinnerung, obwohl schon mehrere Monate seit dem Tage dahingegangen waren, als er mit seinem Schiff das letzte Mal hier war.
Die abendliche Brise trug den Donner der Salutschüsse rund um die Bucht, als die Karronade der Pollux sprach und die Festung eine Antwort gab. Unterdessen führte der Lotse das Schiff zwischen anderen britischen Kriegsschiffen hindurch, die dort auf Reede lagen, während die Mannschaft der Fregatte bereitstand, alle Segel zu bergen und den Anker fallen zu lassen.
»Sehen Sie, da ist die Formidable«, sagte Leutnant Boyd, der Erste Offizier.
Er wies dabei mit der Hand auf das nächstliegende Linienschiff. Travis erkannte die Flagge an der Gaffel und den begehrten Breitwimpel eines Flottenadmirals im Großtopp. Der Wimpel war das Kommandozeichen von Lord James Gambier, Vizeadmiral und Befehlshabers der Kanalflotte, dem außer seinem Flaggschiff auch noch zahlreiche andere Schiffe unterstellt waren.
»Mr. Boyd klar zur Ehrenbezeigung, wenn wir passieren.«
»Aye, eye, Sir.«
Trommeln schlugen an, Männer paradierten an der Reling und Hüte wurden feierlich zum Gruß gehoben, als die Pollux vorüberfuhr. Kurz darauf informierte der Lotse den Kapitän, dass der Liegeplatz jetzt erreicht sei.
»Mr. Boyd, drehen Sie auf und lassen Sie Anker werfen.«
»Jawohl, Sir.«
Die Fregatte ging in den Wind, die Marssegel wurden bemerkenswert schnell festgemacht und die Ankertrosse rauschte dröhnend durch die Klüse. Gut, dass das Manöver fehlerlos gelangen, da es unter den kritischen Blicken vieler anderer Seeleute durchgeführt werden musste. Zuletzt stellten sich die Offiziere mit den Hüten in der Hand nebeneinander auf und verabschiedeten sich mit formvollendeten Verbeugungen. Auch Travis bemühte sich um die beste Form, die ihm zu Gebote stand. Er zog ebenfalls höflich seinen Hut, sagte den Herren aus Plymouth einige Worte des Dankes und geleitete sie zum Fallreep.
Am nächsten Morgen gab es für die Mannschaft viel zu tun, denn Vorräte mussten nun aufgefüllt werden. Seit der Verlegung zur Kanalflotte hatte sich das Schiff jetzt schon zum dritten mal diesem mühevollen Geschäft zu unterziehen. Ihre Wasserfässer wurden von den Tankleichtern neu gefüllt, die Lebensmittel durch das Proviantschiff geliefert, Pulver sowie Kugeln mit dem Pulverkahn herangeschafft und alles, was noch irgendwie fehlte, vom schwimmenden Warenhaus soweit wie möglich abgeschwatzt. Die Pollux war volle drei Monate in der Biskaya ununterbrochen auf See gewesen und hatte sich nun für drei weitere ausgerüstet.
Als die Versorgungsschiffe endlich ablegten, atmete der Kapitän auf. Er hatte mehrere Briefe von seiner Verlobten aus Glasgow bekommen, die man ihm auf dem Achterdeck übergab. Den letzten las er zuerst, weil er wissen wollte, ob es Anna gutging. Travis war mit seiner Lektüre eben fertig geworden, als Boyd nach kurzem Klopfen eintrat. Er blieb am Kartentisch sitzen und hörte sich an, was sein Erster Offizier zu melden hatte. Es waren lauter ganz unwichtige Kleinigkeiten, sodass er sich wundern musste, warum dieser seinen Kommandanten überhaupt mit all dem völlig gleichgültigen Zeug belästigte.
»Gibt es sonst noch etwas, Mr. Boyd?«, fragte der Kapitän so abweisend wie möglich, um ihn zum Schweigen zu bringen.
»Nein, Sir, das ist alles.«
Plötzlich wurden auf dem Achterdeck Befehle ausgerufen, bloße Füße trampelten über die Planken und laufende Enden klatschten an Deck. Travis stand schon an der Kajütentür, um herauszufinden, was dies alles zu bedeuten hatte, als er sich einem herbeieilenden Fähnrich gegenüber sah.
»Signal vom Flaggschiff, Sir: Kapitän der Pollux zur Meldung beim Flottenadmiral!«
»Danke, Mr. Leigh.«
An Deck hob Boyd grüßend die Hand an den Hut, als Travis dort erschien.
»Ich habe verstanden gemeldet, als wir das Signal abgelesen hatten, Sir«, erklärte er.
»Das war richtig, Danke. Und lassen Sie bitte das Heckboot klarmachen.«
Wenn der Vizeadmiral einen Fregattenkapitän zu sich rief, so durfte man nicht einmal mit der Antwort warten, bis der Kommandant unterrichtet war. Zudem hatte das sicherlich einen triftigen Grund.
»Meldung von Mr. Mitchell, Sir. Ihr Boot ist klar«, informierte Fähnrich Cutter atemlos seinen Kapitän.
Nie zuvor war es Travis so eindringlich zum Bewusstsein gekommen, dass man in Königs Diensten nichts als ein besserer Sklave war. Er musste nun von Bord gehen, weil er der Vizeadmiral ihn auf sein Schiff befohlen hatte, was er auf keinen Fall ablehnen konnte.
»Gut, ich komme gleich«, erwiderte der Kapitän. »Mr. Boyd, Sie übernehmen das Kommando, solange ich abwesend bin.«
»Aye, eye, Sir.«
Danach stieg er in das längsseits wartende Boot. Im letzten Augenblick, fiel es ihm ein, sich noch einmal umzusehen. Da standen die Fallreepgäste in den weißen Handschuhen, die Boyd eigens für solche Zwecke aus weißem Zwirn hatte anfertigen lassen. Ein Seemann, der mit Häkeln umzugehen verstand, hatte sie gemacht. Zuletzt fiel sein Blick auf die Reihe der Bootsmannsmaate, deren Pfeifen ihm soeben den Abschiedsgruß trillerten. Als die Pfeifen schwiegen, tastete er mit dem Fuß nach dem Boot. Von hier aus konnte man ziemlich genau auf den Freibord der Pollux schließen. Nach der Vorschrift hatte nämlich die Ehrenbezeigung aufzuhören, wenn der von Bord gehende Kapitän mit dem Kopf in Deckhöhe war. Hut, Handschuhe, Säbel und Bootsumhang machten ihm das Leben schwer, als er achterlich in die das Boot kletterte.
Ärgerlich gab Travis den Befehl zum Ablegen. Der Bootshaken ließ den Halt an der Bordwand fahren und einen Augenblick ging scheinbar alles drunter und drüber, nachdem das Boot abdrehte und vier kräftige Arme an seinem Mast das Luggersegel heißten. Für Travis war es ein seltsames Gefühl, so tief unten zu sitzen, dass er die grünen Wogen des Wassers in greifbarer Nähe hatte, denn immerhin war es nun schon einige Zeit her, seit er das letzte mal von Bord seines Schiffes gegangen war.
Bald lag das Boot auf seinem Kurs, es konnte raumschoots laufen, denn der Wind hatte ein paar Strich nach Westen gedreht. Travis warf einen langen Blick achteraus nach der Pollux, die da ankernd lag. Sachverständig betrachtete er die Linien ihres Rumpfes und gab sich endlich wieder einmal aus einiger Entfernung, Rechenschaft über die verschiedene Höhe ihrer Masten, über den Abstand, den sie untereinander hatten sowie über den Fall ihres Bugspriets. Er wusste nun schon recht gut, wie sich sein Schiff unter Segel benahm, dennoch gab es immer noch etwas hinzuzulernen. Doch jetzt war dazu allerdings keine Zeit, denn eine einsetzende Bö legte das Boot hart über und schon war es um seine ganze Selbstsicherheit geschehen. Der bescheidene Seegang, von dem die Pollux überhaupt keine Notiz nahm, gewann, von dem kleinen Boot aus gesehen, geradezu unheimliche Dimensionen. Das unangenehme Fahrzeug lag nicht nur über, sondern hob sich zugleich mit schwindelerregender Hast, wie schwebend über die Seen. Wo war jetzt das feste Deck seiner Fregatte, wo ihre gemessenen Bewegungen, an die er sich so unter vielen Leiden endlich gewöhnt hatte? Ihm, der dem bevorstehenden Ereignis ohnedies mit zitternden Nerven entgegensah, gab dieses Boot mit seinen ungewohnten Bocksprüngen vollends den Rest. Würgend und schluckend kämpfte er gegen die Seekrankheit, die ihn hier sozusagen aus dem Hinterhalt anfiel. Aber, um sich abzulenken, richtete er sein Augenmerk auf das Flaggschiff, welches in einiger Entfernung von der Pollux entfernt im Hafen von Plymouth lag.
Bald ragte der gewaltige Rumpf der HMS Formidable, einem Linienschiff des zweiten Ranges, vor ihm aus dem Wasser auf. Travis war nicht so seekrank und aufgeregt, dass es ihn kaltgelassen hätte, ob sein Boot eine gute Figur machte oder sein ganzes Schiff blamierte. Aber diese Sorge wurde bald durch die bevorstehende Aufgabe verdrängt mit gebührender Haltung über das Seefallreep an Bord zu gelangen. Die Formidable war ein hochbordiger Dreidecker, darum war es für den nervösen Kapitän nicht so ganz einfach, in seiner hinderlichen Uniform über die Jakobsleiter an Deck zu entern, obwohl ihm die geschickte Ausnutzung der Schiffsbewegungen nicht unwesentlich dabei half. Irgendwie gelangte er schließlich ans Ziel. Und als sein Kopf in Höhe des Großdecks war, schrillten die Pfeifen der Bootsmannsmaate ihren Willkommensgruß.
Travis grüßte vorschriftsmäßig die angetretene Wache mit der Hand an den Hut. Kapitän Hancock, Kommandant des Flaggschiffes, war zufällig an Deck und empfingen ihn mit herzlichen Worten. Travis hoffte, dass dieser nicht merkte, wie er vor Aufregung schluckte, als er dessen Grußworte erwiderte. Nach der Enge auf der Pollux kam ihm das Deck der Formidable fantastisch weit und geräumig vor. Das Linienschiff trug vierundachtzig Geschütze und entsprach in ihren Maßen sowie der Bauart einem richtigen Dreidecker. Sie stammte nämlich aus einer Zeit, da die Royal Navy noch solche mächtigen Schiffe baute, weil sie die kleineren französischen Vierundsiebziger durch brutale Übermacht statt durch Taktik und Disziplin zu schlagen hofften.
Ein Flaggleutnant schickte sich an, den Gast in die Admiralskajüte zu führen. Der Raum war mit allem erdenklichen Überfluss ausgestattet. Sobald man den Fuß hineinmachte, versank man in dicken, weichen Wilton-Teppichen, die jedes Geräusch verschluckten. In einem Vorraum wartete ein Steward in strahlend weißer Montur, der den Hut, Handschuhe sowie Umhang von Travis abnahm. Die Deckbalken waren lichte sechs Fuß über dem Teppich. Lord Gambier hatte sich so an diese Höhe gewöhnt, dass er, ohne sich zu bücken, auf seinen Gast zutrat, um ihm die Hand zu schütteln, während der Kapitän unwillkürlich den Kopf einzog.
Travis wunderte sich ein wenig keine Flaggoffizere vorzufinden, denn anwesend waren nur er selbst und der Vizeadmiral. Er musste erleben, dass ihn der Lord eine lange Zeit in so kritischer, abschätzender Weise musterte, dass er unter anderen Umständen bestimmt die Fassung verloren hätte. Aber heute war er in Gedanken immer noch bei seiner Anna und was sein Äußeres betraf, waren drei Monate ununterbrochener Seedienst und zwei Wochen Sturm wahrhaftig der Entschuldigung genug, dass sein Rock schäbig war und er eine einfache Seemannshose trug. Aber Travis hielt denn prüfendem Blick ohne Scheu stand. Er vermutete, dass irgend etwas in der Luft lag, denn es herrschte eine undefinierbare Spannung, obwohl er den Pflichten des Gastgebers mit vollendeter Grazie und Gewandtheit nachkam, es scheinen offenbar noch ganz andere Dinge zu laueren.
»Ich freue mich Sie zu sehen, Travis.«
»Guten Morgen, Mylord.«
»Ich bedauere, dass ich Sie herbemühen musste, aber ich wollte Sie persönlich sprechen.«
»Gewiss, Mylord.«
»Setzen Sie sich doch bitte«, meinte der Vizeadmiral, während er sich am Tisch niederließ.
»Darf ich ihnen einen Kaffee anbieten?«
»Gerne, Mylord, da sage ich nicht nein.«
Nachdem der Stewart einen Kaffee aus der Porzellankanne in eine Tasse einschenkte und diese dann Travis reichte, verließ der Mann den Raum, damit die beiden Männer ungestört sein konnten.
»Nun, ich werde mich so kurz wie möglich fassen, damit Sie bald wieder zur Pollux zurückkehren können«, sagte Lord Gambier.
Der Kapitän nickte wohlwollend und war klar, dass der Lord die Katze jetzt wohl aus dem Sack lassen würde.
»Wie lange werden Sie brauchen, bis Ihr Schiff wieder seeklar ist?«
Nur keine Ausflüchte dachte sich Travis. Hier galt allein die Wahrheit, alles andere war sinnlos.
»Der Proviant sowie die Munition werden gerade geliefert. Ich hoffe, bis zum Abend alle Vorräte an Bord zu haben, Mylord«, erklärte er.
»Sind Ihre Offiziere und die Mannschaft an Bord vollzählig?«
»Jawohl, Mylord, es gibt keine Ausfälle.«
»Dann können Sie heute noch auslaufen?«
»Ja, Mylord.«
»Gut! Und nun zu Ihrem neuen Auftrag«, begann der Vizeadmiral und lehnte sich in seinem Holzstuhl zurück. »Niemand darf ein Wort von dem erfahren, was ich Ihnen jetzt sage, denn Ihr Auftrag ist streng geheim.«
»Natürlich, Mylord, darauf können Sie sich verlassen.«
»Ihren Operationsbefehl bekommen Sie später noch schriftlich zugestellt, doch ich will Ihnen im groben lieber gleich sagen, was er enthält, damit Sie Fragen stellen können, falls Ihnen etwas nicht klar sein sollte«, sagte Lord Gambier und nahm sich ein paar Sekunden Zeit, ehe er sich in die Einzelheiten vertiefte. »Ich werde die Pollux diesmals in die Karibik schicken. Das heißt, Sie segeln auf dem schnellsten Weg nach Venezuela und müssen dort südamerikanische Rebellen mit Waffen beliefern, damit sich diese gegen das spanische Kolonialreich erheben.«
»Sie meinen, dass die Dons ihre Kräfte aus Europa abziehen, um ihre Kolonien zu verteidigen?«, fragte Travis überlegend.
»Sie etwa nicht?«
»Doch, Mylord.«
»Nur ein Dummkopf könnte etwas anderes erwarten und zu denen gehören Sie ja wohl nicht«, meinte der Admiral lächelnd.
»Mylord, darf ich Fragen, wieso gerade Sie mich für diese Aufgabe ausgewählt haben?«, wollte Travis vom Vizeadmiral wissen.
»Sie haben sich in diesem Krieg bis jetzt ausgezeichnet bewährt und sich unter meinem Kommando einen Namen gemacht. Ich halte Sie daher für den Richtigen, der diese schwierige Mission erfolgreich ausführen kann«, erwiderte Lord Gambier.
»Besten Dank, Mylord.«
Hätte der Kapitän diese Worte gleichgültig zur Kenntnis nehmen sollen? Nein, solche Heuchelei brachte er nicht über sich. Wenn der Lord so etwas sagte, dann war das keine simple Anerkennung, sondern ein hohes Lob.
»Die entsprechende Waffenladung für die Aufständischen steht bereit und wird Ihnen noch von einem Leichter zugestellt«, fuhr der Vizeadmiral fort. »Anschließend stechen Sie umgehend in See. Sobald Sie Ihren Auftrag erledigt haben, kommen Sie wieder nach Britannien zurück.
»Jawohl, Mylord.«
»Und eines lassen Sie sich noch gesagt sein: Es gibt blindes, törichtes Draufgängertum und kühlen, berechnenden Wagemut. Treffen Sie hierin immer die rechte Wahl und ich werde Ihnen in allem Ungemach zur Seite stehen, das Ihnen aus Ihrem Handeln erwachsen könnte.«
Die braunen Augen des Vizeadmirals begegneten dem festen Blick der Blauen des Kapitäns. Was Lord Gambier da eben gesagt hatte, mehr noch, was unausgesprochen geblieben war, gab Travis mächtig zu denken. Sein Vorgesetzter hatte ihm seinen Beistand versprochen, aber das Gegenstück dazu, die Drohung für den Fall seines Versagens, war unterblieben. Wollte der Lord damit seinen Worten eine größere Wirkung verleihen oder handelte es sich gar nur um einen billigen Trick von ihm, dem Untergebenen gegenüber? Nein, beides war ausgeschlossen. Die Aussage von Lord Gambier war ganz und gar der Ausdruck seiner Wesensart. Er galt stets als ein Mann, der seine Kommandanten nicht nur antrieb, sondern wirklich führte. Das war höchst bemerkenswert.
Travis fuhr erschrocken zusammen. Er hatte seinen Befehlshaber sekundenlang hemmungslos angestarrt, während ihm das alles durch den Kopf ging. Das war wohl recht taktlos von ihm gewesen.
»Ich habe alles verstanden, Sir«, sagte er.
Dann erhob sich der Vizeadmiral von seinem Stuhl. Sein aufkommendes Lächeln verriet ihn vollends als Mann der Tat. Travis entnahm daraus, dass dieser mit dem Sieg Britanniens über Napoleon Bonaparte und seinen Verbündeten schon voller Ungeduld entgegensah. Der Lord suchte bestimmt nicht nach Gründen oder Ausreden, um eine fällige Entscheidung hinauszuschieben. Er dankte dem Kapitän für dessen Erscheinen und beide gaben sich zum Abschied die Hand.
»So, aber nun möchte ich Sie nicht länger hier binden. Hoffentlich bleibt Ihnen das Glück auch weiterhin treu.«
»Vielen Dank, Mylord.«
Bis zu diesem Augenblick hatte Travis sich leichtfertiger Weise eingebildet, dass man ihn wieder zum Blockadedienst an die spanische Küste abkommandieren würde, statt in die Karibik fahren zu müssen. Offenbar hatte er sich darin allerdings gründlich geirrt und darum haderte er jetzt mit sich selbst. Denn bei näherem Zusehen sprach ja wirklich eine Menge dafür, dass man gerade ihn mit dieser gefährlichen Mission betraute. Er hatte eine ausgezeichnete Besatzung an Bord, seine Fregatte war mit achtunddreißig Kanonen gut bewaffnet und eignete sich vortrefflich für die Aufgabe, die ihm der Vizeadmiral zugedacht hatte. Das alles wusste er und hatte doch keinen Schluss daraus gezogen. Dies war die erste bittere Pille, die es für ihn zu schlucken gab.
Als Nächstes galt es herauszufinden, warum ihm dieser böse Denkfehler unterlaufen war. Nachdem es ihm klargeworden war, gab er sich einen Ruck. Wie ein glückliches Geschick sollte das sein? Aufgelegter Unsinn. Er war Kapitän eines Schiffes, das in vorderster Linie stand. Gab es eine bessere Gelegenheit, Ruhm zu ernten, sich auszuzeichnen? Kampf, Pflichterfüllung sowie der Einsatz von Ehre und Leben, schon die Erwartung dessen, was ihm bevorstand, jagte ihm wieder jene Schauer der Erregung durch die Glieder, deren er sich aus früheren Tagen so deutlich entsann. Gewiss, es ging ihm um den Ruhm, aber im Augenblick lag ihm noch mehr daran zu wissen, dass mit ihm selbst wieder alles im Lot war. Als Travis wieder zu sich gefunden hatte, sah er die Dinge in der richtigen Ordnung. In erster Linie war und blieb er Seeoffizier der britischen Marine. Seine in Schottland verweilende Anna musste sich hingegen mit dem zweiten Platz abfinden. Aber nun gab es keinen weiteren Grund, dass er noch länger auf dem Flaggschiff des Vizeadmirals verweilte, denn er musste trotz seines aufgewühlten Gemütszustandes jetzt wieder auf sein Schiff.
Travis kehrte er in allerbester Stimmung auf seine Pollux zurück. Das lag vor allem daran, dass man ihn und seine Mannschaft mit einer wichtigen Mission betraute, von der sich die Admiralität viel versprach. Als er an Bord kam, begrüßte ihn der Erste Offizier wie immer mit der Hand am Hut.
»Mr. Boyd, ist der Proviant an Bord?«, fragte der Kapitän nach.»Jawohl, Sir.«
»Wurde auch die zusätzliche Ladung übernommen?«
»Jawohl, Sir. Es waren insgesamt fünfzig Holzkisten«, erwiderte der Erste Offizier nickend.
»Gut, machen Sie bitte Schiff klar zum Ankerlichten und lassen Sie alle Segel setzen. Bitte übernehmen Sie dabei persönlich die Aufsicht.«
»Jawohl, Sir. Ich habe noch eine Frage...«
»Mr. Leigh, Signal von Pollux an Formitable: Erbitte Detachierung«, wandte sich Travis an den Fähnrich.
Nur ein einziges Mal konnte der Kapitän auf dem Achterdeck hin und her gehen, da kam bereits die Antwort von Lord Gambier.
»Detachiert!«, meinte der junge Mann.
»Danke, Mr. Leigh.
Niemand wagte es, den Kapitän anzusprechen. Sehr bald erschien dann wieder der Lotse. Offenbar war es dem Vizeadmiral gelungen, das übliche Tempo der Behörden zu beschleunigen. Rasch waren die Marssegel gesetzt, der Anker aufgehievt und schon glitt die Pollux mit dem ersten Hauch der aufkommenden Landbrise zum Hafen von Plymouth hinaus. Erst als der Lotse von Bord war und die Pollux mit Südwestkurs in See steuerte, nahm er sich die Zeit, Boyd anzuhören.
»Ich erinnere mich, dass Sie noch etwas von mir wollten.«
»Ja, Sir. Darf ich Fragen, was sich den Kisten befindet, die wir geladen haben, Sir? Es könnte möglicherweise wichtig sein, falls wir diese bei starkem Seegang notfalls umsetzen müssen.«
Travis Miene verfinsterte sich und gab sich die größte Mühe natürlich zu geben, dass auch seinem Tonfall nichts anzumerken war.
»Mr. Boyd, Sie werden von mir alles erfahren, wenn die Zeit gekommen ist und ich es für richtig halte. Im Moment gibt es Wichtigeres zu tun.«
»Aye, eye, Sir.«
Es war alles andere als schön, wie der Kapitän seinem Ersten Offizier mit schneidenden Sarkasmus abfertigt hatte, doch es war nun einmal nicht zu vermeiden. Travis wollte ihm noch nicht über den bevorstehenden Auftrag einweihen, weil er fürchtete, dass die Mannschaft davon etwas erfuhr. Aber an Boyd prallte das Ganze wirkungslos ab, denn er kannte ja die Launen des Kapitäns.
Travis richtete sich, mit einem Blick auf das Kielwasser und die Segel, an den nautischen Offizier der Pollux.
»Mr. Perkins, der Wind ist fürs Erste stetig. Geben Sie mir jetzt den Kurs in die karibische See.«
»Die Karibik?«, fragte der Leutnant verwundert.
»Haben Sie dagegen Einwände?«
»Nein, Sir.«
Der Leutnant machte ein langes, kummervolles Gesicht und war eine ganze Weile damit befasst, diese Neuigkeit zu verarbeiten, ohne dabei eine Miene zu verziehen.
»Dann tun Sie gefälligst, was ich Ihnen aufgetragen haben«, knurrte der Kapitän gereizt, weil ihm das Gehabe des Mannes auf die Nerven ging.
»Jawohl, Sir«, bestätigte dieser eiligst.
Die Überraschung, die dieses Wort auslöste, war natürlich zu verstehen. Außer Travis wusste niemand von der Mannschaft um den Befehl, der die Pollux in See schickte und keiner von ihnen ahnte, welchen Platz in der weiten Welt sie ansteuern sollten. Die Erwähnung der Karibik engte die Anzahl des Zielortes in keiner Weise ein, denn der Atlantik war der Ausgangspunkt für eine Vielzahl von möglichen Zielen.
»Der Kurs ist Südwest zu West, Sir«, sagte er wenige Minuten später. »Wenn wir die Boje an der Ausfahrt passiert haben gehen, können wir über Stag gehen und mit dichten Schoten anliegen.«
»Mr. Perkins, schreiben Sie den Kurs auf die Tafel.«
»Aye, Sir.«
Die Fregatte gehorchte dem Ruder und nahm immer mehr Fahrt auf, als alle Segel zu ziehen begannen. Der Wind frischte auf und die Pollux jagte schäumend dahin, während die Männer schwitzend die Rahen genau in die Stellung trimmten, die vor Boyds kritischen Augen Gnade fand.
»Bitte setzen Sie die Royals, Mr. Boyd. Und lassen Sie auch die Leesegelspieren ausrennen.«
»Jawohl, Sir.«
Travis merkte sofort, dass er sich auf die Seemannschaft seines Ersten Offiziers ganz und gar verlassen konnte. Er sah jetzt ein, dass seine Bedenken überflüssig gewesen waren, aber sein Eindruck von dem Mann war immerhin schon volle zwei Jahre alt und hatte in dieser langen Zeit vielleicht an Berechtigung eingebüßt. Der Erste Offizier gab seine Befehle in wohlüberlegten, dem Fortgang der Manöver entsprechenden Zeitabständen. Das Schiff legte sich unter dem Druck der Segel über, nicht weich und ohne Rückgrat, sondern federnd wie eine gute Säbelklinge, die von kräftigen Händen gebogen wird.
An Backbord segelte eine andere britische Fregatte vorbei. Die Pollux rauschte in fliegender Fahrt an ihr vorüber und erwies ihr die schuldige Ehrenbezeigung. Travis konnte sich vorstellen, wie den Seeleuten dort drüben der blasse Neid packte, wenn sie sahen, wie die Pollux einem aufregenden Abenteuer entgegen stürmte. Dabei hielten sie natürlich nicht zugute, dass sich sie volle eineinhalb Jahre an der französischen Küste im Einsatz war.
»Soll ich die Leesegel setzen, Sir?«, fragte Boyd.
»Ja, tun Sie das bitte«, antwortete Travis. »Mr. Cutter, was sagt das Log?«
»Vier Knoten, Sir, vielleicht sogar etwas darüber, fast fünf möchte ich sagen.«
Nach der langen Zeit des Eingesperrtseins in engen Revieren empfanden Travis und seine Mannschaft das alles wie eine wahre Erlösung und freuten sich auf neue Abenteuer, während das Schiff in der nächtlichen Prise den Atlantik hinaus fuhr.
Kapitel 2
Im Verlauf der nächsten drei Monate langen Seereise, von Britannien nach Venezuela, bei der man kein Land berührt hatte, war Boyd sich über manches klargeworden, was dem Kapitän gefiel oder nicht. So durfte man ihn zum Beispiel während der ersten Stunde des Tages nicht anreden oder auf andere Weise seine Gedankengänge unterbrechen. Den ständigen Befehlen entsprechend, die infolge der ungewöhnlichen Länge der Fahrt bereits in Fleisch und Blut übergegangen waren, hatte Bootsmann Hastings dafür gesorgt, dass die Luvseite des Achterdecks schon beim ersten Tagesschimmer mit Sand und Steinen gereinigt worden war.
Boyd, führte wieder grüßend die Hand an den Hut, als der Kapitän nach Anbruch der Morgendämmerung das Deck der Pollux betrat, sagte aber nichts. Er und der Fähnrich der Wache zogen sich auf die Leeseite zurück, worauf Travis sofort mit seinem einstündigen Morgenspaziergang auf dem Achterdeck begann. Er beschränkte sich darauf, auf dem sieben Meter langen Deckplanken auf und abzugehen. Auf der einen Seite wurde seine Wanderung durch die Gleitschienen der Deckgeschütze begrenzt, auf der anderen durch die in das Deck eingelassenen Ringbolzen, an denen die Taljen zum Richten der Kanonen angeschlagen wurden. So kam es, dass die Fläche, auf der er sich frühmorgens Bewegung zu machen pflegte, fünf Fuß breit und einundzwanzig Fuß lang war.
Schnellen Schrittes wanderte der Kapitän hin und her. Obwohl er ganz in Gedanken versunken war, wussten seine Untergebenen doch aus Erfahrung, dass sein seemännischer Instinkt stets wach blieb. Unbewusst bemerkte Travis den über die Deckplanken fallenden Schatten der Takelage des Großmastes und spürte den Luftzug auf seiner Wange, sodass die geringste Unachtsamkeit des Rudergängers eine Zurechtweisung seitens des Kommandanten nach sich zog. Diese fiel um so schärfer aus, als er in der wichtigsten Stunde seines Tagewerks gestört wurde. In gleicher Weise nahm sein Unterbewusstsein, die Wind und Wetter betreffenden Tatsachen zur Kenntnis.
Nach dem Aufstehen hatte er, ohne es bewusst zu wollen, noch in seiner Kammer am Kajütkompass festgestellt, dass Kurs Süd anlag, wie das seit zwei Wochen schon der Fall war. Ebenso unwillkürlich erkannte er beim Betreten des Oberdecks, dass die östliche Brise gerade ausreichte, das Schiff steuerfähig zu erhalten, obwohl alle Segel bis zu den Royals standen, der Himmel ein ungetrübtes Blau zeigte und die See fast spiegelglatt war. Gewichtig und gleichmäßig glitt die Pollux über die langgestreckte, friedliche Dünung.
Der erste bewusste Gedanke des Kapitäns bestand schon in der Beobachtung, dass die im Morgenlicht tiefblaue und gegen den westlichen Horizont hin silbrig werdende Karibik einem in Blau gehaltenen Wappenschild ähnelte. Dann schmunzelte Travis fast ein wenig, denn dieser Vergleich drängte sich ihm jeden Morgen auf. Der Gedanke machten sein Hirn im Augenblick ganz klar. Er sah die Leute auf den Deck mit Sand und Steinen schrubben. Sie unterhielten sich in gleichbleibendem Tonfall. Zweimal vernahm er ein Lachen. Das war gut so. Leute, die plauderten und lachten, sahen nicht danach aus, als planten sie eine Meuterei. An solche Möglichkeit hatte Kapitän Travis aber letzthin immer wieder denken müssen.
Seit fast drei Monaten befand sich das Schiff nunmehr auf hoher See. Die Vorräte waren fast aufgezehrt. Vor acht Tagen hatte er die tägliche Wasserration auf eindreiviertel Liter herabsetzen müssen. Das war für Männer, die nördlich des Äquators vorwiegend von Salzfleisch und Hartbrot leben mussten, nicht viel, zumal das mitgeführte Wasser inzwischen schon fast zu einer grünlichen Brühe geworden war. Ebenfalls hatte Travis vor einer Woche den letzten Zitronensaft austeilen lassen. Innerhalb eines Monats musste man mit dem Auftreten von Skorbut rechnen und dabei befand sich kein Wundarzt an mehr Bord, denn Dr. Ingram war inzwischen der Syphilis und den Folgen alkoholischer Ausschweifungen erlegen.
Seit Anfang des Monats gab es wöchentlich fünfzehn Gramm Tabak und Travis beglückwünschte sich dazu, dass er den Tabakvorrat in persönliche Verwaltung genommen hatte. Hätte er das unterlassen, so hätten die Narren bereits alles verraucht und ohne Tabak wurden die Männer unzuverlässig. Er wusste auch, dass die Leute sich die Kürzung des Tabaks mehr zu Herzen nahmen, als den Mangel an der Feuerung für die Kombüse, die zur Folge hatte, dass ihnen ihre Tagesration Pökelfleisch halbgar ausgegeben wurde, sobald die schon grün gewordene Brühe Frischwasser zu kochen begann. Dennoch bedeuteten alle diese Einschränkungen noch nichts im Vergleich mit der weitgehenden Verringerung der Rumration. Sie vollends zu streichen, hatte Travis nicht gewagt, aber nun befand sich nur noch für zehn Tage Rum an Bord. Der besten Kriegsschiffsbesatzung der ganzen Welt war nicht mehr zu trauen, wenn man sie ihrer Rumration beraubte.
Man weilte jetzt in der Karibik und im Umkreis von zweihundert Seemeilen gab es kein anderes britisches Schiff. Dafür aber lagen irgendwo im Osten paradiesische Inseln mit schönen Frauen und reichlicher Nahrung, die man sich mühelos beschaffen konnte. Ein Leben glückseligen Nichtstuns schien zum Greifen nahe zu sein. Es brauchte sich bloß ein Halunke unter den Leuten zu befinden, der, besser unterrichtet als die übrigen, davon erzählte. Wohl würde er zunächst keinen Einfluss ausüben können, aber wenn es in Zukunft mittags nicht mehr die ersehnte Rumausgabe gab, so musste damit gerechnet werden, dass die Mannschaft solchen Einflüsterungen zugänglich wurde. Seitdem die betörte Besatzung der Bounty im Pazifik gemeutert hatte, lastete dieses Ereignis auf der Seele jeden Kapitäns seiner britischen Majestät.
Immer noch mit raschen Schritten auf- und abgehend, warf Travis den Matrosen nochmals einen scharf prüfenden Blick zu. Zwei Monate ununterbrochener Seefahrt hatten zwar eine glänzende Gelegenheit geboten, aus dieser Bande von Galgenvögeln und gepressten Menschen brauchbare Seeleute zu machen, aber die Seereise dauerte dafür, dass es keinerlei Ablenkung gab, zu lange. Je eher man die Küste von Venezuela erreichte, desto besser. Ein Landurlaub würde die Leute zerstreuen und es konnten frische Lebensmittel, Wasser, Tabak und alkoholische Getränke beschafft werden. Seine Gedanken beschäftigten sich mit dem letzten Besteck. Der Richtigkeit des errechneten Breitengrades war er gewiss und die Mondbeobachtung der vergangenen Nacht schien den mittels des Chronometers bestimmten Längengrad zu bestätigen, obwohl es eigentlich unglaublich war, nach einer dreimonatigen Reise überhaupt noch den Chronometer zu Rate ziehen zu können. Wahrscheinlich lag die südamerikanische Küste keine hundert Seemeilen weit mehr vor dem Bug des Schiffes. Perkins, hatte zwar zu Travis bestimmter Versicherung zweifelnd den Kopf geschüttelt, aber dieser war ein alter Trottel, den man als Navigationsoffizier kaum brauchen konnte. Jedenfalls würde es sich binnen weniger Tage herausstellen, wessen Meinung wohl die Richtige war.
Wiederum sprangen die Gedanken des Kapitäns um. Wie sollte man die nächsten zwei oder drei Tage zubringen? Die Mannschaft musste beschäftigt werden. Nichts war für das Entstehen einer Meuterei günstiger als lange, faule Tage. Während der acht wilden Wochen, die ihn das Überqueren des Atlantiks gekostet hatte, war ihm die Möglichkeit einer Empörung überhaupt nicht vor Augen getreten. Also sollte es heute Vormittag zu einer Klarschiff-Übung und zum Scharfschießen verwendet werden, wobei jedes Geschütz fünf Schuss feuern sollte. Möglicherweise wurde das bisschen Wind durch die Erschütterung der Luft zeitweilig gänzlich vertrieben, aber daran ließ sich nichts ändern. Vielleicht war dies die letzte Gelegenheit zur Übung, ehe es wirklich zu Gefechtshandlungen mit spanischen oder sogar französischen Schiffen kam.
Kurz darauf schlug die Schiffsglocke siebenmal an. Sieben Glas in der Frühwache. Travis hatte die Morgenwanderung ein gutes Stück über das Stundenmaß hinaus ausgedehnt. Er fühlte, dass seine Haut unter dem Hemd schweißig wurde und trat zu dem neben dem Ruder stehenden Ersten Offizier.
»Guten Morgen, Mr. Boyd«, sagte Travis straff.
»Morgen, Sir«, erwiderte dieser genau so, als sei der Kapitän nicht bereits seit fünf Stunden, wenige Meter von ihm entfernt, hin und her gewandert.
Travis besah sich die Schiefertafel, die einen Überblick über die Geschehnisse der letzten vierundzwanzig Stunden gab. Es hatte sich nichts Besonderes ereignet. Das stündliche Loggen hatte Geschwindigkeiten von drei bis viereinhalb Knoten ergeben und aus der Tafelrückseite war zu ersehen, dass die Pollux auf südlichen Kurs geblieben war. Er merkte sehr wohl, dass ihn Boyd gespannt ansah und er mit Fragen sozusagen geladen war.
Es befand sich nur ein einziger Mensch an Bord, dem das Ziel der Fregatte bekannt war. Und dieser eine war der Kapitän selbst. Mit versiegelter Order hatte er Britannien verlassen und als er den Umschlag befehlsgemäß auf dreißig Grad Nord und zwanzig Grad West geöffnet hatte, war es ihm nicht in den Sinn gekommen, wenigstens seinem Ersten Offizier vom Inhalt des Schreibens zu unterrichten. Seit dem Auslaufen gab sich Boyd alle Mühe, keine Fragen zu stellen, aber es fiel ihm sichtlich schwer. Ohne ein Wort zu sprechen, hängte Travis die Tafel wieder auf, stieg den Niedergang hinunter und betrat seine Kammer.
Es war Pech für den Ersten Offizier, dass er in solcher Weise im Dunkeln gehalten wurde, aber der Kapitän hatte nicht deswegen auf eine Erörterung seiner Befehle verzichtet, weil er Boyds Schwatzhaftigkeit fürchtete. Vielmehr hegte er andere Befürchtungen. Auf einem früheren Kommando hatte er seinem eigenen Mitteilungsbedürfnis die Zügel schleifen lassen. Sein damaliger Erster Offizier hatte sich das so weitgehend zunutze gemacht, dass Travis schließlich keinen Befehl mehr erteilen konnte, ohne dass dieser vorher besprochen wurde. Seit damals war er daher bemüht gewesen, den Untergebenen innerhalb der von den Regeln der Höflichkeit gezogenen Grenzen zu halten, doch hatte er erkannt, dass es ihm selbst unmöglich war, diese zu bestimmen. Stets sprach er ein Wort zu viel, das er dann später bereute. Dieses Unternehmen hatte er mit dem festen Vorsatz begonnen und er ähnelte darin einem Trinker, der sich nicht zutraut, bei mäßigem Alkoholgenuss zu bleiben, nichts zu seinen Offizieren zu sagen, was der Dienst nicht unmittelbar erforderte. Sein Entschluss war durch die zwingende Notwendigkeit zur Geheimhaltung der ihm erteilten Befehle noch fester geworden. Zwei Monate lang hatte er sich daran gehalten. Je stärker er unter die Einwirkung des natürlichen Standes der Dinge geriet, desto verschlossener wurde er. Im Atlantik hatte er mit Mr. Boyd immerhin zuweilen über das Wetter gesprochen. Hier in der Karibik beschränkte er sich meist nur auf ein Räuspern.
Travis Kammer war ein winziges von der Kajüte durch eine Holzwand getrenntes Gelass. Die Hälfte des Raumes wurde von je einem Achtzehnpfünder eingenommen und im Rest hatten gerade noch seine Koje, der Schreibtisch und seine Seekiste Platz. Dobson, sein Steward, packte das Rasierzeug und den Ledernapf aus, den er auf einer kleinen Konsole unterhalb des an der Wand angebrachten Stückchens Spiegelglas aufbaute. Die beiden Männer konnten sich in der Enge kaum bewegen. Um seinen Vorgesetzten eintreten zu lassen, quetschte sich Dobson gegen den Schreibtisch. Er sagte nichts, denn er war ein Mann weniger Worte. Aus diesem Grunde hatte Travis ihn ausgesucht, denn auch seinem Diener gegenüber musste er sich vor seiner Sünde der Geschwätzigkeit in Acht nehmen.
Travis streifte das feuchte Hemd und die Hosen ab. Halbnackt trat er vor den Spiegel, um sich zu rasieren. Das Gesicht, das er im Glas bemerkte, war weder hübsch noch hässlich, weder alt noch jung. Melancholisch braune Augen blickten ihn an, die Stirn war ziemlich hoch, die Nase einigermaßen gerade und der gut geformte Mund verriet die in zwanzigjährigem Seedienst erworbene Charakterfestigkeit. Das leicht gelockte braune Haar begann an den Schläfen lichter zu werden, wodurch die Stirn noch etwas höher erschien. Travis war dies unbehaglich, denn der Gedanke eine Glatze zu bekommen, war ihm zuwider. Und als er an seinem nackten Oberkörper heruntersah, kam ihm die andere Sorge zum Bewusstsein. Schlank und muskulös war er gebaut. Wenn er sich zur ganzen Höhe seiner sechs Fuß aufrichtete, machte er eine durchaus wirkungsvolle Figur. Dort unten aber, wo die Rippen endeten, ließ sich das Vorhandensein eines Bauches nicht verheimlichen, der gerade begann, über den unteren Teil des Brustkorbes hervorzutreten. Mit einem für seine Generation seltenen Abscheu fürchtete Travis das Dickwerden. Ihn ekelte der Gedanke, seinen schlanken, glatthäutigen Körper durch eine unziemliche Wölbung verunstaltet zu sehen. Das war der Grund, weswegen er, der im Grund genommen zur Bequemlichkeit neigte und das Gewohnheitsmäßige hasste, sich dazu zwang jeden Morgen einen Spaziergang auf dem Achterdeck zu machen.
Nachdem der Kapitän das Rasieren beendet hatte, legte er Messer und Pinsel nieder, damit der Steward sie reinigte, bevor er sie wegräumte. Danach legte ihm der Steward einen zerschlissenen Schlafrock um die Schultern. Dieser folgte Travis an Deck zur Hauptpumpe, nahm ihm den Schlafrock ab und pumpte eifrig Seewasser, während sich der Kapitän würdevoll unter dem Wasserstrahl drehte. Dann bekleidete Dobson die tropfnassen Schultern abermals mit dem Schlafrock und folgte dem Kapitän wieder in die Kajüte. Ein sauberes Leinenhemd, verbraucht, aber instand gesetzt und weiße Hosen lagen auf der Koje. Während Travis sich anzog, half ihm Dobson in den abgetragenen, mit verblichenen Litzen besetzten Rock und reichte dann dem Kapitän den Hut. In der ganzen Zeit wurde kein Wort gesprochen, so sehr war Travis das System des Schweigens, zu dem er sich selbst gezwungen hatte, in Fleisch und Blut übergegangen. Und er, dem jede Routine verhasst war, hielt sich jetzt, um das überflüssige Sprechen zu vermeiden, so völlig an sie, dass er, wie das übrigens jeden Morgen geschah, genau in dem Augenblick wieder an Oberdeck erschien, als es Acht glaste.
Travis blickte mit einem Lächeln zu seinem Ersten Offizier hinüber, das diesen sofort veranlasste herbeizueilen.
»Ich habe heute früh die Absicht mit der Mannschaft einen Ausbildungsdienst zu machen, Mr. Boyd.«
»Jawohl, Sir«, gab der Erste Offizier zur Antwort und nicht etwa ›Selbstverständlich, Sir‹, weil er wusste, dass sich das für einen Untergebenen nicht gehörte.
Aber seine Augen leuchteten auf, denn für Boyd gab es nichts Schöneres, als die Segel zu reffen, die Rahen an Deck zu nehmen oder wieder aufzubringen, die Trossen aus ihren Lasten zu zerren und nach der Heckpforte zu mannen, um sie als Spring zu benutzen. Oder Hunderte von Manövern immer wieder durchzuproben, die Wetter oder Krieg erfordern mochten.
»Zwei Stunden werden Ihnen für heute wohl genügen, nicht wahr, Mr. Boyd? Ich kann mich nur an ein einziges kurzes Geschützexerzieren erinnern.«
Seit ihr Abfahrt aus England hatte ihm die Seekrankheit so böse mitgespielt, dass er seiner Sache nicht ganz sicher war.
»Jawohl, wir exerzierten in den letzten Monaten nur drei Mal, Sir.«
»Dann wollen wir nach dem Frühstück wieder eine Stunde an den Geschützen exerzieren. Es konnte leicht sein, dass wir für unser Können sehr bald Verwendung haben.«
Boyd nickte zustimmend und sah mit unerschütterlichem Gleichmut über das Oberdeck. Die Pfeifen der Bootsmannsmaate riefen alle Mann. Bald war das Exerzieren in vollem Gange. Schwitzend jagten die Matrosen die Wanten hoch und enterten wieder nieder oder sie holten sie aufgereiht im Takt an einem Ende. Die Unteroffiziere trieben sie unermüdlich an und Mitchell überschüttete sie dabei mit einer wahren Sturzflut von Schmähworten. Es war natürlich gut und richtig, die Mannschaft in Übung zu halten, aber ernstliche Mängel, die behoben werden mussten, zeigten sich dabei nicht.
Von ihren dreihundert Mann an Bord waren zweihundertsechsundvierzig erfahrene Seeleute im Rang von Vollmatrosen. Dazu kamen noch zwanzig Leichtmatrosen, die gleiche Anzahl Schiffsjungen, vier Offiziere und nur zehn unerfahrene Landratten. Das war ein ganz ungewöhnliches Zahlenverhältnis, eines, das im Lauf der Mobilmachung der britischen Flotte wohl auf keinem Schiff mehr zu erzielen war. Dazu kam, dass mehr als die Hälfte dieser Männer schon zuvor auf Kriegs- oder Handelsschiffen gedient hatte. Sie waren also nicht nur Seeleute von Beruf, sondern überdies auch altgediente Männer der Royal Navy. Die meisten dieser Männer waren also bereits in der Bedienung von Schiffsgeschützen geübt, vierzig oder fünfzig von ihnen hatten sogar schon Gefechte mitgemacht. Darum wusste jeder auch sofort, was ihm oblag und worauf es ankam, als es jetzt ans Geschützexerzieren ging.
Nach beendeter Übung nahm der Erste Offizier vor Travis Haltung an, hob die Hand zum Gruß an den Hut und wartete auf den nächsten Befehl.
»Danke, Mr. Boyd. Bitte befehlen Sie Ruhe.«
Die Pfeifen der Bootsmannsmaate zwitscherten über Deck, darauf versank das Schiff in lautloses Schweigen.
»Ich werde jetzt die Stationen besichtigen, wollen Sie die Güte haben, mich zu begleiten, Mr. Boyd.«
»Aye, eye, Sir.«
Travis begann sogleich die Karronaden auf dem Steuerbordachterdeck zu inspizieren. Er fand hier nichts zu bemängeln und begab sich dann weiter nach vorn, um die Zweiunddreißigpfünder auf der Steuerbordseite zu mustern. Bei jedem Geschütz machte er halt und ließ sich das Zubehör zeigen: Kartusche, Kuhfuß, Handspake, Schwamm und Keil. So ging er von Kanone zu Kanone.
»Was haben Sie zu tun, wenn Ihr Geschütz feuert?«
Er hatte diese Frage an den jüngsten Matrosen gerichtet, den er entdecken konnte. Der Junge trat verlegen von einem Fuß auf den anderen, als er begriffen hatte, dass der Kapitän ihn ansprach.
»Nimm Haltung an, Mensch!«, fauchte ihn Boyd an.
»So sagen Sie mir doch, welche Station Sie haben«, wiederholte Travis geduldig.
»Hier, Sir. Ich bediene den Ansetzer.«
»Ich freue mich, dass Sie es wissen und Ihre Gefechtsstation im Kopf haben. Obwohl der Kapitän sowie der Erste Offizier auf Sie einreden, werden Sie auch wissen, was Sie zu tun haben, wenn feindliche Kugeln in die Bordwand schlagen.«
Travis ging weiter. Ein Kommandant hatte es wirklich nicht schwer, seine Leute mit einem Scherzwort zum Lachen zu bringen. Jetzt machte er schon wieder halt.
»Was soll denn das, Mr. Goodlife?«
»Sir?«
»Diese Batterie hat ein Pulverhorn zu viel. Für je zwei Geschütze ist doch immer nur eins vorgesehen.«
»Jawohl, Sir. Das kommt daher…«
»Ich weiß sehr gut, woher das kommt. Aber eine Begründung ist noch längst keine Entschuldigung. Und wie viele Pulverhörner haben wir bei dieser Geschützgruppe? Sehen Sie, da haben wir’s.«
Die Verschiebung des dritten Geschützes nach achtern hatte Moores Geschützmannschaft um ein Pulverhorn gebracht und dafür Goodlifes Batterien ein überzähliges in die Hand gespielt.
»Es hätte den jungen Herren gut zu Gesicht gestanden, selbst dafür zu sorgen, dass die Geschütze ihrer Gruppe richtig ausgestattet sind. Auf einen Befehl brauchten Sie dazu nicht zu warten.«
Moore und Goodlife waren junge Herren, die von der Marineschule an Bord kommandiert waren, um als Fähnriche ausgebildet zu werden. Was Travis bisher von ihnen gesehen und mit ihnen erlebt hatte, wollte ihm gar nicht gefallen, aber er musste sie als diensttuende Unteroffiziere einsetzen und im eigenen Interesse mit Liebe und Sorgfalt erziehen, damit aus beiden brauchbarere Leutnants wurden. Seine dienstliche Aufgabe deckte sich also hier durchaus mit dem eigenen Besten. Er hatte ihnen und die anderen Bürschchen zurechtzubiegen, aber durfte sie nicht brechen.
»Ich bin überzeugt, dass ich keine weitere Zurechtweisung nötig haben werde«, sagte der Fähnrich, obwohl er das genaue Gegenteil erwartete.
Aber ein gutes Wort war in jedem Fall besser als eine Drohung. Dann ging der Kapitän weiter und brachte die Besichtigung der Steuerbordgeschütze zu Ende. Auf der Back nahm er die acht Neunpfünder Bugkarronaden in Augenschein und ging daraufhin an den Backbordgeschützen entlang wieder nach achtern. Bei dem Seesoldatenposten am vorderen Niedergang machte er halt.
»Wie lautet Ihre Wachvorschrift?«
Der Seesoldat stand in straffer militärischer Haltung vor ihm, die Füße im Winkel von fünfundvierzig Grad, die Muskete am rechten Bein, den Zeigefinger der Linken an der Hosennaht. Sein Kopf wurde durch die Halsbinde wie in einem Schraubstock festgehalten. Er starrte eisern geradeaus und über Travis Schulter hinweg, da dieser nicht genau vor ihm stand.
»Es ist mir verboten, meinen Posten zu verlassen«, begann er und betete seinen Wachbefehl herunter, wie er ihn wohl schon tausendmal heruntergeleiert hatte.
Erst als der Mann an den Schlusssatz kam, der sich auf seine augenblickliche Verwendung bezog, klangen seine Worte etwas lebhafter.
»Ich darf niemand erlauben, unter Deck zu gehen, mit Ausnahme von Leuten, die leere Kartuscheneimer tragen.«
Diese Bestimmung sollte verhindern, dass sich Feiglinge ein Versteck tief unter der Wasserlinie suchten.
»Was machen Sie, wenn man Verwundete unter Deck bringen will?«
Dem Seesoldaten verschlug es die Sprache. Er fand so schnell keine Antwort, denn mit dem Denken war es nach all den Jahren des Drills so eine Sache.
»Darüber habe ich keinen Befehl«, stammelte er endlich und drehte immerhin die Augen, nicht aber den Kopf in Richtung des Kapitäns.
Travis warf Boyd einen Blick zu.
»Ich werde mit dem Feldwebel der Seesoldaten sprechen«, sagte Boyd.
»Wer hat sich nach der Klarschiffrolle um die Verwundeten zu kümmern?«
»Der Küfer und sein Maat, der Segelmacher und sein Maat, Sir, vier Mann im Ganzen.«
Man konnte wetten, dass Boyd über alle diese Einzelheiten auf Anhieb Auskunft zu geben wusste. Travis hatte wohl eben zwei Kleinigkeiten bemängeln müssen, für die der Erste Offizier letzten Endes verantwortlich war, aber er brauchte darüber kein weiteres Wort zu verlieren, denn so wie er Boyd kannte, schämte sich der ohnehin in Grund und Boden.
Jetzt ging es den Niedergang hinunter zum Pulvermagazin und den Zweiunddreißigfündern auf dem Hauptbatteriedeck. Durch das Glasfenster der Lichtkammer schimmerte eine Kerze und spendete gerade so viel Helligkeit, dass die Pulverjungen genug sehen konnten, wenn man ihnen die geladenen Kartuschenbeutel durch die doppelten Wollvorhänge reichte, die sie von der eigentlichen Pulverkammer trennten. Dort standen der Feuerwerker und sein Maat, beide in Filzpantoffeln bereit, die Kartuschen auszugeben und nötigenfalls zu füllen.
Zum Schluss war noch der achtere Niedergang an der Reihe, wo sich Gibson der Sanitätsgast bereithielt, die Verwundeten zu versorgen. Wie leicht, dachte Travis, mochte es eines Tages auch ihm widerfahren, dass man ihn blutüberströmt und mit zerschmetterten Knochen hierher schaffte. Er wurde diese dummen Gedanken erst los, als er wieder auf das Oberdeck kam.
»Mr. Kenney!«, das war wieder einer von den jungen Herren. »Was wissen Sie über die Ausgabe von Laternen bei Nachtgefechten?«
»Ich muss warten, bis Mr. Boyd ausdrücklich befiehlt, dass sie ausgegeben werden.«
»Und wen schicken Sie nach den Laternen, wenn Sie diesen Befehl erhalten?«
»Matrose Hearne, Sir.«
Dabei deutete er auf einen jungen Mann, der neben ihm stand und einen besonders aufgeweckten Eindruck machte. Aber er hatte mit seiner Antwort nicht den Bruchteil einer Sekunde gezögert?
Der Kapitän wandte sich an Hearne.
»Nun, sagen Sie mir, wohin Sie in diesem Fall gehen.«
Der Matrose schielte blitzschnell hinüber zu Kenney. Immerhin, das konnte man als Verwirrung oder Verlegenheit deuten, aber der Fähnrich schwankte nun ein ganz klein wenig auf den Beinen, als wollte er mit der Schulter in eine bestimmte Richtung weisen. Hinzu kam eine rasche Handbewegung vor seinem Leib.
»Nach vorn, Sir, der Bootsmann gibt sie aus, unter der Back.«
»Richtig«, sagte Travis.
Er zweifelte keinen Augenblick, dass Kenney es einfach vergessen hatte, Boyds Befehl über die Gefechtslaternen weiterzugeben. Aber der Fähnrich war immerhin schlau genug gewesen, das Versäumte wiedergutzumachen. Und Hearne hatte nicht nur erstaunlich rasch begriffen, was der andere wollte, sondern überdies höchst anständig gehandelt, weil er seinen Unteroffizier nicht in der Patsche sitzen ließ. Es war also aus verschiedenen Gründen gut, wenn man die beiden im Auge behielt. Dass sich die Laternen unter der Back befanden, hatte der Bursche einfach deshalb erraten, weil dort auch das Bootsmannshellegatt lag.
Der Kapitän gelangte, immer von Boyd gefolgt, wieder auf das Achterdeck. Er ließ seinen Blick noch einmal nachdenklich über das Deck wandern und musterte nur noch kurz die Backbordachterdeck-Karronaden, die er noch nicht besichtigt hatte. Dann suchte er sich einen Platz aus, wo man gut verstehen konnte, was er sagte.
»Mr. Boyd...«, ließ er sich dort vernehmen, »wir haben ein ausgezeichnetes Schiff. Wenn wir uns richtig ins Zeug legen, ist die Besatzung bald so, wie sie sein soll. Bitte fahren Sie mit dem Artilleriedienst fort.«
»Aye, eye, Sir.«