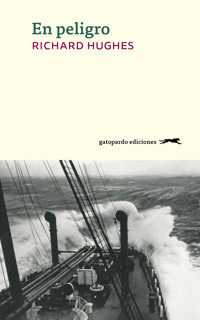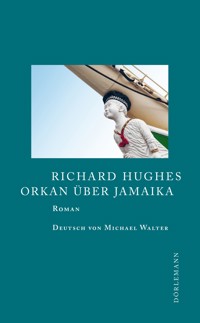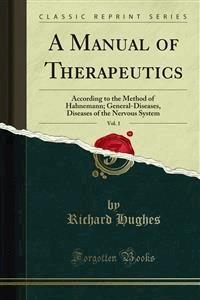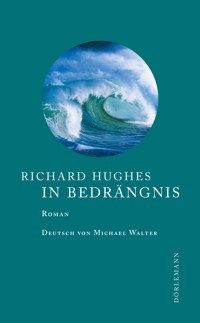
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Dörlemann eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Die beeindruckendste Lektüre des Jahres ist schlicht und ergreifend die Entdeckung von Richard Hughes'Roman aus dem Jahr 1938, ein kleines Meisterwerk über die Todesangst auf einem Schiff, das in einen Hurrikan gerät – und über alles Sein.«Simon Schama, The GuardianDer Dampfer Archimedes ist ein Frachtschiff in allerbestem Zustand, als er den Hafen von Norfolk, Virginia, verlässt, um an einem wunderschönen sonnigen Herbsttag durch den Panamakanal nach China zu fahren. Seine Ladung besteht aus Tabak und Altpapier. Doch kaum erreicht es die karibischen Inseln, gerät das Schiff durch einen unerhörten Sturm in schwerste Bedrängnis. Während vier Tagen kämpfen Captain Edwardes und seine Mannschaft, vom Ersten Offizier über den Leitenden Ingenieur bis zum chinesischen Maat um die Archimedes – und um ihr Leben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 253
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Richard Hughes
In Bedrängnis
Roman
Aus dem Englischenvon Michael Walter
DÖRLEMANN
Die Originalausgabe »In Hazard. A Sea Story« erschien 1938 bei Chatto and Windus, London. Die Arbeit des Übersetzers am vorliegenden Text wurde vom Deutschen Übersetzerfonds gefördert. Neuübersetzung Alle Rechte vorbehalten © 1938 by the Executors of the Estate of Richard Hughes Porträt von Richard Hughes: Bruno de Hamel, ca. 1960 Satz und eBook-Umsetzung: Dörlemann Satz, Lemförde ISBN 978-3-03820-899-0www.doerlemann.ch
Inhalt
Richard Hughes
Hinweis
Ich habe die in dieser Geschichte geschilderten Ereignisse nach besten Kräften strikt innerhalb der Grenzen des wissenschaftlich Möglichen belassen; innerhalb der Grenzen dessen, was geschehen ist oder geschehen kann. Trotzdem bleibt es eine erfundene Geschichte, keine historische, und keine einzige Figur ist gedacht als Porträt irgendeiner lebenden Person.
R. H.
Erster Teil
Der Anfang
Kapitel Eins
Unter den Menschen, die mir begegnet sind, ragt in meiner Erinnerung ganz besonders ein gewisser Mr. Ramsay MacDonald heraus. Er war Leitender Ingenieur und, nach eigenem Bekunden, ein weitläufiger Vetter von Mr. J. Ramsay MacDonald, dem Staatsmann. Er besaß auch wirklich, was Gesicht und Schnurrbart betraf, große Ähnlichkeit mit seinem »Vetter«; und zuerst verblüffte mich der Anblick, wie da anscheinend mein Premierminister im Overall und mit der Aura echter Autorität und Fachkenntnis resolut unter einer demontierten Maschineneinheit hervorkroch.
Denn ursprünglich bin ich Mr. MacDonald während der ersten Labourregierung im Jahr 1924 begegnet, auf der Archimedes, einem einschraubigen Turbinendampfer von etwas über 9000 Tonnen.
Es war ein prächtiges Schiff. Ein reines Frachtschiff (es sei denn, man weigert sich, die moslemischen Pilger, die es gelegentlich beförderte, als Fracht zu klassifizieren). Die Reederei, ein hoch angesehenes Handelshaus in Bristol, besaß eine große Flotte, doch sie liebte jedes einzelne Schiff und spornte es zur Höchstleistung an, als wäre es ihr Kind – eine tiefe, aufrichtige, eigennützige Liebe, keine bloße Gefühlsduselei. Die Reederei baute ihre Schiffe nach eigenen Entwürfen. Sie achtete auf deren perfekten Zustand und zögerte nie, alles abzuwracken, was veraltet oder unsicher schien. Sie schloss für ihre Schiffe keine Versicherung ab. Eventuelle Verluste wollte sie ebenso wenig teilen wie die Gewinne. Darum waren alle, von der Firmenleitung bis zur Bordkatze, bedingungslos entschlossen, jedes Verlustrisiko zu vermeiden.
Man traf die allergrößten Vorsichtsmaßnahmen. Nehmen wir zum Beispiel die Schornsteinstage der Archimedes. Sie waren ausgelegt, einer Belastung von einhundert Tonnen standzuhalten! Aber wie konnte es jemals zu einer Belastung von einhundert Tonnen für die Schornsteinstage kommen? Ein Sturm von fünfundsiebzig Meilen pro Stunde risse einem Segelschiff jeden Fetzen Leinwand aus der Takelage; und selbst ein derartiger Hurrikan würde, nach den Berechnungen der Konstrukteure, den Schornstein der Archimedes höchstens mit einem Gesamtdruck von zehn oder fünfzehn Tonnen belastet haben. Der Schornstein (er bestand aus einem inneren und einem äußeren Teil, die miteinander verklammert wurden) war an sich schon stabil genug, um jeder gewöhnlichen Belastung zu trotzen. Bei korrekt montierten Stagen stand dieser Schornstein so sicher wie die Bank von England.
II
Mr. MacDonald, ich sagte es wohl bereits, war Leitender Ingenieur. Er herrschte unumschränkt im Maschinenraum, im Feuerungsraum und in diversen Außenbereichen.
Ein Maschinenraum lässt sich mit keiner Architektur an Land vergleichen. Es ist ein gewaltig hoher Raum – der mehr oder weniger das ganze Schiff von oben bis unten durchzieht. Riesig. Doch anders als die meisten großen architektonischen Räume (mit Ausnahme der Hölle vielleicht) betritt man ihn durch ein kleines Schott ganz oben.
Diese ungeheure Leere füllen ausgeklügelt und planvoll aufgestellte Maschinen: Hochdruck- und Niederdruckturbinen, Untersetzungsgetriebe, Kondensatoren, Pumpen. Dem Besucher bleibt die eigentliche Natur dieser Maschinen jedoch verborgen, denn jede ist fest mit aberhundert schweren Eisenbolzen in einen Eisenmantel eingeknöpft. Große, unterschiedlich dicke Rohre, manche – kalt – aus blankem, betautem Kupfer und andere in weißen, wärmespeichernden dicken Umhüllungen, verbinden die Maschinen.
Haben Sie an einem Nebeltag schon mal diese Spinnfäden gesehen, die wie Stege zwischen den Zweigen eines Gebüsches verlaufen? Im Maschinenraum gibt es ebenfalls kleine Metallstege in verschiedener Höhe und filigrane Stahltreppen, über die man zu jedem Teil dieser riesigen Eisenklötze gelangt; und über sich sieht man Kräne und Hochbahnen zum Transport von Werkzeugen und Ersatzteilen, denn diese Werkzeuge und Ersatzteile wiegen oft etliche Tonnen.
Die Handläufe aus poliertem Stahl sind schlüpfrig durch Feuchtigkeit und Öl. Und die Luft hier kontrastiert mit der schneidenden Seeluft draußen, sie ist warm und weich vom Dampf (der in kleinen Mengen stets irgendwo entweicht), und der Maschinenlärm im Raum bleibt erträglich.
Im Kesselraum (oder Feuerungsraum), den man gewöhnlich von unten her durch ein niedriges Schott am Boden des Maschinenraums betritt, herrschen ganz andere Zustände. Hier ist die Luft noch heißer, aber recht trocken. Außerdem waltet hier eine ähnliche Symmetrie, wie man sie auch in architektonischen Räumen an Land findet: eine Reihe gleichartiger Heizkessel, die unten schmal sind, sich nach oben verbreitern und unter der Decke zusammentreffen gleich gotischen Bögen in einer Metallkrypta (oder wie die Wände eines Zimmers in einem Traum).
Dem Zugang vom Maschinenraum vis-à-vis erstreckt sich eine Reihe Feuertüren, jede mit einem kleinen Guckloch, das von den Flammen dahinter hell erleuchtet wird. Späht man durch so ein Loch in den tobenden Feuerbrand, kann man sich schwer vorstellen, dass er sich nur aus der Verbrennung eines einzigen dünnen, heißen Ölstrahls speist, den eine Düse zerstäubt, die so klein ist, dass sie in die Westentasche passt! Neben jeder Feuertür steht ein Behälter, einem Schirmständer nicht unähnlich. Darin steckt eine Fackel – eine lange Eisenstange mit einem Bündel ölgetränkter Stofffetzen am Ende. Zum Wiederentzünden einer Feuerung (solange sie noch warm ist) muss man nur ganz behutsam zwei Hahnventile öffnen, das eine liefert heißes Öl, das andere einen Druckluftstrom: Und dann zündet ein Chinese die Fackel an und stößt sie durch eine kleine Öffnung in das leere, ofengleiche Gewölbe der Feuerung, wo der heiße Öldunst sofort zu einem brüllenden Flammenmeer explodiert.
Hier – im Feuerungsraum – befindet man sich natürlich direkt unter dem Fuß des Schornsteins. Eine Stahlleiter führt hinauf in den Raum, der ihn an der Basis umgibt, der sogenannte Schornsteinmantel; durch ein Schott gelangen die Heizer direkt an Deck und in die frische Luft. Aber der Besucher, den Mr. MacDonald durch sein Reich führt, kehrt normalerweise wieder in den Maschinenraum zurück.
Und dort, jenseits der Unzahl Heizkessel und klirrender Maschinen, findet man schließlich die schlichte Sache, um die es eigentlich geht: nämlich eine glatte Säule aus Stahl, die in kühlen und komfortablen Lagern ruht und lautlos rotiert – die Schraubenwelle. Sie verläuft in voller Länge durch einen nicht ganz mannshohen Gang bis zum Heck des Schiffs.
Stellen Sie sich einen Baum vor. Die Wurzeln eines Baumes durchziehen als hochkompliziertes Netzwerk den Boden und entnehmen ihm alles Notwendige. Diese Nährstoffe steigen vereint die unscheinbare Säule des Stammes empor und explodieren oben in der Luft in einer Vielzahl von Blättern. Ebenso werden die diversen Kräfte – Druck und Zug –, die von diesem Maschinenwirrwarr ausgehen, in der schlichten Rotation dieser liegenden Säule gebündelt und ruhig ins Meer geleitet, wo sie plötzlich das weiße und glasgrüne Blattwerk der Wirbel und durcheinanderschießender Strömungen entfalten, das gewaltige Gewühl durchpflügter Wogen, aus denen das Kielwasser eines Schiffes besteht.
III
All das lag ausschließlich in Mr. MacDonalds Zuständigkeit, ebenso wie bestimmte andere Mechanismen im Schiff. Die Rudermaschine, zum Beispiel, in ihrem »Haus« auf dem Achterdeck (im Heck). Das ist eine wuchtige Maschine, trotzdem lassen sich ihre immensen Kräfte, die das schwere Ruder mit höchster Präzision einstellen, an- oder abschalten vom schmalen Handgelenk eines chinesischen Rudergängers, der auf der Brücke leicht am Steuerrad dreht. Und sollte das Steuerrad auf der Brücke aus irgendeinem Grund nicht funktionieren, dann lässt sich ein Notsteuer im Heck ankoppeln. Sollte aber die Dampfrudermaschine selber ausfallen, dann säße man in der Klemme. Denn ein so schweres Ruder kann man nicht von Hand bewegen. Die geballte Kraft der ganzen Crew würde nicht ausreichen, es auch nur einen Zoll zu drehen.
Was kann ich Ihnen noch erzählen, damit Sie eine Vorstellung von der Archimedes gewinnen? Ich schweige über ihren prächtigen Anstrich und ihre schönen Linien, denn ich möchte nicht, dass Sie sie so sehen wie ein Verliebter eine Frau sieht, sondern so, wie ein Medizinstudent es tut. (Der Liebhaber erhält später das Wort.)
Hier noch ein paar Informationen. Der Rumpf eines Schiffes besteht aus zwei Hüllen, und der Raum dazwischen ist in Sektoren gegliedert. Diese Sektoren in der Schiffswand heißen Tanks. Sie dienen verschiedenen Zwecken. Einige fassen das Heizöl (denn die Archimedes ist ein Dampfer mit ölgefeuerten Kesseln). Andere können, lässt man sie mit Meerwasser volllaufen, als Ballast dienen, um die Stabilität des Schiffes zu kontrollieren und zu regulieren. Wieder andere enthalten Frischwasser. Zu diesen Tanks gelangt man durch Mannlöcher, die sich zum Teil im Boden des Maschinenraums befinden; belüftet werden sie (denn Heizöl entwickelt explosive Gase) durch jene Rohre, die Ihnen auf dem Promenadendeck eines Linienschiffes unweit der Reling vielleicht schon aufgefallen sind. Es ist die Aufgabe des Schiffszimmermanns, sie auf jeder Wache auszuloten und den Stand ihres Inhalts genau zu protokollieren.
So viel also zu Mr. MacDonalds Reich. Ihm waren sieben Ingenieuroffiziere unterstellt, ein Stückchen roter Stoff neben den goldenen Ärmelstreifen kündete von ihrer tartareischen Tätigkeit, und ihnen wiederum unterstand eine aufgeweckte und geschickte Crew von chinesischen Heizern und Schmierern. Das übrige Schiff – der Rumpf, die Decks und allem voran der Laderaum – gehörte Mr. Buxton, dem Ersten Offizier alias I.O.
Es ist schon merkwürdig, wie wenig Deckoffiziere und Ingenieuroffiziere (der alten Schule) sich für den Arbeitsbereich des anderen interessieren. Dahinter steckt weniger taktvolle Vermeidung eines Übergriffs als völliges Desinteresse. Der Ingenieuroffizier muss sicherstellen, dass bestimmte Maschinen funktionieren, doch es interessiert ihn nicht, wozu sie dienen. Es kümmert ihn ebenso wenig, wohin sie ihn bringen, wie es den Bauch interessiert, wohin die Beine unterwegs sind. Der Deckoffizier wiederum scheint kaum zu wissen, ob er sich auf einem Motorschiff oder auf einem Dampfer befindet (er merkt es höchstens an den stark verschmutzten Decks). Er kann nicht einmal die Funktionsweise der einfachsten, tagtäglich von ihm benutzten technischen Vorrichtung erklären. Auch sonst leben Deckoffiziere und Ingenieuroffiziere ähnlich isoliert voneinander wie Jungen und Mädchen im englischen Schulwesen.
Selbst auf der Archimedes, wo man die Politik verfolgte, die Parteien zusammenzuwürfeln, klappte die Sache nicht so recht. In der blitzblanken Offiziersmesse aus Mahagoni aßen sie an verschiedenen Tischen, wobei ihnen der Tisch für die Kadetten als Barriere diente. Ihre Quartiere waren getrennt. Sogar die chinesischen Heizer schliefen am einen Ende des Schiffs und die chinesischen Decksmänner am anderen!
Es gibt natürlich gewisse Bereiche des Schiffs, wo sich die Grenze kaum ziehen lässt – doch sie wird gezogen, überall. Das Schornsteininnere gehörte zum Beispiel Mr. MacDonald, die Außenseite Mr. Buxton. Die Dampfpfeife gehörte Mr. MacDonald, das Nebelhorn jedoch fiel fraglos in die Zuständigkeit von Mr. Buxton. Dieser Umstand war auf der Archimedes nicht so bedeutungslos, wie es klingt. Mr. Buxton besaß nämlich einen trägen Lemuren, einen Katta aus Madagaskar, namens Thomas. Und Thomas schlief tagsüber regelmäßig im Nebelhorn. Er besaß das Recht dazu, denn das Nebelhorn unterstand ja seinem Herrn. Es war Thomas’ Zufluchtsort.
Der kleine Thomas schlief den ganzen Tag und war nicht einmal nachts besonders munter. Ein Manko jedoch besaß er. Er hatte ein Faible für das menschliche Auge und missbilligte dessen geschlossenen Zustand. Kam er in Mr. Buxtons Kabine, während sein Herr schlief, dann sprang er sacht auf den Rand der Koje und hob mit seinen langen Fingern ebenso geschickt wie behutsam die Lider des Schlafenden, bis der ganze Augapfel frei lag. Das tat er auch bei anderen Deckoffizieren, wenn er sie (zu seinem Kummer) nachts mit geschlossenen Augen vorfand. Sie mussten Thomas natürlich ertragen (wenn es nachts zu heiß war, um die Schotten zu schließen): Es war eine Frage der Disziplin. In der englischen Gesellschaft kommt der Ehefrau der Rang ihres Gatten zu; und auf See kommt dem Haustier der Rang seines Besitzers zu. Eine Kränkung des Lemuren des Ersten Offiziers wäre gleichbedeutend mit einer Kränkung des Ersten Offiziers gewesen.
Was die Ingenieuroffiziere betraf, da wusste Thomas ganz genau, dass er nicht einmal in die Nähe ihrer Unterkünfte kommen durfte, aber im Nebelhorn seines Herrn wagte niemand, sich an ihm zu vergreifen.
IV
Im Spätsommer 1929 (fünf Jahre nach meiner ersten Begegnung mit Mr. MacDonald) lud die Archimedes in verschiedenen Häfen an der Atlantikküste Stückgut für den Fernen Osten. Zuständig für die komplizierte Einlagerung war natürlich Mr. Buxton (ein Deckoffizier muss tatsächlich mehr von der Ladung verstehen als vom Seegang). In New York verstaute er etliche Säcke mit Wachs ganz unten. Dann folgte eine Unmenge buntes Allerlei. Unter anderem einige Tonnen altes Zeitungspapier, das die Chinesen zum Bau ihrer Häuser verwenden. Das meiste wurde in den Zwischendecks verstaut – also weit oben, wegen des relativ geringen Gewichts. In Norfolk (Virginia) nahm man eine Ladung Tabak von minderer Qualität an Bord, der gleichfalls für China bestimmt war, wo man ihn zu billigen Zigaretten verarbeiten würde. Auch er lagerte in den Zwischendecks.
Norfolk war der letzte Ladungshafen, und hier verzögerte sich ihre Abfahrt ein wenig. Worüber sich jedoch keiner beschwerte. Philadelphia war trotz der stinkenden Docks irgendwie ganz nett gewesen, weil die meisten Offiziere dort Freunde hatten; aber an Gastlichkeit schlug Norfolk Philadelphia um Längen. Kapitän und Erster Offizier dürfen (in der Regel) nie gleichzeitig an Land gehen. Doch in Norfolk gab es so viele Feste, dass beide auf ihre Kosten kamen. Sogar Mr. MacDonald hatte sich schließlich zur einmaligen Teilnahme überreden lassen und amüsierte sich – er versuchte es immerhin.
Die rangniederen Offiziere besuchten meist andere und zwanglosere Partys und machten dabei allerhand erhellende Erfahrungen. Mr. Watchett, ein noch sehr junger Offizier aus dem nüchternen ostanglischen Marktflecken Fakenham, wurde beispielsweise eines Nachts von einer Gruppe junger Männer und Mädchen aus den Südstaaten aufgegabelt. Er erzählte ihnen, er stamme aus Norfolk in England – das genügte als Empfehlung. Obwohl er sie vorher noch nie gesehen hatte, behandelten sie ihn gleich so selbstverständlich, als wären sie alte Freunde. Sie gingen mit ihm bis zum Umfallen tanzen, irgendwo; und plötzlich sprangen alle in ihre Autos und fuhren hinaus in die Nacht. Der beißende Geruch öliger Sandstraßen, die riesig hohen Bäume, die über ihnen fast zusammenwuchsen, der Lärm der Frösche und Insekten. Sie kamen zu einem stattlichen Haus im Kolonialstil und gaben Dick Watchett in einem muffigen Zimmer voller viktorianisch anmutender Möbel Maiswhisky zu trinken.
Sie waren alle unheimlich kultiviert. Unter ihnen befand sich ein älterer Mann, ein ehemaliger Soldat. Er trug ein goldbronziertes Holzbein zu seinem Abendanzug, denn er behauptete, die rein praktische Beinprothese, die er im Alltag anlege, passe nicht zu einem Smoking. Zur Gruppe gehörte auch ein wunderschönes, blondes Mädchen mit großen, unschuldigen Augen. Sie war blutjung und besuchte noch die Highschool. Sie erzählte Dick, sie stamme aus einer ganz besonders aristokratischen Familie, deren Blut seit unzähligen Generationen jeden Floh, der ein Familienmitglied biss, wahnsinnig machen würde. Diese Besonderheit sei ihnen letztlich auch zum Verhängnis geworden. Denn einer albernen Wette wegen hätte ihr Vater etliche der unersetzlichen Mitwirkenden eines Flohzirkus mutwillig um den Verstand gebracht; und damit man die vom Gericht verhängte Schadenersatzsumme bezahlen konnte, hätte man die Familienplantage verpfänden müssen. Das erzählte sie zumindest Dick.
Hier schwante Dick zum ersten Mal, dass es in Amerika, ebenso wie in Europa, uralte aristokratische Familien gibt, die sich ungeheuer viel auf ihr Blut einbilden.
Der Mann mit dem goldbronzierten Holzbein bedrängte das Mädchen (es hieß Sukie) mit seinen Zärtlichkeiten. Sie sträubte sich, weil sie wirklich so unschuldig war, wie sie wirkte; sie erkor sich Dick zum Beschützer und schmiegte sich an ihn wie ein Vögelchen. Er merkte nicht, dass sie sogar noch viel mehr Maiswhisky trank als er. Viel mehr als sie in ihrem Alter vertrug, außerdem war dies ihre erste derartige Party; doch nachdem sie einmal angefangen hatte, dachte sie gar nicht ans Aufhören. Der Whisky floss aus Glasballons, die eine Gallone fassten; es herrschte also kein Mangel.
Bald erzählte sie Dick, sie hätte eine Katze, die wäre so raffiniert, dass sie erst Käse fressen und dann in die Mauselöcher pusten würde, um so die Tierchen zu ködern und herauszulocken. Ihr Blick wurde immer wirrer, und als sie in Dicks Arm lag, zitterte sie ab und zu. Dick redete nicht viel mit ihr, aber er genoss ihre Gegenwart. Ihm war selbst etwas schwindlig, und die Party schien mal näher, mal weiter weg, und er konnte dem Geschehen kaum folgen. Sukie hatte inzwischen einen halben Liter des schwarz gebrannten Alkohols intus, und das ist für eine Sechzehnjährige eine ganze Menge, und irgendwann wurde die Wirkung übermächtig. Sie wand sich plötzlich aus Dicks Armen und sprang auf. Ihre unnatürlich geweiteten Augen schienen niemanden wahrzunehmen, nicht einmal ihn. Sie zerrte an den Trägern ihres Kleids und an ein paar Verschlüssen und hatte im Nu kein Stückchen Stoff mehr am Leib. Ein paar Sekunden stand sie so da, splitterfasernackt. Dick hatte so etwas noch nie erlebt. Dann kippte sie um.
Dick stellte abrupt sein Glas weg, in ihm hämmerte ein wilderer Rausch. Bekleidet war sie schon schön gewesen, aber so war sie noch unendlich schöner, hingegossen wie ein Teich; die weiße Haut; ihr kleines unglückliches Gesicht, bereits verzerrt von der aufkommenden Übelkeit. Plötzlich merkte Dick, dass alle anderen das Zimmer verlassen hatten; und genauso plötzlich merkte er, dass er dieses Mädchen mehr liebte als alles auf der Welt. Er wickelte sie mit zittrigen Händen in den Kaminvorleger, damit sie sich nicht erkältete, bettete sie so bequem wie möglich auf ein Sofa und kehrte bebend auf sein Schiff zurück.
Er lag stundenlang wach, absolut unfähig, das intensive Bild von Sukies betrunkener Unschuld auszublenden. Doch endlich schlief er ein, ihr schönes Gesicht und ihr nackter Körper flackerten durch seine Träume. Und plötzlich erwachte er, weil kleine dünne Finger ihm die schweren Lider hoben, und er starrte durch sein Traumgeflecht in große, leuchtende Augen, nur wenige Zentimeter von seinen entfernt; aber es waren nicht Sukies Augen. In panischem Erschrecken hieb er auf den Lichtschalter.
Es war Thomas, der mit weichem Fell und langem Schwanz auf seinen unnatürlich langgezogenen Füßen davonhoppelte und nervös mit den Ohren zuckte.
Am nächsten Abend, dem Abend vor ihrer Abfahrt nach Colon und dem Panamakanal, veranstaltete Captain Edwardes ein Fest an Bord, wo zu Grammophonmusik getanzt wurde. Das Grammophon gehörte Mr. Foster, dem Zweiten Offizier. Die Damen waren Bekannte des Captains, zumeist Verwandte des Firmenagenten oder der Verfrachter. Ihre Einladung hatte die Pflicht diktiert. Keine von ihnen jung, keine schön, und da sie auch nicht aristokratisch waren, so wie Dicks Freunde, benahmen sie sich ganz tadellos, wenn auch ein wenig ungehobelt. Captain Edwardes, Mr. Buxton und Mr. MacDonald waren ausgelassen und kokett wie Kinder, und es wurde sehr lange getanzt – fast bis halb zwölf.
Der einzige Offizier, der nicht teilnahm, war Mr. Rabb. Mr. Rabb gehörte nicht zur Archimedes, er hatte als Supernumerar angemustert, nicht als regulärer Schiffsoffizier. Eigentlich gehörte er zur Descartes – auch einem Schiff aus der Philosophen-Flotte der Sage-Linie – und sollte in Colon abgesetzt werden, um dort an Bord der Descartes zu gehen.
Mr. Rabb war ein strenggläubiger Christ und missbilligte Tanzen eigentlich grundsätzlich. Ganz besonders bei vorgesetzten Offizieren, die doch für die ihnen anvertrauten jüngeren Offiziere die Verantwortung trugen. Außer den vier Auszubildenden, halbe Kinder noch, war da zum Beispiel Dick Watchett. Wenn er mit diesen Damen tanzte, konnte das in ihm leicht jene Leidenschaft entfachen, vor der uns nach Gottes Willen ein Leben auf See bewahren sollte. Watchett ließ sich äußerlich keine Erregung anmerken, wenn er eine Tanzpartnerin im Arm hielt; aber das war wider die Natur – wer wusste das besser als Mr. Rabb? Und die jungen Leute sind ja so falsch.
Es ging ihn jedoch nichts an, dies war nicht einmal sein Schiff. Doch er hoffte, Captain Theobald von der Descartes würde sich als ein Mann von größerem Ernst erweisen.
Dick Watchett mochte Mr. Rabb, so wie alle Jüngeren, die mit ihm in Kontakt kamen. Die Seekadetten vergötterten ihn. Und er war mit seiner klaren, herzlichen Stimme ja auch ein liebenswerter Mensch, der die Jungen oder die Armen anständig und mit Höflichkeit behandelte – ein typischer Engländer im besten Sinne.
Kapitel Zwei
Die Archimedes lief am nächsten Nachmittag um vier Uhr von Norfolk aus und fuhr den Elizabeth River entlang in die Hampton Roads. Der Leuchtturm von Craney Island – dachte Dick – sah aus wie ein Schweizer Chalet auf Stelzen. Die gelbe Küste war niedrig und flach mit Sandstränden; auf den Roads herrschte lebhafter Verkehr – hauptsächlich Küstendampfer und lange Leichterketten.
Um halb sieben lagen sie vor Cape Henry und setzten dort den Lotsen ab.
Schiffe mit Kurs nach Süden steuern dicht unter Cape Henry, innerhalb der Untiefen. Die Küste von hier bis hinunter nach Cape Hatteras ist merkwürdig, zumeist nur ein flacher Strandstreifen, der die Binnengewässer vom Ozean trennt, eine ziemlich verschwommene Grenze für einen so großen Kontinent. Bis dorthin lief Captain Edwardes’ Kurs küstennah. Doch südlich von Cape Hatteras fällt die Küste nach Westen ab; bei Cape Hatteras, um drei Uhr morgens, verabschiedete sich die Archimedes daher von Nordamerika und nahm Kurs auf die Westindische Insel San Salvador.
Ein klarer, schöner Tag. Das Meer dunkelblau wie der Himmel, in dem vereinzelt weiße Federwolken schwammen. Obwohl es bereits Spätherbst war, schien der Sommer zurückzukehren. Denn seit sie den Golfstrom passiert hatten, kompensierte die von Wolken und Nebel ungetrübte Sonne die fortgeschrittene Jahreszeit durch die Kraft, die ihr die südliche Breite verlieh. Die Archimedes war allein auf hoher See und das Festland eben erst vergessen – die glücklichste Zeit für jeden an Bord eines Schiffes.
Das heißt, sie war allein bis auf die Delphine. Denn als der Vorsteven des Schiffs das violette Glas durchschnitt, pflügte er glitzernde, schneeweiße Schaumberge auf; und etwas Schöneres als die tief im Innern dieses Glases tanzenden Delphine hatte ich noch nie gesehen. Ein Dutzend Tiere, mächtig, viel größer als ein Mensch, am Rücken olivbraun, die Flanken und der Bauch von einem leuchtenden Blassgrün; ihre Form: Gestalt gewordene Geschwindigkeit. Die spitze Schnauze vor der wulstigen Stirn teilte das Wasser perfekt, und hinter der rudernden Schwanzflosse schloss es sich wieder, so als sei nichts gewesen.
Meistens tanzten sie paarweise, glitten vor dem Steven hin und her wie Schlittschuhläufer, dann kreuzten sie – einer oben, einer unten – übereinander hinweg, drehten sich um die eigene Achse, ein silbrig grünlicher Blitz tief unten im Wasser, stiegen nach oben, bis ihre Rückenflosse die Luft wie eine weiße Feder durchtrennte, schnellten hoch wie kraftstrotzende Meerjungfrauen, haltlos vor Glück, warfen sich im Sprung auf den Rücken bald zu zweit, manchmal zu dritt, zu viert oder auch zu fünft. Plötzlich schossen zwei davon, entfernten sich vom Schiff; aus dem Nichts tauchten zwei neue auf, kreuzten den Bug und gesellten sich zu dem himmlischen Wasserspiel.
Anfangs hatte Sukie alles andere in Dicks Bewusstsein bis in den letzten Winkel hinein überstrahlt, doch schon jetzt, nach zwei Tagen, war sie geschrumpft und in der Ferne verschwunden wie das Portal, durch das man in einen Tunnel eingefahren ist; überirdisch leuchtend und heller als das Tageslicht, aber sehr weit weg und klein und scharf umrissen. Doch jetzt, als er den Delphinen zuschaute, schien sein ganzes Bewusstsein für einen Moment wieder von dem Licht überflutet, das alle dunklen Ecken sanft ausleuchtete und dann zu einem Gefühl wohliger Traurigkeit verblasste.
Am selben Abend sah er noch einmal etwas sehr Schönes, einen seltenen Anblick (außer im Chinesischen Meer): ein ferner Streifen Ozean phosphoreszierte so stark, dass er einen Widerschein in den Himmel warf. Als sie die Stelle dann erreichten, funkelte das Wasser wie das Sternenfirmament, und alles, was sich darin bewegte, war in kaltes Feuer gehüllt. In der Tiefe verströmten irgendwelche Fische ein rotierendes Licht wie ein Leuchtfeuer.
Ein seltenes und großartiges Schauspiel. Doch es rührte ihn nicht so an wie die nackten Delphine.
II
Nach vier Tagen hatten sie San Salvador erreicht.
Die kleine sommerliche Oase lag nun hinter ihnen; danach herrschten eine graue, südöstliche Dünung und eine frische Brise; das Wetter war bewölkt mit gelegentlichen Schauern. Doch es bestand keinerlei Grund, richtig schlechtes Wetter zu erwarten; das Ende der Hurrikan-Saison lag mindestens zwei Wochen zurück, die Dünung kam nicht lang und ölig, was sonst einen tropischen Sturm ankündigt, und auch die Wolken ließen keineswegs Schlimmes ahnen. Belebendes Wetter, mehr nicht.
Die Bordroutine ging ihren Gang. Während der Mahlzeiten richtete niemand unaufgefordert das Wort an den Captain. Captain Edwardes war privat keine einschüchternde Erscheinung, ja nicht einmal imposant, sein Posten hingegen schon.
Captain Edwardes besaß nicht von Natur aus jene souveräne Ausstrahlung, die so vielen Seeleuten eigen ist. Er war klein, mit etwas kindlichen, aber dunklen Zügen. Seine Augen leuchteten, doch eher vor Begeisterung als vor Stärke; und man merkte, er wäre ausgesprochen umgänglich gewesen, hätte es ihm sein Posten erlaubt. Er stammte aus Carmarthenshire, und einem gebürtigen Norfolker, wie Dick Watchett, fiel es irgendwie schwer, einem Waliser Respekt entgegenzubringen. Der Erste Offizier, Mr. Buxton, kam hingegen aus Dicks Heimat, und ihn hätte Dick insgeheim lieber auf dem Kommandoposten gesehen.
Auch Mr. Foster, der Zweite Offizier – ein derber Nordengländer – wirkte wie ein tüchtiger Seemann.
Aber ein unparteiischer Physiognom, der in der Messe Ausschau hielt nach jemand, dem er blind vertrauen konnte, hätte mit ziemlicher Sicherheit den kleinen, hageren Mann aus Devon gewählt, den Supernumerar Mr. Rabb mit den ruhigen, strahlend blauen Augen und dem energischen Kinn, der mehr einem Marineoffizier als einem Offizier der Handelsflotte glich.
Nur etwas störte an Mr. Rabb: Seine Nägel waren stets bis aufs Fleisch abgekaut.
Um zwei Uhr morgens kam das Leuchtfeuer von San Salvador in Sicht. Sie ließen es zehn oder zwölf Meilen östlich liegen und passierten zwischen dieser Insel und Rum Cay, deren weiße Zwillingsklippen im ersten Morgendämmer gerade auftauchten. Sie navigierten nun zwischen den Inseln, wahrten jedoch von allen Abstand; der blaue Turm von Bird Rock lag kurz nach dem Frühstück querab. Es herrschte weiter Schauerwetter bei mäßigem Wind und mäßiger Dünung, und den übrigen Tag sahen sie nichts mehr, bis sie um vier Uhr nachmittags den hohen Turm auf Castle Island sichteten.
Dick hatte die Westindischen Inseln noch nie gesehen; es war enttäuschend, von diesen halkyonischen Inseln jetzt nichts weiter zu erblicken als ab und zu einen Leuchtturm oder hinter dem Regenvorhang einen verwaschenen, hingeduckten Fleck.
Um neun Uhr abends befanden sie sich östlich von Cape Maysi, dem östlichsten Zipfel Kubas, und fuhren in die breite, als Windward Passage bekannte Meerenge zwischen Kuba und Haiti ein. Das Kap selbst liegt zu tief, als dass man es in der Dunkelheit sehen könnte, aber die hintereinander gestaffelten Reihen der Purial Mountains hoben sich undeutlich gegen den helleren Himmel ab.
Um fünf Uhr am nächsten Morgen, es tagte eben, liefen sie östlich an Navassa Island vorbei; ein unfruchtbarer Kalksteinschwamm zwischen Jamaika und Haiti. Das war das letzte Land, das sie sehen würden vor dem Erreichen Colons am Zugang des Panamakanals (wo Mr. Rabb an Bord seines eigenen Schiffes wechseln sollte). Vor ihnen lag die kurze Passage durch die offene Karibik – eine rund 48-stündige Fahrt.
Den ganzen Tag über fegte ein frischer Nordostwind, und die schwarze See war rau. Aber was bedeuten raue See und ein halber Sturm schon für ein modernes, prächtiges Schiff wie die Archimedes? Nur eine Gelegenheit, ihre guten Eigenschaften unter Beweis zu stellen; nur eine willkommene Abwechslung vom sonst enervierenden Bordalltag. Der Wind pfiff in den Drähten, Gischt schwappte übers Vordeck und erwischte mitunter einen unbesonnenen Chinesen, der in seiner papierdünnen Kattunkleidung das Raumdeck überqueren wollte. Für Dick Watchett auf der Brücke bedeutete es, dass er sich als echter Fahrensmann fühlte, und es vertrieb die triste Vorstellung, heutzutage bestünde das Seemannsleben nur aus dem Büffeln für Prüfungen und dem Abzählen von Kolonialwaren.
Gegen Abend tobte ein richtiger Sturm. Mit Schlimmerem musste man indes nicht rechnen, jetzt wo die Hurrikan-Saison vorüber war. Das Meer wogte immerhin so hoch, dass die Archimedes stampfte und rollte; und wären Passagiere an Bord gewesen, hätten sie stumm und elend in ihren Kabinen oder halberfroren in den Deckstühlen gelegen und gar nicht mehr gut ausgesehen; manche wären vielleicht auch eilig auf Deck hin und her gerannt und hätten sich kernig gegrüßt mit dem hartgesottenen Grinsen von Schmalspur-Wikingern. Aber es gab keine Passagiere an Bord der Archimedes, nicht einmal Pilger, und der einzige, der sich übergeben musste, war Thomas, und er erledigte dies dezent und diskret in den Tiefen des Nebelhorns.
Der Sturm fand seine Erklärung, als der Funkwetterbericht einging. Das Zentrum einer »tropischen Störung« lag einige hundert Meilen weiter östlich: anders gesagt, ein kreisförmig um den Kern eines Tiefdruckgebiets gruppiertes System von Stürmen, die noch früher im Jahr zu Hurrikanstärke hätten anwachsen können.
Der Bericht meldete aber eine Störung von geringer Intensität, die sich nur äußerst langsam in westlicher Richtung verlagerte. Die Meldungen der letzten fünfzig Jahre erwähnen für den Monat November keinen schweren Hurrikan. Die Tiefdruckgebiete füllen sich immer wieder auf, und der Wind erstirbt. Und jetzt schrieb man bereits Mitte November. Da aber die Parole der Sage-Linie »Vorsicht« lautete, wich Captain Edwardes von seinem südlichen Kurs etwas nach Westen ab, um dem Tief ganz aus dem Weg zu gehen. Ein Hurrikan stand zwar keinesfalls zu erwarten, sollte aber trotzdem einer aufziehen, dann würde auf einem Schiff wie der Archimedes kein Hahn danach krähen. Doch sei das Risiko auch noch so klein, ein Navigator hat die Pflicht, es weiter zu verringern.
Über Nacht musste der Sturm sich eigentlich erschöpfen, und am nächsten Abend würden sie in Colon einlaufen. Ein leichter Barometeranstieg am späten Abend bestätigte endgültig, dass der Sturm in Kürze hinter ihnen liegen würde.
Aber nein: Um sechs Uhr morgens begann das Barometer wieder zu fallen, und es stürmte in der Tat sehr heftig. Dem schlechten Wetter jetzt weiterhin nach Westen ausweichen zu wollen, wäre unklug gewesen, denn dort lagen Riffe; und Riffe gilt es noch mehr zu meiden als Stürme. Colon war nun nicht mehr sehr weit, und die Wetterberichte von dort versprachen jedem Ankömmling milde Brisen und schönes Wetter. Also wurde der neue Kurs direkt nach Süden gesetzt, um das kleine Störungsgebiet zu umfahren, in das sie da ganz offensichtlich irgendwie hineingeraten waren.
Um acht Uhr an diesem Morgen beschloss Mr. Buxton, einen Rundgang durch das Schiff zu machen, um alles in Ordnung zu bringen und für einen Sturm vorzubereiten, nur für den Fall, dass sie doch etwas abbekamen. Es war eine routinemäßige Vorsichtsmaßnahme, weiter nichts; auf einem Schiff wie der Archimedes