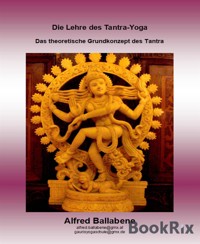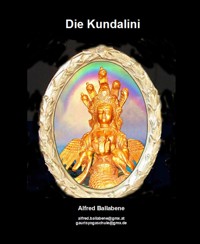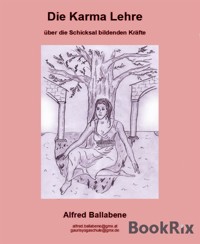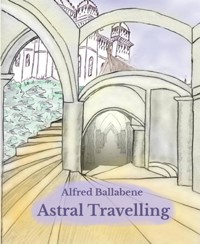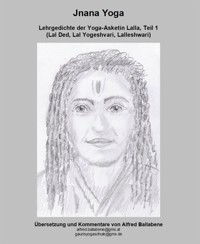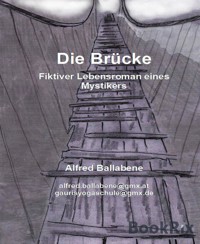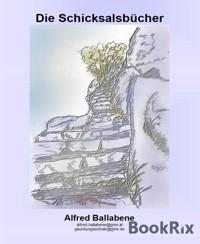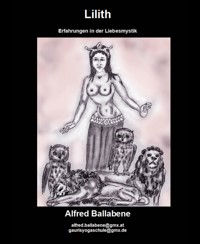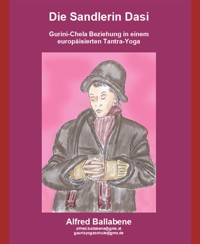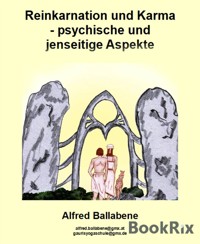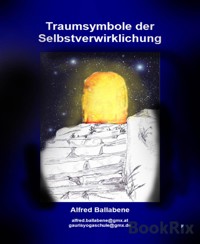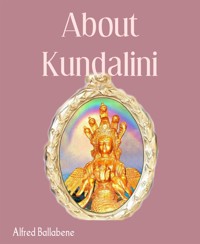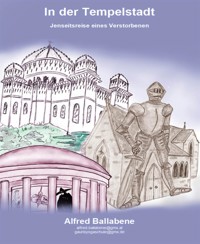
0,00 €
Mehr erfahren.
Wenn wir einmal von dieser Welt gehen und die jenseitige Welt betreten, sind wir nicht allein und auch nicht verloren. Freundschaften und Liebesverbindungen sind in diesen Welten stärker und ausgeprägter, als sie je im irdischen Leben waren. Von daher können wir damit rechnen, dass uns Stütze und Hilfe zuteil wird, sollten wir solche benötigen. Die meisten Menschen, wenn sie ihre Jenseitsreise antreten, kommen von Anfang an in eine schöne Welt, in eine sogenannte Erholungs- und Anpassungsebene. Dort treffen sie alle ihre Bekannten und Lieben.
Einige wenige Verstorbene gehören nicht zu den Glücklichen, welche in Liebe und mit Freudentränen empfangen werden. Aber auch sie sind nicht verloren. Ihre Ankunft findet sich in einer weniger schönen Welt, sei es aus diesem oder jenem Grund. Aber auch dies ist kein Anlass hoffnungslos zu sein. Im Gegenteil, es kann ein spannender Weg mit Entdeckungen und neuen Freundschaften stattfinden. Über einen solchen Weg berichtet uns die vorliegende Broschüre. Was hier erzählt wird, ist kein Produkt purer Fantasie, sondern wurde in zahlreichen Astralreisen erschaut und erlebt. Aus diesen Eindrücken, wobei einzelne Erlebnisse gleich Mosaiksteinchen zusammengefügt wurden, entstand der vorliegende Roman.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
In der Tempelstadt
Jenseitsreise eines Verstorbenen
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenIn der Tempelstadt
Jenseitsreise eines Verstorbenen
Alfred Ballabene
Text und Illustration, Publikationsrechte: Alfred Ballabene, Wien, 2007, koloriert 2017
Vorwort
Vier Personen, deren Schicksale sich in vergangenen Leben zusehends verflochten haben, finden im Jenseits zueinander. Sie lernen gemeinsam und unterstützten einander.
Zumindest für zwei von ihnen war das irdische Leben schwer und belastend. Wie ein Echo hallte dies noch in der jenseitigen Welt nach und setzte sich dort zunächst in unglückseliger Weise fort. Doch das ist nur vorübergehend. Niemandem ist die Möglichkeit genommen zu lernen und seinem Leben eine wunderschöne erfüllende Wendung zu geben.
Wir sind Reisende, in dieser und in der jenseitigen Welt. Wie für alle Reisenden gilt auch hier: „halte deine Augen offen, beobachte und lerne“. Eine der Botschaften in diesem Roman heißt: Sich an Egoismen und Wünsche zu binden schafft Abhängigkeiten und verursacht Stagnation. Von psychischen Automatismen frei zu werden, ist der Beginn, um das eigene Dasein frei gestalten zu können. Erst dann sind wir bereit die Wunder der Welt, ob hier oder dort, in beglückender Weise zu genießen. An uns ziehen Welten und Zeiten vorbei, wir wandern von Kulisse zu Kulisse, nichts können wir für immer fest halten – außer unserer Erinnerung und das, was wir daraus gelernt haben. In noch jungen Jahren lernte ich von meinem Guru: „Die Welt ist eine Brücke, bau dir kein Haus darauf!“
Das Wichtigste, das sich zu erlernen lohnt und was uns letztlich zu einer höchsten Erfüllung führt, ist die Liebe. Sie verbindet letztendlich uns alle und führt uns durch die Zeiten. Sie trotz der Widerwärtigkeiten des Lebens zu erkennen und zu finden, ist in unseren Inkarnationen eine immer wieder neu gestellte Aufgabe."
Der Flusspfad
Ein grenzenloser, schwarzer Raum umgab Elbrich. Kein Halt, kein Laut, grenzenlose Leere und Stille. Selbst die Zeit schien stehen geblieben zu sein. Im Inneren Elbrichs jedoch kochte eine turbulente Welt von Gefühlen und Gedanken, die in der momentanen Verwirrung Halt suchten. Was war geschehen?
Er erinnerte sich seiner abfallenden Gesundheit und Körperkraft. Dann war sein Kampf um das Leben zu Ende. Ein Licht umgab ihn und dann kam dieser leere Raum. Er hatte sich durch sein Leben hindurch mit Spiritualität und auch Jenseitswelten befasst, doch diese Situation war ihm fremd. Konnte sie Realität sein oder war sie nur Täuschung? Hatte er eine Fieberphantasie oder war er verstorben?
Noch im Grübeln hörte er eine weibliche Stimme, die von überall her zu kommen schien:
"Du hast deinen physischen Körper abgelegt und stehst vor einem neuen Lebensabschnitt. Löse deine Gedanken von allem, was dir zu Lebzeiten wichtig erschien, es hat jetzt keine Geltung mehr und ist nur dazu angetan, dich in deinem Weitergehen zu behindern. Konzentriere dich auf das was kommt. Sei unbesorgt, du bist nicht allein und nicht unbeschützt, auch wenn du dich bisweilen verlassen fühlen mögest. Ich war immer bei dir und begleite dich auch jetzt, unsichtbar, wie auch auf deinem Erdenweg. Wenn du dich nach innen wendest, kannst du meinen Rat als Intuition erfühlen, jetzt sogar besser als in deinem vergangenen irdischen Leben. Erinnere dich immer meiner Worte und fühle dich nicht verlassen, ich bin bei dir!
Wenn immer du Entscheidungen zu treffen hast, höre in dich hinein. Ebenso, wenn du Trost brauchst.
Dein jetziger Zustand entsteht dadurch, dass deine irdischen Wahrnehmungen erstorben und deine neuen Sinne noch nicht erwacht sind. Dieser Zustand geht schnell vorüber. Merkst du, wie du in eine jenseitige Landschaft gezogen wirst? Du kannst es fühlen, auch wenn du nichts siehst und hörst. Es sind deine Seelenkräfte, welche dich dort hin ziehen.
Noch etwas zu der Welt, in der du dich bald befinden wirst: dein höherer, unsterblicher Wesensteil hat diesen Weg für dich ausgesucht. Du wirst in eine karge Welt gelangen. Nicht zur Strafe, sondern aus deinem dir noch unbewussten Wunsch einem Freund zu helfen, der sich dorthin verirrt hat. Mit ihm bist du in früheren Leben verbunden gewesen. Ihr habt euch öfters als nur einmal Treue geschworen. Sie blieb bestehen, auch wenn die Wirren der Schicksale euch bisweilen auseinander und gegeneinander getrieben haben. Du wirst den Weg zu ihm und noch einen weiteren Freund finden und beiden helfen. Sie brauchen dich.“
Kaum waren diese Worte verklungen, sah Elbrich vor sich einen Schein, einer matten Scheibe gleich. Bald vergrößerte sich dieser Bereich als würde er darauf zufliegen.. Es war keine Zeit um nachzudenken, denn schon, ohne aufzuschlagen, fühlte er harten Boden unter sich. Er lag auf dem Bauch, seine Hände ertasteten kantiges Geröll. Er hob seinen Kopf und sah Nebelschwaden, die über steiniges Gelände zogen. Dann stand er auf. Es gelang ihm mühelos, alle körperlichen Erschwernisse der letzten Zeit waren fortgewischt.
Elbrich
Er blickte um sich. Vor sich und zur rechten Seite erstreckte sich begehbares, ebenes Gelände. Es war karger Boden ohne Bewuchs, bedeckt mit Geröll. Sich nach hinten wendend sah er steil ansteigende Hügel, sich teilweise in Nebel auflösend. Sie waren ebenfalls kahl und von gleicher Beschaffenheit wie der Rest. Links, nicht weit von seinem Standort, schien ein Flusslauf zu sein, mit winterlich blattlosen Bäumen und gelbbraunen Gräsern. Dorthin entschied er sich seine Schritte zu lenken.
Es war ein ausgetrocknetes Flussbett. An seinem Ufer fand sich ein Pfad, den Elbrich nun entlang ging. Der Pfad schlängelte sich um Felsen und kleine Hügel. Bisweilen bahnte er sich durch dichtes Gebüsch, dann wieder zeigte sich offenes Gelände mit trockenem Gras. Aber immer blieb er möglichst nahe dem Flussbett. Würde die Sonne scheinen, so würde das Gras in herrlichem Goldgelb aufleuchten. So aber sah es winterlich dürr aus. Dennoch fand Elbrich es schön diesen Weg zu gehen. Er liebte Abwechslung und er liebte das Unbekannte. So manch dicker Weidenbaum mit hohlem Stamm und knorrigen Ästen hätte einen Maler entzückt. Ängstliche Gemüter wiederum hätten in den Nebel umwobenen Bäumen bedrohliche Gestalten gesehen, hätten sich hier schutzlos und verlassen gefühlt. Seltsam, wie unterschiedlich Bewertungen sein können. Jedenfalls Elbrich, der lange Zeit durch Krankheit ans Bett gefesselt gewesen war, genoss es, sich frei bewegen zu können und eine vielfältige und abwechslungsreiche Landschaft vor sich zu haben.
Es mochte wohl geraume Zeit vergangen zu sein, und er hatte eine weite Strecke zurückgelegt. Dennoch kannte er keine Müdigkeit und war frisch wie zu Beginn seiner Wanderung. Entsprechend gut war auch seine Stimmung. Aufmerksam betrachtete er alles, was sich seinen Augen bot.
Die Umgebung des Flusslaufes wurde felsiger und nach einer scharfen Biegung schienen Flusslauf und Weg in ein breites Tal hinab zu führen. Offenbar war es ein Hochland, auf dem er gewandert war. Zur rechten Seite war ein haushoher Felsblock, der leicht zu erklimmen war. Darauf stieg Elbrich. In einem großartigen Panoramablick konnte er die Landschaft unter sich weit überblicken. Hin und wieder übertünchten Nebelschleier, aus denen dürre Bäume wie Finger herausragten, manche Niederung. Elbrich setzte sich und genoss den Ausblick.
Gleichmäßig senkte sich das Tal vor ihm in die dunstige Tiefe. Doch siehe, seitlich des Hangfußes lag eine Stadt. Halb verdeckt gab sie einen kleinen Teil ihrer Häuser und einer Stadtmauer zu sehen. Ein schmutziger Dunst schien diesen Teil noch zusätzlich zu verdecken. An manchen Stellen war der Schleier in schwachem Rot erhellt, als würde es darunter brennen. An anderen Stellen war er rauchig dunkel.
„Merkwürdig“, dachte Elbrich. „Hier gibt es keine Abgase von Heizung und Autos. Sollte es die Aura der Stadt sein? Die Farben und Qualitäten von Gedanken und Gefühlen, die empor qualmen? Das würde nichts Gutes verheißen!“
Noch nie hatte er bislang eine Aura gesehen, weder in seinem irdischen Leben, noch in der bisher durchwanderten, menschenleeren Gegend. Hier aber schien er eine solche vor sich zu haben. Warum sollte er sie nicht sehen können? Er sah ja jetzt nicht mehr mit physischen Augen, sondern hatte einen Astralkörper mit astraler Wahrnehmung.
Neugierde erfasste ihn und er fand es verlockend, das Tal hinunter zur Stadt zu eilen. Allerdings war die Ausstrahlung der Stadt eine deutliche Warnung. Elbrich war hin und her gerissen. Er entschloss sich zu einem Kompromiss: „Ich werde sie mir aus der Nähe ansehen, aber nicht betreten.“ Das schien sowohl der Neugierde als auch der Vorsicht gerecht zu sein. So wäre es möglich, sich mehr Klarheit zu verschaffen.
Elbrich macht sich auf den Weg.
Die Atmosphäre wurde zusehends schwer und bedrückend. Es war wie eine Last, die sich auf die Seele legte und stumpf und willenlos machte. Elbrich aber fühlte sich stark genug, um dem widerstehen zu können.
Nicht lange, der Weg wurde breiter, wurde zur Straße und führte zu einem Tor in der Stadtmauer.
Nun stand er nur noch wenige Schritte von dem Tor entfernt. Es war ein eigenartiges Tor. Kein viereckiges, verschließbares Loch, wie man allgemein Tore beschreiben könnte. Nein, dies war ein Kunstwerk, wenngleich kein ansprechendes. Es war das Halbrelief eines weit aufgerissene Rachens eines Stieres aus glattem Stein. Es erweckte den Eindruck, als würden Eintretende von seinem Rachen verschluckt werden.
Das Höllentor
Noch in Betrachtung versunken, beschlich Elbrich ein Empfinden, als ob der Stier leben würde und seine Augen drohend auf ihn gerichtet wären. Elbrich erinnerte sich an Märchen, in denen Bilder und Figuren von Geisterschlössern ein Scheinleben hatten und Besuchern mit ihrem Blick folgten. Hier schien es Wirklichkeit zu sein. Nein, es war doch anders als in den Geisterschlössern der Märchen. Die Augen des Stieres schienen nicht nur zu leben, sie strahlten Energie aus. Eine zwingende Energie!
Elbrich wurde schwach in den Beinen, Kälte und eine Gänsehaut überzog seinen Rücken. Mit Willensanstrengung, möglichst schnell, bevor es zu spät war und er dem Bann des Tores unterlegen war, drehte er um und beeilte sich, möglichst rasch und weit von hier weg zu kommen.
Erleichtert atmete er auf, als er den Felsen erreicht hatte, von dem aus er zuerst die Stadt gesehen hatte. Den ganzen Weg zurück, allerdings mit abnehmender Kraft, fühlte er den stechenden Blick des Stieres in seinem Rücken. Die unsichtbare Kraft schien ihn zu verfolgen. Doch je weiter er sich von ihrer Quelle entfernte, desto stärker fühlte er die eigene Kraft und Vitalität obsiegen.
Elbrich setzte sich wieder auf den Felsen als Aussichtsplattform und überlegte. Er fühlte sich nunmehr sicher genug.
Zu seinem Erstaunen machte er folgende Beobachtung: wenn er länger zur Stadt blickte, fühlte er sich von dieser angezogen. Ein gleichsam innerer Sog begann seine Entscheidungsfähigkeit zu benebeln, um ihn unwiderstehlich zur Stadt hinab zu ziehen. Wenn er weg blickte, die Landschaften zu seinen Seiten betrachtete, dann flachte das Verlangen ab und er wurde ruhiger. Es war bemerkenswert, wie eine bloße Hinwendung des Blickes sich dermaßen auswirken konnte. Er testete dies einige Male aus. Jedes Mal kam er zum gleichen Ergebnis. So entschied er sich, nicht mehr zur Stadt hinab zu blicken und damit den Sog zu vermeiden. Er begann die nächsten Schritte zu überlegen. Es gab nur noch zwei Richtungen, denen er folgen konnte.
Sein Verlangen nach menschlicher Gesellschaft war gewachsen. Es war anfangs schön die Landschaft zu bewundern. Doch sobald Neuartiges auftauchte, wie etwa die Stadt, wäre es doch schön gewesen jemanden bei sich zu haben, um sich beraten zu können.
Die menschenleere Gegend zu seinen Seiten bot allerdings keine Aussicht auf Begegnung. Das machte es ihm nicht leicht, eine Entscheidung zu finden.
„Jede Gegend ändert sich einmal und es wäre doch schön, könnte man hinter den Horizont schauen. Aber vielleicht war das sogar möglich? Zwar nicht, um das Dahinter zu sehen, aber vielleicht konnte man es erspüren?“
Er stand auf, schloss die Augen und fühlte in sich hinein. Um mehr Klarheit zu bekommen, versuchte er seinen Wunsch den rechten Weg zu finden in Worte zu fassen. Zuerst formte er den Wortlaut in Gedanken, wiederholte diese und schließlich sprach er laut aus: „Welche Richtung soll ich wählen?“ Zwei oder dreimal sprach er es aus. Das laute Sprechen klärte sein Bewusstsein und verbesserte seine Konzentration. Während dessen begann er sich langsam im Kreis zu drehen.
Der Versuch brachte keine Klarheit. Allerdings die Richtung der Stadt konnte er auch mit geschlossenen Augen deutlich spüren. Also war etwas an der Methode dran. Das ermutigte ihn. So gab er nicht auf und setzte den Versuch fort. Diesmal schloss er die Augen und drehte sich abermals, jedoch schweigend, aber dennoch die Suchfrage in sich und aufmerksam auf seine inneren Empfindungen achtend. Ganz langsam drehte er sich, immer wieder innehaltend, um besser nach innen horchen zu können.
Da, auf einmal kam ein leicht besseres Gefühl in ihm auf. Er öffnete die Augen und erkannte, dass die Richtung, die sich besser anfühlte, nach rechts führte, senkrecht zum abfallenden Weg. Weit weg war eine Felswand zu sehen, welche die davor liegende Steinebene säumte. Sie schien nicht hoch zu sein, vielleicht nur 50 oder 80 Meter. Ein vages Gefühl ließ die Felswand bedeutsam erscheinen. Dennoch war er sich nicht sicher, ob es Wunsch, Täuschung oder eine innere Hellwahrnehmung war. Er fühlte sich wie ein Rutengänger, der seine Fähigkeit erst seit Kurzem erworben und erprobt hatte, unsicher und doch auf das höchste am Ergebnis interessiert. Er drehte sich noch einige Male in die unterschiedlichen Richtungen, und das Empfinden eines guten Gefühles auf der rechten Seite wiederholte sich. Das Gefühl war nur schwach und er war sich deshalb nicht ganz sicher. Da aber keine Richtung etwas Besseres zu bieten hatte und er zudem die Richtigkeit seiner Wahrnehmung überprüfen wollte, nun, warum sollte er dann nicht nach rechts hin zur Felsenwand gehen?
Bald war die Felsenwand erreicht. Dort fand sich ein schmaler Fußpfad, der an ihr entlang führte. Angekommen entschied sich Elbrich für die linke Seite, also die Fortsetzung der alten Richtung. Der Landschaftscharakter wechselte. Hecken begannen die ursprünglich freie Seite zu begrenzen. Zwischen den Hecken wuchsen immer öfters Bäume und bildeten einen Wald, allerdings mit schwer begehbarem Dickicht.
Im Weitergehen dachte Elbrich nach, ob es ihm möglich wäre, wieder jene Stärke des religiösen Vertrauens zu erlangen, wie sie ihn auf Erden oft begleitete hatte. Er besann sich darauf ein religiöser Mensch und Idealist gewesen zu sein. Noch während dieser Gedanken ertappte er sich, dass weniger Edelmut sondern eher Egoismus der Hintergrund für sein Bedürfnis war. Denn, wenn man es genau nahm, jetzt wo er keinen menschlichen Begleiter hatte, musste Gott als Ersatz herhalten. „Ach ja“, seufzte er in sich hinein, „des Menschen Seele hat zwei Seiten: eine des Vergnügens, wenn es ihm gut geht und eine religiöse Seite, wenn es ihm schlecht geht.“
Nun, so war es leider. Aber sollte er aus dieser Erkenntnis heraus den unterschwelligen kleinen Rest an Religiosität über Bord werfen? Nein!
Er blieb stehen und versuchte den Psalm „Der Herr ist mein Hirte“. Jedoch zu seinem Erstaunen fiel ihm die Wortfolge des Psalms nicht ein. Mühselig versuchte er Wort für Wort in Erinnerung zu bringen, vergeblich. Seltsam, in seinem Leben war ihm dieser Psalm so geläufig gewesen, schon von Kindheit an. Wie war es nur möglich, dass er nicht beten konnte? War es die Qualität der Ebene, die solches verbot? Selbst die wenigen Sätze, die er zu bilden vermochte, hatten keine Kraft. Er musste sich dermaßen auf den Wortlaut des Psalms konzentrieren, dass religiöse Gefühle und Hingabe nicht möglich waren. So gab er es wieder auf.
Grübelnd ging er weiter. Bald schenkte er der Umgebung wieder mehr Aufmerksamkeit, denn der Weg war abwechslungsreich und voll belebender Eindrücke. Der Pfad schmiegte sich eng an die Felswand. Dann weitete er sich in einer breiten Senke aus, um dann, Rinnsalen gleich, sich in mehrere Spurrinnen zu verzweigen.
Wiederum wurde der Pfad schmal und zwängte sich zwischen einem großen, gespaltenen Steinblock durch. Danach, angeschmiegt an die Felswand, war der Pfad von dieser wie von einem Dach überwölbt. Einige Schritte weiter stand er auf einmal vor dem Eingang einer Felsenhöhle. Er blickte hinein. Sie war im Ausmaß wie ein großes Zimmer. An die Wände gelehnt kauerten fünf Gestalten.
Er trat ein. Nach der Zeit des Alleinseins schien ihm die Höhle mit ihren Obdachsuchenden ein Gefühl der Geborgenheit zu vermitteln. Er hörte genauer in sich hinein. War es wirklich Geborgenheit, was er fühlte? Nein, es war der Drang sich hinzuwerfen und fallen zu lassen! Es war ein innerer Ruf, etwa wie: „vergiss alle Sorgen, lass ab vom Wandern, Suchen, von jeglicher Mühe, lass dich fallen in den Schlaf des Vergessens!“
Merkwürdig, wie stark die Ausstrahlung des Ortes wirkte. Allerdings war sie weniger mächtig als die des Stiertores.
Während seiner Wanderung war er weder von Sorgen gequält worden, noch hatte er sich einsam gefühlt oder den Weg beschwerlich empfunden. Hier wurden ihm Empfindungen suggeriert, die er gar nicht hatte. Wäre er abergläubisch, so würde er sagen: „auf diesem Ort lastet ein Fluch!“