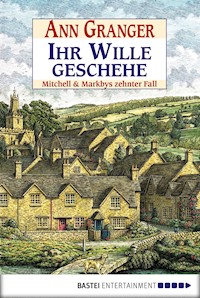7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Krimi
- Serie: Mitchell & Markby Krimi
- Sprache: Deutsch
Mitchell & Markbys zwölfter Fall. Tammy Franklin ist erst zwölf Jahre alt, doch sie hat bereits viel zu viele Erfahrungen mit dem Tod gemacht. Vor zwei Jahren starb ihre Mutter nach einer langen Krankheit, und nun wird die Leiche ihrer Stiefmutter in der Nähe eines Eisenbahngleises gefunden. Diesmal ist es Mord. Superintendent Markby ist sehr wohl bewusst, dass Tammy nun auch noch ihren Vater zu verlieren droht, denn für den Inspector, dem er den Fall übertragen hat, ist Hugh Franklin der Hauptverdächtige. Obwohl Markby sich alle Mühe gibt, sich aus den Ermittlungen herauszuhalten, wird er immer tiefer in den komplexen Fall verstrickt und braucht mehr als je zuvor die Hilfe seiner Freundin Meredith Mitchell ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 528
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über die Autorin
Titel
Impressum
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Über die Autorin
Ann Granger war früher im diplomatischen Dienst tätig. Sie hat zwei Söhne und lebt heute mit ihrem Mann in der Nähe von Oxford. Bestsellerruhm erlangte sie mit der Mitchell-und-Markby-Reihe und den Fran-Varady-Krimis. Nach Ausflügen ins viktorianische England mit den Lizzie-Martin-Romanen, knüpft sie mit der Serie um Inspector Jessica Campbell wieder unmittelbar an die Mitchell-und-Markby-Reihe an.
ANN GRANGER
IN DUNKLER TIEFE SOLLST DU RUHN
Mitchell & Markbys zwölfter Fall
Ins Deutsche übertragen von Axel Merz
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Titel der englischen Originalausgabe:Beneath These Stones
© 1999 by Ann Granger
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2005/2011 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Gerhard Arth / Stefan Bauer
Titelillustration: David Hopkins/Phosphorart
Umschlaggestaltung: Bianca Sebastian
E-Book-Produktion: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN 978-3-8387-0690-0
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
KAPITEL 1
»TUT MIR LEID, wenn ich ein wenig spät dran bin«, sagte George Biddock. »Ich musste noch bei meiner alten Tante vorbeischauen. Sie ist über neunzig, wissen Sie? Ein wenig taub und die Beine sind nicht mehr gut, aber noch wunderbar klar im Kopf.«
»Ich verstehe«, sagte Meredith mit einem demonstrativen Blick auf ihre Armbanduhr. »Ja, ein biblisches Alter. Ich hatte Ihnen gesagt, Mr Biddock, dass ich heute Morgen unbedingt einen Zug erwischen muss.«
»Na, dann mal los mit Ihnen, Süße«, erwiderte George gut gelaunt. »Machen Sie, dass Sie Ihren Zug noch kriegen.« Wie er es sagte, klang das Hetzen nach Zügen wie ein exzentrisches Hobby. »Ich hab Ihre kleine Zeichnung und meine Maße dabei.« Um es zu beweisen, zog er Merediths völlig zerknitterte Skizze aus der Hosentasche, die er mit eigenartigen handschriftlichen Markierungen in blauer Farbe versehen hatte.
Sie standen unter der Eingangstür von Merediths kleinem Reihenendhaus. George sog die Luft zwischen den Zähnen hindurch, während er die Fassade mit fachmännischen, anerkennenden Blicken in Augenschein nahm, und steckte den Plan in die Tasche zurück. Meredith vermutete, dass er dort bleiben würde, bis die Arbeit erledigt war. Sie musterte George abschätzend und fragte sich, ob es die richtige Entscheidung gewesen war, Mr George Biddock mit dem Bau des kleinen Vordachs zu beauftragen.
Der Handwerker war ein Einheimischer. Wenn die Bewohner der kleinen Stadt Bamford vernahmen, dass man eine kleine Arbeit erledigen lassen wollte, erhielt man stets die gleiche Empfehlung. »Rufen Sie George Biddock an. Der macht das schon.«
Die Vorstellung, dass jemand nicht George Biddock beauftragen könnte, wurde als ein Affront gegen den Stolz der Einheimischen betrachtet. Als Meredith gegenüber ihrer Nachbarin, Mrs Crouch, erwähnt hatte, dass sie darüber nachdachte, ein kleines Vordach vor ihre Haustür bauen zu lassen, wurde ihr – vorhersehbar – geraten, sich an George Biddock zu wenden.
»Er macht das in null Komma nichts«, lautete die Empfehlung. Mehr noch, Mrs Crouch hatte die Telefonnummer von George mit Wachsmalstift auf eine laminierte Pappeule geschrieben, die in ihrer Küche hing. Hernach war die Sache abgemacht. George Biddock würde den Anbau übernehmen und sonst niemand.
Dies war der Grund, aus dem Meredith im Büro Bescheid gegeben hatte, dass sie an diesem Tag später anfangen würde. Sie wollte auf George Biddock warten, um ein paar letzte Einzelheiten zu klären, bevor sie sich auf den Weg machte, um in den Zug nach London zu steigen und George die Konstruktion des Vordachs zu überlassen. Er hatte am Abend zuvor das Holz und ein paar Säcke Zement in einem alten, klappernden Lieferwagen vorbeigebracht. Das Holz lag ungesägt an der Seite des Bürgersteigs. Die Zementsäcke waren dezent in eine Plastikplane eingehüllt.
Das Vordach war Meredith als eine gute Idee erschienen. In ihrem Hausflur zog es. Ein Vordach mit einer kleinen Veranda würde, so hoffte Meredith, zu niedrigeren Heizkosten führen. Mehr noch, jeder, der bei schlechtem Wetter vor ihrer Haustür stand und darauf wartete, dass sie öffnete, wurde bis auf die Haut durchnässt. Nachdem Meredith selbst im Winter einmal in diese Situation gekommen war, während sie ihre Taschen nach dem Hausschlüssel durchwühlt hatte, war sie zu dem Entschluss gekommen, dass es nun reichte. Sobald der Frühling vor der Tür stand, würde sie etwas unternehmen.
George hatte den Auftrag mit den Worten »Ah, Doris Crouch hat mir bereits erzählt, dass Sie eine hübsche kleine Veranda mit einem Vordach haben möchten« quittiert. Also war es gut, dass ich ihn gefragt habe, sagte sich Meredith, als ihr dämmerte, dass die Buschtrommeln schneller gewesen waren als sie selbst.
Um fair zu sein, er schien gewusst zu haben, worüber sie redete, und sein Preis war akzeptabel. Gleichzeitig dämmerte ihr schnell, dass es notwendig sein würde, von Anfang an genau festzulegen, was sie haben wollte, oder George würde bauen, was er als angemessen empfand, und nicht, was sie sich wünschte. Doch nun kamen ihr zum ersten Mal nagende Zweifel, was George Biddocks allgemeine Zuverlässigkeit betraf. Es war nett von George, eine alte Tante zu besuchen, kein Zweifel. Doch George war selbst schon jenseits der sechzig, und Meredith war nicht überrascht zu erfahren, dass seine Tante in den Neunzigern war. Auf der anderen Seite hoffte sie, dass die Tante sich nicht als eine Standardausrede für Zuspätkommen oder gänzliches Fernbleiben von der Arbeit erweisen würde.
Doch jetzt war George erst einmal da, eine große, schlaksige Gestalt in einem alten Arbeitsanzug über einem ausgefransten gestrickten Pullover. Die Jackenärmel endeten ein gutes Stück oberhalb der Handgelenke, und seine gewaltigen knorrigen Hände baumelten linkisch an den Seiten herab. Auf dem kahl werdenden Kopf trug er eine schmierige Lederkappe. Hinter einem Ohr lugte ein Bleistiftstummel hervor, hinter dem anderen eine zerknitterte, ungerauchte Zigarette.
»Dann lasse ich Sie jetzt mit der Arbeit allein«, sagte Meredith.
»Ah«, sagte George abwesend. Soweit es Meredith betraf, war sie entlassen. Jetzt noch hier zu bleiben bedeutete, ihm im Weg zu stehen, das war der unausgesprochene Wink mit dem Zaunpfahl.
Meredith setzte den Wagen rückwärts aus der Garage und machte Anstalten, zum Bahnhof zu fahren. Einem letzten Impuls folgend, ließ sie die Seitenscheibe herunter und rief: »Ich habe Ihnen doch meine Büronummer gegeben, oder? Sie können mich jederzeit anrufen, falls es ein Problem gibt.«
»Bei so einer kleinen Geschichte wie der?«, entgegnete George. »Das ist ein Klacks. Fahren Sie nur. Doris Crouch hat mich sicher kommen sehen und den Wasserkessel schon aufgesetzt.«
Du meine Güte. Meredith kurbelte das Fenster wieder hoch und schloss George und seine Arbeitspraxis damit aus. Sie hatte ihn mit dem Bau beauftragt, und sie konnte ihn jetzt nicht wieder feuern. Außerdem hatte sie keine Zeit mehr, mit ihm zu diskutieren.
Wie die Sache lief, hatte ihre Verspätung ein unmittelbares Problem zur Folge. Der Parkplatz des Bahnhofs war voll. Sie musste auf einen holprigen, unbefestigten Grasplatz ganz am Ende weiterfahren und den Wagen dort abstellen. Rein technisch betrachtet gehörte der Grasplatz zum Gelände des Bahnhofsparkplatzes, auf dem ihr Parkschein gültig war, doch ihre Stimmung besserte sich nicht gerade, als sie die Beine aus dem Wagen schwang und merkte, wie ihre hohen Absätze im Dreck versanken.
Vielleicht hatte der Auftrag an George, ein Vordach zu bauen, in Wirklichkeit weniger mit dem nassen Wetter zu tun, als mit der allgemeinen Stimmung, die in letzter Zeit in Meredith vorgeherrscht hatte. Es hatte alles mit Alan zu tun, was sonst. Alan und seinem Vorschlag zu heiraten. Dem Vorschlag, den sie abgelehnt hatte. Eine Ablehnung, die er im Gegenzug mit einer Art störrischer Gelassenheit akzeptiert hatte, als wäre er sicher, dass sie mit der Zeit ihre Meinung doch noch ändern würde.
Was sie ganz bestimmt nicht tun würde, wie sie sich zahllose Male gesagt hatte, während sie im Zug gesessen oder unter der Dusche gestanden oder sich die Zähne geputzt hatte oder mit dem Abwasch oder Aufräumen oder anderen alltäglichen Dingen beschäftigt gewesen war. Genau genommen während jeder Aktivität, die einem Zeit zum Nachdenken und Sinnieren ließ.
Diese Entschlossenheit hätte ihr eigentlich Seelenfrieden verschaffen müssen. Stattdessen jedoch hatte sie sich in einem Zustand größter Unzufriedenheit wiedergefunden. Sie gab seinem Verhalten die Schuld dafür, dass sie sich zugleich streitlustig und elend fühlte wie ein Wurm. Deswegen die Entscheidung, ihre Lebensverhältnisse ein wenig aufzupolieren.
Das Vordach mit der kleinen Veranda war in dieser Hinsicht nicht die einzige Entscheidung, die sie getroffen hatte. Sie war viel zu nachlässig mit ihrer Kleidung geworden und mit ihrem allgemeinen Erscheinungsbild. Sie war nie ein Modepüppchen gewesen und würde es auch niemals werden, obwohl sie groß genug gewachsen war, um als professionelles Model zu arbeiten. Doch sie besaß nur ein Durchschnittsgesicht, wie man ihr während ihrer Kindheit immer und immer wieder gesagt hatte. »Was für ein Glück, dass Meredith Grips im Kopf hat!«, hatte Meredith zufällig die Worte einer freundlichen Tante aufgeschnappt. »Mit ihrem Gesicht jedenfalls wird sie die Welt nicht in Begeisterung versetzen.«
Heute, im Erwachsenenalter, wusste Meredith, dass es sehr schwer war, mit einem Gesicht wie dem ihren irgendetwas in Begeisterung zu versetzen. Die Bemerkung hatte sie damals nicht sonderlich verletzt und hatte ihr auch später keine Sorge gemacht. Auf der anderen Seite hatte sie ihrem Spiegelbild im Schlafzimmerspiegel erst gestern noch gesagt, dass es keine Entschuldigung dafür war, durch die Gegend zu laufen und dabei, wie ihre Tante es ausgedrückt hätte, auszusehen, als wäre man rückwärts durch eine Hecke geschleift worden.
Deswegen hatte Meredith am heutigen Morgen die zusätzliche Zeit des Wartens genutzt, um etwas für ihr Aussehen zu tun. Sie trug ein neues rostfarbenes Kostüm und hatte ihren braunen Pagenkopf sorgfältig gestylt.
Die Schuhe waren ebenfalls recht neu, doch nun waren beide Absätze mit einem hohen braunen Schmutzrand verunziert. Es blieb keine Zeit mehr, um sie jetzt noch sauber zu wischen. Der Zug lief in den Bahnhof ein.
Meredith verschloss den Wagen, raffte den engen Rock ein wenig und sprintete, die Aktentasche in einer Hand, mit trotz der Absätze bewundernswerter Geschwindigkeit über den Parkplatz zum Eingang des Bahnhofs. Sie drängte sich durch die Vorhalle und kam auf dem Bahnsteig an, als die Türen des Zugs zischend aufglitten. Sie stieg ein und ließ sich auf den nächstbesten freien Sitz fallen.
Ein Vorteil des späteren Zuges bestand darin, dass nicht so viele Pendler unterwegs waren. Statt in einer schwitzenden, übellaunigen Menge eingekeilt zu stehen, hatte sie die freie Auswahl an Sitzplätzen in einem Waggon, in dem nur wenige andere Reisende waren. Ihr im Gang gegenüber saß ein Mann und las in seiner Zeitung, obwohl er sich die Zeit nahm, ausgiebig auf ihre Beine zu starren. Meredith zupfte ihren Rock so weit nach unten, wie es ging, was nicht sehr weit war. Zwei Frauen ein Stück weiter unterhielten sich angeregt. Ein Teenager, der Kopfhörer trug, zuckte und wackelte mit dem Kopf am Ende des Waggons und war unübersehbar in seiner eigenen Welt versunken.
Meredith stellte ihre Aktentasche auf den Sitz neben sich und suchte in der Handtasche nach einem Papiertaschentuch, um ihre Schuhe zu reinigen. Die Zugtüren glitten zischend zusammen, und der Zug setzte sich langsam in Bewegung. Sie fuhren aus dem Bahnhof.
Sie waren noch nicht weit gekommen und hatten noch kaum an Geschwindigkeit gewonnen, als er wieder langsamer wurde und schließlich stehen blieb. Meredith, einen Schuh in der einen und ein Papiertaschentuch in der anderen Hand, spähte neugierig aus dem Fenster.
Sie standen kurz vor einem ausrangierten viktorianischen Viadukt von bescheidener Größe, umgeben von Waldland. Die Böschung erhob sich steil zu beiden Seiten der Gleise und war überwuchert mit Brennnesseln, schwarz vom Frost des Winters mit vereinzelten frischen, hellgrünen Trieben dazwischen. Meredith erblickte außerdem Brombeergestrüpp und junge Holunderbüsche, überwuchert von den nackten letztjährigen Zweigen von Schmetterlingssträuchern, jener Pflanze, die sich immer wieder an den unwahrscheinlichsten Nischen und Ecken findet und eine Vorliebe für Eisenbahngleise zu haben scheint, denn sie wächst häufig im schmalen Zwischenraum zwischen den parallelen Schienensträngen. Sie standen im ersten frischen Grün. Hinter dem Gestrüpp, weiter oben und zum Teil auch mittendrin standen dürre blattlose Bäume bis zum Rand der Böschung. Doch direkt vor Meredith …
Ihr Herz machte einen verblüfften Sprung. Direkt gegenüber war ein großer grüner Frosch, der ihr feindselig in die Augen starrte.
Hellgrün, smaragdfarben, mit vorstehenden schwarzen Augen und aus einem weichen Plüsch angefertigt, baumelte er vom untersten Zweig einer Birke, in der er sich offensichtlich mit einem Trageriemen verfangen hatte.
Meredith erkannte, dass es einer von jenen gegenwärtig modernen Rucksäcken in Gestalt eines Comic-Tiers war. Was er dort zu suchen hatte, vermochte sie sich allerdings nicht vorzustellen. Er sah sauber aus, unbeschädigt, ja brandneu. Es war schon traurig, dass die Leute ihren Abfall wild in die Gegend warfen. Supermarkt-Einkaufswagen, alte Bettgestelle, die allgegenwärtigen schwarzen Plastikmülltüten – all das fand sich heutzutage an den unmöglichsten Stellen. Doch diese groteske Kreatur, dieser Frosch mit dem Gesichtsausdruck, der sowohl amüsiert als auch ein klein wenig bedrohlich wirkte, das war einfach kein Abfall.
Meredith runzelte die Stirn.
Der Mann auf der anderen Seite des Gangs legte seine Zeitung zur Seite, als er sah, dass seine Mitreisende angestrengt durch das Fenster nach draußen starrte und beobachtete: »Sie arbeiten wahrscheinlich wieder an den neuen Gleisen. Gestern haben wir um die gleiche Zeit hier gestanden. Es wird nicht lange dauern; sie lassen uns bestimmt gleich weiterfahren.«
»Ja«, antwortete Meredith geistesabwesend. An einem anderen Tag hätte sie sich vielleicht über die zusätzliche Verspätung aufgeregt, die ihren Tagesablauf noch weiter durcheinander bringen würde. Wenn das so weiterging, war sie erst zur Mittagszeit an ihrem Schreibtisch. Doch heute, abgelenkt vom glotzäugigen Starren des Frosches, schenkte sie den Worten des Mannes nur wenig Aufmerksamkeit.
Er zuckte die Schultern, nahm sein Mobiltelefon hervor und begann, Gott und der Welt die Neuigkeiten von seiner Zwangslage im stehen gebliebenen Zug nach London zu verkünden.
»Hallo, Roger? Ich werde ein wenig später kommen, der Zug …«
Allmählich hatten sich Merediths Augen an das Zwielicht der im Schatten liegenden Böschung gewöhnt, und sie konnte mehr Einzelheiten im chaotisch wachsenden Wirrwarr aus Ästen und Zweigen unterscheiden. Weiter oben schien ein Pfad durch die Vegetation zu führen, obwohl Meredith sich nicht vorstellen konnte, wer um alles in der Welt sich hierher verirren sollte. Es sei denn natürlich, unerschrockene Brombeersammler hatten sich, angelockt von den Früchten, im letzten Herbst hierher durchgekämpft, unbeeindruckt von den vorbeidonnernden Zügen.
Sie bemerkte eine plötzliche Bewegung und zuckte erschrocken zusammen, als sich ein großer dunkler Schatten vom Boden erhob, zwischen den Bäumen hindurch in die Höhe schwang und über das alte Viadukt davonflatterte. Sie versuchte ihre Nerven zu beruhigen. Sicherlich gab es entlang den Schienen eine Menge Abfälle für Aasfresser. Tote Vögel, Mäuse, die Reste der Beute, die ein Fuchs geschlagen hatte vielleicht. Nichtsdestotrotz verspürte Meredith, wie sich in ihr eine innere Unruhe regte. Es war dieser Frosch, es waren diese leblosen, glänzenden, vorstehenden Augen, die bizarre Natur dieses Dings, das am Birkenzweig vor ihr baumelte.
Was zur Hölle hatte es hier überhaupt zu suchen? Sie presste die Nase gegen die Scheibe und funkelte den Rucksack wütend an.
»Hallo, James? Ich stecke im Zug nach London fest …«
Der Mann auf der anderen Seite des Gangs schien sich durch sein gesamtes Adressbuch arbeiten zu wollen.
Meredith riss sich gewaltsam von dem grünen Frosch los und wandte sich wieder der Reinigung ihrer Schuhe zu. Sie erhob sich und ging zu einem Abfallbehälter, um die verschmutzten Taschentücher zu entsorgen. Als sie zu ihrem Platz zurückkehrte, störte der Mann mit dem Mobiltelefon die morgendliche Routine einer Person namens Cathy.
Meredith richtete ihre Aufmerksamkeit erneut auf den Frosch. Just in diesem Augenblick setzte sich der Zug ruckelnd in Bewegung. Der Frosch geriet in den Luftzug und schwankte, was den Eindruck erweckte, als würde er Meredith zum Abschied mit den kurzen grünen Plüscharmen winken (oder mit den Vorderbeinen, wenn man pedantisch war).
»Auf Wiedersehen auch dir«, murmelte Meredith geistesabwesend. Der Mann auf der anderen Seite steckte sein Mobiltelefon ein und warf einen flüchtigen Blick zu Meredith. Dann nahm er erneut seine Zeitung zur Hand und versenkte sich darin.
Wenn man in England mit der Bahn unterwegs ist, dachte er wohl, dann trifft man eben hin und wieder ein paar schrullige Leute. Die junge Frau ihm gegenüber passte zwar nicht in das übliche Muster von schrulligen Fahrgästen, aber man konnte ja nie wissen.
Langsam und schaukelnd fuhr der Zug über die Gleise, hinein in das hohe alte Viadukt, in die Dunkelheit und auf der anderen Seite wieder zurück in den Sonnenschein. Die Arbeiter in ihren fluoreszierenden, orangefarbenen Sicherheitsjacken traten von den Gleisen zurück und stützten sich auf ihre Hacken und Schaufeln. Sie betrachteten den vorbeifahrenden Zug ohne besonderes Interesse. Der Zug wurde schneller und schneller, und bald ratterten sie schwankend über die Schienen, als versuchte der Lokführer, einen Teil der verlorenen Zeit wieder wettzumachen. Der grüne Frosch versank bald in einer Nische in Merediths Bewusstsein und blieb dort für die nächste Zeit unbemerkt sitzen.
»Tut mir Leid, dass ich so spät komme«, entschuldigte sich Meredith bei Gerald, mit dem sie ein geräumiges Büro teilen musste. »Hat jemand nach mir verlangt?«
»Nein«, antwortete Gerald gut gelaunt. »Aber da du nun schon hier bist, gehe ich heute früher zum Essen. Kommst du mit?«
Meredith dachte an die Kantine und schüttelte den Kopf. »Ich habe spät gefrühstückt, und ich habe einen Apfel und eine Tüte Erdnüsse dabei.«
»Planst du einen Ausflug in den Zoo? Das ist die Sorte Futter, die sie den Schimpansen geben.«
»Du machst wirklich immer die nettesten Komplimente, Gerald.«
»Ich brauche was Anständiges zum Essen«, entgegnete er. »Ich mag nun mal eine heiße Mahlzeit in der Mitte des Tages.«
»Was ist denn los mit dir? Wirst du nicht von deiner Mutter bekocht?«
Das war ein unfreundlicher Seitenhieb und als Rache für seine Anmerkung wegen ihres Essens gemeint. Gerald lebte trotz seiner neununddreißig Jahre noch bei seiner besitzergreifenden Mutter, die ihren Sohn vergötterte, und es war für jeden Betrachter offensichtlich, dass sie ihn sehr gut fütterte.
»Wenn ich nicht anständig esse«, sagte Gerald, »dann kann ich mich nicht konzentrieren. Ich glaube, heute gibt es in der Kantine Makkaroni mit Käse.« Er trottete glückselig davon.
Meredith öffnete ihre Aktentasche, nahm den Apfel hervor und legte ihn an die Seite ihres Schreibtischs. Dann saß sie dort und starrte auf das Telefon. Sie hatte Alan seit dem vorletzten Wochenende nicht mehr gesehen, und keiner von beiden hatte den anderen angerufen. Das konnte weiter nichts bedeuten, als dass er beschäftigt war. Sie konnte ihn anrufen. Sie konnte ihn jetzt im Regionalen Hauptquartier anrufen. Nur ein paar Worte. Ein einfaches Hallo. Doch sie spürte ein merkwürdiges Zögern, das sie daran hinderte, den Hörer abzunehmen.
Die Natur ihrer Beziehung zu Alan hatte eine subtile Veränderung erfahren. Eine unsichtbare Grenze, eingezeichnet irgendwo in ihrer beider Verstand, war überschritten worden. Man konnte es auch einfacher und brutaler ausdrücken: Alan war ein abgewiesener Freier, der sich den Umständen entsprechend anständig zu verhalten bemühte. Sie war zerfressen von Schuldgefühlen, weil sie ihn unglücklich gemacht hatte.
Selbstverständlich hatten beide erklärt, dass sie so weitermachen wollten wie bis zu diesem Gespräch, bis sie eines Tages erneut über dieses Thema reden würden – Eine Chance wäre gar nicht so schlecht, wirklich nicht, Mädchen!, sagte eine unangenehme leise Stimme an diesem Kreuzungspunkt in ihrem Hinterkopf. Wer sagt denn, dass er dich noch mal fragen wird? Warum sollte er? Außerdem willst du ihn doch gar nicht, oder etwa doch? –, doch so einfach war es nicht. Wie konnte es auch?
Merediths Blick glitt zu dem Apfel, und sie betrachtete das Stück Obst gedankenverloren, während sie sich fragte, was aus der menschlichen Rasse geworden wäre, wenn Eva ihren Adam abgewiesen hätte. Nein, andersherum, wenn Adam seine Eva abgewiesen hätte. Schließlich war es Eva gewesen, die den Apfel gepflückt hatte, nicht wahr, und der arme, willensschwache Adam … Heh! Ich gehe jede Wette ein, dass sie Adam nicht bedrängen musste. Warum war es immer die Schuld der Frauen? Warum sollte sie das Gefühl haben, es wäre ihre Schuld? Weil ihre Weigerung Alan verletzt hatte, sagte sie sich, und weil dies etwas war, das sie nicht gewollt hatte, obwohl ihr klar gewesen war, dass sie es nicht vermeiden konnte. So störrisch sie in dieser Angelegenheit wie in vielen anderen Dingen auch war, hing sie einer einmal gefällten Entscheidung nach und drehte und wendete sie nach allen Seiten, obwohl sie zum gegebenen Zeitpunkt geglaubt hatte, ehrlich zu sein, ja sogar mutig.
Je mehr Zeit verging, desto unsicherer war sie, was die letzten beiden Dinge betraf.
»Ich weiß einfach, dass es das Richtige war!«, sagte sie dem Apfel.
Gut, dass Gerald in seiner Mittagspause steckte. Der kleinste Hinweis, die leiseste Andeutung reichte stets aus, um Gerald zu einem Schwall von Fragen zu veranlassen. Vielleicht hätte Gerald lieber Polizist werden sollen. Wie Alan. Wenn Gerald einmal eine Fährte aufgenommen hatte, ließ er sich so leicht nicht wieder abschütteln. Aus diesem Grund war sie unverbindlich freundlich und aufgesetzt fröhlich gewesen in den letzten paar Wochen im Büro. Nun ja, es mochte ihr vielleicht gelingen, Gerald an der Nase herumzuführen, doch sich selbst konnte sie nichts vormachen. Meredith seufzte.
Sie war ein Dummkopf gewesen, schätzte sie, sich einzubilden, dass die Dinge nach dieser Abfuhr einfach so weiterlaufen würden wie bisher. Dass sie und Alan einfach weitermachen könnten, als sei nichts geschehen. Oberflächlich taten sie selbstverständlich beide so. Doch es war nicht abzustreiten, dass zwischen ihnen eine gewisse unterschwellige Verlegenheit eingekehrt war.
Meredith schob den Apfel zur Seite und mit ihm das ärgerliche Thema. Sie hatte so viel Zeit mit dem Nachdenken darüber verbracht wie ein Terrier mit einem Spielzeug. Entschlossen wendete sie ihre Aufmerksamkeit ihrem Ablagekorb für eingehende Post zu.
Lange bevor Meredith ihre Entscheidung gefällt hatte, den Anruf bei Alan auf später zu verschieben, schlich der Zigeuner Danny Smith vorsichtig durch die bewaldete Deckung der Eisenbahnböschung, um seine Kaninchenfallen zu überprüfen.
Danny war Anfang vierzig, obwohl er älter aussah. Er war seit vielen Jahren auf den Straßen unterwegs, die parallel zu den Schienensträngen verliefen. Genau genommen schon sein ganzes Leben lang. Vor ihm waren seine Eltern durch diesen Teil des Landes gezogen, und nun zogen er, seine Frau und seine Kinder in halbjährlichen Abständen hier vorbei und parkten ihren Wohnwagen für fünf oder sechs Wochen am Stück auf stets dem gleichen Feld der Hazelwood Farm.
Dieses Arrangement datierte auf ungezählte Jahre zurück. Dannys Eltern hatten mit dem Einverständnis des alten Franklin hier gecampt, und nun campten Danny und seine Familie hier mit der stillschweigenden Billigung von Franklins Sohn Hugh. Dannys ältere Söhne, beide verheiratet mit eigenen Familien, bereisten andere Straßen und kamen nicht mehr auf die Farm. Normalerweise war das Fahrende Volk auf privatem Land nicht willkommen, doch die Familie des Bauern machte bei den Smiths eine Ausnahme, die im Übrigen keine streunenden Hippies waren, sondern echte Roma. Danny besaß einen Reisepass, der dies belegte. Der Pass verschaffte den Smiths Zugang zu etablierten Zigeunertreffpunkten, doch Danny zog nur selten dorthin. Allein die Vorstellung, sich organisieren und mit anderen abstimmen zu müssen, erfüllte ihn mit nacktem Entsetzen und Unverständnis.
Seine verheirateten Söhne andererseits – hauptsächlich auf das Drängen ihrer Frauen hin – schienen von einem etablierten Camp zum nächsten zu fahren. Danny betrachtete es als eine Art Verrat an ihrer Erziehung. Der nächste Schritt wäre ein Haus. Sie würden damit enden, dass sie nicht nur ihre Freiheit aufgaben, sondern eine Art zu leben, wie die Zigeuner sie seit dem Mittelalter in Europa praktiziert hatten, als sie aus Indien eingewandert waren, geführt, wie es die Legende beschrieb, von einem König auf einem Schimmel und mit einer Kapelle, die Musik spielte.
Abgesehen von der Freiheit war ein weiterer Vorteil des Kampierens auf dem Land der Hazelwood Farm die Tatsache, dass die Franklins ihm Gelegenheitsarbeiten anboten und damit die Chance, ein wenig Geld zu verdienen. Danny schuftete redlich für seine Entlohnung, die selbstverständlich nur in bar und auf täglicher Basis ausgezahlt wurde.
Der Kaninchenbau hier in der Böschung war jahrhundertealt, wie Danny schätzte. Vielleicht war er schon genauso lange hier wie die Zigeuner. Auch Kaninchen waren erst im frühen Mittelalter nach England gekommen. Danny wusste dies, weil Simon Franklin, ein gebildeter Mensch, es ihm erzählt hatte. Damals waren sie die Mahlzeit von Gentlemen gewesen. Später wurden sie zur Mahlzeit der armen Leute. Heute aß kaum noch jemand Kaninchen, außer natürlich Danny und seinesgleichen und die älteren Leute auf dem Land, trotz der Tatsache, dass ihr Fleisch sauber war und wohlschmeckend.
Einige der alten Gänge waren verlassen, andere wurden noch immer benutzt, sowohl von Kaninchen als auch von anderen Kreaturen, die von den unterirdischen Grabungen profitierten. Die unermüdlichen Kaninchen gruben ständig neue Baue und erweiterten das unterirdische Labyrinth. Die gesamte Böschung war übersät mit Löchern wie ein Schweizer Käse. Allein die Baumwurzeln hinderten die Böschung am Einstürzen. Ohne die Wurzeln wäre das Ganze nach spätestens ein oder zwei Winterstürmen in sich zusammengefallen wie ein Kartenhaus.
Kaninchen hatten ihre eigenen Verhaltensweisen, und Danny kannte die meisten davon sehr gut. Wenn ein Tier seinen Bau verließ, rannte es nicht einfach irgendwohin. Kaninchen waren territoriale Wesen, und sie benutzten stets die gleichen Pfade für ihre Nahrungssuche. Wenn man erst herausgefunden hatte, wohin die Kaninchen liefen, dann hatte man eine gute Chance, über Nacht das eine oder andere von ihnen zu fangen. Kaninchen fraßen gerne in der frühen Morgendämmerung und bei Anbruch der Dunkelheit. Beim leisesten Anzeichen von Gefahr sprangen sie auf und davon, und ihre hellen Spiegel an der Unterseite der Schwänze waren im schwachen Licht eine leuchtende Warnung für ihre Artgenossen.
Danny sprang und rutschte den Abhang hinunter und folgte dem schwach zu erkennenden Pfad zwischen dem dichten Gestrüpp und den Bäumen hindurch. Als er sich dem Boden näherte, konnte er das Glänzen der Schienenstränge erkennen. Er hatte den stehenden Zug von oben beobachtet und geduldig abgewartet, bis er sich wieder in Bewegung gesetzt hatte. Dann erst war Danny losgegangen. Ihm war bewusst, dass er in den Augen der Obrigkeit gleich mehrere Gesetze übertrat, indem er hier war, doch das war nicht der einzige Grund für seine Diskretion. Danny hatte genau wie die wilden Tiere, deren Wege er so gut kannte, eine angeborene Aversion dagegen, beobachtet zu werden. Er hatte hier oben auf einem Baumstumpf gesessen und gewartet, während er überlegt hatte, wie es sein musste, mit großer Geschwindigkeit herumgefahren zu werden, fremden Zielen entgegenzueilen, während die Landschaft rechts und links nur ein verschwommener, undeutlicher Schatten war. Danny war nie in einem Zug gefahren. Der Gedanke erschien ihm auch nicht besonders einladend, eingesperrt in eine Kabine aus Blech und ohne Kontrolle über das Gefährt.
Danny hob den Blick und runzelte die Stirn. Nicht wegen der glänzenden Schienen, sondern wegen eines merkwürdig fremden Flecks aus leuchtendem, smaragdfarbenem Grün inmitten all der natürlichen Farbtöne aus Braun, Grau und zaghaftem Frühlingsgrün ringsum.
Er blieb stehen. Seine scharfen Sinne arbeiteten angestrengt, und nun spürte er eine erst kurz zurückliegende Störung, eine Nuance, mehr nicht. Irgendetwas, das nicht hierher gehörte. Etwas, das nicht stimmte.
Er drehte den Kopf von einer Seite zur anderen und spähte mit schnellen, dunklen Augen in das Unterholz. Er sog prüfend die Luft ein. Alles war still. Doch seine Haare richteten sich auf. Die Unruhe war zu etwas Physischem geworden, fast spürbar, als hätte er nur die Hand ausstrecken müssen, um sie zu berühren. Geh weg!, sagten all seine Sinne zusammengenommen. Geh weg von diesem Ort.
Fast hätte er sich zum Gehen gewandt. Doch es war nicht das erste Mal, dass er hier war, und am vergangenen Abend, als er seine Schlingen gelegt hatte, war noch nichts falsch gewesen. Vielleicht hatte der Zug die Natur gestört, dieses rumpelnde Metallmonster aus einer anderen Welt. Außerdem war er neugierig wegen des grünen Flecks weiter unten.
Danny setzte seinen Weg über den Pfad fort und näherte sich der Stelle. Bald konnte er sehen, dass es eine Art Tasche war, die an einem Zweig baumelte. Ein ziemlich blödes Ding war es, das aussah wie ein viel zu großer Frosch. Er blickte sich um, achtete auf die kleinste Bewegung, lauschte mit gespitzten Ohren, während er nach dem Besitzer der Tasche suchte. Doch da war niemand.
Er nahm die Tasche vom Zweig herab. Sie war schwer, gefüllt mit, wie er feststellte, Büchern. Danny nahm eines davon heraus und betrachtete es stirnrunzelnd. Er war kein Analphabet, doch seine schulische Ausbildung war lückenhaft gewesen, und er war nicht viel weiter gekommen als bis zur ersten Fibel. So ziemlich jedes Wort mit mehr als einer Silbe brachte ihn ins Schwitzen. Zilpah, Dannys Frau, war geschickt im Lesen, deswegen spielte es keine Rolle. Sie unterrichtete sogar die Kinder. Danny hatte seine Kinder regelmäßig zu den einheimischen Schulen geschickt, wenn sie länger irgendwo geblieben waren, doch die Kinder gingen nicht gerne hin, und er konnte es ihnen nicht verdenken. Wenn Zilpah ihnen das Lesen und Schreiben beibringen konnte, dann wusste er nicht, wozu eine Schule sonst noch gut sein sollte. Das Rechnen beispielsweise – was sie in der Schule Arithmetik nannten –, das lernte man von ganz alleine. Wenn man nicht rechnen konnte, konnte man nicht handeln. Danny mochte langsam sein, wenn es ums Lesen ging, doch wenn es darum ging, den Wert eines Haufens Schrott zu berechnen, dann besaß er einen Verstand wie ein Taschenrechner.
Vorsichtig und ehrfürchtig schlug er das Buch auf, denn es war etwas Seltenes in seinen Händen und wahrscheinlich kostbar. Im Buch fand er ein Bild von einem Kerl in einem Anzug aus Blech auf einem Pferd. Es musste ein stabiles, kraftvolles Pferd sein, um diese Last zu tragen. Geschichte, das war es. Es war ein Geschichtsbuch.
Danny wollte es gerade wieder zuklappen, als sein Blick auf die Innenseite des Einbanddeckels fiel und er sah, dass jemand einen Namen hineingeschrieben hatte. Dannys Lippen bewegten sich, als er langsam die Silben buchstabierte. Tammy Franklin. Tammy Franklin. Hugh Franklins kleine Tochter. Danny stieß einen leisen Pfiff aus.
Er wusste nicht, was die Tasche hier unten zu suchen hatte, doch sie musste zurück zur Farm, und er würde sie später an diesem Tag vorbeibringen. Er schlang sie sich über die Schulter, wo sie neben dem schmuddeligen Baumwollsack hing, den er bereits mitgebracht hatte, und wandte sich wieder dem Pfad zu, um sich der Stelle zu nähern, wo er seine Schlingen ausgebracht hatte.
Das Schlagen der Krähenflügel beim Auffliegen hatte er schon vorhin gehört, ohne sich etwas dabei zu denken, doch nun bemerkte er ein weiteres Geräusch. Das geschäftige Summen einer großen Schar von Fliegen, die sich auf ihr Fressen stürzten. Auf dem Land war dies das Geräusch des Todes.
Danny stockte, und seine anfängliche Vorsicht wich Schrecken. Vielleicht hatten die Fliegen ein Kaninchen gefunden, das sich in einer seiner Schlingen verfangen hatte. Doch ein Kaninchen würde nicht solche Scharen von Fliegen anziehen, noch dazu, wenn es so frisch war. Nur eine Sache zog solche Scharen von Fliegen an.
Blut.
Dort zwischen den Büschen lag irgendwo eine tote Kreatur, und Danny nahm nicht eine Sekunde lang an, dass es sich dabei um ein Kaninchen handeln könnte.
Er schob sich auf dem schmalen Pfad zwischen den Brombeersträuchern voran, bis er im Unterholz etwas Blaues erkannte. Inzwischen war er von Angst erfüllt, und er musste gegen den überwältigenden Drang zu flüchten ankämpfen. Die Neugier half ihm dabei und ließ ihn weitermachen. Er näherte sich ein Stück, bog mit seinem Wanderstab eine Brombeerranke zur Seite … und erkannte eine reglose Gestalt auf einem kleinen Fleck zerdrückten Unterholzes. Jetzt wusste er, was die Fliegen angelockt hatte.
Es war kein gewöhnliches Aas. Es war ein Leichnam. Ein menschlicher Leichnam.
Dort lag eine Frau, eine Frau mit langen, blonden Haaren, die von einer Art großer Klammer zusammengehalten wurden. Sie lag auf dem Rücken, die Knie zu einer Seite gebogen, und sie trug Bluejeans, eine grüne Bluse und flache, zum Gehen gemachte Halbschuhe. Die Vorderseite der grünen Bluse unter dem Brustbein war eine schwarze wimmelnde Masse von Fliegen. Aufgebracht warf Danny seinen Stab nach den Fliegen. Sie erhoben sich in einer protestierenden Masse von dem blutigen Fleck, auf dem sie gesessen und gefressen hatten.
In Danny stieg Übelkeit auf. Der Impuls zu fliehen wurde übermächtig, doch Vernunft ließ ihn stehen, wo er war, während er überlegte, was er nun am besten machen sollte. Diese Tote war Menschenwerk, und bald schon würden sich andere Menschen dafür interessieren.
Er musste Fußabdrücke hinterlassen haben, als er über den Pfad die Böschung hinuntergelaufen war, im vom kürzlich erst gefallenen Regen noch weichen Boden. Wenn die Polizei kam, was sicherlich irgendwann in nächster Zeit geschah, würde sie die Fußabdrücke entdecken und nach demjenigen suchen, der sie hinterlassen hatte. Dannys braune Augen zuckten gehetzt über das Terrain rings um die leblose Gestalt. Der Boden war zertrampelt, Zweige abgebrochen, zerquetschte Pflanzen am Boden nicht nur rings um den Leichnam, sondern in einer Spur, die zurück zur Straße oben am Rand der Böschung führte. Diese Spuren erzählten ihre eigene Geschichte, und Danny runzelte die Stirn. Die Tote war hierher geschleppt worden.
An diesem Punkt verspürte Danny einen kurzen Anflug von Erleichterung, gefolgt von Verwirrung. Nachdem er Tammy Franklins Schultasche gefunden hatte, hatte er für einen Augenblick die Befürchtung gehegt, dass es die junge Tammy sein könnte, die hier lag. Doch diese Frau war eindeutig eine Erwachsene, also stellte sich die Frage, was die Tasche von Tammy hier zu suchen hatte.
Danny wusste, dass er seinen grässlichen Fund melden musste. Jedoch nicht die Tasche. Er würde die Tasche nicht melden, sondern sie still und leise ihrer Besitzerin zurückbringen und zu niemandem sonst ein Wort darüber verlieren. Danny hatte nicht gerne mit der Obrigkeit in irgendeiner Form zu tun, und er gestand sich nur unwillig ein, dass er in diesem Fall gar keine andere Wahl besaß. Er würde tun, was er tun musste, doch er sah keine Notwendigkeit, Tammy Franklin oder die Hazelwood Farm mit hineinzuziehen.
Die Bullen würden ihm wahrscheinlich zuerst nicht glauben, nachdem er Meldung gemacht hatte. Sie würden eine ganze Menge Fragen stellen. Danny stählte sich innerlich, um sich weit genug zu nähern, dass er einen Blick auf das Gesicht der Toten werfen konnte. Es war verzerrt vom Todeskampf, doch beklommenen Herzens erkannte er es trotzdem.
Er stieß einen leisen Fluch aus und wischte sich nervös mit dem Handrücken über den Mund. Das machte die Dinge doppelt schwierig. Er wusste nun, dass er die Hazelwood Farm nicht mehr aus der Sache herauslassen konnte. Das Gewicht der Tasche voller Bücher auf seinen Schultern bedeutete eine weitere Komplikation. Sein Herz fühlte sich schwerer an als beide Taschen zusammen. Er konnte der Polizei die Tote melden – oder er konnte zur Farm laufen und Hugh Franklin die schrecklichen Neuigkeiten berichten. Danny war nicht auf diese Aufgabe erpicht. Er konnte sich Besseres vorstellen. Doch er stand in der Schuld der Familie Franklin. Er war es ihnen schuldig, die traurige Nachricht selbst zu überbringen und diese Aufgabe nicht irgendeinem unbeteiligten Fremden in Uniform zu überlassen.
Schweren Herzens wandte sich Danny ab und ging den gleichen Weg zurück, auf dem er gekommen war.
KAPITEL 2
JANE BRADY schob eine widerspenstige Strähne ihrer langen, aschblonden Haare hinter ein Ohr und hoffte, dass die Geste ihre innere Frustration nicht verraten hatte. Sie starrte die Zwölfjährige vor sich auf eine Weise an, die fest, jedoch nicht unfreundlich sein sollte.
Das Mädchen starrte unnachgiebig zurück.
Unentschieden!, dachte Jane, und dann: Ach zur Hölle! Was jetzt?
Als Lehrerin achtete sie stets sorgfältig darauf, keinen ihrer Schüler zu bevorzugen oder zu benachteiligen. Doch es war unmöglich, sich nicht für manche Kinder mehr zu interessieren als für andere. Insbesondere, wenn es wie in diesem Fall eindeutig ein Problem im Hintergrund gab. Nur dass der Versuch, in Tammy Franklin zu dringen, war, als würde man mit dem Kopf gegen eine mentale Mauer aus Ziegelsteinen rennen. Tammy war nicht im herkömmlichen Sinn schwierig. Sie war keine Schülerin, die offen rebellierte. Sie war nie mit Nagellack in der Schule erschienen, mit grünen Haaren oder einer ganzen Reihe von Steckern in den Ohrknorpeln. Vielleicht, dachte Jane nun, vielleicht wäre es leichter gewesen, sie zu packen, wenn sie es getan hätte.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!