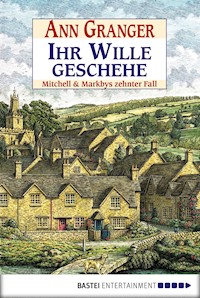7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Krimi
- Serie: Mitchell & Markby Krimi
- Sprache: Deutsch
Mitchell & Markbys 3. Fall. Statt Ruhe und Friede herrscht in Bamford zur Zeit Baustellenlärm, und statt einer zarten Romanze findet Meredith Mitchell eine Leiche, halb einbetoniert in der Baugrube. Inspektor Markby stellt Nachforschungen an, doch der Tote bleibt ein Rätsel und die Farmer der umliegenden Gehöfte hüllen sich in Schweigen. Hier ist jemand mit diplomatischem Geschick gefragt, jemand wie Meredith. Bald schon merkt sie, dass sie mit ihren Fragen in ein Wespennest sticht. In der Scheune der Familie Winthrop macht sie schließlich eine erstaunliche Entdeckung - und bringt sich selbst damit in höchste Gefahr ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 490
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über die Autorin
Titel
Impressum
Danksagung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Unsere Empfehlungen
Über die Autorin
Ann Granger war früher im diplomatischen Dienst tätig. Sie hat zwei Söhne und lebt heute mit ihrem Mann in der Nähe von Oxford. Bestsellerruhm erlangte sie mit der Mitchell-und-Markby-Reihe und den Fran-Varady-Krimis. Nach Ausflügen ins viktorianische England mit den Lizzie-Martin-Romanen, knüpft sie mit der Serie um Inspector Jessica Campbell wieder unmittelbar an die Mitchell-und-Markby-Reihe an.
ANN GRANGER
WARTE, BALD RUHEST AUCH DU
Mitchell & Markbys dritter Fall
Ins Deutsche übertragen von Edith Walter
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Titel der englischen Originalausgabe: »Cold in the Earth«
Copyright © 1992 by Ann Granger
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© für die deutschsprachige Ausgabe 1998/2011 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Stefan Bauer
Titelillustration: David Hopkins
Umschlaggestaltung: QuadroGrafik, Bensberg
E-Book-Produktion: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN 978-3-8387-0698-6
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Schriftsteller brauchen die ganze Zeit über viel Ermutigung und viel Toleranz. Ich (und natürlich Alan Markby und Meredith Mitchell) möchten uns ganz besonders bei John, Judith und Anne für ihre rückhaltlose Unterstützung bedanken.
KAPITEL 1
Laut summend prallte die Fliege gegen das schmutzige Fenster; sie saß in der Falle. Durch den Spalt am oberen Ende wehten warme Stadtluft und das Brausen des durch Whitehall dröhnenden Verkehrs herein, doch die Fliege schien nicht imstande, ihren Fluchtweg zu entdecken. Immer wieder flog sie gegen dieselbe Stelle auf der Scheibe, immer verzweifelter, weil sie hinaus wollte, und anscheinend immer unfähiger, den Weg zu finden.
»Genau wie ich«, sagte Meredith unüberlegt und laut.
»Verzeihung, Miss Mitchell?«
Der Personalchef musterte sie mißtrauisch. Er hatte nicht gern mit Frauen zu tun. Man brauchte kein Hellseher zu sein, um das zu erkennen. Er war klein und übergewichtig, hatte eine rosige Haut und benahm sich großspurig. Es war ihnen vom ersten Moment, in dem sie sein Büro betreten hatte, nicht gelungen, zu einem Einverständnis zu kommen. Ein Fall von gegenseitiger Abneigung auf den ersten Blick.
»Ich weiß, daß viele Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes in meiner Position, die in London arbeiten, unbedingt wieder einen Posten in Übersee haben möchten.«
»Wie recht Sie haben, meine Liebe.«
Gönnerhafter Trottel, dachte Meredith.
»Je nun, die Anzahl der Auslandsposten nimmt ab. Kürzungen, Kürzungen überall.«
»Ja, aber gewiß wäre es im Interesse des Amtes, mich so effektiv einzusetzen wie möglich? Nichts von dem, was ich hier tue, ist irgendwie sinnvoll oder erfüllt irgendeinen Zweck.«
»Das würde ich nicht sagen, Miss Mitchell.« Er schlug in der Akte nach, die auf seinem Schreibtisch lag. »Der Chef Ihrer Abteilung äußert sich sehr anerkennend über Sie. Natürlich ist mir klar, daß Sie früher als britische Konsulin im Ausland der Kapitän Ihres eigenen kleinen Schiffes waren …«
Meredith schnitt eine Grimasse.
»Zweifellos ist ein Schreibtisch in London im Vergleich dazu ein wenig langweilig.«
Das kannste ruhig noch einmal sagen, Kumpel, dachte sie und betrachtete verdrießlich seine rot gepunktete Krawatte. Wer hatte ihm die wohl geschenkt? Seine Frau? Sein reiches Tantchen Flo? Hatte er sie selbst gekauft?
Sie blickte gerade noch rechtzeitig auf, um in seinen kleinen Augen ein boshaftes Funkeln zu sehen. Sie verstand sehr genau, was es bedeutete. Hier war sie völlig in seiner Macht. Er saß seine Zeit ab, liebte das ruhige Leben. Er beneidete sie um ihren Wunsch nach Unabhängigkeit, Ungewißheit und Herausforderung, gleichzeitig nahm er ihn übel. Zum ersten Mal begann Meredith etwas von dem Streß, dem Druck und der Belastung zu verstehen, die dazu führen, daß eine sonst normale Person an Mord denkt.
»Nun denn«, sagte er und legte die Spitzen seiner plumpen Finger aneinander. »Haben Sie einen besonderen Grund, der es für Sie erforderlich oder wünschenswert macht, ausgerechnet jetzt einen Auslandsposten anzustreben?«
»Nein«, gestand sie widerwillig. »Ein Kollege in Übersee hat mir seine Wohnung in Islington überlassen. Davor hatte ich ein Cottage auf dem Land gemietet, doch die tägliche Fahrerei war mir zuviel.«
»Also kein Wohnungsproblem. Sie haben großes Glück, meine Liebe …«
Wenn er das noch einmal sagt …
»Persönliche Probleme?« Das klang mißtrauisch. Seiner Überzeugung nach neigten Frauen zu solchen Dingen.
»Nein!« fauchte sie.
»Dann, Miss Mitchell, sehe ich bei Ihnen wirklich keinen Grund für eine bevorzugte Behandlung. Aber seien Sie guten Mutes. Ihre Arbeit auf Ihrem früheren Posten wurde glänzend beurteilt, und Ihr Job hier mag zwar nicht aufregend sein, aber er ist wichtig. Auch die versehen ihren Dienst, die nur dastehen und warten, denken Sie dran.«
Jetzt reichte es Meredith. Sie stand auf. Sie war einssiebenundsiebzig groß und überragte seine sitzende Gestalt beträchtlich, was sie sehr befriedigend fand. Er sah ziemlich erschrocken aus.
»Sie mögen ja damit zufrieden sein, bis zu Ihrer Pensionierung hinter Ihrem Schreibtisch vor sich hin zu rosten. Aber ich will raus und etwas tun, bevor ich ins Gras beiße.«
Sein rosiges Gesicht verfärbte sich puterrot. »Ich glaube kaum, daß es sinnvoll ist, dieses Gespräch fortzusetzen«, knurrte er wütend und klappte die Akte zu.
Mit dieser Geste schlug er gleichzeitig die Tür für einen Auslandsposten zu, das wußte sie. Wußte auch, daß sie sich das selbst zuzuschreiben hatte. Hol’s der Teufel! »Nein, das ist es in der Tat nicht!« fauchte sie und stolzierte hinaus.
Eingezwängt in einer überfüllten, stickigen U-Bahn, ließ Meredith diese Auseinandersetzung noch einmal an sich vorüberziehen und fühlte nur Zorn und Verzweiflung. Der Zorn richtete sich jetzt nicht auf ihren Gegner, sondern auf sich selbst. Sie hätte es kaum schlechter anfangen können. Ausgerechnet sie, ein Mensch, der viele schwierige Situationen mit Takt und Diplomatie gemeistert hatte. Ich bin erledigt, dachte sie düster. Das bringt mir einen dicken schwarzen Tadel ein. Jetzt krieg ich nie wieder einen Auslandsposten. Bleibe für den Rest meines Lebens Pendlerin.
Jemand trat ihr auf den Fuß, und jemand anderes stieß ihr den Ellenbogen schmerzhaft in die Rippen. Oh, aus diesem täglichen Gedränge wieder draußen sein. Oh, irgendwo anders sein, egal wo. Sie bedauerte jetzt, den Mietvertrag für Rose Cottage gekündigt zu haben, obwohl sich das Haus als zu unpraktisch erwiesen hatte. Wenn sie schon nicht in Übersee sein konnte, dann wäre sie gern wieder in einer ländlichen Gegend Englands. Sie dachte an Alan und beneidete ihn. Er lebte in Bamford, einem hübschen kleinen Städtchen, umgeben von ländlichem Frieden und ländlicher Weite, und konnte dort außerdem einen lohnenden Beruf ausüben, der Abwechslung bot und gelegentlich unerwartete Gefahr. Darüber hinaus war es kurz vor Ostern. Frühling auf dem Land bedeutete wirklich neues Leben, das aus der kalten Erde sproß.
Es roch irgendwie merkwürdig im Haus, obwohl – was ihm im Treppenhaus aufgefallen war – jemand im oberen Stock ein Fenster geöffnet hatte. Wahrscheinlich einer der jüngeren Constables, ein armer Kerl, der es nicht gewohnt ist, den äußerlichen Zeichen der Sterblichkeit so nahe zu sein, dachte Alan Markby, als er die knarrende, teppichlose Treppe hinaufstieg, wobei er wegen etwa vorhandener Fingerabdrücke darauf achtete, das Geländer nicht zu berühren. Genauso achtete er darauf, die Wände nicht zu streifen, denn sie waren schmierig und starrten vor Schmutz.
Er erschien erst spät auf der Szene, da man ihn vom anderen Ende seines Bezirks herbeigerufen hatte. Die ersten Arbeiten würden bereits erledigt sein, und die Ambulanz vor dem Haus wartete nur darauf, daß er kam und sich die Leiche ansah, bevor sie weggebracht wurde. Auf der anderen Straßenseite hatte sich eine kleine Gruppe Neugieriger versammelt. Unter ihnen war mindestens ein echter Nekrophiler. Es gab gewöhnlich einen, der das Polizeipersonal aufhielt und nach den gräßlichen Einzelheiten fragte. Manchmal gaben sich die jämmerlichen Widerlinge als Journalisten aus.
Wild. Dem kam der Geruch am nächsten. Birkhuhn oder Fasan, gut abgehangen, mischte sich hier mit Staub, feuchtem Schimmel und allgemeiner Verwesung. Ganz offensichtlich handelte es sich um ein besetztes Haus. Die Reihenhäuser hier sollten abgerissen und durch einen niedrigen Wohnblock ersetzt werden. Das Nebenhaus war noch bewohnt, was sehr nützlich sein konnte, weil der Nachbar vielleicht Auskunft geben konnte. Doch das Haus, in dem er sich aufhielt, hatte theoretisch leergestanden, die unteren Fenster und die Tür waren mit Brettern vernagelt. Trotzdem waren die Hausbesetzer hineingekommen.
Hinter der Tür, am oberen Ende der Treppe, hörte Markby Stimmengemurmel. Er stieß die Tür auf, und die Gesichter wandten sich ihm zu.
»Oh, da sind Sie ja, Sir«, sagte Sergeant Pearce erleichtert. Auch er wollte weg von hier. Der Gestank war in diesem Raum intensiver. An der Tür stand ein junger, schwitzender, grüngesichtiger Constable. Es war heiß und stickig im Zimmer. Durch das warme Wetter hatte der Verwesungsprozeß bei dem Ding auf dem Bett noch schneller eingesetzt.
»Tut mir leid, daß ich so spät komme«, sagte Markby und meinte es ernst, da sie unverkennbar alle litten.
»Dr. Fuller mußte fort, konnte nicht auf Sie warten, Sir. Er hatte noch einen anderen Termin.«
»Ist schon in Ordnung. Ich werde zweifellos von ihm hören.«
»Sie haben ihre Fotos gemacht«, fuhr Pearce fort und wies auf die beiden unglücklichen Polizeifotografen. »Könnten Sie …«
»Was? O ja, ihr beiden könnt euch trollen.«
In ihrer Hast stießen sie in der Tür zusammen und stürmten dann mit ihren Apparaten die Treppe hinunter.
»Dann wollen wir mal sehen«, sagte Markby resigniert.
Pearce schlug das Laken zurück, mit dem die Leiche pietätvoll zugedeckt war. Er sagte nichts.
Markby sagte: »Sie muß hübsch gewesen sein – früher.«
Sie war nicht älter als ein- oder zweiundzwanzig. Ihre Augen waren starr geöffnet und von mattvioletter Farbe. Sie trug ein schmutziges T-Shirt und an den Knien abgeschnittene, ausgefranste Jeans. Das T-Shirt war hochgeschoben worden, vermutlich von Dr. Fuller, der sie untersucht hatte, und das eingesunkene Fleisch unter den Rippen sah merkwürdig grau aus. Ihr linker Arm war mit dem Handteller nach oben gedreht und von unten bis oben mit roten Flecken, Kratzern und purpurnen Blutergüssen bedeckt, die durch die Sprenkelung der sich zersetzenden Haut allmählich undeutlich wurden.
»Wer hat sie gefunden?«
»Ein Typ von nebenan.« Pearce zeigte auf die Trennwand zwischen den beiden Reihenhäusern. »Er hat sich um das Haus gekümmert, hatte Angst vor Feuer. Dachte, es stehe leer, und kam nachsehen, wieviel Schaden die letzten Obdachlosen angerichtet hatten. Ach, hier ist die Nadel, lag neben dem Bett auf dem Boden.« Pearce hielt eine Plastiktüte in die Höhe, die eine Injektionsspritze enthielt.
Scheußliches Ding, dachte Markby. Laut fragte er: »Wie lange ist sie schon tot? Hat Fuller einen ungefähren Zeitpunkt genannt?«
»Zwei, drei Tage, nach dem ersten Eindruck.«
»Keine Spur von dem Zeug, das sie sich gespritzt hat?«
»Nein. Es haben noch andere hier gewohnt, sagt der Nachbar, aber in den letzten Tagen war es sehr still im Haus, und er hat gedacht, sie wären alle gegangen. Sieht so aus, als hätten sie, als sie das Mädchen gesehen haben, einen Schreck gekriegt und gemacht, daß sie wegkamen.«
»Wir werden viel Glück brauchen, um sie zu finden«, sagte Markby grollend. »Es sei denn, der Nachbar hat ein paar Namen gekannt. Unwahrscheinlich.«
»Es ist wirklich komisch, aber sie hat er tatsächlich gekannt …« Pearce zeigte auf die Tote. »Als ich kam, hat er mir gleich gesagt, daß es Lindsay Hurst ist. Er hatte Lindsay ein paar Wochen lang im Haus ein- und ausgehen sehen und war überrascht, denn ihre Familie ist hier ansässig und durchaus respektabel. Er hätte nie für möglich gehalten, daß Lindsay so enden würde. Das ist alles, was er ausgesagt hat.«
»So etwas ist ja nicht zum ersten Mal passiert. Weiß Ihr Informant, wo die Hursts wohnen?«
»Ja, irgendwo in der Kitchener Close. Die Zahl der Leute, die hier untergekrochen sind, war unterschiedlich. Er hat auch gesagt, er habe sich bei der Polizei und beim Stadtrat beschwert, aber es sei nichts getan worden. Sie wissen, wie schwierig es ist, Hausbesetzer zu vertreiben. Der Stadtrat will sie wahrscheinlich bis zum Herbst dulden, denn dann kommt ohnehin die Abreißkolonne.«
Markby brummte etwas. »Jemand wird in die Kitchener Close gehen und es ihren Eltern sagen müssen. Ich übernehme das, da Sie hier festgesessen und auf mich gewartet haben. Jetzt bin ich an der Reihe, die unangenehme Arbeit zu tun. Alles in Ordnung?«
»Hab mich dran gewöhnt«, sagte Pearce mit einem schiefen Lächeln.
Markby sah den Constable an. »Wollen Sie an die frische Luft?«
»Bitte, Sir.«
»Dann ab mit Ihnen. Sagen Sie den Leuten von der Ambulanz, sie können raufkommen und sie holen.«
Nachdem der Constable geflüchtet war, schaute Markby sich noch einmal im Raum um. Das Bett war das einzige richtige Möbelstück, und auch das sah aus, als stamme es von einer Müllhalde. Auf dem Boden stand ein rostiger Campingkocher. Die anderen Bewohner mußten ihn in ihrer Panik zurückgelassen haben. In einer Ecke stapelte sich Abfall – Flaschen, Schachteln, Papier, leere Dosen, noch eine Spritze … Sie würden alles genau untersuchen müssen. Die Furcht des Nachbarn vor Brandgefahr war nicht unberechtigt gewesen.
Er mußte an die ehrbaren Doppelhäuser in der Kitchener Close denken, woher das tote Mädchen gekommen war, und fragte laut und staunend: »Wie hat sie es nur in diesem Dreck ausgehalten? Zu stolz, um nach Hause zu gehen? Oder zu tief gesunken?«
»Ich habe angerufen und sie überprüfen lassen, bevor Sie kamen, Sir. Sie war bereits als Drogenabhängige registriert und wurde mit einer Ersatzdroge versorgt. Doch offensichtlich bekam sie den ›echten‹ Stoff von anderswo. Dr. Fuller sagt, es sieht so aus, als hätte sie eine ordentliche Dosis genommen, und wenn diese leeren Weinflaschen dort drüben bedeuten, daß sie und die andern getrunken haben, hatte sie nicht die geringste Chance.« Pearce machte ein nachdenkliches Gesicht. »Man würde doch denken, nicht wahr, daß sie, wenn sie abhängig sind, nicht in einem so ruhigen Provinzkaff wie Bamford rumlungern, sondern in irgendeine große Stadt abhauen, wo das Zeug leichter zu kriegen ist.«
»Ruhig, ja. Provinziell, wahrscheinlich. Aber kein Kaff«, sagte Markby. Er liebte Bamford. »Es überrascht mich auch nicht. Nichts in diesem Land überrascht mich noch.«
Pearce bemühte sich, die Sache positiv zu sehen. »Häßliche Geschichte, aber einfach und gradlinig in ihrer Art. Ich nehme an, man wird auf gewaltsamen Tod ohne Nennung der Ursache befinden. Als der Anruf kam, dachte ich, wir hätten es mit einem Mord zu tun, doch das trifft nicht zu.« Pearce schlug mit der flachen Hand nach den Fliegen, die sich in der Luft sammelten und bedrohlich summend über dem Bett hingen.
»Trifft nicht zu?« fragte Markby kalt. »Vielleicht nicht nach Ansicht des Coroners. Meiner Ansicht nach hat sie derjenige getötet, der sie mit Drogen belieferte. Und wir müssen ihn finden, bevor noch ein junger Mensch stirbt.«
»Iß auf, Jess. Was du auf deinem Teller hast, ist nicht einmal genug, um einen Spatzen am Leben zu erhalten.«
»Ich habe keinen Hunger, Ma. Hab genug gegessen, ehrlich.«
»Unsinn. Du ißt noch eine Kartoffel, hier!« Unnachgiebig knallte Mrs. Winthrop noch eine Bratkartoffel auf den Teller ihrer Tochter. »Eine mehr wird dich nicht umbringen.«
Jessica Winthrop zuckte wie im Krampf zusammen. Sie schaute auf die Kartoffel hinunter, die in ihrer krossen, fetten Schale rotgolden glänzte und kämpfte gegen die aufsteigende Übelkeit an. Neben ihr räumte ihr Bruder Alwyn eifrig eine riesige Portion von seinem Teller ab. Alwyn war ein großer und breiter Kerl und arbeitete hart; kein Wunder, daß er aß wie ein Pferd. Die unerwünschte Knolle anstarrend, fragte sich Jessica, wie sie sie dazu bringen konnte, sich in Luft aufzulösen. Alwyn wischte den letzten Soßenrest mit einem riesigen Brocken Brot ab, warf ihr von der Seite her einen Blick zu und blinzelte. Er wußte, was sie dachte.
»Kannst du noch eine Tasse Tee aus der Kanne melken, Elsie?« fragte George Winthrop, der am Kopfende des Tisches saß – eingezwängt in einen uralten geschnitzten Sessel. Man sah nichts von ihm, außer seinem kahlen Kopf und den Spitzen seiner kurzen, dicken Finger, die sich um die Titel- und die letzte Seite der aufgeschlagenen Zeitschrift Farmers’ Weekly krümmten.
Jessica fand, daß ihr Vater, nicht gewohnt, mit Büchern umzugehen, seine Zeitschrift immer so fest umklammerte, als könnte sie ihm ausreißen. Sie war das belesene Mitglied der Familie, ein Unikum unter den Winthrops. Man hatte ihr Anderssein immer toleriert, bis für sie alles schiefgegangen war.
Mrs. Winthrop hatte den Deckel einer großen, braunen irdenen Teekanne gehoben und brütete über dem Inhalt wie ein heidnischer Priester über den Innereien eines Opfers. »Sie braucht noch einen Tropfen Wasser.« Sie stand auf und ging zum Herd.
Kaum kehrte sie ihnen den Rücken, gabelte Alwyn hastig die unerwünschte Knolle vom Teller seiner Schwester und aß sie auf, bevor die Mutter zurückkam. Jess lächelte ihm dankbar zu.
»Na also«, sagte Mrs. Winthrop, als sie mit dem frischen Tee zurückkam. Mit einem anerkennenden Nicken schaute sie auf den leeren Teller ihrer Tochter. »Hast es doch geschafft, sie zu essen. War doch wohl nicht schlimm, oder?«
»Nein, Ma.«
»Wenn du nicht richtig ißt, mein Mädchen, wirst du wieder krank wie – nun ja, wie du’s schon warst.«
Jessica sagte nichts. Sie verstanden nicht, was ein Nervenzusammenbruch war, und sie hatte den Versuch aufgegeben, es ihnen zu erklären. Ihrer Ansicht nach wurde ein Mensch krank, weil er nicht genug aß, sich nicht warm genug anzog oder das Pech hatte, sich eine der üblichen fieberhaften Erkrankungen einzufangen. Den Kranken mit Essen vollstopfen und mit Wick einreiben, und all diese Leiden kurierten sich praktisch von selbst. Ein schwächliches und kränkliches Kind, hatte sie, wo immer sie auftauchte, der durchdringende Geruch von Wick umweht. Ihr Bruder hätte sie vielleicht verstanden, doch sie wollte ihn nicht belasten, da er eigene Sorgen hatte. Er hatte nie darüber gesprochen, aber sie fühlte es. Sie hatten einander immer nahegestanden.
»Du liest zu viele Bücher«, sagte ihr Vater, legte seine Farmers’ Weekly beiseite und nahm die Brille ab (von seinem Vater ererbt und gut genug, er brauchte kein gutes Geld für eine neue auszugeben). Er griff nach seinem Becher. »Das ist der ganze Kummer mit dir und war es schon immer. Nicht genug frische Luft und immer die Nase in einem Buch. Kriegen wir denn heute keinen Pudding?«
»Wart eine Minute, George Winthrop! Es gibt Apfelstreusel, und rümpf ja nicht die Nase, Jessica.«
»Nein, Ma. Soll ich ihn auftragen?« Wenn sie Glück hatte, gelang es ihr vielleicht, sich selbst nur eine winzige Portion auf den Teller zu tun.
»Mach nur. Und hol den Sahnekrug. Er steht auf der Anrichte.«
Jessica durchquerte die vertraute bäuerliche Küche. Jeder Winkel, jede Ritze, jeder Trichter, der bei der Anrichte an einem Nagel hing, bis zu den Kupferpfannen an der Wand, waren ein Teil ihrer Kindheitserinnerungen und hatten dazu beigetragen, daß sie der Mensch wurde, der sie jetzt war. Doch die Erinnerungen brachten keine Wärme mit sich. Sie hatte oft ein schlechtes Gewissen gehabt, weil sie für die Steine und den Mörtel ihres Elternhauses nur wenig Zuneigung empfand. Das Leben auf einer Farm hätte Glück und Sicherheit bedeuten sollen, hatte es jedoch nie getan. Sie war so glücklich gewesen, als sie fortging, um ein weit entferntes College zu besuchen. Aber am Ende war sie doch nur wieder hier gelandet. Manchmal hatte sie das Gefühl, mit einem Gummiseil an die Farm gefesselt zu sein. Sie konnte nur bis zu einem gewissen Punkt weglaufen, dann riß es sie wieder zurück.
Schlimmer noch, seit ihrer Krankheit machte ihr der Gedanke angst, die Farm zu verlassen, so daß sie zwischen widerstreitenden Gefühlen gefangen war wie zwischen Scylla und Charybdis. Sie wußte genau, daß die Dinge, denen sie in der Außenwelt gegenübertreten mußte, nur kleine Probleme waren; doch sie kamen ihr wie schreckliche Hindernisse vor und ließen es nicht zu, daß sie einen Neubeginn auch nur versuchte. Je länger sie blieb, um so schlimmer wurde es. Doch sie konnte nicht gehen.
Nichts von alledem konnte sie ihren Eltern erklären, deren Leben sich um Greyladies Farm drehte und die hier alles fanden, was sie suchten. Sie unterwarfen sich bei allem, was sie taten, den Notwendigkeiten des bäuerlichen Jahres, und die Welt draußen bedeutete ihnen wenig. Sie kannten sie nicht, und sie interessierte sie noch weniger. Nur Alwyn hätte Jessica verstehen können, doch sie sprachen nie darüber.
Allein Jamie hatte es geschafft, für immer fortzugehen und draußen ein erfolgreiches Leben zu führen, weit weg von Greyladies. Aber es hatte Jamie nie etwas ausgemacht, Menschen zu verletzen. Jessica wünschte oft, sie hätte etwas von der berüchtigten Rücksichtslosigkeit der Winthrops geerbt. Jamie mußte außer seinem auch ihren Anteil bekommen haben.
Jessica zog dicke Küchenhandschuhe an, bückte sich und nahm die große runde Backform mit dem Apfelstreusel aus dem Ofenrohr. Als sie sich aufrichtete, begann im Nebenzimmer das Telefon zu läuten.
»Ich gehe«, sagte Alwyn, stand auf und schob sich an ihr vorbei. Er hatte immer Schwierigkeiten, durch die niedrigen Türen zu kommen, die aus einer weit zurückliegenden Zeit stammten, in der die Menschen viel kleiner waren. Er mußte einen Buckel machen und den Kopf einziehen, um nicht anzustoßen.
Jessica stellte das mit Streuseln überbackene Apfeldessert auf die Marmorplatte des Tischs bei der Tür und verteilte mit dem Löffel Portionen auf die blauweißen Teller. Nun ja, auf die blau und gelblich weißen Teller mit den zahlreichen Sprüngen in der Glasur und den abgestoßenen Rändern. Man kaufte auf der Farm kaum einmal etwas Neues. »Sind doch noch gut, die Teller«, hatte Mrs. Winthrop gemeint, als Jessica vorgeschlagen hatte, sie könnten vielleicht wegen der Hygiene … »Wenn du sie richtig spülst, machen ein paar Sprünge nichts aus.« Um die Wahrheit zu sagen, so war natürlich für neue Teller ebensowenig Geld da wie für irgend etwas Neues.
Während sie dicht neben der offenen Tür arbeitete, hörte sie, was Alwyn nebenan am Telefon sagte. Offensichtlich galt der Anruf ihm, und sie hätte nicht gelauscht, aber etwas in seiner Stimme, etwas beinahe verstohlen Schuldbewußtes, weckte ihre Aufmerksamkeit.
»Ich hab dir gesagt, du sollst mich nicht anrufen«, flüsterte er heiser. »Ja, ich weiß … Nun, ich hatte noch keine Gelegenheit … Außerdem ist es nicht an mir, etwas zu sagen!« Beim letzten Satz hob sich Alwyns Stimme fast zu einem gedämpften Schrei. Es folgte ein langes Schweigen und dann Alwyns zornige Antwort: »Ich habe es dir schon einmal gesagt – wenn ich kann.« Der Hörer knallte auf die Gabel, und Alwyn kam mit einem Gesicht zurück, das fast so rot war wie sein Haar.
»Wer war das denn?« fragte seine Mutter.
»Der Wirt vom Fox and Hounds, der wissen wollte, ob ich nächsten Mittwoch beim Darts-Team mitmache. Ich habe ihm schon vor einer Woche oder noch früher gesagt, ich kann ihm nicht garantieren, daß ich wieder spiele.«
Jessica trug die Teller mit dem Apfelstreusel zum Tisch und dachte: Alwyn war noch nie ein guter Lügner. Ihre Blicke trafen sich, als sie ihm den Teller hinstellte, und er sah sie herausfordernd an.
Sie respektierte seine Privatsphäre und hätte ihn nicht mehr nach dem Telefonanruf gefragt, hätte sie ihn am Nachmittag nicht allein erwischt. Sie hatte der Mutter beim Tischabräumen und beim Abspülen geholfen und war dann hinausgeschickt worden. »Damit du an die frische Luft kommst, und nimm ja kein Buch mit, mit dem du dich irgendwo verkriechst.« Also hatte sie Sattel und Zaumzeug aus der Scheune geholt und hatte sich aufgemacht, Nelson auf seiner Koppel einzufangen.
Dort stieß sie unerwartet auf ihren Bruder, der auf einer niedrigen, bröckelnden Mauer saß, Teil einer Ansammlung von Steinen in der Mitte der Koppel. Ihm zu Füßen lag der Schäferhund Whisky und hechelte mit der rosa Zunge in der Hitze, während er auf Befehle wartete. Alwyn saß vornübergebeugt da, die Arme auf den Knien, tief in Gedanken. Er hatte die kräftigen, sonnenverbrannten Hände locker gefaltet, und der Schirm seiner Tweedmütze beschattete sein Gesicht.
Jessica legte Sattel und Zaumzeug auf den Boden und setzte sich neben Alwyn auf die Mauer. Nelson weidete in ihrer Nähe, behielt sie jedoch im Auge, weil er den Sattel gesehen hatte.
»Das Pony ist so verdammt fett«, sagte Alwyn. »Bald wirst du ihm den Sattelgurt nicht mehr umlegen können.«
»Ich bewege ihn jeden Tag.«
»Frißt sich um Sinn und Verstand. Ein nutzloses, stinkfaules Vieh.«
»Halt den Mund, Alwyn. Das sagst du nur, um mich zu ärgern.« Er grinste, und sie fuhr fort, um es ihm heimzuzahlen: »Und warum hast du am Telefon so geflüstert? Erzähl mir bloß nicht, daß es der Wirt vom Fox and Hounds war!«
Sein Grinsen verschwand, und er machte ein finsteres Gesicht. »Nein, ’s war Dudley Newman.«
Jetzt runzelte sie verblüfft die Stirn. »Der Baumeister? Was wollte er?«
»Dasselbe, was er wollte, als er vor einiger Zeit hier aufgekreuzt ist.«
»Unser Land kaufen?« Sie warf das lange blonde Haar zurück. »Dad hat ihm doch gesagt, daß er Greyladies nicht verkauft.«
Alwyn knurrte etwas.
»Also warum hat er dich angerufen?« Sie blieb hartnäckig.
»Woher soll ich das wissen?«
»Alwyn! Ich will es wissen. Hast du mit Newman irgendein Komplott ausgeheckt?«
»Nein!« fauchte er. »Wie könnte ich? Ich habe nicht das letzte Wort. Aber ich habe gesagt, daß ich – wenn Dad es sich anders überlegt – an einem Verkauf interessiert wäre, sofern der Preis stimmt.« Er unterbrach sich, als sei er über seine eigene Courage erschrocken. »Komm, Jess, warum denn nicht? Du würdest deinen Anteil bekommen, und wir könnten von hier weg.« So offen hatte er mit ihr noch nie über dieses ärgerliche Thema gesprochen.
»Sie würden nicht von hier fortgehen.«
»Nein.« Er seufzte. »Das würden sie nicht.«
»Und wenn du hinter Dads Rücken mit Dudley Newman kungelst, kommt er bald dahinter. Du kannst nicht gut lügen, Alwyn. Nicht wie Jamie.«
Sein Kopf fuhr herum. »Wieso erwähnst du ihn?«
»Vor ein paar Tagen ist doch ein Brief von ihm gekommen, oder? An Dad und Ma adressiert. Er hat auf dem Küchentisch gelegen, aber Ma hat ihn rasch verschwinden lassen, damit ich ihn nicht sehe.«
»Nicht rasch genug, wie es scheint«, lautete der lakonische Kommentar.
»Kommt er nach Hause?«
»Der Brief war nicht an mich«, sagte er ausdruckslos.
Eine Weile saßen sie schweigend da und ließen sich die Sonne auf den Rücken scheinen. Der Hund war, die Nase auf den Pfoten, eingeschlafen, und Nelson, zufrieden, daß er nicht eingefangen und gezwungen werden sollte, sich zu bewegen, hatte sich in die entfernteste Ecke der Koppel verzogen.
»Seltsames altes Gemäuer«, sagte Alwyn plötzlich und schlug mit der Hand auf die bröckelnde Mauer, auf der sie saßen. »Könnte uns viele Geschichten erzählen, wetten daß?«
»Ich finde diese Ruinen gruselig«, sagte Jessica schroff.
»Denkst wohl, daß ein paar Gespenster aus den alten Steinen herausspringen, ja?« zog er sie auf.
»Würde mich nicht überraschen. Hier ist einmal ein Verbrechen verübt worden.«
»Wie meinst du das?« Er wandte den Kopf und spähte mit einem stechenden Blick seiner grauen Augen unter dem Mützenschirm hervor.
»Der Brand im Versammlungshaus. In dieser alten Ruine.«
»Guter Gott, Mädchen, ich hab mich schon gefragt, wovon du redest«, sagte er wegwerfend. »Das war kein Verbrechen. Eher ein Unfall.«
»Brandstiftung ist ein Verbrechen.«
»Wer sagt denn, daß es Brandstiftung war? Es ist länger als hundert Jahre her, und niemand weiß es genau. Nur ein bißchen Geschichte, dieses alte Gemäuer, sonst nichts.«
»Es ist ein unheilvoller Ort«, sagte sie leise. »Ich spüre das Unglück förmlich, es sickert aus den Steinen.«
»Unsinn. Fang nicht an, dir was einzubilden.«
»Es liegt Unheil in der Luft.« Jessica blickte, während sie sprach, über das Feld zu dem Turm der Kirche von Bamford, der am Horizont aufragte.
»Was soll denn das heißen? Manchmal redest du wirklich närrisch daher, Jess. Wenn du anfängst solches Zeug vor Ma zu verzapfen, schleppt sie dich wieder zu Dr. Pringle.«
»Ich habe in der Gazette das mit Lindsay gelesen.«
»Oh, das! Ich wußte nicht, daß du sie gekannt hast.« Alwyn schien verärgert und verunsichert. »Wenn ich es gewußt hätte, hätte ich dafür gesorgt, daß die Gazette verschwindet, bevor du sie findest.«
»Ich wünschte, du würdest aufhören, mich zu beschützen!« schrie sie. Er antwortete nicht, und sie fuhr steif fort: »Wir waren vor Jahren Chormädchen, Lindsay und ich. Sie war ein so fröhliches, freundliches Mädchen. Jetzt ist sie tot und auf so schreckliche Weise gestorben.«
»Denk nicht mehr dran«, riet er ihr barsch. »Das alberne kleine Ding hat es selbst getan. Hat keinen Sinn, sich deshalb aufzuregen.« Er stand auf, und der Hund wurde wach und wedelte mit dem buschigen Schwanz. Sogar Nelson schien zu merken, daß die friedliche Pause zu Ende war. Er warf den Kopf zurück und wieherte schrill.
»Ich habe zu tun«, sagte Alwyn. »Versuch ja nicht, mit dem Pony über Hecken zu springen. Mit dem Fett, das es herumschleppt, wird es sie direkt durchpflügen, und ich muß sie dann wieder flicken.«
»Das habe ich nie getan, wie du sehr genau weißt.« Sie schulterte den Sattel und überquerte zielstrebig die Koppel.
»Gespenster, das Unheil«, murmelte Alwyn vor sich hin und versetzte dem nächstbesten halb im Gras vergrabenen Stein des geschwärzten Mauerfundaments einen Tritt. »Sie gehören ganz einfach zur Farm wie du und ich, Junge.« Der Hund blickte auf, spitzte die Ohren, die Augen wachsam und neugierig. »Genau wie du und mein verdammtes Ich«, wiederholte Alwyn mürrisch. »Ich könnte diesen alten Brocken das oder jenes über das Unglücklichsein erzählen. Gib mir eine Schachtel Streichhölzer, und ich brenne mir nichts, dir nichts die ganze verdammte Farm nieder.«
KAPITEL 2
»Beton, Asphalt und Ziegel, das wird alles sein, was bleibt«, sagte Alan Markby mißmutig. »Das ganze Land total verbaut, von Küste zu Küste.«
Er gab diese traurige Erklärung sich selbst, als der Wind ihm in das glatte blonde Haar fuhr und wild daran zauste. Erbittert schob er die Hände in die Taschen seines abgetragenen olivgrünen Parkas und betrachtete finster die Szenerie, ehe er sich auf einen Baumstumpf setzte und einen Riegel Schokolade aus der Tasche nahm. Er aß nicht besonders viele Süßigkeiten, aber es war ihm zu mühsam gewesen, sich ein Sandwich zu machen. Er hatte nur die Schokolade in die Tasche gesteckt und war zu seinem Spaziergang aufgebrochen.
Er hatte hinaus müssen – hinaus aus dem Büro, hinaus aus dem Revier. Wie Pearce prophezeit hatte, war im Fall Lindsay Hurst bei der gerichtlichen Untersuchung auf gewaltsamen Tod ohne Nennung der Ursache erkannt worden. Markby hatte nichts anderes erwartet. Sie hatten es versucht, aber bisher die Mitbewohner des toten Mädchens nicht gefunden. Und da sie nicht einmal einen einzigen Namen hatten, stand so gut wie fest, daß sie sie nie finden würden. Viel wichtiger war, festzustellen, woher Lindsay die tödliche Drogendosis bekommen hatte. Heroin hatte ihr kurzes Leben beendet, und bis vor kurzem hatten sie in dieser Gegend kaum mit Drogen zu tun gehabt. Wieder hatte Pearce recht behalten. Auf Cannabis stießen sie recht häufig, doch in letzter Zeit waren immer öfter härtere Drogen im Spiel und bereiteten der örtlichen Polizei erhebliche Kopfschmerzen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!