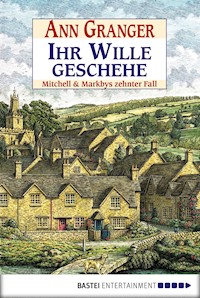7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Krimi
- Serie: Mitchell & Markby Krimi
- Sprache: Deutsch
Zwei Leben - ein Tod: Andrew Pellham ist ein renommierter Anwalt, der auf seinem Landsitz, dem herrschaftlichen Tudor Lodge, ein unbescholtenes Leben führt. Doch die Fassade trügt, denn eines Morgens wird Pellham ermordet in seinem Garten aufgefunden. Die ersten Untersuchungen führen zu der überraschenden Enthüllung, dass der Anwalt offensichtlich ein Doppelleben geführt hat. Und in seiner zweiten Existenz scheint er sich eine Menge Feinde gemacht zu haben. Superintendent Markby ist da über die Hilfe seiner Freundin Meredith ganz froh, denn seine Ermittlungen werden ausgerechnet von seinem Kollegen, Sergeant Prescott behindert, der sich Hals über Kopf in die Hauptverdächtige verliebt ... Mitchell & Markbys 11. Fall.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 542
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Über die Autorin
Ann Granger war früher im diplomatischen Dienst tätig. Sie hat zwei Söhne und lebt heute mit ihrem Mann in der Nähe von Oxford. Bestsellerruhm erlangte sie mit der Mitchell-und-Markby-Reihe und den Fran-Varady-Krimis. Nach Ausflügen ins viktorianische England mit den Lizzie-Martin-Romanen, knüpft sie mit der Serie um Inspector Jessica Campbell wieder unmittelbar an die Mitchell-und-Markby-Reihe an.
ANN GRANGER
TOTE KEHREN NICHT ZURÜCK
Mitchell & Markbys elfter Fall
Ins Deutsche übertragen von Axel Merz
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Titel der englischen Originalausgabe: »Call the Dead Again«
© 1998 by Ann Granger
Für die deutschsprachige Ausgabe
© für die deutschsprachige Ausgabe 2004/2011 byBastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Alexander Huiskes/Stefan Bauer
Umschlaggestaltung: QuadroGrafik, Bensberg
Titelillustration: David Hopkins
Datenkonvertierung E-Book:
hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-8387-0888-1
Sie finden uns im Internet unterwww.luebbe.deBitte beachten Sie auch: www.lesejury.de
Oh grausamer Tod, was hast du getan?Am Boden die sterbliche Hülle liegt,die Seele zum Himmel gerufen.Zu Staub der Leichnam zerfällt.Trauernde Freunde warten vergeblich.Kein Seufzer, keine Tränenbringen die Toten zurück.
Epitaph auf einem Friedhof in Cornwall, 1820
KAPITEL 1
»Ich will heute Abend in Bamford sein. Fährt jemand in diese Richtung?«
Die Worte erklangen scharf und akzentfrei, mit einem leicht gebieterischen Unterton. Die Männer, die sich um den schmuddeligen Imbissstand drängten, wandten wie auf ein Kommando hin die Köpfe. Selbst Wally, Inhaber und Koch in Personalunion, war verblüfft. Er legte beide Hände auf den mittels Ketten gesicherten schmierigen Tresen an der Seite des Wagens und beugte sich vor, um die Sprecherin in Augenschein nehmen zu können.
Durch die Verlagerung von Wallys nicht unbeträchtlichem Gewicht geriet der kleine Lieferwagen ins Wanken, und sein Inhalt klimperte. Eine Pyramide fertig eingepackter Snacks sackte in sich zusammen und landete verstreut auf dem Tresen. Anhand der Farbetiketten ließen sie sich leicht auseinander halten: Käse und Zwiebeln – Barbecue – Hühnchentikka. Ein Snack fiel über den Rand auf den Boden. Ein Kunde, zu dessen Füßen er landete, bückte sich, hob ihn auf und steckte ihn in die Tasche seiner ledernen Blousonjacke. Wally war niemals so abgelenkt, dass er einen Diebstahl wie diesen übersah. Er verdrehte ein blutunterlaufenes Auge, und der Kunde kramte hastig nach Kleingeld, warf dann schnell ein paar Münzen auf den Tresen und wandte sich anschließend sogleich wieder nach der Stimme um.
Der Parkplatz war voll gestellt mit geparkten Lastwagen. Wallys Imbiss war eine regelmäßige Anlaufstelle für die Fernfahrer. Bei ihm gab es heiße Getränke, angebrannte Würstchen, würziges Gebäck mit Kartoffeln, Zwiebeln und Rüben, die er wohlklingend »Cornwall Pasties« nannte, Schinkenbrote und große Stücke Rosinenkuchen. Wally behauptete voller Stolz von seinen Kochkünsten, seine Mahlzeiten machten jeden Kunden satt. Tatsächlich machten sie seine Kunden nicht nur satt, sondern sie hinterließen in ihnen auch das Gefühl, als müsse man niemals wieder etwas essen. Wallys Preise waren niedrig, seine Hygiene fragwürdig, und er hatte rund um die Uhr geöffnet. Dabei beobachtete er, wie er es später gegenüber Sergeant Prescott formulierte, »das Leben. So ungefähr die ganze Bandbreite. Und noch mehr«.
Was er bei dieser speziellen Gelegenheit sah, war eine junge, schlanke Frau, die seiner Meinung nach vielleicht achtzehn oder neunzehn Jahre alt war. Sie trug Jeans und darüber eine Tweedjacke von der Sorte, die Wally eigentlich mit jenem Schlag Männer und Frauen verband, die hin und wieder aus den Führerhäusern von Pferdetransportern stiegen und laut »Bedienung!« riefen, als wäre er das verdammte Ritz. Sie stand ein kurzes Stück entfernt und musterte die Männer mit kritischen Blicken.
»Und«, fügte Wally im Verlauf der späteren Unterhaltung hinzu, »sie war atemberaubend. Wie eins von diesen Models. Groß, ein wenig dünn vielleicht, aber Haare, so was hast du noch nicht gesehen. Jede Menge Haare.« An dieser Stelle klang Wally ein wenig melancholisch und fuhr sich mit der Hand über den kahl werdenden Schädel. »Hatten eine wunderbare Farbe. Gefärbt, schätze ich. Trotzdem, wunderbare Haare. Irgend so ein goldener Bronzeton. Sie war jedenfalls keine gewöhnliche Anhalterin und schon gar keine billige Nutte. Sie hatte Klasse, das konnte jeder sehen.« Er klang ehrfürchtig.
Eddie Evans gingen ähnliche Gedanken durch den Kopf. Er war mit einem unbeladenen Laster auf dem Heimweg. Ein Lastzug ohne Fracht bedeutete ein schlechtes Geschäft, doch es hatte ein Missverständnis gegeben, und ein selbstständiger Fuhrunternehmer wie Eddie, eine Einmannband, die sich selbst beschäftigte, wie er es zu nennen pflegte, endete in so einem Fall in der Regel mit leeren Händen.
Das Wetter war den ganzen Tag lang trüb gewesen, obwohl angeblich bereits Frühling herrschte. Dieses Jahr schien der Winter nur zögerlich zu weichen, um einer wärmeren Jahreszeit Platz zu machen. Die Sonne war hinter einem dichten Wolkenschleier verborgen, und die Temperaturen waren ungewöhnlich niedrig. Bäume und Hecken trieben nur langsam aus, und die Frühlingsblumen hatten ausnahmslos Verspätung.
Die graue Stimmung hatte Eddie angesteckt. Beim Anblick von Wallys Imbisswagen, geschmückt mit den Verheißungen warmer und kalter Erfrischungen, war er auf den Parkplatz eingebogen – nicht so sehr, weil er eine Tasse alten Tees brauchte, um sich zu stärken, sondern weil er belebende Gesellschaft suchte, etwas für die Seele. Andere Fahrer, von denen er einige kannte, versammelten sich stets um diese Tageszeit bei Wallys Imbiss, kurz nach vier Uhr nachmittags. Eddie war nach einer Pause zumute und nach einem Schwätzchen mit ein paar Kollegen.
Im Allgemeinen nahm Eddie keine Anhalter mit, weder weibliche noch männliche. Er kannte jemanden, der eine ganze Menge Scherereien bekommen hatte deswegen. Eddies Bekannter hatte ein Mädchen mitgenommen, das später am anderen Ende des Landes tot in einem Straßengraben gefunden worden war. Die Polizei hatte jeden aufgespürt, der die Kleine gesehen oder sie in seinem Wagen mitgenommen hatte, und es hatte einen Haufen Geld gekostet. Niemand führte Eddies Geschäft oder zahlte seine Hypotheken ab, wenn er zur Befragung festgehalten wurde und seine Termine über den Jordan marschierten. Und so ignorierte Eddie seither die Tramper, die einsam am Straßenrand standen und ihre Pappschilder mit den aufgekritzelten Namen ferner Städte in die Höhe hielten.
Wallys Tee hatte das Gefühl von Depression nicht vertreiben können, das der stahlgraue Himmel und das entgangene Geschäft hervorgerufen hatten. Stattdessen war ein Widerwille hinzugekommen, die gesellige Menge vor dem Imbisswagen zu verlassen und weiterzufahren. Das menschliche Bedürfnis nach Gesellschaft führte letztendlich dazu, dass Eddie an diesem einen Tag eine Ausnahme von seiner ansonsten ehernen Regel machte.
Ohne nachzudenken, hörte er sich sagen: »Ich kann Sie ein gutes Stück weit mitnehmen, Süße. Ich lass Sie an der Abzweigung nach Bamford raus. Von da aus müssen Sie sich eine neue Mitfahrgelegenheit suchen.«
Gesichter, die zuvor die junge Frau angestarrt hatten, drehten sich zu ihm um und starrten nun stattdessen ihn an. Sie alle wussten, dass Eddie sich niemals erbarmte und einen Tramper mitnahm.
Wallys Samowar mit dem heißen Tee darin brodelte und zischte in das verblüffte Schweigen hinein. Der Besitzer des Samowars zog schweigend und missbilligend den Kopf ein, nahm die Münzen, die als Bezahlung für die Kartoffelchips auf dem Tresen lagen, und legte sie in seine altmodische, mechanische Registrierkasse.
Das Mädchen wartete. Niemand machte ein besseres Angebot. Niemand sagte ein Wort, doch die Gedanken aller hingen so schwer in der Luft wie der heiße Dampf aus dem Samowar.
Die junge Frau blickte Eddie an. »Also schön, danke«, sagte sie.
Sie nahm den alten khakifarbenen Proviantbeutel auf, der zu ihren Füßen gelegen hatte, und hängte ihn sich über die Schulter. Offensichtlich hatte sie nicht vor, länger zu warten. Ihr Verhalten war vielmehr das von jemandem, der ein Taxi herbeigerufen hatte – bestimmt jedenfalls nicht das einer Anhalterin, die sich eine kostenlose Mitfahrgelegenheit erbettelt hatte.
Eddie, von ihrer Ungeduld angesteckt, warf seinen leeren Styroporbecher in den verbeulten Abfalleimer aus Drahtgeflecht. Hinter ihm erklang ein amüsiertes Gemurmel, als er die Gruppe zurückließ und zu seinem Sattelzug stapfte.
Wally beschäftigte sich bereits wieder mit seinem spuckenden Samowar. Seine verbliebene Klientel äußerte die Ansicht, dass Eddie sich soeben in Schwierigkeiten gebracht hätte. Privat war Wally durchaus geneigt, sich dieser Meinung anzuschließen, doch er ließ sich niemals dazu hinreißen, in den vielfältigen Diskussionen, die vor seinem fahrbaren Imbissstand ausgetragen wurden, Partei für die eine oder andere Seite zu ergreifen.
Dann fragte jemand: »Wer hat sie eigentlich hergebracht?«
Schweigen, gefolgt von einem Gewirr aus Fragen und verneinenden Antworten.
»Sie muss doch irgendwie hierher gekommen sein! Sie kann doch nicht aus dem Nichts kommen!«, beharrte der erste Fragesteller. »Seht euch doch nur um!«, fügte er hinzu und beschrieb eine weit ausholende Geste mit kräftigem Arm. »Wir sind meilenweit von jeder Ansiedlung entfernt. Hier gibt es nichts als Felder!«
Dennoch wollte niemand die junge Frau auf dem Parkplatz abgesetzt haben, und niemand hatte gesehen, wann sie gekommen war.
»Als wäre sie mitten aus dem Nichts materialisiert«, sagte jemand, und Wally, beleibe kein abergläubischer Mann, fröstelte plötzlich trotz der stickigen Hitze in seinem Imbisswagen.
Eddie bereute seine Hilfsbereitschaft schon, noch bevor er seinen Lastzug erreicht hatte. Von Zweifeln erfüllt kletterte er in das Führerhaus. Die Vertrautheit seiner Fahrerkabine, der leicht verschwitzte Geruch, das Maskottchen, ein Cornwall-Kobold, der Schnappschuss von seiner Frau, mit Tesafilm neben dem Tachometer angebracht, all diese Dinge konnten ihn nicht beruhigen. Stattdessen schienen sie ihn unaufhörlich daran zu erinnern, dass er eine eiserne Regel gebrochen hatte.
Die junge Frau kletterte geschickt auf der Beifahrerseite in die Kabine und gesellte sich zu ihm. Eddie bedachte sie mit einem verstohlenen Blick, während sie ihren Khakibeutel unter dem Beifahrersitz verstaute. Sie war ungefähr so alt wie seine eigene Tochter. Auch Gina hatte lange Haare und trug sie hinter dem Kopf zusammengebunden, doch da endeten die Ähnlichkeiten auch schon. Diese junge Frau hier hatte etwas an sich, eine Aura, einen Touch von etwas Undefinierbarem, der Gina vollkommen fehlte. So stolz Eddie im Allgemeinen auf seine Tochter war, nun spürte er so etwas wie Neid.
Es war nicht so, als wäre die junge Frau modisch gekleidet. Sie trug die üblichen Jeans und komische braune Lederstiefel, die bis zu den Knöcheln reichten. Nicht von der Sorte, die man schnüren musste, sondern altmodische Dinger mit elastischen Gummis in der Seite, die wahrscheinlich eine ganze Menge Kohle gekostet hatten. Gina stand mehr auf die modischen Accessoires, und sie waren so gut wie immer überteuert. Diese Stiefel hier sahen nach allerbester Qualität aus, keine Billigproduktion aus dem Fernen Osten oder Südamerika, die nur eine Saison und einen flüchtigen Trend lang halten musste. Die Jacke, dunkelbrauner Tweed mit ledernen Ellbogenschonern, war ebenfalls Qualität. Darunter trug sie eine dunkle Bluse und einen gelben Männerschal um den Hals. Eddie beobachtete, wie sie den Schal herunterzog und ihn in ihrem Schoß festhielt, während sie nach vorne sah.
Ihr Haar stand in grellem Kontrast zu dieser demonstrativen Schlichtheit. Im schwachen Licht der Kabine sah es aus, als würde es von innen heraus leuchten. Er fühlte sich an einen polierten Messingleuchter in einer Kirche erinnert, in dem sich die tanzenden Kerzenflammen ringsum spiegelten. Es wurde im Nacken von einem Band zusammengehalten, von wo es zur Seite und über eine Schulter fiel. Eine Locke hatte sich gelöst und hing ihr ins Gesicht. Es sah nicht unordentlich aus. Es sah aus, als sollte sie dort hängen. Sie hatte eine wunderbare Haut. Gina hatte Pickel und gab ein Vermögen für Aknemittel aus.
Er legte den Gang ein und lenkte den Sattelzug vom Parkplatz, während er sich der beobachtenden Augen aus der Richtung von Wallys Imbissbude bewusst war. »Ich hab eine Tochter in Ihrem Alter«, sagte er. »Sie heißt Gina.«
»Oh, tatsächlich?« Die Antwort war höflich desinteressiert.
Ein wenig verärgert fragte er: »Und wie heißen Sie?«
»Kate.«
Na wunderbar, dachte Eddie düster. Ihre Bekanntschaft war erst ein paar Minuten alt, und schon jetzt fühlte er sich, als wären fünfundzwanzig Jahre seines Lebens einfach von ihm abgefallen. Er war wieder ein schüchterner Jugendlicher, der versuchte, in einer Bar oder auf einer Party ein Mädchen anzugraben, ein Mädchen, das mit einer anderen Gruppe gekommen war. Ein Mädchen, von dem er sehr schnell erkannte, dass es in einer anderen Liga spielte.
»Dann wohnen Sie also in Bamford?«, erkundigte er sich mit einer Jovialität, die weder ihn selbst noch sie täuschte.
»Nein. Ich besuche jemanden.«
»Kommen Sie von weit?«
»Weit genug.« Eine Pause. »London.« Sie hob eine Hand und schob ihre langen blonden Haare nach hinten, sodass er ihren makellosen Hals sehen konnte. Mit größerem Bedauern als je zuvor, dass er sich in diese Situation gebracht hatte, suchte Eddie Zuflucht in väterlichem Rat.
»Trampen kann für eine junge Frau ziemlich gefährlich sein«, sagte er kritisierend und krallte die Hände in das Lenkrad.
Sie sah ihn aus weit auseinander stehenden Augen an. »Ich bin vorsichtig.«
Sein Mund war ganz trocken. Das lag wahrscheinlich an Wallys altem Tee. Man konnte Schiffsplanken streichen mit diesem Tee.
»Sind Sie Studentin?«, fragte er rau.
»Mmmh …« Sie lehnte sich zurück und blickte verträumt durch die Windschutzscheibe auf die vor ihnen liegende Straße.
»Gina, meine Tochter, macht eine Ausbildung zur Krankenpflegerin.« Er konnte die Verzweiflung in seiner Stimme hören.
»Großartig.« Sie klang geistesabwesend.
Meinetwegen, dachte Eddie. Sie will sich nicht mit mir unterhalten, und ich grabe mir selbst eine Grube, indem ich sie dauernd anquatsche. Ich hätte mich an meine Prinzipien halten sollen. Je schneller ich sie loswerden kann, desto besser. Was soll das überhaupt, warum trampt sie durch die Gegend? Sie hat bestimmt Geld.
Doch Geld hatte oftmals nichts damit zu tun. In einem unangenehm hellen Augenblick kam ihm der Gedanke, dass sie wahrscheinlich ein Spiel spielte. Nicht er hatte sie aufgelesen, sondern sie ihn.
»Dieser Jemand, den Sie in Bamford besuchen wollen …«, sagte er. »Werden Sie erwartet?«
»Ich weiß es nicht«, murmelte sie. »Aber ich denke schon. Auch wenn er nicht mit mir rechnet.« Sie sah ihn erneut an und lächelte. Ein hübsches Lächeln. »Es soll eine Überraschung sein«, sagte sie.
Er setzte sie wie versprochen bei der Ausfahrt nach Bamford ab. Inzwischen war das Tageslicht schwächer geworden, Nebelschwaden trieben über die Felder. In der frühen Dämmerung glichen die Bäume Gespenstern. Man konnte beinahe glauben, dass noch immer Winter wäre. Eddie hatte es kaum erwarten können, sie loszuwerden, endlich, gar keine Frage. Und doch verspürte Eddie nun ein merkwürdiges Zögern, eine junge Frau – irgendeine Frau – in dieser verlassenen Gegend abzusetzen, ganz allein und so spät am Tage. Er sah auf die Uhr im Armaturenbrett. Es war erst zwanzig nach sechs und im Grunde genommen noch gar nicht so spät. Trotzdem, es war kalt draußen. Die kalte Brise wehte durch die offene Beifahrertür herein.
»Kommen Sie zurecht, meine Liebe?«
»Sicher«, rief sie zu ihm hinauf. Nur ihr Kopf war sichtbar, als sie auf der Straße stand.
Sie machte Anstalten, die Tür zuzuwerfen, doch Eddie beugte sich zu ihr hinüber und hielt sie auf. »Ich könnte einen Abstecher machen und Sie direkt vor der Haustür abliefern – aber ich möchte nicht zu spät kommen. Meine Frau wartet zu Hause auf mich.«
»Nicht nötig.« Sie klang so gelassen und zuversichtlich, dass er fast verlegen war wegen seiner Besorgnis. Sie entfernte sich bereits vom Wagen, den Khakisack über den Schultern, der ihre Mähne verdeckte.
»Danke!«, rief sie zu ihm zurück und hob die Hand zum Gruß, ein alabasterweißer Fleck im Zwielicht. Ihre Gestalt wurde undeutlich und verblasste immer mehr, bis sie schließlich nicht mehr zu sehen war. Den ganzen restlichen Heimweg war Eddie nicht im Stande, das Gefühl abzustreifen, dass er irgendwie etwas Unrechtem Vorschub geleistet hatte.
Meredith Mitchell sah den Lastzug vor sich, der kurz vor der Abfahrt Bamford vom Haltestreifen auf die Straße zurückkehrte. Die Rücklichter leuchteten wie wütende rote Augen, als er in die zunehmende Dämmerung davondonnerte. Sie fragte sich, warum er dort angehalten hatte. Vielleicht hatte der Fahrer die Orientierung verloren und auf einer Straßenkarte nachgesehen. Vielleicht hatte er auch ein natürliches Bedürfnis verspürt und angehalten, um sich kurz in die Büsche zu schlagen.
Sie hatte den Laster bereits wieder vergessen, als sie am Ende der Abfahrt stand und auf die Straße nach Bamford einbog. Ihr Herz machte einen Sprung. Es war das letzte kleine Stück auf ihrem Weg nach Hause. Sie war eine Woche lang in den South Downs gewesen und nicht in ihrem Büro im Foreign Office, weil sie gemeinsam mit einigen Kollegen einen Lehrgang geleitet hatte. Zumindest theoretisch dauerte der Lehrgang noch bis zum nächsten Tag, einem Freitag. Erst am Mittag sollte er offiziell enden und Lehrkräfte wie Teilnehmer nach Hause entlassen werden. In der Praxis war praktisch jeder bereits heute, am Donnerstagabend, aufgebrochen und hatte den Lehrgang verlassen.
Meredith hatte sich dem Exodus der Lemminge angeschlossen, weil sie wenig Sinn darin gesehen hatte, auf ihrem Posten zu bleiben wie der zum Untergang verurteilte Wächter bei den Toren von Pompeji. Die wenigen Lehrgangsteilnehmer, die bereit gewesen waren, bis zum Freitag zu warten und ihrem Vortrag zu lauschen, hatten mit sichtlicher Erleichterung zugestimmt, am heutigen Tag eine halbe Stunde länger zu machen, um die restlichen Themen zu besprechen und anschließend ebenfalls nach Hause zu fahren.
Sie hatte Alan angerufen, bevor sie losgefahren war, und hatte ihn über die Änderung des Zeitplans informiert. Sie hatten ausgemacht, dass Meredith direkt zu ihm nach Hause und nicht zu sich fahren würde. Er wollte versuchen, früher Feierabend zu machen und sie in Empfang zu nehmen. Sie würden eine Flasche Wein aufmachen und einen gemütlichen Abend verbringen.
Die Freude darüber, dass sie dem Lehrgang entkommen war und ein gemütlicher Abend auf sie wartete, wurde nur durch die Tatsache ein wenig getrübt, dass sie nicht gerne zur Dämmerstunde mit dem Wagen unterwegs war. Wenn es richtig dunkel war, mitten in der Nacht, wenn die Scheinwerfer die Straße hell erleuchteten, machte es ihr nichts aus. Doch während der Dämmerung mischten sich schwindendes Tageslicht und Scheinwerfer und verwandelten Umrisse in anthropomorphes Leben und Missgestalten. Es erinnerte Meredith jedes Mal an die Szene im Wizard of Oz, als Dorothy, die am Wegesrand stehen bleibt, um einen Apfel zu pflücken, einen gewaltigen Schrecken erleidet, weil der Baum ihr den Apfel wieder entreißt.
Vor ihr war etwas auf der Straße. Es bewegte sich zum Rand hin, als es in den Kegel ihrer Lichter gelangte. Zuerst hielt Meredith es für ein Tier. Kleine Muntjakhirsche wanderten durch die Pflanzungen zu beiden Seiten der Straße, seit sie vor vielen Jahren aus irgendeinem Park entwichen waren; mittlerweile hatte sich ihre Population prächtig entwickelt. Doch es war kein Hirsch, wie Meredith schnell sah, sondern eine menschliche Gestalt. Eine echte menschliche Gestalt und kein Streich, den ihre übereifrige Fantasie ihr spielte. Jemand marschierte die Straße entlang, hier draußen, wenigstens fünf Kilometer von den ersten Häusern der kleinen Stadt Bamford entfernt. Vielleicht jemand von einer Farm?
Als Meredith vorbeifuhr, bemerkte sie, dass es eine junge Frau war, die einen kleinen Rucksack oder etwas in der Art auf der Schulter trug. Es war recht spät für eine Anhalterin, obwohl, um der Wahrheit die Ehre zu geben, die junge Frau keinen Daumen gehoben und auch nicht signalisiert hatte, dass sie mitgenommen zu werden wünschte.
Vielleicht bewog genau das Meredith dazu, auf die Bremse zu treten. Während sie darauf wartete, dass die junge Frau herankam, schaltete sie die Innenbeleuchtung ihres Wagens ein, damit die Fremde sehen konnte, dass eine Frau auf sie wartete und nicht irgendein dämlicher Kerl, der eine Chance witterte.
Doch das eingeschaltete Innenlicht machte es Meredith schwer, etwas im Rückspiegel zu erkennen. Der ehemalige Vorteil des Fahrers war verloren, und nun war es Meredith, die allein in ihrem Wagen saß, gut sichtbar für jedermann, und sich wie in einem Goldfischglas fühlte, während draußen jemand näher kam, der für sie unsichtbar war. Oder waren es mehrere? Es hätten durchaus auch zwei sein können, und Meredith hatte den zweiten schlichtweg übersehen. Es wäre wahrscheinlich besser gewesen, nicht dem Instinkt nachzugeben und anzuhalten. Der Impuls, den guten Samariter zu spielen, endete womöglich noch damit, dass sie von zwei streunenden Hippies überfallen und beraubt wurde. Fast wäre sie wieder losgefahren, doch falls der einsame Fußgänger tatsächlich Hilfe benötigte, würde Merediths Flucht wie ein grausamer Streich aussehen. Also wartete sie.
Als der Fußgänger endlich neben Meredith angekommen war und vor dem Beifahrerfenster auftauchte, da geschah dies so unvermittelt, dass Meredith völlig überrascht wurde. Sie war froh zu sehen, dass die junge Frau allem Anschein nach doch alleine durch die Nacht marschierte.
Meredith riss sich zusammen, ließ das Fenster nach unten und rief: »Hallo, ich fahre nach Bamford – wenn Sie mitfahren wollen?«
»Ich möchte nicht bis ganz in die Stadt, nur bis zu den ersten Häusern.« Die Stimme kam deutlich und akzentfrei, vermittelte den Eindruck von Wohlerzogenheit. Obwohl man darauf heutzutage nicht mehr ohne Weiteres schlussfolgern konnte.
»Fein. Ich setze Sie am Stadtrand ab.«
Die junge Frau nahm auf dem Beifahrersitz Platz und legte ihren Proviantbeutel in den Schoß. Sie starrte geradeaus durch die Scheibe nach draußen, beobachtete den Lichtkegel der Scheinwerfer und schwieg ansonsten.
Das beharrliche Fehlen eines jeden Versuchs einer Unterhaltung war auf Dauer entnervend, und so unternahm Meredith einen Versuch. »Wohnen Sie in Bamford?«
»Nein.« Höflich, doch bestimmt. Das geht Sie nichts an, sagte der Ton.
Meinetwegen, dachte Meredith, die es ebenfalls nicht mochte, von Fremden ausgefragt zu werden. Ihre nächste Bemerkung war auf das Notwendigste beschränkt: »Wo soll ich Sie rauslassen? Wissen Sie, wo Sie hinmüssen?«
Die junge Frau sah Meredith an. »Es heißt Tudor Lodge. Ich glaube – so wurde es mir jedenfalls beschrieben –, es liegt ganz am Rand der Stadt, fast das erste Haus.«
»Ich kenne Tudor Lodge. Es gehört den Penhallows.«
»Ja.«
»Ich kenne Carla Penhallow. Sind Sie eine Freundin von Luke?«
Schweigen. Meredith hatte das Gefühl, als hätte ihre Frage die junge Frau aus der Fassung gebracht.
»Nein.« Die Antwort war einsilbig, wie schon zuvor, doch diesmal fehlte die verschlossene Gelassenheit.
Nun ja, rief sich Meredith ins Gedächtnis, es geht mich tatsächlich nichts an. Sie will es mir nicht verraten, also sollte ich gefälligst meinen vorlauten Mund halten.
Doch ihre Neugier war geweckt und obsiegte über höfliche Diskretion. »Wenn Sie noch nie in Tudor Lodge waren«, hörte Meredith sich fast gegen ihren Willen nachhaken, »dann werden Sie überrascht sein. Es ist ein sehr altes und wunderschönes Haus, auch wenn es gewissermaßen das reinste Flickwerk ist.«
»Flickwerk?« Wenigstens diesmal schwang Neugier in der Stimme der jungen Frau mit. Na endlich, dachte Meredith. Doch noch eine menschliche Regung.
»Der älteste Teil ist elisabethanisch. Er befindet sich auf der linken Seite, wenn Sie das Haus von der Straße her sehen. Auf der rechten Seite befindet sich eine Erweiterung aus georgianischer Zeit. Die Steinveranda ist viktorianisch, Tudorstil. Trotzdem passt alles irgendwie zusammen. Ich beneide Andrew und Carla sehr um dieses Haus.«
»Es klingt hübsch …« Ein Hauch von Aufforderung weiterzusprechen. Die junge Frau wollte mehr wissen und war nun offensichtlich doch bereit, sich mit Meredith zu unterhalten.
Doch jetzt war die Reihe an Meredith, sich mit Informationen zurückzuhalten. Wer um alles in der Welt war diese junge Frau überhaupt? Sie sah aus wie neunzehn, wirkte gut erzogen und doch so kühl wie Pfefferminze …
Endlich – ein wenig verspätet – zählte Meredith zwei und zwei zusammen. Die junge Frau musste aus dem Lastzug ausgestiegen sein, an der Abfahrt nach Bamford. Sie war bis dorthin getrampt. Das ergab aber doch keinen Sinn!? Es wäre nur dann logisch gewesen, wenn sie eine Freundin von Luke war, dem Sohn der Penhallows. Eine Studentin, knapp bei Kasse, wie das eben bei Studenten so üblich war. Doch falls sie eine Freundin der Eltern war, entweder von Andrew oder Carla, oder jemand von Carlas Verlag oder dem Fernsehsender, der Carlas populärwissenschaftliche Sendungen produzierte, dann hätte sie doch wohl einen eigenen Wagen gehabt.
Der Name von Bamford leuchtete auf dem Ortseingangsschild auf, zusammen mit dem Namen jener obskuren französischen Partnerstadt. Meredith passierte die letzten Reihen von Hecken, und eine Tankstelle kam in Sicht, unordentlich, doch hell erleuchtet und beruhigend. Hinter der Tankstelle eine Reihe Steincottages, gefolgt von einem kleinen Wäldchen. Sie erreichten die ersten Straßenlaternen, die soeben zündeten und brummend zum Leben erwachten. Und dort lag auch schon Tudor Lodge, ein wenig abgesetzt von der Straße hinter einem eisernen Gitter. Die hohen Schornsteine und der charakteristische spitze Giebel hoben sich noch immer von dem dunkelgrauen Abendhimmel ab.
Meredith lenkte zum Straßenrand. »Da wären wir …«
Sie unterbrach sich. Die junge Frau hatte bereits die Tür geöffnet und schlüpfte nach draußen.
»Danke fürs Mitnehmen.« Sie schlang sich den Proviantbeutel über die Schulter, lief ein paar Schritte die schmale Einfahrt hinauf und drehte sich dann zu Meredith um. Offensichtlich wartete sie, dass Meredith davonfuhr. Aus Höflichkeit gegenüber ihrer Wohltäterin?
Nein, überlegte Meredith. Wohl kaum. Sie möchte nicht, dass ich zusehe, wie sie zur Tür geht und läutet. Irgendetwas stimmte nicht an der Geschichte, so viel stand fest.
Doch selbst wenn es so war, fiel es Meredith schwer, sich einen Grund für dieses Verhalten vorzustellen. Die junge Frau hatte ausgesehen wie aus der Oberschicht. Um diese Tageszeit, wo die meisten Leute in ihre Häuser zurückkehrten, schien es unwahrscheinlich, dass ein Einbrecher unterwegs war – und falls doch, so war es noch viel unwahrscheinlicher, dass er sich von möglichen späteren Zeugen mitnehmen ließ.
Meredith zwang sich zu einem knappen Lächeln, erwiderte den Abschiedsgruß und machte Anstalten zu fahren.
»Das Dumme mit dir ist«, schalt sie sich, »dass du mit einem Polizisten befreundet bist. Das hat dich misstrauisch gemacht.«
Meredith sah in den Rückspiegel, wo sich die schlanke Gestalt abwandte und das dunkle Tor von Tudor Lodge passierte, um im Dämmerlicht der Gärten dahinter zu verschwinden.
Meredith hörte den Raben nicht, der sich stets als letzter der gefiederten Bewohner eines Gartens zur Nachtruhe niederlässt. Als der Rabe sein Territorium zur Abendpatrouille überflog und den Eindringling erspähte, stieß er ein lautes, sich wiederholendes Krächzen aus. Es war auch gar nicht nötig, dass sie ihn hörte.
Denn trotz aller Bemühungen, ihre Befürchtungen zu unterdrücken, war in Meredith genau wie in Eddie Evans zuvor das beunruhigende Gefühl haften geblieben, etwas Unheilvollem Vorschub geleistet zu haben.
KAPITEL 2
Andrew Penhallow klopfte an der Schlafzimmertür. »Wie geht es dir jetzt?«, fragte er leise.
Aus dem Zimmer dahinter murmelte seine Frau mit schmerzerfüllter Stimme eine unverständliche Antwort. Er öffnete die Tür einen Spaltbreit. Die Vorhänge waren zugezogen und sperrten das wenige noch vorhandene Tageslicht aus. Das Mobiliar des Schlafzimmers war nur in undeutlichen Umrissen zu erkennen. Auf dem Bett in der Mitte des Raums erkannte er eine zusammengekrümmte Gestalt: Carla, seine Frau, bot ein Bild des Elends.
»Entschuldige«, sagte er hilflos. »Kann ich etwas für dich tun?«
»… sterben«, stöhnte das Häufchen Elend.
»Ein Aspirin?«
»Nein … geh weg … danke …«
Er schloss leise die Tür und kehrte über die knarrende Eichentreppe nach unten zurück. Das Haus war von einer warmen, dumpfen Stille erfüllt. Mehr als einmal hatte Andrew gedacht, dass in diesem alten Gebäude während der Dämmerung die Vergangenheit zum Leben erwachte. Es war, als kämen die Geister all jener, die unter diesem Dach gelebt hatten, aus ihren Verstecken hervor, um Geschichten über längst vergangene Lieben und Abenteuer auszutauschen. Um darüber zu jammern, dass sie tot waren, oder sich über die gegenwärtigen Bewohner lustig zu machen. In einem Anflug barocker Fantasie fragte er sich, ob er sich eines Tages zu ihnen gesellen würde. Vielleicht hätte er einen Lieblingsplatz zum Spuken, dort neben dem geschnitzten Pfosten der Treppe, von wo aus er seine Nachfolger beobachten würde, wenn sie hinauf- und hinunterrannten, und sie verspottete, unsichtbar und lautlos. Wenn man erst einmal tot war, so vermutete Andrew, hatte man nicht mehr allzu viele Möglichkeiten. Man musste daraus machen, was man konnte.
Andrew stand achtzehn Monate vor seinem fünfzigsten Geburtstag. Die große Fünf-Null rückte unbehaglich näher. Es deprimierte ihn weniger, als dass es ihn mürrisch machte. Er fürchtete, dass er anfing, die verschrobenen alten Leute zu verstehen, die ununterbrochen über die moderne Jugend schimpften. In Wirklichkeit schimpften sie natürlich darüber, dass sie selbst nicht länger jung waren. War es nicht George Bernard Shaw gewesen, der gestöhnt hatte, dass Jugend bei den Jungen verschwendet war? Würde zu ihm gepasst haben, dachte Andrew. Doch wer auch immer sich so einen Bart wachsen ließ und in Knickerbockers herumlief, hatte sich bestimmt längst von allen jugendlichen Geschmäckern abgewandt.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!