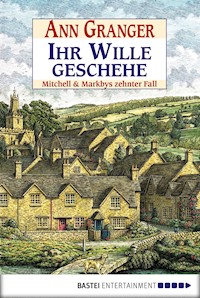7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Krimi
- Serie: Mitchell & Markby Krimi
- Sprache: Deutsch
Der verkrümmte Leichnam einer Siam-Katze und die des dazugehörigen Besitzers: Das ist Meredith Mitchells erster Eindruck von dem kleinen Städtchen Westerfield, wo sie eigentlich nur an der Hochzeit ihrer Nichte teilnehmen wollte. Nun aber wird sie in einen komplizierten Mordfall verwickelt und beginnt auf eigene Faust zu ermitteln - sehr zum Missfallen von Inspektor Markby, der sich nicht nur beruflich für Meredith interessiert ... "Mord ist aller Laster Anfang" ist der Auftakt einer Reihe von Kriminalromanen im klassisch englischen Stil um das liebenswerte Detektivpaar Meredith Mitchell und Alan Markby.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 393
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Über die Autorin
Ann Granger war früher im diplomatischen Dienst tätig. Sie hat zwei Söhne und lebt heute mit ihrem Mann in der Nähe von Oxford. Bestsellerruhm erlangte sie mit der Mitchell-und-Markby-Reihe und den Fran-Varady-Krimis. Nach Ausflügen ins viktorianische England mit den Lizzie-Martin-Romanen, knüpft sie mit der Serie um Inspector Jessica Campbell wieder unmittelbar an die Mitchell-und-Markby-Reihe an.
ANN GRANGER
MORD IST ALLER LASTER ANFANG
Ein Mitchell & Markby Roman
Ins Deutsche übertragen von Edith Walter
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Copyright © 1991 by Ann Hulme
Titel der amerikanischen Originalausgabe:»Say it with Poison«
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 1999/2010 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Stefan Bauer
Titelillustration: David Hopkins
Umschlaggestaltung: QuadroGrafik, Bensberg
E-Book-Produktion: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN 978-3-8387-0605-4
Sie finden uns im Internet unter
www.luebbe.de
Bitte beachten Sie auch: www.lesejury.de
Für John
KAPITEL 1
Der Lift ging schon wieder nicht. Meredith Mitchell starrte ihn wütend an – sie war müde nach einem anstrengenden Tag, zerknittert von der Heimfahrt in einer überfüllten Straßenbahn und staubig von dem Gang durch die sonnigen Straßen. Daß der Lift nicht funktionierte, war weder neu noch überraschend. Er war ein Museumsstück mit reich verzierten Gitterstäben und sah aus wie ein Affenhaus im Privatzoo eines viktorianischen Sammlers. Die Gitterstäbe liefen an der Spitze in metallene Laubverzierungen aus, die stolz zur Schau gestellte Fördervorrichtung mit Tragseil, Steuerseil und Führungsschiene glich einem der technischen Geräte aus dem »Jahrbuch für Jungen«. An einem der metallenen Akanthusstiele war eine Metalltafel befestigt, auf der eine Inschrift auf deutsch verkündete, daß dieser Lift in der Blütezeit der österreichisch-ungarischen Monarchie eingebaut worden war. Irgendein Witzbold hatte, vermutlich von einer Reise nach Wien, eine Ansichtskarte mit dem Porträt von Kaiser Franz Josef mitgebracht und in die Liftkabine geklebt. Dort blieb sie hängen und wurde von dem betagten ungarischen Hausmeister mit jener Ehrfurcht behandelt, die normalerweise Heiligenbildern vorbehalten bleibt. Meredith schnitt dem schnurrbärtigen alten Kaiser in dem blauen Militärmantel mit Messingknöpfen eine Grimasse. Heute hatten Seine Kaiserliche Hoheit den Lift ganz für sich allein.
Sie nahm ihre Aktenmappe auf und begann die sanft geschwungene steinerne Treppe zu erklimmen, wobei sie sich müde am Treppengeländer abstützte. Obwohl überall die Farbe abblätterte, unter der Decke Spinnweben hingen und man den Eindruck hatte, daß das ganze Gemäuer allmählich zu Staub zerfiel, besaß der Wohnblock noch etwas von der Eleganz des Fin de siècle: Die Treppe, über die Meredith sich jetzt zur dritten Etage hochschleppte, war breit genug für Krinolinen. Aber die Heizung arbeitete nur selten richtig, die Installationen waren abenteuerlich, im Keller gab es Ratten, und manchmal nahm eine von ihnen die falsche Abzweigung und verirrte sich in eines der oberen Stockwerke. Meredith hatte einmal spät abends die Wohnung verlassen und auf der Türschwelle eine Ratte gefunden, die sich den Bart putzte. Dennoch liebte sie das Haus und beneidete die anderen Konsulatsangestellten nicht um ihre moderneren Wohnungen in den seelenlosen Betonbauten draußen in der Wildnis der neuen Vorstädte. Es rückte die Dinge in die richtige Perspektive; es blinzelte dem Besucher verschwörerisch und ein bißchen durchtrieben zu wie ein welker alter Beau, der noch nicht allen Schneid verloren hat. Die Zeit sorgt schließlich immer auf die eine oder andere Weise dafür, daß unsere Ambitionen nicht in den Himmel wachsen.
Endlich stand sie vor ihrer Tür – ein wenig außer Atem und ins Schwitzen geraten in dem stickigen Treppenhaus. Marija, die Putzfrau, war heute hiergewesen und hatte den Messingbriefkasten, auf dem noch in verblaßter gotischer Schrift das deutsche Wort »Briefe« stand, auf Hochglanz poliert. Natürlich machte sich heute kein Postbote mehr die Mühe, seine Tasche mit den Briefen hier heraufzuschleppen. Er warf die Post in die numerierten Metallkästen, die unten in der Vorhalle an der Wand hingen. Das heißt, die Post der anderen Leute. Merediths private Post, sofern sie welche erhielt, kam in einem Leinensack zusammen mit der Diplomatenpost, die regelmäßig vom Kurierdienst zugestellt wurde. Tatsächlich aber kam es nur selten vor, daß sie überhaupt private Briefe erhielt.
Die Leute daheim vergessen einen zwar nicht, wenn man mehrere Jahre im Ausland gearbeitet hat, aber die Verbindung aufrechtzuerhalten wird immer schwieriger. Das zumindest sagte sich Meredith. Die Lebenswege verlaufen in unterschiedlichen Richtungen, und wenn man immer weniger gemeinsam hat, verliert man sich schließlich aus den Augen. Merediths Eltern lebten nicht mehr, und sie hatte weder Bruder noch Schwester. Sie korrespondierte, mit zeitweiligen Unterbrechungen, mit zwei alten Schulfreundinnen – eine von ihnen hatte letzte Weihnachten keinen Brief geschrieben, nur eine Karte geschickt, und zum nächsten Weihnachtsfest würde wahrscheinlich auch die ausbleiben –, aber beide waren verheiratet, hatten sich um eine immer größer werdende Kinderschar zu kümmern und nahmen ganz richtig an, daß Meredith an einer minutiösen Schilderung ihres Familienalltags nicht interessiert sein würde. Ihre einzige nahe Verwandte, eine Cousine, war zugleich die einzige, die nicht unter diese Kategorie fiel. Eve Owens führte ein abwechslungsreiches Leben, in dem die häuslichen Dinge stets eine geringere Rolle spielten als die Ereignisse in dem Bereich, den sie »das Busineß« nannte. Sie beide schafften es, in Verbindung zu bleiben. Gerade noch. Ob es gut war, war eine andere Sache.
Heute war ein Brief eingetroffen, der Meredith mit Freude, aber auch mit Unbehagen erfüllte. Neuigkeiten von Eve zu erfahren brachte sie immer etwas durcheinander. Sie rührten alte, halb versunkene Erinnerungen wieder auf, die man am besten ruhen lassen sollte. Toby Smythe, der Vizekonsul, der die private Post immer als erster durchsah, hatte ihn mit einem bedeutsamen »Hier, der ist offenbar für Sie!« zu Meredith hineingebracht, was daran lag, daß Eve unbedacht ihren Namen und ihre Adresse auf die Rückseite des Couverts geschrieben und Toby beides gelesen hatte. Neugierige Fragen brannten ihm auf den Lippen, doch der stählerne Blick aus Merediths Augen hinderte ihn daran, sie zu stellen – vorläufig. Sie hatte den Brief mit einem knappen »danke« entgegengenommen und ihn auch nicht geöffnet, nachdem Toby sich widerwillig verzogen hatte. Sie legte ihn auf ihren Schreibtisch und betrachtete ihn eine Weile, bevor sie ihn, noch immer ungeöffnet, hastig in die Tasche stopfte. Als sie jetzt nach ihrem Schlüssel suchte, brachte sich der Brief, als ihre Finger ein knisterndes, steifes Etwas streiften, wieder in Erinnerung.
»Du wartest noch ein bißchen«, sagte Meredith lautlos zu dem Brief. Sie schloß auf und betrat die Wohnung. Marija war selbst nicht mehr da, hatte aber den Geruch von Bohnerwachs zurückgelassen. Meredith ließ die Tasche fallen, hängte den Mantel auf und ging in die Küche, um den Kessel aufzusetzen. Wie für Wohnungen aus dieser Epoche typisch, war jeder der Wohnräume riesig, die Küche hingegen eine winzige Kombüse mit Marmorfußboden, wo die Köchin, kaum imstande, sich umzudrehen, geschwitzt hatte, während die Familie in dem weiträumigen Salon saß und sich von einem Ende zum anderen nur schreiend verständigen konnte. Meredith ließ sich Zeit, trödelte herum und strich sich ein Erdnußbuttersandwich, das sie gar nicht wollte. Endlich trug sie Brief, Tee und Sandwich in das geräumige Wohnzimmer und stellte das Tablett auf ein modernes, protziges hölzernes Möbelstück, das den offiziellen Stellen wohl als angemessene Investition erschienen war. Der Augenblick, den sie so lange hinausgeschoben hatte, war da. Sie setzte sich in den letzten Glanz der Abendsonne, musterte den glatten elfenbeinfarbenen Umschlag mit einem mißtrauischen Blick und machte ihn auf.
Kein Wunder, daß er so steif war. Er enthielt einen Brief und eine Karte. Die Karte war, wie sich bald herausstellte, eine geschmackvoll gravierte Hochzeitseinladung. Einen Moment dachte Meredith, Eve wolle sich kopfüber in die vierte Ehe stürzen, doch bei einem schnellen Überfliegen der Karte sah sie, daß Sara, Eves Tochter und Merediths Patenkind, die Braut war.
Von neuem rief ihr aufwallendes schlechtes Gewissen die ferne Erinnerung an eine kalte Kirche und ein wimmerndes Baby in ihr wach. Vor ihrem inneren Auge erschien Eve, jung, hübsch und auf eine bezaubernde Weise mütterlich. Neben ihr stand Mike, der stolze Vater – er war ja so stolz auf seine winzige Tochter gewesen. Es hatte, außer Meredith, noch zwei weitere Paten gegeben, doch ihre Namen hatte sie vergessen. Sie war eine sehr junge Patin gewesen, und das Ereignis hatte schwer auf ihren Schultern gelastet. Sie hatte eine furchtbare Verantwortung gespürt. Und das Gefühl einer Schuld hatte an ihr gezehrt – einer Schuld, die sie dazu trieb, Eve, die sie in Wirklichkeit doch sehr liebte, hassen zu wollen. Sie war in jenem ganz besonderen Fegefeuer der Jugend gefangen, in Gefühle verstrickt, die sie erschreckten, die sie nicht verstand, die sie gleichzeitig himmelhochjauchzend und zu Tode betrübt machten. Sie hatten ein bezauberndes, nach außen hin harmonisches Trio abgegeben, die hübsche Ehefrau und Mutter, ein schönes Baby und der stolze junge Vater und Ehemann. Meredith hatte ihnen direkt gegenübergestanden, an eine Säule gedrückt, sich hinter dem hohen gemeißelten Taufbecken aus Stein verbergend, sie hatte sterben, in die holprigen Steinplatten versinken wollen, die den Fußboden der uralten Kirche bildeten, sie wäre am liebsten direkt hinabgesunken in die darunterliegende Krypta, um sich dort den Toten zuzugesellen, die aller fleischlichen Pein entronnen waren. Damals hatte sie geglaubt, der schlechteste Mensch auf Erden zu sein.
Der Vikar stellte den Paten die übliche Frage: »Wollt ihr, im Namen dieses Kindes, dem Teufel und all seinen Werken widersagen, dem eitlen Pomp und falschen Glanz dieser Welt mit all ihren Begierden und den Begierden des Fleisches, auf daß ihr ihnen weder folgen noch euch von ihnen leiten lassen werdet?« Obwohl sie sich noch so sehr anstrengte, es zu verhindern, war ihr Blick in die Höhe gezogen worden, sie war, über das Taufbecken hinweg, Mikes Augen begegnet und hatte das Gefühl gehabt, daß alles, was in ihrem Herzen war, ihr jetzt wie ein Brandzeichen auf der Stirn stehen mußte, so daß alle es lesen konnten.
»Antworte!« hatte sie der Vikar unwirsch aufgefordert.
Undeutlich hatte sie gemurmelt: »Ich widersage« und konnte bis zum heutigen Tag nicht verstehen, warum nicht sofort ein Blitzstrahl sie getroffen und getötet hatte, dort, auf den abgetretenen Steinplatten. Sogar jetzt, mit Eves Brief und Karte in der Hand, war ihr, als könne sie das Kerzenwachs riechen und die erdige Feuchte, die in alten Steinen sitzt, und den Staub in den Betkissen. Sie hörte im Geist das Wasser spritzen, das weitärmelige Chorhemd des Priesters rascheln und das überraschte, leise Piepsen des Kindes in seiner Armbeuge.
Zuweilen, sagte Meredith sich später, wächst man aus der jugendlichen Verwirrung heraus, manchmal aber reift sie zu einer Verwirrung heran, die noch im Erwachsensein Bestand hat, und man kann sich ihr nur entziehen, indem man flieht. Einen anderen Ausweg gibt es nicht. Zu gegebener Zeit nahm Meredith ihr Wanderleben auf. Von Posten zu Posten, von Land zu Land. Jetzt war sie hier, britische Konsulin, fünfunddreißig Jahre alt und sehr gut in ihrem Job. Meredith, so sagten alle, ist eine Karrierefrau. Aber sie war auch ein Flüchtling.
Das Schicksal hat jedoch die häßliche Unart, sich an unsere Rockschöße zu hängen. Jetzt war der wimmernde Säugling zur Frau herangewachsen und wollte heiraten. Das boshafte Schicksal mußte auf diesen Tag gewartet haben und führte jetzt, während es Meredith mit einem höhnischen Grinsen beim Lesen der Karte zusah, in der Ecke des Wohnzimmers einen gespenstischen kleinen triumphalen Tanz auf. Und es war, unleugbar, ein ziemlicher Schock, so plötzlich festzustellen, wie schnell die Jahre verflogen waren.
»Mann«, murmelte Meredith, »wie alt ist sie eigentlich?« Sie zählte schnell mit den Fingern nach. Neunzehn. »Verdammt, ich hab ihr zum Achtzehnten kein Geburtstagsgeschenk geschickt. Wann feiert man jetzt seine Großjährigkeit? Mit achtzehn oder einundzwanzig? Ich werde ihr etwas unglaublich Tolles zur Hochzeit schenken müssen. Wen um alles in der Welt heiratet sie überhaupt?«
Eine genauere Inspektion der Karte enthüllte, daß es sich um einen gewissen Jonathan Lazenby handelte. Wegen des Hochzeitsgeschenks würde sie sich von Eve beraten lassen müssen. Das letzte, was sie ihrer Erinnerung nach ihrem Patenkind geschickt hatte, war ein Kinderbuch gewesen. Sie begann den Brief zu lesen.
Du wirst doch versuchen zu kommen, nicht wahr, Merry? Eves ausladende Handschrift schwankte, mal nach links, mal nach rechts kippend, über die Seite, fiel hin und wieder sogar über den Rand und ließ dann Worte auf eine kuriose Weise unvollendet. Wir sind eine so kleine Familie. Wir haben überhaupt keine richtigen Verwandten, und die Lazenbys werden vermutlich in Armeestärke auftreten. Es wird eine ganz bescheidene Hochzeit, nur Familie, weißt du, und es wäre Sara peinlich, wenn unsere Seite der Kirche leer bliebe. Sie heiratet in unserer kleinen Dorfkirche, die praktisch nicht mehr benutzt wird und eigens geöffnet werden muß. Ich hoffe sehr, es riecht nicht muffig nach feuchten Kniekissen. Die Kirche hat hübsche bunte Glasfenster und wird sich auf den Hochzeitsfotos bestimmt gut machen. Zu Mikes Familie habe ich den Kontakt völlig verloren. Ich hätte ihn wohl aufrechterhalten sollen, nehme ich an, um Saras willen, aber so, wie die Dinge endeten, habe ich es nicht getan. BITTE KOMM AUF JEDEN FALL!
»So, wie die Dinge endeten«, wiederholte Meredith. Den Brief in der Hand, blieb sie ein paar Minuten in einer still gewordenen Welt sitzen. Eine Schmeißfliege, die gegen die Fensterscheibe stieß, holte sie in die Gegenwart zurück. Die Fliege lag auf dem Rücken und surrte völlig sinnlos mit den Flügeln. Meredith stand auf, schaufelte sie auf Eves Brief und beförderte sie aus dem Fenster. Ein Schwall warmer Spätnachmittagsluft wehte herein und brachte das Geräusch der Straßenbahnen mit, die einen Block entfernt vorüberklirrten. Plötzlich überkam sie eine überwältigende Sehnsucht nach England und nach einem Heim, das sie nicht auf dem Rücken mit sich trug wie eine Schnecke: die unbestimmte, verlockende Ahnung einer Welt mit Doppeldeckerbussen, Chintzbezügen, Sommerregen, der gegen Fensterscheiben prasselte, und getoasteten Teekuchen.
Warum sollte sie die Einladung nicht annehmen? Ihr stand noch jede Menge Urlaub zu, und sie brauchte eine Ruhepause. Es wäre schön, mit dabeizusein, wenn Mikes Tochter heiratete. Mike hätte es auch gefallen. Allerdings – wie würde es möglich sein für sie, in der Kirche zu stehen und nicht an jenen anderen Gottesdienst zu denken, an die Fragen und Anworten? Wie sollte sie dann nicht an Mike denken? Denn sie tat es noch immer, öfter, als gut für sie war, und ganz gewiß auch öfter, als es Sinn hatte. Sie schob die Einladung in das Couvert zurück. Die Entscheidung konnte warten. Nicht sehr lange zwar, denn der Hochzeitstermin war nicht mehr allzu weit entfernt, aber gewiß noch eine Woche, bis sie ihre Antwort dem nächsten für England bestimmten Postsack anvertrauen konnte. Es war ein langer Tag gewesen heute, sie fühlte sich unbehaglich und staubig, und ihre eigene Unentschlossenheit lastete zusammen mit einer Vielfalt anderer unbewältigter Gefühle auf ihr. Sie ging ins Bad und drehte die Hähne auf, um alles gründlich von sich abzuwaschen.
»Ich mag keine Hochzeiten«, sagte Alan Markby energisch. Er spähte zu einem Hängekorb hinauf. »Die Hitze schadet diesem Ding. Ich nehme es lieber weg.«
»Bißchen spät«, sagte sein Schwager Paul und wendete die Steaks auf dem Grill. »Ich fürchte, die Lobelie ist inzwischen gut geräuchert. Bleibt weg von hier, Kinder.«
Markbys Schwester Laura stand aus einem Liegestuhl auf, dehnte und streckte sich und dirigierte ihre Brut in eine Ecke, wo sie sich mit Coladosen niederließ und zudem, wie Markby resigniert feststellte, mit scheußlichen roten Eislutschern, die schneller zu tropfen begannen, als die kleinen Münder sie verspeisen konnten, und die Steinplatten seines Patios mit häßlichen scharlachroten Flecken sprenkelten. Er fragte sich, warum er sie eigentlich eingeladen hatte, damit sie ihm nun seinen Sonntagnachmittag verdarben. Schlechtes Gewissen, dachte er.
Laura, hinter einer riesengroßen Sonnenbrille versteckt, wandte ihr Gesicht der Sonne zu. Sie hatte einen hellen Teint, und ihr blondes Haar verwandelte sich, je weiter der englische Sommer fortschritt, in skandinavisches Weißblond. Sie war mittlerweile gut gebräunt und stellte lange, wohlgeformte Beine zur Schau. Markby dachte in einem Anflug von Humor: Ich habe noch nie jemanden gesehen, der weniger nach einer erfolgreichen Anwältin aus einer hochangesehenen, alteingesessenen Anwaltskanzlei ausgesehen hätte.
»Es ist soweit!« verkündete Paul. »Steaks für uns, Hamburger für die Kinder, Würstchen für alle, die welche haben wollen.«
Während sie aßen, kamen sie wieder auf die Hochzeitseinladung zu sprechen, die in Markbys Küche mit Reißzwecken an die Tür der Speisekammer geheftet war.
»Es ist doch schmeichelhaft, wenn man gebeten wird, den Brautführer zu machen«, bot Laura ihre ganze Überredungskunst auf. »Besonders wenn es sich bei der Brautmutter um die berühmte Eve Owens handelt.«
»Es ist nur schmeichelhaft, wenn man ein alter Freund der Familie ist. Ich kannte Robert Freeman eher flüchtig. Ich habe mit ihm Golf gespielt und einige Male ein Glas mit ihm getrunken. Aber er war gar nicht Saras Vater, nur Stiefvater Nummer zwei, und er ist vor anderthalb Jahren gestorben. Sara selbst habe ich zwei- oder vielleicht dreimal gesehen. Sie kleidet sich wie eine Außerirdische, hüpft herum wie ein ungezogenes Hündchen und rettet Wale. Eve Owens bin ich auch nicht viel öfter begegnet, und ich bin wahrlich kein Fan ihrer Filme. Das letzte Mal, daß ich sie gesehen habe, war bei der Beerdigung des armen alten Bob Freeman. Sie sah in Schwarz einfach umwerfend aus und war von Fotografen umringt. Ich will nicht behaupten, sie habe nicht richtig getrauert, aber als sie eine einzelne rote Rose ins Grab warf, ging ein wahres Blitzlichtgewitter los. Die ganze Sache war einfach grotesk, und bei dieser Hochzeit wird es nicht anders sein. Paparazzi werden sich um die besten Plätze streiten, um die berühmte Brautmutter zu knipsen, und euer Ergebener wird im Zylinder dabeistehen und sich alle Mühe geben, so auszusehen, als wisse er, was er dort soll.« Markby blickte mit gequälter Miene von seinem Steak auf. »Lieber Gott, sie werden mich womöglich noch als ›Eve Owens neuesten ständigen Begleiter‹ titulieren.«
»Du hast aber auch ein Glück!«
»Gibst du mir ein bißchen Zeitungspapier, das ich den Kindern unterlegen kann, Alan?« fragte Paul freundlich. »Sie machen hier eine ziemliche Schweinerei in deinem Patio.«
»Um Himmels willen, das sieht ja tatsächlich so aus, als hätten sie ein Schwein geschlachtet. Der Dingsda hat seinen Hamburger fallen lassen – da bleibt bestimmt ein Fettfleck zurück.«
»Er heißt Matthew! Du solltest wirklich den Namen deines Neffen kennen, Alan.«
Man kam für eine Weile vom Thema ab, während die Kinder regelrecht in Zeitungspapier gewickelt wurden, freilich zu spät, um den Schaden noch zu verhindern.
»Du kannst dich nicht weigern, den Brautführer zu machen, Alan. Es wäre mehr als unhöflich.«
»Ich mag keine Hochzeiten, habe Hochzeiten noch nie gemocht. Mir hat schon meine eigene nicht gefallen, und das war ein böses Omen – wenn es je eins gegeben hat, dann dieses.«
»Du solltest wieder heiraten. Du bist jetzt zweiundvierzig. Du solltest eine Familie haben.«
»Nein, danke«, sagte Markby und betrachtete mürrisch das in seine Steinfliesen einsickernde Fett. »Was die Ehe anbelangt, hat mir einmal gereicht. Matthew, hör auf, die Fuchsienblüten platzen zu lassen, sei so lieb.«
»Sie gehen dadurch auf.«
»Sie gehen von selbst auf, vielen Dank. Kann ich dieses Hochzeitsdingsbums wirklich nicht ablehnen? Warum hat sie nur mich darum gebeten? Sie rief mich an und behauptete, Robert hätte es gern gesehen. Absoluter Quatsch. Er hätte nicht einmal daran gedacht.«
»Wenn er noch lebte, hätte er nicht daran denken müssen. Er wäre selbst der Brautführer seiner Stieftochter gewesen.«
Markby kapitulierte. »Nun gut, ich tu’s. Aber es ist ein Fehler, ich spür’s in allen Knochen.«
»Mum, Vicky hat alle roten und lilafarbenen Blumen gepflückt …«
KAPITEL 2
Meredith hatte sich ihre Cousine nie als Landpomeranze vorgestellt. Es paßte einfach nicht zu ihr, sich fern von ihren Freunden und Berufskollegen zu vergraben. Als Meredith vor der alten Pfarrei, Eves derzeitigem Zuhause, vorfuhr und den Motor abstellte, fragte sie sich, ob es wohl die Idee von Robert Freeman, Eves letztem Ehemann, gewesen war, dieses reizvolle, wenn auch schon ein bißchen heruntergekommene gelbe Backsteingebäude inmitten einer ländlichen Kulisse an der Grenze von Oxfordshire und Northamptonshire zu erstehen.
Das Dorf hieß Westerfield, das zumindest verkündete ein teilweise schon in den Boden eingesunkenes, hinter hohem Gras halb verborgenes Schild dem sich nähernden Reisenden. Es lag etwa sechs Meilen von dem Marktstädtchen Bamford entfernt, und um es auf der Generalstabskarte zu finden, mußte man mit zusammengekniffenen Augen schon sehr genau die winzige Druckschrift studieren, ehe man den Namen entdeckte. Dicht daneben stand ein Symbol und die lakonische Anmerkung »Ausgrabungen«. Was es mit diesen Ausgrabungen auf sich hatte, wußte nur der liebe Gott; nirgends gab es, soweit sie bis jetzt gesehen hatte, handfeste Hinweise darauf, wo diese historischen Raritäten zu finden waren. Vermutlich handelte es sich lediglich um einige Buckel im Feld irgendeines Bauern, die auf Befestigungen aus der Bronzezeit schließen ließen. In Westerfield war der Boden schon lange von menschlicher Hand bearbeitet worden.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!