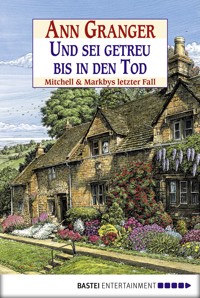
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Krimi
- Serie: Mitchell & Markby Krimi
- Sprache: Deutsch
Meredith Mitchell und Alan Markby planen ihre Hochzeit und haben eigentlich genug zu tun. Der Besuch von Toby Smythe, einem alten Freund von Meredith, wird daher mit gemischten Gefühlen aufgenommen, zumal Toby die beiden um professionelle Hilfe bittet: Alison Jenner, eine Verwandte von ihm, wird erpresst. Vor 25 Jahren stand sie wegen Mordverdachts an ihrer Tante Freda vor Gericht, wurde jedoch freigesprochen. Offensichtlich will jemand die Vergangenheit nicht ruhen lassen. Doch wer ist der anonyme Erpresser? Und welches Geheimnis glaubt er zu kennen? Meredith und Alan beginnen nur widerwillig zu ermitteln - und stoßen in ein Wespennest, was ihre Hochzeit auf mehr als nur eine Art gefährdet ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 496
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Über die Autorin
Ann Granger war früher im diplomatischen Dienst tätig. Sie hat zwei Söhne und lebt heute mit ihrem Mann in der Nähe von Oxford. Bestsellerruhm erlangte sie mit der Mitchell-und-Markby-Reihe und den Fran-Varady-Krimis. Nach Ausflügen ins viktorianische England mit den Lizzie-Martin-Romanen, knüpft sie mit der Serie um Inspector Jessica Campbell wieder unmittelbar an die Mitchell-und-Markby-Reihe an.
ANN GRANGER
UND SEI GETREU BIS IN DEN TOD
Mitchell & Markbys letzter Fall
Ins Deutsche übertragen von Axel Merz
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Titel der englischen Originalausgabe: »That Way Murder Lies«
© 2004 by Ann Granger
Für die deutschsprachige Ausgabe
© für die deutschsprachige Ausgabe 2004/2011 byBastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Gerhard Arth/Stefan Bauer
Umschlaggestaltung: Bianca Sebastian
Titelillustration: David Hopkins/Phosphorat
Datenkonvertierung E-Book:
hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-8387-0891-1
Sie finden uns im Internet unterwww.luebbe.deBitte beachten Sie auch: www.lesejury.de
All jenen Lesern gewidmet,die Mitchell und Markby über die Jahre gefolgt sind.
KAPITEL 1
Die drei Umschläge lagen auf der Fußmatte unmittelbar hinter der Haustür. Der Postbote hatte sie mit der Sorglosigkeit eines Mannes durch den Briefkastenschlitz gestoßen, der keine Vorstellung hatte von den sich daraus ergebenden Konsequenzen. Er fuhr davon, und Kies wurde von den Reifen aufgewirbelt. Betsy, die alte schwarze Labradorhündin, schob die frische Post mit der Nase vor sich her und beschnüffelte sie misstrauisch. Als Alison langsam durch den Flur herankam, blickte die Hündin sie fragend an, mit besorgt erhobenen Augenbrauen, leisem Winseln und unsicherem Schwanzwedeln, alles zur gleichen Zeit.
Sie weiß es, dachte Alison. Sie spürt, dass etwas nicht stimmt und dass es mit der Post zu tun haben muss, auch wenn sie nicht wissen kann, was es ist. Man kann Menschen etwas vormachen, aber niemals einem Hund.
Sie ließ die Hand sinken und tätschelte den Kopf des alten Tiers. »Keine Sorge, Betsy. Alles ist in Ordnung.«
Betsy wedelte energischer mit dem Schwanz, halb beruhigt, und stieß den Kopf gegen Alisons Knie, als diese sich zu den Umschlägen hinunterbeugte. Einer davon war länglich, braun und sah offiziell aus. Jeremy konnte sich um die Probleme kümmern, die sich daraus ergeben mochten. Der zweite Umschlag sah aus, als stammte er von einer Kreditkartengesellschaft. Auch darin würden sich nur gewöhnliche Alltagsprobleme finden. Der dritte Umschlag jedoch war kleiner, weiß und quadratisch, und die gedruckte Anschrift lautete Mrs Alison Jenner. Alisons Herz stockte kurz und schien dann wie ein Stein in ihren Magen zu fallen. Ein kurzes Schwindelgefühl bemächtigte sich ihrer, ihre Knie gaben nach, und sie sank zu Boden und setzte sich neben Betsy, die Beine untereinander geschlagen wie zu einer plötzlichen Yoga-Meditationsübung. Einen Moment lang saß sie einfach nur da, die Augen starr auf den Umschlag gerichtet, bis die Hündin ihre feuchte Nase in Alisons Ohr drückte, gefolgt von einem zaghaften Lecken.
Es riss Alison aus ihrer Benommenheit, doch die beißende, schmerzhafte Bestürztheit war immer noch da. Genau wie der Umschlag. Noch einer, dachte sie. Bitte nicht! Doch es war einer, es war einer, noch so einer …
Für einen Augenblick verwandelte sich die Bestürzung in Empörung, in Zorn gegen den Schreiber. »Wie kannst du es wagen, mir das anzutun!«, rief sie laut in die Stille ihres Hauses hinein. Betsy neigte den Kopf und legte die pelzige Stirn erneut in besorgte Falten. »Du hast kein Recht, das zu tun!«, rief Alison, und die Worte hallten um sie herum.
Die Vergeblichkeit ihrer Empörung wurde ihr bewusst. Übelkeit stieg in ihr auf, füllte ihren Mund mit saurer, beißender Galle, die in ihrer Kehle brannte und faulig schmeckte. Sie schluckte ihre Wut herunter und sammelte die Umschläge auf. Dann erhob sie sich und ging, gefolgt von der alten Hündin, mit den Briefen ins Esszimmer. So laut und wütend zu schreien war noch mehr als nutzlos, es war gefährlich. Mrs Whittle könnte sie hören.
Das Zimmer war kühl und relativ dunkel. Die Sonne kam erst am Nachmittag zu dieser Seite des Hauses. Der Esstisch aus poliertem Eichenholz war bereits abgeräumt. Sie frühstückten nicht mehr so ausgiebig in diesen Tagen, Alison und Jeremy, lediglich Toast und einen Becher Kaffee. Der Tisch war eine von Jeremys Antiquitäten, vor langer Zeit erstanden, lange bevor Alison ihn kennen gelernt hatte. Seine dunkle Oberfläche mit den uralten Kratzern und Schrammen hatte wahrscheinlich mehr als eine Krise erlebt. Es war erschreckend, dachte Alison, wie unbelebte Objekte so viel überleben konnten, unter dem menschliche Wesen einfach zerbrachen. Sie warf die beiden länglichen Umschläge auf den Tisch und richtete ihre Aufmerksamkeit erneut auf den quadratischen weißen in ihren Fingern. Wenigstens war Jeremy nicht zu Hause. Er war mit dem Wagen nach Bamford gefahren, um ein paar Besorgungen zu machen. Er wusste nichts von den Briefen, und er durfte es auch niemals erfahren. Er würde etwas dagegen unternehmen wollen, und was auch immer es war, es würde die Sache verschlimmern. Alison riss den Umschlag auf und nahm das einzelne gefaltete Blatt hervor, das er enthielt. Die hasserfüllten Worte waren ihr inzwischen seltsam vertraut. Sie variierten selten, meist in nicht mehr als einem oder zwei Sätzen. Obwohl es nur wenige waren, erzeugten sie in Alison unermesslichen Schmerz und namenlose Angst.
DUHASTSIEUMGEBRACHT. DUHASTFREDAKEMPUMGEBRACHT. DUHASTWOHLGEGLAUBT, DUWÄRSTDAVONGEKOMMEN, ABERICHWEISSES, UNDBALDWIRDESJEDERWISSEN. DUWIRSTBEKOMMEN, WASDUVERDIENST. DUWIRSTDAFÜRBÜSSEN.
»Warum tust du mir das an?«, flüsterte Alison jetzt. »Hasst du mich so sehr? Wenn ja, warum? Was habe ich dir getan? Wer bist du? Kenne ich dich? Bist du jemand, den ich für einen Freund halte, den ich regelmäßig sehe, mit dem ich mich unterhalte und scherze, mit dem ich zusammen esse? Oder bist du ein Fremder?«
Viel, viel besser, wenn ein Fremder dieses Gift verspritzte. Der Verrat durch einen Freund, der Gedanke, dass jemand, dem sie vertraute, ihr so etwas antun könnte, war so schmerzhaft, dass Alison zu begreifen meinte, was den Verrat des Judas so besonders schlimm gemacht hatte. Er war der Freund, der mit dem Verratenen zusammen am Tisch gesessen hatte. Alison konnte sich vorstellen, wie groß der Schmerz angesichts dieses Verrats gewesen sein musste. War der Schreiber dieser Briefe genauso ein lächelnder falscher Freund?
Eine weitere Frage brannte in ihren Gedanken. »Woher weißt du von alledem?«, fragte sie den unbekannten Schreiber. »Niemand in dieser Gegend hier weiß davon. Es liegt alles mehr als fünfundzwanzig Jahre zurück und hat sich viele Meilen von hier zugetragen. Hat dir jemand davon erzählt? Wer war es, und woher weiß er davon? Oder hast du einen Artikel in einer vergilbten Zeitung gelesen, mit der jemand eine Schublade ausgeschlagen hat? Ich war damals dreiundzwanzig Jahre alt! Ich bin, ich war damals unschuldig! Und jetzt kommst du daher und willst, dass ich für etwas bezahle, das ich nicht getan habe!«
Sie würde den Brief vernichten, wie sie die vorhergehenden vernichtet hatte. Doch ein weiterer würde kommen, und beim nächsten Mal war Jeremy vielleicht vor ihr da. Er würde den Brief nicht öffnen, nicht, wenn er an sie persönlich adressiert war. Doch er würde wahrscheinlich fragen, von wem er wäre, und dann würde sie ihn anlügen müssen. Sie wollte ihn nicht belügen. Bis jetzt war es ihr gelungen, dies zu umgehen, und sie hatte einfallsreiche Wege gefunden, um vor ihm beim Briefkastenschlitz zu sein. Weil die Post dieser Tage von Mal zu Mal später zu kommen schien, verbrachte sie die halben Vormittage damit, nach dem Knirschen der Reifen des Postautos zu lauschen, nach dem fröhlichen Pfeifen des Fahrers und dem Klappern des Briefkastenschlitzes. Manchmal, wenn das Wetter schön war, benutzte sie Betsy als Vorwand, um nach draußen zu gehen und den Postboten abzufangen. Sie zerrte den unwilligen alten Hund die Straße hinauf und hinunter, bis der kleine rote Postwagen erschien und sie ihn aufhalten konnte. Doch das war nicht jeden Tag möglich, ohne dass der Postbote misstrauisch geworden wäre. Er war jung, und sie wusste, dass er ihr Verhalten bereits eigenartig fand. Sie konnte es an seinem nachdenklichen Gesichtsausdruck erkennen. Wahrscheinlich hatte er bereits all seinen Kollegen im Depot erzählt, dass die Frau vom Overvale House nicht mehr alle Tassen im Schrank hatte. Doch es war immer noch besser, wenn sich derartige Gerüchte verbreiteten, als wenn er irgendwann merkte, dass sie das Eintreffen der Post wegen irgendeiner darin enthaltenen Sendung fürchtete. Er war jung genug, um sich von seiner Neugier leiten zu lassen. Was möglicherweise dazu führte, dass die Existenz dieser Briefe bekannt wurde. Doch wie lange würde das noch weitergehen? Würde der Schreiber irgendwann des Katz-und-Maus-Spiels überdrüssig werden? Was würde er dann tun? Einfach mit den Briefen aufhören – oder seine Informationen publik machen, wie er es angedroht hatte?
Die Übelkeit kehrte zurück. Alison ließ den Brief auf den Tisch fallen, und die makellose Weißheit des Papiers stand in grellem Kontrast zu dem dunkel gewordenen Eichenholz. Sie rannte zur Toilette im Erdgeschoss und übergab sich heftig in die Kloschüssel, bis ihr Zwerchfell schmerzte. Hitze stieg brennend in ihr auf, und Schweiß brach ihr aus allen Poren. Sie spritzte sich kaltes Wasser ins Gesicht, um sich Linderung zu verschaffen, und wischte es mit einem Handtuch trocken. Sie schielte in den kleinen Spiegel und sah, dass ihre Haut zwar noch fleckig war, doch ansonsten sah sie einigermaßen normal aus – normal genug für Jeremy jedenfalls.
Jeremy! Sie hatte den Brief auf dem Esszimmertisch liegen lassen, und ihr Ehemann würde bald nach Hause zurückkehren! Alison rannte zurück ins Esszimmer.
Es war zu spät. Da ihr Kopf in der Kloschüssel gesteckt hatte, hatte sie seine Rückkehr nicht bemerkt. Jeremy stand am Tisch und hielt das kleine weiße Blatt in den Händen. Er blickte zu ihr, als sie eintrat.
»Wie lange geht das verdammt noch mal schon so?«
Es war Donnerstag. Gründonnerstag, um genau zu sein. Nach dem Mittagessen würde Meredith ihren Schreibtisch im Londoner Foreign Office aufräumen und für ein langes Osterwochenende nach Hause fahren, um erst am folgenden Dienstag wieder arbeiten zu gehen. Der Gedanke erweckte Hochstimmung in ihr. Das Wetter war die ganze Woche lang gut gewesen, und mit ein wenig Glück würde sich daran auch über die Feiertage nichts ändern. Sie würde Zeit finden, sich mit Alan zu entspannen, über das Haus zu reden, das sie kaufen wollten, und all die Dinge zu erledigen, die sie aufgeschoben hatte. Der Druck der Arbeit würde schwinden, und sie beide hatten die Pause nötig. Auf der anderen Seite des Raums packte Polly, mit der sie ihr geräumiges Büro teilte, bereits ihre Sachen zusammen. Meredith streckte die Hand nach dem Eingangskorb auf ihrem Schreibtisch aus, wo ein Sonnenstrahl auf eine einzelne dünne Akte fiel. Sobald sie diese bearbeitet hatte, konnte sie ebenfalls packen und wäre frei.
Der Sonnenstrahl erlosch abrupt. Jemand stand vor ihrem Schreibtisch. Meredith blickte auf.
»Toby!«, rief sie aus. »Woher um alles in der Welt kommst du denn diesmal wieder?«
»Peking«, antwortete Toby Smythe. »Ich hab gerade meine Dienstzeit dort beendet. Jetzt bin ich zu Hause und mache erst mal Urlaub, bevor sie mich wieder woanders hinschicken. Oder wenigstens hoffe ich, dass sie mich woanders hinschicken …« Seine Miene wurde ein wenig betrübt. »Ich hab mich heute Morgen um eine weitere Abordnung ins Ausland beworben. Ich will nicht für Ewigkeiten in London hinter einem Schreibtisch versauern wie du.«
Das war zwar nicht besonders höflich, doch es entsprach der Wahrheit. Meredith saß inzwischen seit einer ganzen Weile hinter ihrem Schreibtisch. Seit ihrer Rückkehr vor einer Reihe von Jahren aus der ehemaligen Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien genau genommen. Sie war dort Konsulin gewesen. Doch jetzt war sie nichts weiter als eine Sachbearbeiterin an einem Schreibtisch in diesem Raum. Das Jugoslawien, das sie gekannt hatte, war auseinander gefallen, und es schien ihr, als wäre ihre Karriere parallel dazu zum Stillstand gekommen. Trotz wiederholter Eingaben und Anfragen hatte man ihr keinen neuen längerfristigen Posten im Ausland angeboten, nichts außer einigen immer nur wenige Wochen dauernden Jobs als Ersatz für jemanden, der krank geworden war, oder als Verstärkung in einem Notfall. Zuerst war sie überzeugt gewesen, fest überzeugt, dass es irgendeinen geheimen Grund geben musste, warum sie in London festgehalten wurde, irgendeinen Grund, den sie niemals erfahren würde. Irgendwo war sie irgendjemandem auf die Füße getreten, oder sie hatte sich einen Ruf verschafft, der ihre Vorgesetzten unruhig machte. Doch nun hatten sich die Umstände geändert. Sie verspürte nicht länger das Bedürfnis, »aus dem Land zu flüchten«, wie Alan Markby ihr Verlangen, im Ausland zu arbeiten, stets zu beschreiben pflegte. Alan hatte nie gewollt, dass sie wegging. Sie lächelte vor sich hin bei dem Gedanken, dann hob sie den Blick und lächelte zu Toby auf.
»Es macht mir nichts aus, in London zu sein«, sagte sie. »Ich heirate im Sommer.«
Toby zuckte theatralisch zurück, beide Hände erhoben, die Handflächen nach außen gestreckt. »Doch nicht etwa den Kriminalbeamten, mit dem du schon seit einer Reihe von Jahren herumhängst?«
»Sein Name ist Alan«, sagte Meredith grob. »Und das weißt du ganz genau! Und ich habe nicht mit ihm ›herumgehangen‹, wie du es nennst!«
In der anderen Ecke des Büros lachte Polly auf. Meredith spürte, wie ihr Ärger verflog. Es war sinnlos, sich über irgendetwas aufzuregen, was Toby sagte oder tat. Toby war Toby, und die Osterferien standen vor der Tür, Herrgott noch mal.
»Dann hat es also keinen Sinn, wenn ich mir weiter Hoffnungen mache?«, fragte Toby. Er seufzte melodramatisch, und Polly kicherte.
»Du hattest noch nie einen Grund, dir Hoffnungen zu machen«, entgegnete Meredith. »Trotzdem, ich freue mich, dich zu sehen.«
»Ich konnte doch nicht ins Foreign Office kommen, ohne dich zu besuchen.« Toby stemmte die Hände auf den Schreibtisch und beugte sich vor. »Ich hatte überlegt, das heißt, falls du dich nicht nach Feierabend gleich in die Arme von Mister Recht und Ordnung wirfst, ob ich dich zum Mittagessen ausführen darf?«
»Nicht, wenn du ihn Mister Recht und Ordnung nennst!«
»’tschuldige. Komm schon, lass uns zusammen essen gehen. Ich verspreche, dass ich ihm keine respektlosen Namen mehr geben werde. Wir können uns unterhalten, über die alten Zeiten reden und …« Toby zögerte kurz. »Ich bin ziemlich froh, dass ihr noch zusammen seid, du und Markby. Weil ich nämlich ein Problem habe. Das heißt, nicht ich, sondern ein Freund von mir. Markby könnte ihm vielleicht einen Rat geben.«
Meredith schüttelte den Kopf. »Wenn dein Freund ein Problem mit dem Gesetz hat, dann sollte er sich vielleicht an einen Anwalt wenden. Alan ist keine Briefkastentante. Wenn es wirklich eine Polizeiangelegenheit ist, dann ist es noch einfacher. Dein Freund sollte zur nächsten Polizeistation gehen und dort mit jemandem reden. Alan kann sich nicht in fremde Zuständigkeitsbereiche einmischen. Wenn es eine Ermittlung wegen eines ernsten Verbrechens gibt, die außerhalb seines Gebiets stattfindet, dann muss er sich mit der lokalen Polizei arrangieren, aber das macht er bestimmt nicht wegen eines kleinen Problems, das ein Freund von einem Freund hat. Das weißt du ganz genau, Toby!«
»Ah«, entgegnete Toby unverzagt. »Aber das Problem liegt in Markbys Zuständigkeitsbereich. In eurer Ecke – deswegen ist er der ideale Ansprechpartner.«
Meredith seufzte. Toby war noch nie Alans Lieblingsbekanntschaft gewesen. Sie spürte instinktiv, dass eine Bitte, Toby zu helfen, auf taube Ohren stoßen würde. Doch Toby stand vor ihr und sah sie so voller Hoffnung an, und er war ein alter Freund. Man ließ alte Freunde nicht hängen. Sie musterte ihn. Ordnung war schon immer ein Fremdwort für ihn gewesen. Sein Anzug war so verknittert, dass es aussah, als hätte er den Flug von Peking nach London darin verbracht. Doch Toby gehörte nicht zu der Sorte von Leuten, die in einem Anzug reisten. Er hatte ihn wahrscheinlich in seinem Koffer zerdrückt. Der oberste Hemdenknopf war offen, und der Knoten seiner Krawatte hing fünf Zentimeter darunter. Plötzlich wurde Meredith bewusst, dass sie sich aufrichtig freute, ihn zu sehen.
»Natürlich gehe ich mit dir essen«, sagte sie.
Toby, der sich mental wahrscheinlich immer noch in Peking aufhielt, führte sie zu einem Restaurant in Chinatown. Es war voll, alle Tische besetzt, und die Kellner eilten hin und her. Die Aktivitäten und das Stimmengewirr ringsum bedeuteten, dass sie sich ungestört und vertraulich unterhalten konnten.
»Mal im Ernst«, sagte Toby, nachdem sie ihre Bestellungen aufgegeben hatten. »Meinen Glückwunsch und alles zu deiner bevorstehenden Heirat. Aber wieso hast du deine Meinung geändert? Ich weiß ja, dass er von Anfang an scharf darauf war, dich zu heiraten, aber ich hatte immer den Eindruck, dass du nicht wolltest.«
»Ich hab meine Meinung nicht geändert. Ich hab nur länger gebraucht, um mich zu entscheiden.«
Verdammt lange. Die Vorstellung zu heiraten, zur Ruhe zu kommen, hatte früher stets Panik in ihr aufsteigen lassen. Eigenartigerweise, nachdem sie sich endlich dazu entschlossen hatte, waren ihre Bedenken verschwunden.
»Das große Ereignis findet im Sommer statt, sagst du? Ich würde gerne auf deiner Hochzeit tanzen, aber mit ein wenig Glück hab ich bis dahin einen neuen Posten. Nein, sorry, das klingt, als wollte ich nicht kommen – du weißt, wie ich es gemeint habe. Wenn ich irgendwo in Europa bin, finde ich bestimmt einen Weg zu kommen – falls ich eingeladen bin, heißt das.«
»Selbstverständlich bist du eingeladen. Wir haben den Termin im Sommer gewählt, weil das Haus bis dahin nicht fertig renoviert ist. Wir kaufen nämlich das alte Vikariat in Bamford. Die Kirche will es seit langem verkaufen, und Alan war schon immer scharf darauf. Besonders auf den Garten. Aber es ist in einem grauenvollen Zustand. Wir brauchen eine neue Küche, ein neues Bad, neue elektrische Leitungen und müssen es von oben bis unten renovieren. Sicher kommen noch mehr Dinge hinzu, wenn wir erst einmal angefangen haben. Das ist immer so.«
»Und was passiert mit dem Vikar?«
»James wird in einen Ziegelkasten in einem Neubaugebiet umziehen. Die Kirche ist der Meinung, dass er dort näher bei seinen Gemeindemitgliedern ist. Hofft sie. James macht es nichts aus. Seine Haushälterin ist in den Ruhestand gegangen. Sie ist unglaublich alt. Niemand weiß, wie alt genau. Mrs Harmans Alter ist eine Art Staatsgeheimnis. Jedenfalls hat sie endlich die Schürze an den Nagel gehängt, und James muss sich nun selbst um sich kümmern. In einem neuen, kleineren Haus mit einer Einbauküche und einem kleinen Garten kommt er viel besser zurecht, und so sind alle glücklich und zufrieden. Bis auf die Tatsache, dass ich mich weigere, in einem Haus zu campieren, in dem Arbeiter die Treppen hinauf- und hinuntertrampeln. Ich wohne immer noch in meinem kleinen Reihenhaus in Bamford, und Alan wohnt in seinem Haus. Beide Häuser stehen zum Verkauf. Wer seines als Erster verkauft, zieht beim anderen ein. Wenn wir beide verkaufen, nun ja, dann wird uns wahrscheinlich nichts anderes übrig bleiben, als zwischen den Farbtöpfen zu campieren.«
»Ich hab immer noch meine Wohnung in Camden«, sagte Toby, als das Essen von einem gehetzten Kellner gebracht und unsanft vor ihnen abgesetzt wurde. Der Kellner hastete gleich wieder davon. »Sieht so aus, als wäre sie inzwischen obszön viel Geld wert. Ich kann es kaum glauben.«
Meredith manövrierte ihre Essstäbchen um eine Garnele und tauchte sie in die süß-saure Soße.
Toby nahm einen Bissen von seiner knusprigen Ente. »Jeder hat so seine Probleme – was mich zu meinem bringt, beziehungsweise dem meines Freundes.«
»Hör mal, Toby«, sagte Meredith entschieden. »Wenn es dein Problem ist, dann hör auf, so zu tun, als ginge es um einen Freund. Das wäre dumm, und ich will überhaupt nichts hören, es sei denn, du bist absolut offen zu mir. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass ich dir nicht verspreche, mit Alan darüber zu reden. Ich biete dir lediglich meine Meinung an, das ist alles.«
»Einverstanden«, stimmte Toby zu. »Es ist nicht mein Problem, ehrlich nicht. Die Person, um die es geht – nun ja, er ist ein Verwandter. Jeremy Jenner. Er ist ein Cousin meines Vaters. Als ich ein kleiner Junge war, hab ich ihn Onkel Jeremy genannt. Heutzutage sage ich nur Jeremy zu ihm. Er hat für große multinationale Konzerne gearbeitet und viel Geld verdient, und mittlerweile hat er sich auf einen Landsitz in der Nähe von Bamford zurückgezogen, um von seinen schmutzigen Gewinnen zu leben.«
»Sind sie schmutzig?«
Toby schüttelte den Kopf. »Nein, absolut legal. Es sei denn, du gehörst zu den Globalisierungsgegnern. Dann würdest du ihn wahrscheinlich als Staatsfeind betrachten. Aber Jeremy ist so aufrichtig wie nur irgendwas. Er ist mit einer richtig netten Frau namens Alison verheiratet. Sie ist ein Stück jünger als er. In den Vierzigern, und er ist über sechzig, auch wenn er nicht so aussieht.«
»Ich verstehe. Und was ist das Problem? Er scheint doch ziemlich gesetzt zu sein.«
»Es ist nicht seins. Es ist das von Alison.«
Meredith stöhnte. »Also noch eine Stufe entfernter.«
»Ich hab ihn angerufen«, berichtete Toby. »Sobald ich gelandet war. Ich wollte meine Verwandten sehen, und offen gestanden hatte ich gehofft, dass er mich über das Wochenende einladen würde, über Ostern. Was er getan hat. Aber ich musste mir zwanzig Minuten lang die Geschichte von seinem beziehungsweise Alisons Problem anhören!«
»Dauert es so lange, mir die Geschichte zu erzählen?«, fragte Meredith.
»Nein, bestimmt nicht. Ich mach’s kurz«, versprach Toby. »Der alte Knabe war offensichtlich gestresst und ziemlich wütend obendrein. Wie es scheint, hat Alison Drohbriefe erhalten, schon seit einer ganzen Weile, und er hat es eben erst herausgefunden.«
»Dann sollte er damit zur zuständigen Polizei gehen!«, sagte Meredith prompt.
»Es gibt nur einen einzigen Brief, weil Alison die anderen verbrannt hat. Er ist damit am gleichen Morgen zur lokalen Polizeistation gegangen und war ganz und gar nicht glücklich über die Reaktion der Beamten dort. Deswegen war er so außer sich, als ich mit ihm gesprochen habe. Er hat gesagt, sie wären unhöflich, inkompetent und klein gewesen.«
»Klein?«, fragte Meredith, während sie überlegte, ob sie ihn richtig verstanden hatte in all dem Lärm ringsherum. »Meinst du kleinkariert oder wirklich klein?«
»Klein. Jeremy ist der Ansicht, dass sie die Mindestgröße für den Polizeidienst drastisch gesenkt haben. Seinen Worten nach zu urteilen waren die Beamten in Bamford praktisch Zwerge. Wenig beeindruckend, sagte er.«
»Ich glaube nicht, dass ich deinen Onkel Jeremy in die Nähe von Alan lasse!«, sagte Meredith. »Wenn er so etwas zu Alan sagt, dann geht Alan durch die Decke!«
»Ich gebe zu, dass der gute alte Jeremy manchmal ziemlich direkt sein kann«, sagte Toby. »Ich glaube, es liegt an den vielen Jahren als Industriekapitän. Er ist es gewöhnt, Befehle zu geben und zuzusehen, wie Untergebene hastig jedem seiner Wünsche nachkommen. Er hat die Beamten wahrscheinlich schikaniert, bis sie ihm höflich, aber bestimmt gesagt haben, dass er sich verziehen soll.«
»Ich werde ihn nicht mit Alan reden lassen!«, sagte Meredith entschieden.
»Warte! Er würde mit Markby nicht so umspringen, weil Markby von der richtigen Sorte ist.«
»Richtige Sorte?« Meredith ließ eine Garnele von ihren Essstäbchen fallen. Sie landete in der süß-sauren Soße. »Was zur Hölle ist die ›richtige Sorte‹?«
»Er hat einen hohen Rang. Er ist Superintendent, oder nicht? Jeremy ist daran gewöhnt, mit den Topleuten zu reden. Markby war auf einer Privatschule, er ist höflich gegenüber Damen und trägt polierte Schuhe. Er ist, wenn ich mich recht entsinne, ziemlich groß gewachsen. Groß genug, um Jeremys Vorstellung von einem ordentlichen Polizisten zu entsprechen. Sie würden wunderbar miteinander zurechtkommen.«
»Das wage ich zu bezweifeln! Dein Onkel Jeremy klingt wie ein richtiger Snob!«
»Das ist er nicht. Nicht wirklich. Nur ein wenig konditioniert von den vielen Jahren im Vorstand. Er ist ein wenig spröde, das ist alles. Alison ist ganz anders als er. Sie ist überhaupt nicht versnobt, wie du es nennst. Sie ist total süß. Du würdest sie mögen.«
»Vielleicht. Aber ich glaube nicht, dass ich deinen Onkel Jeremy mag. Nebenbei bin ich wahrscheinlich groß genug, um seiner Vorstellung von einem Polizeirekruten zu entsprechen.«
»Sei nicht so voreingenommen, Meredith«, bettelte Toby. »Er ist wirklich ein hochanständiger Bursche, aber er ist im Augenblick wegen dieser Briefe völlig daneben. Er braucht Hilfe. Glaub mir, er gehört nicht zu der Sorte, die gleich um Hilfe schreit. Er meldet sich erst, wenn die Situation wirklich verzweifelt ist. Er liebt Alison über alles. Er würde für sie morden, und ich möchte nicht in der Haut dieses Briefeschreibers stecken, wenn er ihn zu fassen kriegt. Außerdem hat er ein schwaches Herz. Diese ganze Aufregung ist nicht gut für ihn, bestimmt nicht.«
Meredith betrachtete Tobys in sorgenvolle Falten gelegtes Gesicht. Er kratzte sich den dichten Schopf brauner Haare und erwiderte ihren Blick.
Na schön, dachte Meredith. Wozu sind Freunde da? Toby scheint sich wirklich um seinen grauenvollen Verwandten zu sorgen. Ich könnte zumindest versuchen zu helfen.
»Hat die Polizei gesagt, ob irgendjemand aus der Gegend ebenfalls Drohbriefe bekommen hat?«, fragte sie. »Wenn ich mich recht entsinne, ist es häufig so, dass die Schreiber solcher Briefe einen Groll gegen eine ganze Gemeinde hegen. Sie setzen sich hin und schreiben diese Briefe an alles und jeden. Am Ende ist es meist jemand völlig Unerwartetes. Einer, den niemand verdächtigt hätte.«
Toby schüttelte den Kopf. »Nein. Nur Alison hat diese Briefe bekommen. Oder besser gesagt, niemand sonst hat sich bei der Polizei gemeldet. Wir und die Polizei glauben, dass die Briefe wahrscheinlich nur an sie gerichtet sind, weil es nicht die übliche Sorte von Drohbrief ist. Keine bösen Ausdrücke, keine Anschuldigungen wegen perversem Sex, nichts von den Dingen, die üblicherweise kranken Gehirnen entspringen. Die Briefe beziehen sich auf ein bestimmtes Ereignis aus Alisons Vergangenheit, etwas, das sich wirklich zugetragen hat. Deswegen ist sie so außer sich, genau wie Jeremy. Denk nur, dieser Irre hat ein paar sehr persönliche und private Informationen über Alison herausgefunden. Kein Wunder, dass sie so reagiert.«
»Das ist allerdings etwas Ernsteres«, sagte Meredith nüchtern. Sie fragte sich, ob Toby ihr erzählen würde, was für ein spezifisches Ereignis das gewesen war, oder ob sie ihn danach würde fragen müssen. Das Problem mit Familiengeheimnissen war, dass die Leute sie nur zögerlich mitteilten, selbst wenn sie gezwungen waren, Hilfe zu suchen. Jeremy, Alison und Toby würden lernen müssen, über ihre Geheimnisse zu sprechen. Meredith versuchte es zunächst auf einem Umweg. »Der Briefeschreiber hat kein Geld verlangt, habe ich Recht?«
»Nein, noch nicht jedenfalls. Er erhebt lediglich eine Anschuldigung, immer und immer wieder, und er droht, alles publik zu machen.«
»Wo ist der Brief jetzt?«
»Bei der Polizei. Sie versuchen Fingerabdrücke zu finden oder so etwas. Alison ist außer sich bei dem Gedanken, dass die Cops ihn lesen. Sie möchte nicht, dass irgendjemand davon erfährt. Jeremy kennt die Geschichte, weil sie ihm alles erzählt hat, als sie geheiratet haben. Ich weiß es, weil er mir alles am Telefon erzählt hat. Aber niemand sonst weiß etwas, es sei denn, der Schreiber setzt seine Drohung in die Tat um und macht alles publik. Falls es ein Schreiber ist und nicht eine Schreiberin, was wir nicht wissen. Ich würde sagen, es ist eine Frau. Frauen machen solche Dinge.«
»Die Waffe der Frau ist Gift, ob nun in einer Flasche oder auf Papier niedergeschrieben, meinst du? Es gibt genügend Männer, die solche Briefe geschrieben haben.«
»Schon gut. Wir nehmen mal an, dass es ein Mann war, okay? Alison ist jedenfalls in Panik. Sie sagt, sie müssten das Haus verkaufen und fortziehen, wenn die Geschichte bekannt würde. Die Leute auf dem Land sind schon merkwürdig. Sie zeigen ein ungesundes Interesse für Dinge, die sie nichts angehen, und Gerüchte verbreiten sich wie Lauffeuer.«
»Nicht mehr als in der Stadt«, widersprach Meredith in dem Bemühen, das Leben auf dem Land zu verteidigen.
»Glaub das bloß nicht. Die Bauern sind absolut scheinheilig, und sie können erbarmungslos sein, wenn sie glauben, dass man sich nicht einfügt. Auf dem Land ist so wenig los, dass das gesellschaftliche Leben alles ist. Von jeder Gästeliste gestrichen zu werden bedeutet eine Katastrophe. In der Stadt sucht man sich neue Freunde, dort gibt es einen größeren Pool, wenn man so will. Auf dem Land ist man auf seine Nachbarn angewiesen. Wenn der Inhalt dieses Briefes bekannt wird, dann werden sie Jeremy und Alison schneiden, ohne Zweifel. In der Stadt gibt es zu viele andere Dinge, als dass sich irgendjemand um das scheren würde, was sein Nachbar treibt.«
»Conan Doyle«, warf Meredith ein, nicht bereit, in diesem Disput so schnell nachzugeben. »Conan Doyle hat geschrieben, dass es sich genau andersherum verhält. Oder wenigstens sagt Holmes das in einer seiner Geschichten. Holmes sagt zu Watson, dass niemand genau weiß, was auf dem Land so passiert, weil die Menschen so isoliert sind.«
Toby dachte über ihr Argument nach. »Wie dem auch sei – diese ländliche Stille und dieser scheinbare Frieden tun den Leuten nicht gut. Es macht sie merkwürdig, und wer weiß, was in ihren Köpfen vorgeht?«
»Willst du andeuten, dass einer von ihnen Alisons Geheimnis entdeckt hat und diese Briefe schreibt, um es ihr zu zeigen? Aber wie hat er es herausgefunden? Wenn wir das in Erfahrung bringen, wissen wir vielleicht schon, wer es war.« Meredith runzelte die Stirn. »Warum Alison mit Drohungen quälen? Wenn das Ergebnis, wie du sagst, zu sozialer Isolation führen würde, warum erzählt der Unbekannte es nicht allen, wenn sein Ziel ist, ihr zu schaden? Stattdessen schreibt er ihr Briefe. Was will er bezwecken?«
»Das ist eine Frage, die keiner von uns beantworten kann. Alison würde keiner Fliege etwas zuleide tun. Sie hat keine Feinde.«
»Sie hat zumindest einen Feind«, berichtigte Meredith ihn. »Es sei denn, diese Briefe sind nur ein übler Scherz. Hat sie den Umschlag behalten? Wenn der Schreiber die Marke geleckt hat, finden sich darauf vielleicht Spuren von seiner dns.«
»Siehst du? Du weißt so viel über diese Dinge. Ich wusste, dass es richtig war, mit dir zu reden!« Tobys Gebaren war das eines Mannes, der erfolgreich eine Bürde auf eine andere Schulter abgeladen hatte.
Ich bin eine dumme Kuh, dachte Meredith. Warum hab ich zugelassen, dass er mir die Sache in den Schoß legt? »Noch eine Sache«, sagte sie. »Und es ist wichtig. Bevor ich mich entscheide, ob ich Alan diese Geschichte erzähle, muss ich wissen, worum es genau geht. Was hat Alison in ihrer Vergangenheit angestellt? Das ist nämlich die Ursache für all die Scherereien. Ich bin die Diskretion in Person, Toby. Ich werde mit niemandem darüber reden. Aber du bittest mich mehr oder weniger, Alan zu sagen, dass er zu der zuständigen Polizeistation gehen und einen Aufstand veranstalten soll. Alan hat auch ohne das genug Arbeit um die Ohren. Ich muss wissen, ob es wirklich wichtig genug ist. Tut mir Leid, aber allein die Gefahr, dass Jeremy und Alison all ihre Freunde verlieren könnten, reicht mir nicht. Wie es aussieht, sind diese Freunde sowieso oberflächlich.«
Toby nickte. »Ja. Mir ist klar, dass du es erfahren musst. Ich habe Jeremy gewarnt.«
»Du hast Jeremy gesagt, du würdest mit mir reden? Ehrlich, Toby …«
Er schnitt ihr den hervorgesprudelten Protest ab, indem er hastig seine Geschichte fortsetzte, im vollen Bewusstsein, wie Meredith sich säuerlich eingestand, dass ihre Neugier über den Ärger siegen würde.
»Vor fünfundzwanzig Jahren stand Alison vor Gericht. Sie wurde für unschuldig befunden. Das heißt, sie war nicht schuldig, und die Jury kam zum gleichen Schluss.«
»Und warum soll daraus heute ein Problem entstehen?«, fragte Meredith. »Warum sollte sie sich Sorgen machen, dass die Nachbarn es erfahren könnten? Ich denke, die Menschen auf dem Land sind viel toleranter, als du glaubst.« Meredith zögerte. Toby wich ihrem Blick aus. »Toby? Weswegen stand Alison vor Gericht?«
»Mord«, antwortete Toby leise.
KAPITEL 2
»Ich habe mich so auf die Osterfeiertage gefreut!«, sagte Alan Markby. Er starrte missmutig auf einen übergewichtigen jungen Mann, der an ihrem Tisch vorbeigeschlurft war. Das Bier im Glas des Jungen war übergeschwappt und hätte sie fast getroffen. »Und jetzt erzählst du mir, dass dieser elende Smythe über Ostern in der Gegend ist!«
»Hey!«, protestierte Meredith. »Ich lasse nicht zu, wenn er dir böse Namen gibt, also solltest du ihn auch nicht ›diesen elenden Smythe‹ nennen! Er ist ein netter Kerl, und er hat ein gutes Herz. Man muss sich nur ein wenig an seinen Sinn für Humor gewöhnen.«
»Muss man das? Ich werde versuchen, daran zu denken. Soweit es mich betrifft, ist er ein wandelndes Katastrophengebiet. Er übt einen schlimmen Einfluss auf alles und jeden in seiner Umgebung aus, ganz besonders, wie ich hinzufügen möchte, auf dich, sobald du in seine Nähe kommst. Er ist ein Unglücksbringer. Überleg nur, was passiert ist, als er dir seine Wohnung vermietet hat. Kurze Zeit später taucht er wieder auf, weil er aus irgendeinem Land geworfen wurde, als Du musstest ausziehen und bei Ursula Gretton im Bauwagen auf einer archäologischen Grabung wohnen, bis zu den Knien im Schlamm und rein zufällig neben Bergen von Leichen! Dann brach er sich das Bein, und du musstest …«
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























