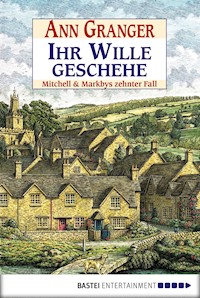7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Krimi
- Serie: Mitchell & Markby Krimi
- Sprache: Deutsch
Inmitten der idyllischen Wälder der Cotswolds wird die Leiche der fünfzehnjährigen Lynne Wills gefunden. Chief Inspektor Markby übernimmt den Fall - und weiß von Anfang an, dass er vor einem der schwierigsten seiner Karriere steht.
Trotz seiner jahrelangen Erfahrung muss er feststellen, dass er so gut wie nichts über Lynne Wills und ihre Generation weiß. Da kommt ihm die Hilfe von Meredith Mitchell gerade recht, deren diplomatisches Geschick nicht nur bei den Jugendlichen, sondern auch in hohen aristokratischen Kreisen gefragt ist - denn genau dorthin führt die Spur des Mörders.
Mitchell & Markbys 6. Fall.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 480
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über die Autorin
Titel
Impressum
Zitat
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Über die Autorin
Ann Granger war früher im diplomatischen Dienst tätig. Sie hat zwei Söhne und lebt heute mit ihrem Mann in der Nähe von Oxford. Bestsellerruhm erlangte sie mit der Mitchell-und-Markby-Reihe und den Fran-Varady-Krimis. Nach Ausflügen ins viktorianische England mit den Lizzie-Martin-Romanen, knüpft sie mit der Serie um Inspector Jessica Campbell wieder unmittelbar an die Mitchell-und-Markby-Reihe an.
ANN GRANGER
EIN SCHÖNER ORT ZUM STERBEN
Mitchell & Markbys sechster Fall
Ins Deutsche übertragen von Axel Merz
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Titel der englischen Originalausgabe:A Fine Place For Death
© 1994 by Ann Granger
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2002/2011 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Stefan Bauer
Titelillustration: David Hopkins
Umschlaggestaltung: QuadroGrafik, Bensberg
E-Book-Produktion: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN 978-3-8387-0695-5
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Das Grab ist ein gar feiner und privater Ort, Doch niemand, so dächt ich, umarmt sich dort.
Andrew Marvell
KAPITEL 1
Hungrig und wachsam schlüpfte der Fuchs aus dem Labyrinth alter Tunnel, das sich entlang der Fundamente des verlassenen Gebäudes erstreckte. In den tiefsten Tiefen dieser von Tieren gegrabenen Katakomben war die Luft verpestet von einem Miasma der Verwesung, das den Fuchs seltsam unruhig machte. Deswegen war er noch nie auf der untersten Ebene gewesen.
Seit kurzem war ein weiterer Grund für Unruhe hinzugekommen, über der Erde, ein neuer Geruch, der das Unterholz verschmutzte, selbst hier oben, wo die Luft frisch war. Menschen waren zu diesem verlassenen Flecken zurückgekehrt. Menschen, die wie der Fuchs ihre Zwecke in der Dunkelheit verfolgten und deren Kommen vom leisen Brummen eines Automotors angekündigt wurde. Der Fuchs hatte gelernt, das Geräusch zu erkennen und sich leise davonzustehlen.
In dieser Nacht trottete er auf seinen schlanken, schwarz gezeichneten Beinen über den frostharten Boden. Die spitze Nase am Boden, die Rute gesenkt, witterte er hungrig nach dem Duft einer Mahlzeit – Aas, von dem er fressen konnte, oder eine Kreatur, die schwächer oder dümmer war als er und sich erbeuten ließ. Dann drang erneut das ferne mechanische Brummen an sein scharfes Gehör. Der Fuchs hielt inne, warf einen Blick zurück auf das Unterholz und die beiden Türmchen, deren Spitzen die Bäume überragten und die im Mondlicht silbern glänzten.
Ein Lichtstrahl huschte plötzlich über ihn hinweg und ließ seine Augen wild leuchten. Der Mensch war gekommen, und für einen kurzen Augenblick begegneten sich die beiden Wesen der Nacht, bevor jeder wieder seiner eigenen dunklen Wege ging.
Adeline Conway stand am Fenster und starrte furchterfüllt hinaus auf das dunkle Land. Ihre dünnen weißen Finger, auf denen sich die locker sitzenden Ringe gedreht hatten, sodass die kostbaren Steine nach innen zeigten, umklammerten den Samtvorhang und zerknitterten den Stoff. Adelines Mann Matthew wusste, dass sie sich vor der Dunkelheit fürchtete. Trotzdem rief er sie nicht vom Fenster weg, denn er wusste auch, dass sie von der Dunkelheit fasziniert war. Er beobachtete, wie sie an dem schweren Vorhang zerrte und ihn vor das Fenster zog, um die Silhouetten der Bäume auszusperren, die vor dem Nachthimmel schwankend tanzten. Als sie zu ihrem Stuhl beim Kamin zurückkehrte, rieb sie sich die kalten Finger, und er sah, während sie verstohlen die Ringe wieder richtig herum drehte, dass die Nägel bläulich-weiß angelaufen waren.
»Es ist kalt.« Ihre Stimme besaß einen quäkenden, durchdringenden, wehleidigen Ton wie die eines verirrten Kätzchens. Es war unmöglich, diese Stimme zu ignorieren oder Adeline deswegen böse zu sein.
Mitleid mischte sich in Matthews Verärgerung. Er seufzte und erhob sich, um ein kleines Scheit auf das offene Feuer in dem großen Adam-Kamin zu werfen.
Funken stoben knackend und knisternd auf, sandten tanzende Schatten durch das Zimmer und schreckten einen schwarzen Perserkater auf, der auf dem Kaminvorleger geschlummert hatte. Der Kater hob den Kopf und fixierte Matthew aus feindseligen smaragdgrünen Augen. Er wusste, dass Matthew den Funkenschauer verursacht hatte – außerdem war er Adelines Schoßtier und reflektierte die Stimmungen und Gefühle, die Matthews Frau ausstrahlte. Wenn Matthew je versuchte, das Tier zu streicheln, biss es nach ihm. Jetzt sank der schwere Kopf auf die Pfoten zurück, und die Augen verengten sich zu misstrauischen grünen Schlitzen, die Matthew aufmerksam beobachteten.
Matthews Verärgerung nahm weiter zu. Er würde gleich hinaus in die kalte Winterluft gehen, und hier drin war die Hitze unerträglich. Sehr wahrscheinlich würde er sich eine Erkältung zuziehen, und alles nur, weil Adeline darauf bestand, dass dieses Zimmer jeden Abend aufgeheizt wurde wie ein Treibhaus im Kew Garden. Die Temperatur stand in bemerkenswertem Kontrast zum Hausflur und den Schlafzimmern, in denen eisige Kälte herrschte.
Matthew starrte rebellisch um sich. Die Eleganz des Salons aus dem achtzehnten Jahrhundert vermittelte noch immer eine Atmosphäre von kultiviertem Luxus, auch wenn die Farben an den Wänden verblasst und das Mobiliar inzwischen ein Mischmasch verschiedenster Stile war. Die heruntergefallenen Seiten seiner Abendzeitung verbargen kaum die ausgetretenen Flecken auf dem Teppich.
Adeline mit ihren dünnen, aristokratischen Zügen und dem leicht wirren Gehabe passte ausgezeichnet in diese Umgebung. Wie hätte es auch anders sein sollen – schließlich war sie hier aufgewachsen, in diesem alten Haus, dem Heim ihrer Familie. So unfähig Adeline in vielerlei Hinsicht auch sein mochte – das galt nicht in Angelegenheiten, die Park House betrafen, das unstrittig ihr Haus war, im wörtlichen wie im übertragenen, moralischen Sinne. Daher das irrsinnige Heizen in diesem Zimmer. Daher die Weigerung, die Maler kommen zu lassen oder andere Fremde, um neue Vorhänge oder Teppiche auszumessen. Und letztendlich war das auch der Grund, warum es unmöglich war, sie aus dem Haus zu locken, ganz gleich, wie sehr er sich bemühte …
Matthews Blick fiel auf einen kleinen Tisch in der Ecke, der übersät war mit gerahmten Fotografien, darunter ein Bild seiner Tochter als Baby auf dem Schoß seiner Mutter. Er musste nur von dort zu dem großen Porträt an der Wand sehen, um zu erkennen, wie früh die physische und mentale Degeneration seiner Frau angefangen hatte. Auf dem Ölgemälde war Adeline eine wunderschöne lächelnde junge Frau von achtzehn Jahren, mit gelocktem kastanienbraunen Haar und warmen dunklen Augen. Die junge Mutter auf dem Porträt starrte den Fotografen mit einem gehetzten Blick an und umklammerte das Baby auf ihrem Schoß. Wann immer Matthew diese beiden Bilder verglich, wie er es häufig unwillkürlich tat, kehrte die alte, quälende Frage zurück: Ist das alles meine Schuld? Habe ich sie zerstört? Und mit den Schuldgefühlen kam der Groll, der Groll darüber, dass sie diese Gefühle in ihm verursachte.
Matthew musterte seine Frau verstohlen. Sie hatte im Verlauf des letzten Jahres noch mehr an Gewicht verloren. Unter ihrer Kleidung bestand sie wahrscheinlich nur noch aus Haut und Knochen – doch es war lange Zeit her, dass er sie anders als vollständig angezogen gesehen hatte.
Laut sagte er: »In fünf Minuten fahre ich Katie holen. Soll ich Prue Bescheid sagen?«
Adelines Gesicht zuckte. »Sie sollte so spät nicht noch draußen sein, nach Einbruch der Dunkelheit! Es ist viel zu gefährlich! Ich wünschte, Katie würde nicht immer wieder zu diesem Jugendclub gehen. Ich wünschte, sie würde überhaupt nicht nach Bamford gehen! Sie lernt die falschen jungen Menschen kennen. Sie hat ja keine Ahnung … sie ist so unschuldig. Die anderen Jugendlichen, sie sind wie … wie junge Wilde!«
»Ich bin sicher, dass Vater Holland ein strenges Auge auf seinen Jugendclub hat.«
»In ihrem Alter hatte ich längst nicht so viele Freiheiten! Meine Eltern hätten mir niemals erlaubt, mit diesem Gesindel zu verkehren.«
Fast hätte er laut aufgelacht. Adelines Eltern hatten schließlich nicht verhindern können, dass ihre Tochter jemanden heiratete, der in ihren Augen Gesindel war.
»Die Zeiten ändern sich, Addy. Gib Katie wenigstens die Chance, ein normales Leben zu führen! Nächsten Sommer bekommst du deinen Willen, wenn sie nach Frankreich zu Mireille geht.«
Er gab sich alle Mühe, die Bitterkeit aus seiner Stimme zu halten, doch es gelang ihm nicht. Wäre es nach seiner Frau gegangen, dann hätte sie das Kind am liebsten in einen goldenen Käfig gesperrt, ohne die Gefahren zu sehen, die daraus erwuchsen. Soll Katie doch ausgehen und sich mit anderen Jugendlichen treffen. Soll sie doch lernen, wie die Wirklichkeit aussieht. Das war sein Wunsch gewesen. Alles war besser, als aufzuwachsen wie ihre Mutter! Es war schmerzvoll genug, dass seine Tochter überhaupt groß werden musste.
Adeline war zu ihrem Sessel am Feuer zurückgekehrt. Sam, der Kater, setzte sich auf und reckte den Hals, um zu sehen, ob auf ihrem Schoß noch ein Plätzchen für ihn frei wäre, doch sie hatte ihren runden Stickrahmen aufgenommen und zupfte nervös an der halbfertigen Arbeit. Matthew fragte sich abwesend, was es werden sollte wahrscheinlich ein Tablettdeckchen oder irgendein anderes nutzloses Ding. Doch Adeline war Expertin mit Nadel und Faden, und die malvenfarbenen Gänseblümchen und grün schattierten Blätter waren wundervoll gearbeitet.
Sie durchbrach die verlegene Stille und sagte: »Ja. Katie muss zu Mireille.«
Er verspürte keine Lust zu streiten. Außerdem war nicht mehr genug Zeit.
»Du bist müde, Addy. Ich gebe Prue auf dem Weg nach draußen Bescheid.« Sie antwortete nicht, und er erhob sich und beugte sich über sie. »Du liegst sicherlich bereits im Bett, wenn Katie und ich zurück sind, also sage ich dir lieber jetzt gute Nacht.« Er küsste sie auf die Stirn.
Unter seiner Berührung zuckte sie zusammen. »Ich möchte Katie noch sehen, wenn ihr wieder da seid! Sag ihr, sie soll in mein Schlafzimmer kommen und mir gute Nacht sagen.«
»Ja. Natürlich.« Sie hatte ihn seit Ewigkeiten nicht mehr zu sich eingeladen, doch das war ihm inzwischen egal. In dieser Hinsicht hatte er längst andere Arrangements getroffen. Er drückte ihre Hand flüchtig zum Abschied, und obwohl er schwitzte, war ihre Berührung kalt wie die einer Leiche.
Matthew verließ den stickigen Salon. Im Flur war es kalt wie in einem Kühlschrank, doch er atmete erleichtert durch. Einen Augenblick lang blieb er stehen, allein, eingehüllt in die Stille und Leere des großen Hauses. In einer Ecke tickte leise eine große Standuhr und verkündete der Welt eine falsche Zeit. Die Uhr hätte als Symbol für das gesamte Haus stehen können – unzeitgemäß, fehl am Platz und ohne Aussicht auf Änderung. Jedenfalls nicht, soweit Matthew es zu beurteilen imstande war.
Matthew wandte den Kopf nach links. Das Haus war heutzutage aufgeteilt – der Korridor war durch eine grüne Tür blockiert. Es hatte wochenlanger Diskussionen mit Addy bedurft, um sie einzubauen, ermüdender Diskussionen, durchbrochen von hysterischen Anfällen. Am Ende hatte Addy zugestimmt, weil dahinter die Büros lagen, von denen aus Matthew seine Geschäfte erledigte. Das ständige Klingeln der Telefone und das Geklapper der Schreibmaschine hatte sie gestört, am meisten jedoch die aufdringliche Nähe seiner Arbeits- und Geschäftswelt, dieses Eindringen von Realität in ihre Fantasiewelt. Adeline hatte der Tür zugestimmt, jedoch nur aus Furcht.
Auch Matthew versteckte sich. Er versteckte sich hinter dieser Tür vor seinen häuslichen Problemen. Vertiefte sich mithilfe seiner Assistentin, Marla Lewis, in seine Arbeit. Marla lebte in einer abgeschlossenen Wohnung im zweiten Stock. Sie und Adeline begegneten sich niemals.
Matthew rannte die breite Treppe hinauf und in den ersten Stock. Hinter der Tür lag eine weitere Wohnung, doch nicht so abgeschieden wie die Marlas. Es war wichtig für die Familie, dass diese Räume zugänglich blieben. Hinter der Tür war das leise Geräusch eines laufenden Fernsehers zu hören, irgendeine Spielshow, Lachen, Applaus. Matthew klopfte.
»Prue? Mrs. Conway möchte gleich zu Bett gehen.«
Der Fernseher verstummte augenblicklich. Matthew hörte, wie sich auf der anderen Seite der Tür jemand rührte, dann antwortete eine ernste Stimme: »Ja, ich habe verstanden.«
»Ich muss jetzt weg nach Bamford, um meine Tochter abzuholen.«
Die Tür wurde geöffnet, und Matthew trat hastig einen Schritt zurück. Eine stämmige, tüchtig aussehende Frau in einem handgestrickten Pullover und Tweedrock erschien.
»Dann mal los mit Ihnen«, sagte sie. »Keine Sorge, ich komme zurecht.«
»Danke sehr, Prue.« Er zögerte, dann fügte er hinzu: »Ich bin Ihnen wirklich sehr dankbar. Ich weiß gar nicht, wie ich, wie wir ohne Sie …«
»Ja, ja, gehen Sie schon!«, unterbrach sie ihn schroff.
Als er die Haustür öffnete und ihm die kalte frische Nachtluft ins Gesicht wehte, hörte er Prue Wilcox hinter sich die Tür zum Salon öffnen und sagen: »Nun, wollen wir den großen Holzhügel hinaufsteigen, Liebes?« Es klang, als spräche sie mit einem Kind.
Matthew zog die Haustür hinter sich ins Schloss und ging zum Wagen, während er in den Taschen nach seinen Schlüsseln kramte. So ging es einfach nicht mehr weiter. Die Situation war unerträglich.
Der Schweiß auf seiner Haut wurde rasch unangenehm kalt in der nächtlichen Brise. Er rieb sich mit den breiten Händen über das Gesicht und fühlte sich mit einem Mal sehr alt, obwohl er erst achtundvierzig war. In den besten Jahren, verdammt noch mal! Und doch, wenn die Dinge so weiter liefen wie bisher, auf ihre unerbittlich vorhersehbare Weise, dann gab es nichts mehr, was das Leben für ihn noch bereithielt. Seine vergangenen Erfolge waren nur noch eine Erinnerung an den verlorenen Optimismus, und seine Zukunft war unentrinnbar mit Adeline verknüpft.
Er war in einem kleinen Reihenhaus in einem Londoner Vorort aufgewachsen und hatte seinen Weg in die Welt aus eigener Kraft geschafft, nur mit seinem Verstand und seinem Talent. Er war stolz darauf. Er hatte Adeline eher zufällig kennen gelernt, auf irgendeiner Party, einer Versammlung, auf der er als Außenseiter gewesen war, verlegen und schüchtern zugleich. Adeline war ebenfalls schüchtern gewesen, obwohl sie dazugehört und sich unter Freunden befunden hatte. Sie hatten sich zueinander hingezogen gefühlt. Vielleicht hatte sie Mitleid mit ihm gehabt. Für ihn war sie das wunderschönste Wesen gewesen, das er jemals gesehen hatte. Ihre Hochzeit war ihm wie die Erfüllung all seiner Träume erschienen. Und als Katie geboren wurde, war es das Sahnetüpfelchen auf dem Kuchen gewesen.
Von diesem Tag an war es immer nur bergab gegangen.
Wie bei so vielen anderen unglücklichen Paaren, so war auch bei ihnen ihr Kind seit langem das Einzige, was sie noch aneinander band. Doch selbst über Katies Erziehung gingen ihre Ansichten auseinander. Adeline wollte Katie nach dem Schulabschluss im Sommer für ein Jahr nach Paris schicken, um sie auf das Erwachsenenleben vorzubereiten. Er missbilligte diesen dummen Plan, den seine Frau und ihre französische Freundin Mireille ausgebrütet hatten, und er hasste die Vorstellung, dass seine kleine Katie in die Fänge dieser beutegierigen Französin geriet, die in seiner Tochter ohne jeden Zweifel eine angemessene Partie für ihren Tunichtgut von Sohn sah. Doch Adeline war taub für jeden seiner Einwände. Katie würde nach Frankreich verfrachtet werden, gegen ihren eigenen Willen und gegen seinen. Und er? Er würde allein mit Adeline zurückbleiben. Die Aussicht war albtraumhaft. Unerträglich.
Warum verschwinde ich nicht einfach?, fragte er sich. Warum lasse ich mich nicht von ihr scheiden, oder sie sich von mir? Sie würde es nicht tun. Adeline klammerte sich an ihn wie eine Ranke, oder genauer: wie giftiger Efeu! Und in ihrem Zustand konnte er sie auch nicht verlassen. Sie schwebte nun schon seit Jahren dicht vor dem Abgrund. Es würde nicht viel erfordern, sie über die Kante zu stoßen, hinein ins mentale Chaos. Er saß in der Falle.
Genau in diesem Augenblick, wie um seine zum Zerreißen angespannten Nerven noch weiter zu dehnen, ertönte hinter ihm in der Dunkelheit lautes Quieken und Kreischen.
Matthew verzog das Gesicht zu einer Grimasse. Wenn er diese elenden Mistviecher doch nur irgendwie loswerden könnte! Düster raste er in seiner Limousine über den Weg und auf die Straße nach dem kleinen Städtchen Bamford hinaus, um sein einziges Kind nach Hause zu holen.
»Also schön, alles hinsetzen!«, rief Vater Holland.
Der Lärm im Kirchensaal hielt unvermindert an. Während des Diavortrags waren sie unter Kontrolle gewesen, doch jetzt, nachdem die Beleuchtung wieder angegangen war, fühlte sich das Publikum aus seiner ungewohnten Immobilität entlassen. Stühle wurden gerückt, und Stimmen stritten lauthals. Auf der anderen Seite des Tisches, wo Mrs. Pride in einer rosa karierten Kittelschürze bemüht war, Orangenlimonade in Plastikbechern halbwegs zivilisiert auszuteilen, herrschte reges Gedränge. Die Auswahl selbst gebackener Kuchen, den ihr Damenkränzchen gespendet hatte, war längst verschwunden, von gierigen Fingern innerhalb weniger Minuten weggezaubert.
»Ruhe!«, donnerte Vater Holland.
Fast wurde es still. Der Mob wandte sich ihm zu, und so ein Mob besitzt nur wenige gewinnende Züge, dachte Meredith Mitchell. Sie empfand das jugendliche Ungestüm der Anwesenden sowohl als arrogant wie auch als ignorant, eine unverschämte Herausforderung gegen jedwede Autorität. Während Merediths Vortrag hatten sie ununterbrochen gekichert, gezappelt und mit Süßigkeitenpapierchen geknistert. Möglich, dass Meredith unfair war. Sie grub ein paar vage Erinnerungen an ihre eigene Pubertät aus, mit all den Qualen, die man an Leib und Seele auszustehen hatte. Es war tatsächlich ein elendes Geschäft, das Erwachsenwerden. Die Hormone machten einem das Leben zur Hölle, und man wusste beim besten Willen nicht, was man eigentlich wollte, nur das, was man auf gar keinen Fall wollte, das aber dafür mit umso leidenschaftlicherer Bestimmtheit.
»Also schön.« Der Vikar wurde allmählich heiser. »Ich bin sicher, wir alle sind Meredith sehr dankbar, dass sie dem Jugendclub heute Abend ihre kostbare Zeit zur Verfügung gestellt und interessante Dias von ihren Reisen gezeigt hat. Was haltet ihr von einer Runde Applaus, um eure Dankbarkeit zu zeigen?«
Pflichtergeben klatschten sie Beifall, und aus dem hinteren Teil des Saals kam der eine oder andere anerkennende Ruf – mit ironischem Unterton.
»Danke sehr!«, rief Meredith über den Tumult hinweg. »Es … es war mir ein Vergnügen.« Insgeheim hatte sie bereits beschlossen: »Nie wieder!«
Zwei Jugendliche näherten sich ihr, beide vielleicht sechzehn Jahre alt, womit sie ein oder zwei Jahre mehr zählten als das übrige Publikum. Einer der beiden, ein ernster, gelehrt dreinblickender Junge mit einer Stahlrandbrille, machte sich daran, gewissenhaft die Projektionsleinwand einzurollen. Als er Merediths Blick bemerkte, lächelte er schüchtern zurück und sprudelte hervor: »Der Vortrag hat ihnen sehr gefallen!«
»Dessen bin ich mir gar nicht so sicher«, entgegnete Meredith, schob sich das dichte braune Haar aus der Stirn und fügte, weil sie wusste, wie leicht Jugendliche sich verunsichern ließen und sie nicht unhöflich erscheinen wollte, hinzu: »Ich danke euch beiden für eure Hilfe. Ohne euch hätte ich es bestimmt nicht geschafft.«
Sein Gesicht lief zu einem unvorteilhaften Rot an, das seine Ohren leuchten ließ, und das Mädchen neben ihm plapperte los: »O ja! Es war ein großartiger Vortrag, Meredith! Ich möchte auch einmal einen so aufregenden Beruf haben wie Sie!«
Meredith hatte in der Dunkelheit des Kirchensaals alle Hände voll zu tun gehabt, um sich die Aufmerksamkeit der Jugendlichen zu erhalten, und keine Zeit gefunden, ihre beiden Helfer zu betrachten, so dankbar sie auch für ihren Eifer war. Als sie jetzt das Mädchen ansah, das vielleicht gerade sechzehn Jahre alt war, stellte sie voll Überraschung fest, dass es eines jener Wesen war, bei dessen Geburt die Götter zweifellos gelächelt hatten. Es war mehr als gewöhnliche jugendliche Anmut, die das Versprechen einer zukünftigen wirklichen Schönheit in sich trug, es war eine Art Leuchten, das sie umgab, eine fast greifbare Frische und Spontaneität.
Meredith hörte sich sagen: »Das Foreign Office ist genau genommen eine sehr große Behörde, und nur hin und wieder kommt man an interessante Orte. Meistens ist die Arbeit schrecklich langweilig. Ich komme heutzutage nicht mehr so häufig ins Ausland. Ich arbeite in London, an einem Schreibtisch, und alles ist Routine.«
Das Mädchen beugte sich vertraulich vor. »Aber als Sie im Ausland waren, dann wenigstens, weil Sie es gewollt haben und weil ein Sinn dahinter gesteckt hat! Nicht wie bei meiner Mutter, die mich unbedingt zu ihrer Freundin schicken will …«
Der Junge mischte sich ein. »Sie kann dich nicht zwingen zu gehen!«
»Doch, das kann sie! Du verstehst das nicht, Josh. Es ist nicht ihre Schuld.«
Meredith vermutete irgendeinen komplizierten zugrunde liegenden Disput zwischen den beiden und wollte sich nicht in den Streit hineinziehen lassen. Sie deutete auf das restliche Publikum, das wie Quecksilber aus dem Kirchensaal in die kühle Novembernacht strömte. Draußen ging das Geschreie noch eine Weile weiter, bevor es in der Ferne verklang. »Vielleicht haben sie sich alle zu Tode gelangweilt«, sagte sie zu den beiden und bemühte sich, einigermaßen unbeschwert zu klingen. »Sie rennen davon, so schnell sie können.«
Der Vikar trat hinzu und wischte sich über die Stirn. »Es ist gar nicht so einfach, ihr Interesse wachzuhalten. Sie haben sich prachtvoll geschlagen, Meredith! Die Jugendlichen kommen nur ungern in den Club, wissen Sie, und in spätestens ein oder zwei Jahren haben wir sie an die Pubs verloren, wenn sie andere Gesellschaft suchen. Das Problem ist, dass es in einer kleinen Stadt wie Bamford herzlich wenig gibt, was sie sonst noch unternehmen könnten.«
»Aber die Jugendlichen, die heute Abend hier waren, sind doch wohl noch eine ganze Weile zu jung, um in Pubs zu dürfen?«
Vater Hollands Barthaare richteten sich auf. »Ich räume ein, dass die meisten Pubs in der Stadt recht genau sind, was das Alter ihrer Kundschaft anbelangt. Die einheimische Polizei tut ihr Übriges, um die Wirte bei der Stange zu halten. Aber spät am Tag, wenn das Personal schon gestresst ist, hat es häufig einfach nicht die Zeit, um sich die Kundschaft genauer anzusehen, die ihre Bestellungen aufgibt. Und die Jugendlichen machen sich einen Sport daraus, die Kellner zu überlisten. Sie halten es für schlau und erwachsen.« Er seufzte schwer. »Außerdem gibt es eine Reihe von Wirten, denen Geld wichtiger ist als die Einhaltung von Gesetzen zum Schutz unserer Jugend.«
Er richtete seine Aufmerksamkeit auf das Mädchen. »Alles in Ordnung, Katie? Wie kommst du nach Hause?«
»Mein Vater holt mich ab.«
»Gut. Und du, Josh? Wenn du noch einen Augenblick warten möchtest, nehme ich dich auf dem Rücksitz mit.«
»Ich hätte auch noch Platz in meinem Wagen«, erbot sich Meredith.
Josh schob seine Brille hoch und lächelte nervös. »Es macht mir nichts aus, zu Fuß zu gehen. Wirklich nicht. Es ist nicht weit.«
»Nun ja, ich danke euch beiden jedenfalls recht herzlich«, sagte Meredith. »Lasst alles einfach liegen, ich kümmere mich schon um den Rest. Nehmt euch noch etwas Saft und Kuchen, das heißt, falls noch welcher übrig ist.«
»Nette Kinder«, sagte der Vikar eine kurze Weile später, als die beiden Jugendlichen gegangen waren. »Zu schade, dass es nicht mehr von ihrer Sorte gibt. Ich werde Katies Hilfe vermissen, wenn sie nicht mehr da ist, aber vermutlich lässt sich daran nichts ändern. Ihre Familie lebt in Park House, ein wenig außerhalb der Stadt, und Katie muss jedes Mal abgeholt werden. Joshs Eltern leben in Übersee, und er wohnt bei einer Tante. Er ist ein wenig gehemmt, wie Sie sicherlich bemerkt haben, und die Arbeit für den Jugendclub hat ihn aus seinem Schneckenhaus gelockt. Ah, Mrs. Pride!«
Mrs. Pride kam herbeigestürzt, rotgesichtig und glühend vor Anstrengung. Ihre silbernen Locken waren im Getümmel um die Kuchen in Unordnung geraten, und die Vorderseite ihrer Schürze war nass von verschüttetem Orangensaft, doch ansonsten wirkte sie gelassen.
»Ich habe den Wasserkessel aufgesetzt, in der Kochecke. Ich bin sicher, Sie beide können eine anständige Tasse Tee vertragen.«
»Sie gute Seele«, sagte der Vikar.
»Mögen Sie vielleicht noch ein paar Makronen? Ich habe extra welche für Sie aufgehoben. Diese Kinder sind wie die Heuschrecken. Sie futtern einfach alles, was ihnen in die Finger kommt! Deswegen habe ich ein paar Kleinigkeiten für uns beiseite geschafft. Sie mögen sicherlich auch eine Makrone, Meredith, nicht wahr?«
»Danke für Ihre Mitarbeit heute Abend, gute Frau«, sagte Vater Holland einige Minuten später, nachdem der Tee fertig war. »Wissen Sie, ich denke oft, es wäre besser, bei derartigen Gelegenheiten zwei Helfer dabeizuhaben, statt immer nur einen. Die Kinder haben nicht gerade das, was man Partymanieren nennt.«
»Mavis Farthing wäre normalerweise mitgekommen, aber sie hat sich eine Erkältung eingefangen«, sagte Mrs. Pride, während sie einen Makronenkrümel von ihrer üppigen Brust streifte. »Ich muss morgen unbedingt bei ihr vorbeischauen. Und Miss Rissington muss mit dem kalten Wetter aufpassen, wegen ihrer Bronchien. Natürlich hätte ich auch Cissy fragen können, aber sie ist so spät abends nicht gerne unterwegs, nicht in der dunklen Jahreszeit jedenfalls. Ich komme schon zurecht, machen Sie sich bloß keine Gedanken! Die kleine Katie hat mir prima geholfen.«
Sie tranken ihren Tee aus, und Meredith half Mrs. Pride beim Abspülen der Tassen und Teller und beim Aufräumen der kleine Kochküche, während Vater Holland durch den Saal ging, die Fenster schloss und die Toiletten abspülte.
»Alles in Ordnung«, sagte er und klimperte mit dem großen Schlüsselbund, als er zu den beiden Frauen zurückgekehrt war. »Ich muss nur noch abschließen, dann können wir nach Hause. Ich möchte Ihnen noch einmal meinen Dank aussprechen, Meredith! Nehmen Sie Mrs. P. mit?«
»Natürlich, wir sind schließlich Nachbarn.« Meredith lächelte.
»Nett von Ihnen, mich mitzunehmen«, sagte Mrs. Pride und verstaute Teller in einer Kiste. »Normalerweise muss ich mit meinem alten Fahrrad fahren. So kann ich diese Kiste mitnehmen und muss nicht morgen noch einmal vorbeikommen, um sie aufzusammeln. Hm, wessen Teller ist denn das? Das Etikett hat sich gelöst. Wahrscheinlich gehört er Mavis. Sie hat ihn ausgeliehen. Ich bringe ihn morgen bei ihr vorbei, wenn ich sie besuche.«
»O ja, Mrs. Farthing«, murmelte Vater Holland. »Wenn sie wirklich krank ist, komme ich morgen und besuche sie ebenfalls.«
Draußen vor dem Saal standen Katie und Josh dicht beieinander und führten offensichtlich ein hitziges Streitgespräch. Sie brachen ab, als Meredith im hell erleuchteten Ausgang sichtbar wurde, und beobachteten schweigend, wie sie zum Wagen ging. Vater Holland und Mrs. Pride folgten. Der Vikar schaltete die Lichter aus und verschloss die Tür hinter sich.
»Und du bist sicher, dass dein Vater auf dem Weg ist, Katie?«
»Ja. Es dauert bestimmt nur noch ein paar Minuten. Außerdem leistet Josh mir beim Warten Gesellschaft.« Katie hatte weiße Ohrenschützer auf und die Arme unter die Achselhöhlen geschoben. Jetzt hüpfte sie auf der Stelle, um sich aufzuwärmen. Sie sah aus wie ein plötzlich zum Leben erwachtes Plüschkaninchen.
Die Erwachsenen trennten sich. Vater Holland zog seinen Schutzhelm an und donnerte auf seiner mächtigen Yamaha davon. Mrs. Pride quetschte ihre Kiste auf den Rücksitz von Merediths Wagen und stieg schnaufend vor Anstrengung ein. Sie fuhren los.
»Schmuser«, sagte Mrs. Pride überraschend.
»Verzeihung?« Meredith benötigte eine Sekunde, um den altmodischen Ausdruck zu verarbeiten und ihn auf gegenwärtige Verhältnisse zu übertragen.
»Der junge Josh und die kleine Katie.«
»Tatsächlich? Ich dachte eigentlich eher, sie streiten sich?«
»O nein«, widersprach Mrs. Pride entschieden. »Er steht jeden Donnerstagabend bei ihr, bis ihr Vater sie abholt. Aber er ist viel zu schüchtern, um den entscheidenden Schritt zu machen. Ich hab ihm gesagt, dass ein verzagtes Herz nie eine Märchenfee gewinnt, aber er ist nur bis unter die Haarwurzeln rot geworden.«
Sie durchquerten das Stadtzentrum und passierten hell erleuchtete Schaufenster. Die Läden des indischen Restaurants waren geschlossen, doch dahinter schimmerte gelbes Licht. Sie passierten den Imbisswagen und eine Frittenbude und kamen in die schlechter beleuchteten Außenbezirke.
»Ich kann mir denken, dass Mr. und Mrs. Conway, Katies Eltern, sich jemand Besseren für ihre Tochter vorstellen«, fuhr Mrs. Pride nachdenklich fort.
»Jemand Besseren?«, fragte Meredith verblüfft.
»Sie wissen schon, was ich meine, Liebes. Er ist ein netter Bursche, der junge Josh, und ich weiß sehr wohl, dass sich die Zeiten geändert haben, seit ich ein junges Mädchen war. Aber nicht alles ist anders geworden. Mrs. Conway ist eine geborene Devaux. Das war früher einmal die bedeutendste Familie hier in der Gegend. Ihnen gehört Park House. Es war nett von Ihnen, diesen Vortrag zu halten«, wechselte sie entschlossen das Thema. »Schön zu sehen, dass Zugezogene sich in das Leben in der Stadt integrieren und hier und da aushelfen, und das, obwohl Sie eine vielbeschäftigte Karrierefrau sind! Ich muss gestehen, ich habe Ihren Vortrag sehr genossen! Ich hatte ja keine Ahnung, dass Sie schon so weit herumgekommen sind! Werden Sie wieder ins Ausland gehen?«
»Das bezweifle ich«, antwortete Meredith und verlangsamte vor einer Kreuzung ihre Fahrt. »Es gibt meistens mehr Leute, die ins Ausland wollen, als es im Ausland Posten gibt. Die einzigen Reisen, die ich heutzutage unternehme, sind meine täglichen Fahrten im Zug nach London und zurück. Ich wollte Katie nicht entmutigen; sie schien sich sehr für einen Beruf wie den meinen zu interessieren … aber so sind die Dinge nun einmal, fürchte ich. Und was meine Aushilfe in der Gemeinde angeht, so fürchte ich, dass ich nicht viel tun kann. Im Gegensatz zu Ihrer Damengesellschaft. Sie scheinen wirklich überall dabei zu sein.«
»Was sollte ich wohl sonst mit meiner Zeit anfangen?«, entgegnete Mrs. Pride einfach.
Sie waren vor den kleinen Reihenhäusern angekommen, in denen beide wohnten, Meredith ganz am Ende und Mrs. Pride direkt daneben, als Nachbarin.
Mrs. Pride spähte durch die Scheibe. »Außerdem, junge Leute wie Sie haben immer so viel andere Dinge zu tun! Vermutlich werden Sie dieses Wochenende wieder mit Arbeiten an Ihrem Haus verbringen?«
»Ich wollte die Küche in Angriff nehmen, ja. Ich habe nach einem walisischen Küchenschrank Ausschau gehalten, einem hübschen alten Stück, nach Möglichkeit antik. Auf jeden Fall alt. Aber im Augenblick gibt es keine Haushaltsauflösungen in der Gegend, und die Antiquitätengeschäfte haben nichts annähernd Passendes zu bieten.«
Ihre Begleiterin schüttelte ungläubig den Kopf. »Ich werde niemals verstehen, warum die Leute von heute all den alten Plunder kaufen wollen, den wir vor Jahren weggeworfen haben! Es gibt doch so wunderschöne moderne Küchen mit Arbeitsplatten aus Resopal und alles! Wenn Sie schon etwas Antikes haben müssen, warum gehen Sie dann nicht in den Hobbymarkt? Dort gibt es antike Möbel, die in flache Pakete zerlegt sind, mit Schrauben und allem drum und dran. Man muss sie nur noch zusammenstecken. Ich bin sicher«, und an dieser Stelle bedachte Mrs. Pride Meredith mit einem frivolen Blick, »dieser nette Polizist, mit dem Sie befreundet sind, würde Ihnen gerne beim Zusammenbauen helfen.«
»Er hat ebenfalls ziemlich viel zu tun«, sagte Meredith und wollte damit jede weitere Anspielung im Keim ersticken.
»Oooh!«, beharrte Mrs. Pride ungerührt und mit dem Taktgefühl eines Elefanten im Porzellanladen. »Dann lassen Sie uns hoffen, dass es nichts Ernstes ist! Wir wollen schließlich keine hässlichen Dinge wie Mord und dergleichen in unserem schönen Bamford!«
KAPITEL 2
»Wo ist denn deine Freundin heute Abend?«, fragte der Mann mit dem Schnurrbart.
Er stützte einen Ellbogen auf die Theke und straffte mit der freien Hand unmerklich die Revers seiner grünen Tweedjacke. Zu seiner sichtlichen Verärgerung wählte ein anderer Gast – offensichtlich in der Angst, dass die Sperrstunde kommen und er seine letzte Runde nicht rechtzeitig bestellen könnte – genau diesen Augenblick, um sich zwischen sie zu drängen und eine Bestellung aufzugeben. Ihm wurde die Sicht auf das Mädchen versperrt, und er bekam ihre Antwort nicht mit.
Unbekümmert wiederholte sie ihre Worte. »Sie hatte etwas anderes vor.«
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!