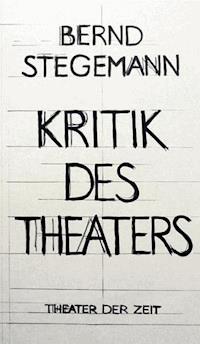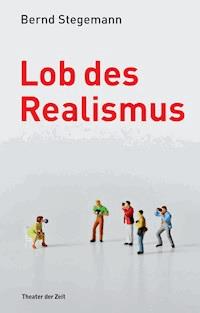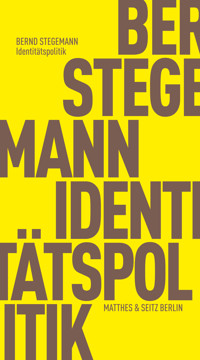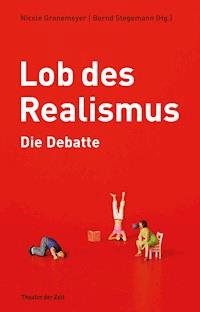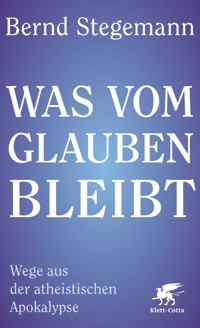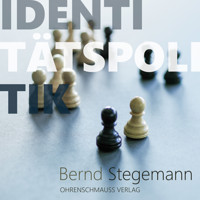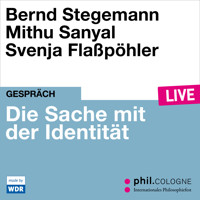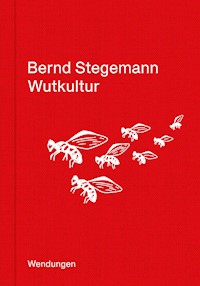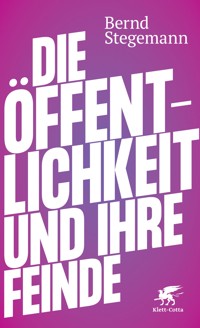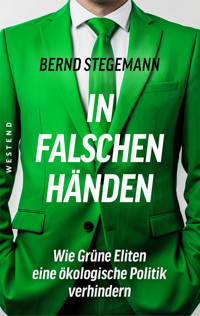
14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Westend Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Noch gestern wollten alle Grün sein. Heute gilt die Partei als Symbol für den Hochmut, der vor dem Fall kommt. Die Grünen scheitern und dieses Scheitern ist ein Ausdruck für die Krise unserer Gesellschaft. Die Moral des gebildeten Bürgers hat abgewirtschaftet. Allzu oft tritt sein Egoismus hervor. Man ist für Migration und lebt in den teuren Vierteln der Stadt. Man predigt Flugscham und ist bereits um die ganze Welt geflogen. Bernd Stegemann analysiert die existenziellen Widersprüche der Grünen, die als bürgerliche Milieupartei keinen Weg zur ökologischen Politik finden. Doch ihr Scheitern ist kein Grund zur Freude. Denn es würde um die Welt besser bestellt sein, wenn die Grünen ihren Hochmut überwinden könnten, und ihren "grünen" Auftrag ernst nehmen würden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 230
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Ebook Edition
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.westendverlag.de
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
ISBN: 978-3-98791-063-0
1. Auflage 2025
© Westend Verlag GmbH, Waldstr. 12 a, 63263 Neu-Isenburg
Umschlaggestaltung: Buchgut, Berlin
Umschlagmotiv: © Marat / AdobeStock
Satz: Publikations Atelier, Weiterstadt
Inhalt
Cover
Einleitung
Grüner Hochmut
Die Partei des neuen Individualismus
Aus Widersprüchen werden Parteien
Das neue Individuum
Das Grüne Paradigma
Ideologie
Fehler
Unsichtbare Ideologie
Ideologische Arroganz
Grüne Gefühle
Wachsender Widerstand
Radikale Gefühle
Ungläubige Fanatiker
Grenzen der Meinung
Betroffenheit und Macht
Grüne Selbstsucht
Ökologie der Angst
Panik-Prognosen
Luhmann und die Grünen
Angst-Politik
Etappen der Unsicherheit
Klimapolitik
Ökologische Politik
Die Kinderschuhe der Ökologie
Ökologie des Egoismus
»Folge der Wissenschaft!«
Natursinne
Grüner Zorn
Progressives Ressentiment
Eliten-Aktivismus
Grüne Ignoranz
Offene Grenzen
Geschlossene Brandmauer
Tierwohl, nein danke.
Robert Habeck
Ende
Anmerkungen
Orientierungspunkte
Cover
Inhaltsverzeichnis
Bernd Stegemann
In falschen Händen
Wie Grüne Eliten eine ökologische Politik verhindern
Einleitung
Am Ende ging alles sehr schnell. Am Vormittag des 6. November 2024 war Donald Trump zum amerikanischen Präsidenten gewählt, und am Abend verkündetet Olaf Scholz den Rausschmiss von Christian Linder. Die erste Regierung aus SPD, FDP und den Grünen1 ist damit gescheitert. Bereits im Frühjahr zeichnete sich dieses Ende ab, und lange schien es, als wären die Grünen die Hauptschuldigen. Denn ihre Deutungshoheit schmolz genau so schnell wie ihre Wahlergebnisse. Die Grünen wurden von der Partei, die jeder gut finden musste, zur Partei, die keiner mehr gut finden durfte.
Das Ampel-Aus fing mit dem Verlöschen des Grünen Lichts an, doch an ihrem Ende wirkten sie wie unbeteiligt. Die Grüne Unschuld stand am 7. November vorm Kanzleramt und beklagte sich, dass sich das alles »nicht richtig anfühlt«. In dieser Szene erscheinen wie in einem Brennglas die Grüne Politik und ihre Probleme: Man ist dabei und steht doch als moralische Instanz darüber. Man scheitert als Bundesregierung und stellt das eigene Gefühl nach vorn. Man ist Partei der Ökologie und vertritt die Interessen der eigenen Klientel. Im Scheitern der Grünen liegt der Schlüssel, um ihren verzweifelten Hochmut und ihren belehrenden Kleinmut zu verstehen.
Am 18. November beendete ich die Arbeit an diesem Buch. Es ist ein Buch über die Grünen und ein Buch gegen die Grünen. An beidem gibt es in Deutschland keinen Mangel. Denn in keinem anderen Industrieland ist eine Umweltschutzpartei so stark wie hier. Von den einen als Weltenretter geliebt, werden die Grünen von immer mehr Menschen abgelehnt. Die Teilung zwischen Zustimmung und Ablehnung verläuft entlang von Milieugrenzen. Akademisch gebildete Großstädter stehen unerschütterlich zu der Partei, die den Goldstandard ihrer Moral vertritt. Alle anderen schauen mit wachsender Skepsis auf die Belehrungen aus dem Elfenbeinturm. Warum soll man diese übersichtliche Lage nun noch einmal beschreiben?
Die Grünen scheitern. Und ihr Scheitern ist Ausdruck einer Krise unserer Gesellschaft. Die Moral des gebildeten Bürgertums scheint abgewirtschaftet. Allzu häufig offenbart sie sich als Doppelmoral: Man ist für Migration, wohnt aber selbst in einem gentrifizierten Stadtteil, dessen hohe Mieten jeden Flüchtling fernhalten. Man befürwortet den Ausbau von Windkraftanlagen und wohnt in der Stadt. Man begrüßt die bürokratische Gängelung der Wirtschaft, um sie beim klimafreundlichen Umbau zu überwachen, aber ist Beamter. Man predigt Flugscham und ist bereits um die ganze Welt geflogen. Diese plakativen Beispiele für die Doppelmoral sind aber nur der boulevardtaugliche Teil des Grünen Scheiterns. Die Ursache für das Zerbrechen dieses Images liegt nicht allein im Egoismus seiner Anhänger, sondern vielmehr in der fundamentalen Krise der spätindustriellen Gesellschaften. Dieser Niedergang trifft die Grünen besonders hart, da sie das privilegierte Kind der gegenwärtigen Widersprüche sind.
In modernen Gesellschaften gibt es eine Vielzahl von Krisen. Und als wäre die Lage noch nicht kompliziert genug, gibt es einen Streit darüber, welche Krise die Mutter aller Probleme sein soll und welche Medizin dagegen helfen könnte. Politische Parteien entstehen aus den elementaren Widersprüchen einer Epoche, und sie versuchen, eine Lösung dafür zu finden. Die Grüne Partei ist als Reaktion auf die ökologische Krise entstanden. Damit gehört sie zu den wenigen Parteien, die auf einen neuen Typus von Krise reagieren wollen. Doch die Ökologie ist bei den Grünen in den falschen Händen.
Bisher vertraten Parteien menschliche Interessen. Die sozialistischen Parteien kämpften für die Lebensbedingungen der Ausgebeuteten, die liberal-konservativen Parteien für die Interessen der bürgerlichen Eigentümer, und die faschistischen Parteien sind aus dem Ressentiment derjenigen entstanden, die sich zurückgesetzt und bedroht fühlten. Die Weltanschauungen unterscheiden sich kategorisch und führen entsprechend zu verschiedenen Arten von Parteien.
Die Grünen sind aus dem neuen Widerspruch der Ökologie entstanden. Ökologie bedeutet in seiner einfachsten Definition ein Denken, das die Auswirkungen menschlichen Handelns auf seine Umwelt beachtet. Waren bisher nur menschliche Akteure Gegenstand von Politik, tritt nun die ganze Welt in die Arena. Wie radikal sich ein ökologisches Denken von den bisherigen menschlichen Interessenskämpfen unterscheidet, wird erst langsam bewusst. Die Grünen stehen im Zentrum dieser Entwicklung eines ökologischen Bewusstseins, und zugleich sind sie ihr Bremsklotz. Denn Grüne Politik steht mit beiden Beinen in menschlicher Interessenspolitik.
Die These, die hier untersucht werden soll, lautet: Die Grünen sind die Partei des neuen Individualismus und nicht der ökologischen Wende. Die ökologische Dimension bleibt hinter den komplexen Ich-Ansprüchen verborgen. Die Grünen sind vor fünfundvierzig Jahren gegründet worden und könnten mittlerweile erwachsen sein. Doch sie agieren noch immer wie ein Teenager, der zwischen lautstarken Forderungen und beleidigtem Trotz schwankt. Die Grünen haben aber nicht nur das Erwachsenwerden vertagt, sie haben vor allem verpasst, die außermenschliche Dimension der Ökologie denkbar und fühlbar zu machen.
Was als Gutmensch mit seiner robusten Doppelmoral zum Spott im Kabarett taugt und was als Hassfigur für andere Parteien dient, ist darum nur die oberflächliche Beschreibung eines Phänomens, das die spätmoderne Gesellschaft prägt. Das neue Individuum ist die reflektierte Gestalt des alten Egoisten. Es nutzt die älteste Form von Politik, indem es die eigenen Ansprüche mit einer allgemeinen Wahrheit verknüpft, und es schließt daraus, dass seine Interessen die Richtung für alle vorgeben dürfen.
Das neue Individuum überführt die alte Anmaßung der Eliten in das schillernde Gewand der Gegenwart und produziert dabei ein Wunderwerk von Paradoxien: Die neuen Eliten verhalten sich wie empörte Teenager, die wissen, dass sie Teenager sind und darum empört sein dürfen. Ihr infantil herrisches Auftreten spekuliert auf die erwachsene Reaktion der Gesellschaft, die ihr Aufbegehren lobt. Das reflexive Individuum ist die trickreiche Gestalt des alten Egoismus, der seine selbstbewussten Ansprüche zur hochstehenden Moral verzaubert.
Lange wirkte der Zauber des reflektiert-naiven Zeitgenossen verführerisch, und vor allem die Medien waren seiner Behauptung erlegen, die progressive Richtung zu kennen. Doch jetzt, wo die Fassade bröckelt, wird sichtbar, wie wenig die Grünen als ökologische Vordenker taugen. Hinter der progressiven Behauptung tritt der auftrumpfende Individualismus hervor, und dieser neue Individualismus sucht nicht nach einer ökologischen Politik, sondern er selbst ist das Problem der Ökologie. Die massenhaften Ich-Ansprüche drohen das Netz der sozialen Systeme zu zerreißen. Wo jeder seine eigene Welt sein will, wird die gemeinsame Erde zum Schlachtfeld der Ansprüche. Und im globalen Maßstab zerreißen die milliardenfachen Konsumansprüche die ökologischen Netze schneller, als sie von der Natur wieder geheilt werden können. Die paradoxe Haltung des neuen Individualismus besteht darin, diese Überforderung zu beklagen und zugleich den Weg des Individualismus weiterzugehen. Die Krise der Ökologie ist zugleich eine Krise derjenigen, die einen Weg zur ökologischen Politik suchen.
Der neue Individualismus produziert nicht nur unendliche Ansprüche an die Welt, sondern er hat auch ein verfeinertes Sensorium für Diskriminierungen aller Art, so macht er die Umwelt zum Objekt seiner Achtsamkeit. Das sensible Ich klagt eine heile Welt ein, weil es sich darin wohlfühlen möchte. So wird die Ökologie durch die Brille der eigenen Empfindung betrachtet, und so werden Umwelt und Gesellschaft zu Objekten, die dem eigenen Wohlbefinden dienen sollen. Gute Luft und reines Wasser gehören zum gleichen Forderungskatalog, zu dem auch Meldestellen gegen »Hass und Hetze« gehören. Das Ziel aller Reinheits-Forderungen ist das eigene Befinden in der Welt. Die Umwelt muss vor Verschmutzung geschützt werden, wie die Minderheiten vor Diskriminierung und das eigene Ich vor Kränkungen bewahrt werden sollen.
Die Grüne Partei ist keine ökologische Partei, sondern eine Partei, in der die Ökologie die Rolle eines geliebten Haustiers einnimmt. Man würde vieles dafür tun, aber der Grund dafür ist die eigene Gefühlsbindung und kein Bewusstsein von der Eigenlogik des Lebewesens. Aus dieser Perspektivverschiebung folgt der seltsam infantile Stil der Grünen. Man fühlt sich von der schmutzigen Welt persönlich gekränkt und ist darum permanent entrüstet über nebensächliche Fehler. Ein falsches Wort oder ein Auto, das mit dem falschen Motor fährt, werden zum Skandal, hinter dem die realen Zusammenhänge verschwinden. Das empörte Ich wird zum Maßstab, durch den Nebensächliches gewaltig und Wichtiges unsichtbar wird.
Die radikale Ich-Perspektive ist das Kennzeichen des Grünen Milieus. Und genau in dieser Ich-Perspektive liegt der Widerspruch zwischen einer ökologischen Politik und einer menschlichen Interessenspolitik. Doch gerade dieser Kurzschluss aller Probleme auf die Ich-Perspektive und ihrem Wunsch nach Wohlbefinden ist das Erfolgsrezept innerhalb des Grünen Milieus. Er ist folgenreich für die Gesamtgesellschaft und gefährlich für die Ökologie der Welt. Das ökologische Scheitern ist also keine Folge einzelner geglückter oder missglückter Grüner Entscheidungen, sondern es ist die zwangsläufige Fehlentwicklung einer Partei, die für ihren gründenden Widerspruch noch immer keine politische Gestalt gefunden hat.
Ich halte die ökologische Frage für eine der relevantesten Fragen unserer Zeit, und ich hoffe, dass es bald in allen Industrienationen Parteien gibt, die sich auf den Weg zu einer ökologischen Politik machen. Eines der größten Hindernisse auf diesem Weg sehe ich in der Ich-Zentrierung der ökologischen Politik durch die Grünen. Je länger die Grünen mit Ökologie identifiziert werden und je mehr auffällt, dass sie die Partei eines Milieus sind, das von der globalen Ausbeutung am meisten profitiert und diesen Profit mit moralischen Skrupeln vor sich und der Welt legitimiert, desto mehr gerät die Ökologie in Misskredit.
Je länger die ungelösten Fragen der Ökologie in den falschen Händen der Grünen bleiben, desto tragischer wird es für die Welt. Grünen-Hasser werden in diesem Buch die Bestätigung für ihren Hass finden. Doch sie werden zugleich lernen, dass der Grund für die scharfe Kritik der Grünen ein gänzlich anderer sein muss. Die Grünen sind nicht gescheitert, weil sie eine ökologische Politik versucht haben. Und die Grünen scheitern nicht nur, weil sie innerparteilich den Widerspruch von hochgestimmter Predigt und machiavellistisch quotierter Machtpolitik bis zum Äußersten treiben. Vielmehr scheitern sie, weil sie bisher noch keine ernsthaften Versuche unternommen haben, die neuen Wege einer ökologischen Politik zu erforschen. Sie segeln unter falscher Fahne. Dafür muss man sie kritisieren und darf sie vielleicht sogar hassen.
Die Ignoranz gegenüber den unbeantworteten Fragen der Ökologie zeigt sich aktuell darin, dass die Grünen anstreben, eine Volkspartei zu werden, und traurig sind, dass sie vom Volk nicht genug geliebt werden. Der Irrtum wäre leicht aufzuklären. So wie jedes Milieu, dessen Ideologie sich als hegemonial empfindet, verwechseln die Grünen den Zuspruch der eigenen Blase mit der Meinung in der Bevölkerung. Dieser Trugschluss ist verständlich, da die Grünen in der privilegierten Position sind, dass ihre Meinung mit der Mehrheit der offiziellen Medien identisch ist. Dass sie in Tagesschau und heute-journal gelobt werden, während die AfD kategorisch verdammt wird, und dass die großen Zeitungen wie ZEIT, SPIEGEL oder Süddeutsche Zeitung wohlwollend über sie berichten und besorgt sind, wenn es ihnen einmal nicht gut ergeht, diese zugewandte Aufmerksamkeit hat die Grünen glauben lassen, die Liebe sei allgemein.2
Doch das ist eine optische Täuschung. Die Grünen sind die Partei des Milieus des neuen Individualismus, und dieses Milieu ist prägend für die Felder der symbolischen Ordnung. Medien, Hochschulen, Kunst- und Kultur-Einrichtungen sind die vorrangigen Arbeitsplätze der kreativen Klasse. Die Dominanz auf diesen Feldern bedeutet aber weder eine Mehrheit in der Bevölkerung noch sichert die hier propagierte Weltanschauung, dass sich eine Mehrheit davon überzeugen lässt. Und vor allem bedeutet die wechselseitige Bestätigung innerhalb des Milieus nicht, dass hier politisch sinnvolle Vorschläge oder ökologische Konzepte erarbeitet würden.
Die optische Täuschung des Grünen Milieus besteht darin, aus der kulturellen Hegemonie im eigenen Umfeld einen Wahrheits- und Machtanspruch für alle abzuleiten. Dass sie in der Homogenität der Meinungsblase die wenigen Andersdenkenden mit moralischer Einschüchterung aus dem Blickfeld drängen können, führt zu dem trügerischen Schluss, dass auch alle anderen ihnen folgen müssen. Je mehr sie realisieren, dass ihre Hoheit an den Grenzen ihrer Stadtviertel endet, desto empörter schimpfen sie über die unzähligen Abweichler in der Bevölkerung. Doch der inflationäre Nazi-Vorwurf, der innerhalb der Milieugrenzen noch zu ängstlichen Reaktionen führt, weckt außerhalb nur noch Achselzucken.
Die Ökologie ist bei den Grünen in falschen Händen, da der Anspruchs-Individualismus den Blick auf das eigene Wohlbefinden richtet und der bevormundende Politikstil das Thema »Ökologie« zu einem verhassten Politikfeld gemacht hat. Das strategische Problem der Grünen besteht darin, dass eine Milieu-Partei, die gerne eine Volkspartei wäre und meint, dafür das Volk erziehen zu müssen, ebendieses Volk gegen sich aufbringt. Und der fundamentale Widerspruch der Grünen Partei besteht darin, dass eine Politik aus der radikalen Ich-Perspektive im kategorischen Widerspruch zur Ökologie steht.
Das Grüne Scheitern ist das Scheitern der aktuell herrschenden Eliten, deren Denkweise nicht mehr zu den Problemen der Realität passt. Wie sich Eliten verhalten, die ihre Macht schwinden sehen, gehört zu den existentiellen Fragen einer jeden Gesellschaft. Die Selbstverteidigung der Eliten kritisch zu verfolgen, gehört zum Fundament der Demokratie. Um besser verstehen zu können, warum die Ökologie bei den Grünen Eliten in den falschen Händen ist, braucht es ein Buch über das Milieu und seine Partei.
Grüner Hochmut
Die Partei des neuen Individualismus
Aus Widersprüchen werden Parteien
Parteien organisieren die Vertretung von Interessen und Weltanschauungen. Sie entstehen aus gesellschaftlichen Widersprüchen und versuchen, diese durch politisches Handeln aufzulösen. Die sozialdemokratischen Parteien sind das beste Beispiel für solche Mühen und Erfolge. Ihre Geschichte enthält aber – ebenso wie die der konservativen Parteien – die Botschaft, dass eine erfolgreiche Aufhebung des treibenden Widerspruchs dazu führen kann, dass eine Partei ihren Auftrag verliert.
Die sozialdemokratischen Parteien und die konservativ-bürgerlichen Parteien sind im 19. Jahrhundert aus den grundlegenden Bruchlinien entstehender Industriegesellschaften hervorgegangen. Die sozialdemokratischen Parteien haben die marxsche Analyse des Gegensatzes von Kapital- und Arbeiterinteressen genutzt und daraus ihre Art von sozial gerechter Politik entwickelt. Die bürgerlichen Parteien machten hingegen das Eigentum zum Zentrum ihrer Politik und propagierten den Liberalismus als Freiheitsversprechen des erfolgreichen Einzelnen. Damit stellten sie sich gegen die marxsche Analyse und zugleich gegen die traditionellen Privilegien des Adels. Die Organisation der Parteien und die Art ihres politischen Auftretens hat sich aus ihrer Kritik an den ihrer Meinung nach falschen Verhältnissen abgeleitet.
Das Ideal linker Politik besteht in der Gleichheit aller Menschen. Um den Klassengegensatz aufzulösen, mussten die Klasseninteressen mit robusten Argumenten wie Streik und Klassenkampf durchgesetzt werden. Aufgabe linker Parteien war es, ein Bewusstsein der eigenen Klasse zu bilden. Das vereinzelte proletarische Subjekt sollte sich als Genosse in einer sozialistischen Internationalen begreifen, um gemeinsam für die Klasse der Ausgebeuteten zu kämpfen.
Das Ideal konservativer Politik ist hingegen die Freiheit jedes Einzelnen. Die Interessen der Eigentümer begründen ein anderes Bild vom Menschen als den proletarischen Massenmenschen und streben eine andere Art von Ordnungspolitik an als die Organisation von Kollektiven. Aus Sicht konservativer Parteien stehen sich darum nicht die Kollektive von Klassen gegenüber, sondern die Einzelinteressen sollen der Fluchtpunkt politischer Entscheidungen sein.
Mit den Grünen betrat 1980 eine neue Partei die Bühne, die bis heute im Rechts/Links-Spektrum nicht eindeutig zuzuordnen ist. Nach ihrer Selbstbeschreibung sind die Grünen eine linke ökologische Partei. Doch beide Attribute sind nur teilweise zutreffend, und in wesentlichen Aspekten gleichen sie eher einer Selbstbeschwörung, wenn nicht einer strategischen Lüge. Der Widerspruch, aus dem die Grünen hervorgegangen sind, wurde von ihnen weder in linke noch in ökologische Politik aufgelöst.
Dennoch ist ihr Erfolg der Beweis, dass sie einem relevanten gesellschaftlichen Widerspruch eine Stimme gegeben haben. Mit dem Erstarken von Industrie und Massenkonsum entstanden nicht nur die soziale Frage und die Freiheitsansprüche, sondern seitdem wachsen auch die Schäden, die das menschliche Tun der Natur und dem Erdsystem zufügen. Die Anerkennung, dass menschliches Handeln auch gegenüber seiner Umwelt nicht folgenlos bleibt, bildet den ökologischen Widerspruch, auf den die Grünen reagieren wollen. Dieser Widerspruch unterscheidet sich von anderen politischen Widersprüchen dadurch, dass auf der einen Seite der Mensch und auf der anderen Seite seine Umwelt steht. Am Umgang mit diesem neuen Widerspruch wächst und scheitert die Grüne Partei. Ihr Scheitern ist so verhängnisvoll, da bis heute keine andere politische Kraft entsteht, die diesen neuen und elementaren Widerspruch im politischen System repräsentieren könnte. Die Frage lautet darum: Ist die Ökologie bei den Grünen in den richtigen Händen?
Parteien entstehen und vergehen mit der sozialen Realität, auf die sie reagieren. Parteien sind, auch wenn das die traditionsreicheren unter ihnen von sich glauben wollen, kein Selbstzweck. Sie können verschwinden, wenn sie ihren Auftrag erfüllt haben und durch ihre Politik die Missstände behoben sind, deretwegen sie einst gegründet wurden.
Die sozialdemokratischen Parteien stehen in Europa und auch in Deutschland vor diesem Problem. Arbeiter und Angestellte sind durch Sozialversicherungen und in der Anerkennung ihrer Berufe dem Besitzbürger nicht mehr fundamental unterlegen. Es besteht zwar noch die große Ungerechtigkeit in der Verteilung der Vermögen, doch taugen diese Zahlen, so erschreckend sie auch sind, kaum noch dazu, um politische Energien freizusetzen. Mit der gefühlten Gleichrangigkeit aller Einwohner und der Abschaffung der extremen Ungleichheit in den Lebensbedingungen scheint die Empörung über die systemische Ungerechtigkeit des Kapitalismus ermattet zu sein. Seit die soziale Frage befriedet und unter einem Berg von Bürokratie begraben ist, suchen die sozialdemokratischen Parteien nach einem neuen Widerspruch. Dass ihre Suche bisher wenig erfolgreich ist, hängt auch mit den Grünen zusammen.
Die konservativen Parteien waren, wie es ihr Name schon verrät, weniger auf kämpferische Umgestaltung als auf Sicherung des Besitzstandes aus. Doch die Mittelschicht steht inzwischen auch von verschiedenen Seiten unter Druck. Die neoliberale Agenda bedroht durch die Entgrenzung der Märkte auch die wohlhabenderen Bürger. Die entscheidende Veränderung besteht aber darin, dass es innerhalb der Mittelschicht eine Spaltung in das Milieu einer alten und einer sich neu bildenden Mittelschicht gibt.
Auf eine solche neue soziale Klasse machte bereits Karl Mannheim 1929 aufmerksam, als er das Milieu einer »sozial freischwebenden Intelligenz«1 beschreiben wollte. Damit meinte er die Bildungsschicht, deren Weltanschauung nicht mehr aus ihrer Stellung innerhalb der materiellen Ordnung resultiert, wie es etwa bei Bauern oder Proletariern offensichtlich ist. Die neue Intelligenz erwächst nicht aus den konkreten sozialen Verhältnissen, sondern schwebt frei über den Dingen, wo sie sich als eigener Wert bildet. Vor allem der deutsche Kulturprotestantismus hatte die Bildung zu einem Mittel erhoben, mit dem man sich aus den Verhältnissen befreien und sich zugleich ihnen gegenüber in eine moralische Position bringen konnte. Man wusste es besser, nicht weil man Arbeiter, Bauer oder Techniker war, sondern weil man mit den richtigen Werten auf deren Tun schaute.
Die Unzugehörigkeit zu einer Klasse wurde zur Qualität verklärt, da sie eine alles überblickende Intelligenz hervorbringt, die sich berufen fühlt, alles zu bewerten. So ist der freischwebenden Intelligenz ein Drang zum moralischen Furor eigen, da sie ihren »Mangel an sozial-vitaler Bindung«2 kompensieren muss. Zugleich festigt sie ihre eigene Identität, indem sie sich der Bedeutung ihrer »Mission« versichert. Ihr Belehrungseifer resultiert aus einer Bindungslosigkeit, die mit weltanschaulichen Überzeugungen kompensiert werden soll. Die Wurzeln dieses Milieus reichen bis ins 19. Jahrhundert und erfahren durch die postmaterielle Revolte der 1968er einen Bedeutungsschub, der sich in der Gesellschaft der Singularitäten in der Gegenwart machtvoll ausformuliert.
Zur Partei fand dieses Milieu aber erst mit den Grünen. Die Besonderheit dieser Klasse, die keine Klasse sein will, ist noch immer schwer zu erfassen. Denn im Gegensatz zum Proletarier und Besitzbürger gründet ihre Identität nicht in materiellen Interessen, sondern in einer paradox gebauten Individualität. Die Widersprüche dieser neuen Mittelschicht sind darum grundlegend anders gelagert als die der anderen Parteien. Und die Organisation der Interessen, die es braucht, um daraus politische Entscheidungen zu machen, ist ebenfalls grundlegend verschieden.
Hatten die alten Parteien als Zentrum ihrer Politik reale Widersprüche, die sich durch die Ökonomie geformt haben, und materielle Interessen, die sie als Partei durchsetzen wollten, so sind die Grünen aus Paradoxien entstanden. Ihre grundlegende Paradoxie besteht darin, dass sie die Interessenvertretung des neuen Individualismus sind und zugleich ökologische Politik anstreben. Individualismus und Ökologie stehen aber in einer unauflösbaren Spannung zueinander; die ökologische Einsicht besteht darin, dass die Ansprüche des Individualismus die Ursache ökologischer Folgeprobleme sind. Dieser Widerspruch wird von den Grünen nicht in der Politik aufgehoben, indem sie die Interessen der einen oder der anderen Seite vertreten, sondern sie stärken beide Seiten gleichzeitig.
Der Umgang mit Paradoxien ist ungleich komplizierter als der mit Widersprüchen. Die Grünen sind als Partei die institutionelle Gestalt der paradoxen Widersprüche. Sie sind Partei und Anti-Partei, sie wollen regieren und zugleich protestieren, sie wollen Politiker sein und Aktivisten, sie wollen Milieu-Partei sein und Volkspartei, und ihre Vorschläge sind Teil der Lösung und Teil des Problems. Zu welcher Seite hin die Paradoxien aufgelöst werden, entscheidet darüber, wie konstruktiv grüne Politik sein kann oder wie destruktiv sie wirkt. Da im Zentrum der Grünen der neue Individualismus steht, muss man zuerst ihn skizzieren, um die Folgeprobleme erklären zu können.
Das neue Individuum
Der neue Individualismus zeichnet sich durch besonders abgründige Paradoxien aus. Zum einen wird die Befreiung von allen beengenden Bindungen betrieben: Das Ich soll sich emanzipieren, um dadurch selbstbestimmter leben zu können. Die eigenen Bedürfnisse werden zum Maßstab des Handelns, und das Leben gilt umso geglückter, je mehr das befreite Subjekt sich selbst verwirklicht zu haben glaubt. Die erste Paradoxie besteht darin, dass in einer Gesellschaft, in der alle ihre Wünsche verwirklichen wollen, ebendiese Wunscherfüllung verhindert wird.
Je mehr der neue Anspruchs-Individualismus zur Norm wird, desto mehr ist das einzelne Ich davon überzeugt, dass seine Wünsche einen Rechtsanspruch auf Verwirklichung haben. Eine Gesellschaft, in der jedes Bedürfnis durch Gesetze geschützt wird, widerspricht aber dem Bedürfnis nach Freiheit. So wird die Emanzipation von zwei gegenläufigen Kräften beherrscht: Das Schutzbedürfnis des einen ist die Unfreiheit des anderen. Und da die Bedürfnisse unendlich sind, erzeugen sie eine Ressourcenknappheit, in der die Wünsche in Konkurrenz zueinander geraten. Individuen, die ihre Bedürfnisse zum Zentrum der Gesellschaft machen, erschaffen einen Staat, im dem die Regeln des Lebens immer engmaschiger werden. Die Dialektik der Biopolitik3 besteht darin, dass die Freiheit des Individuums zu einem Anspruch nach umfänglicher Sicherheit wird, die zur Unfreiheit aller wird.
Aus dem Individualismus-Paradox entsteht die Gesellschaft der Singularitäten.4 Hier wird das einzelne Ich nicht nur zum Maßstab allgemeiner Gesetze, sondern die Originalität des Ich-Seins wird zum Zwang, um auf den Märkten der Arbeitskraft und sozialen Beziehungen erfolgreich sein zu können. Nur wer sich erkennbar als besonderes Subjekt zeigt, steigert seine Attraktivität. So unterliegt die Befreiung einem neuen Zwang, sich permanent selbst zu optimieren. Das zweite Paradox besteht also darin, dass die Suche nach den positiven Emotionen der Befreiung zu einer Gesellschaft führt, die negative Emotionen bereitet: »Überforderung und Neid, Wut, Angst, Verzweiflung und Sinnlosigkeit«5 werden zur alltäglichen Erfahrung des einzigartigen Individuums. Die singulären Menschen fühlen sich von der Welt und ihren Mitmenschen verlassen.
Aus dem psychologischen Symptom der Singularität entsteht das dritte Paradox: Je sensibler die Wünsche des Ich befolgt werden, desto häufiger sind die Kränkungen, die die Welt dem Ich bereiten. Dieses Paradox findet sich in verschiedenen Varianten. Am bekanntesten ist das Integrationsparadox: Je besser Minderheiten in der Mehrheitsgesellschaft integriert sind, desto genauer wird nach möglichen Diskriminierungen gefahndet und umso empörter wird auf den kleinsten Fund reagiert.6 Die Steigerung der Sensibilität führt nicht nur zum Sensibilitätsparadox, sondern sie verlagert die politischen Ansprüche von materiellen Interessen auf postmaterielle Werte. Einkommen und Besitz treten hinter die Erwartung an Respekt und die Forderung nach einem gelungenen Leben zurück.
Das vierte und aktuell folgenreichste Paradox besteht in der Macht des Opfers. Je wichtiger die Einzigartigkeit wird, um Erfolg haben zu können, desto wertvoller wird der Opferstatus. Denn nichts verleiht mehr Aufmerksamkeit und mehr Zuspruch als eine anerkannte Opferidentität. Jede Identitätsgruppe fahndet danach, welche Merkmale sie als Opfer stark machen kann. Auf der anderen Seite wächst mit der Opfermacht die Fürsorgepflicht. Wenn das Opfer besondere Rechte reklamieren kann, kann derjenige, der sich besonders fürsorglich darum kümmert, einen Statusgewinn in der moralischen Hierarchie erreichen.7 Der besondere Umgang des Grünen Milieus mit dem Thema der Migration erklärt sich aus dieser Fixierung auf die Opferidentitäten, denn keine andere Gruppe hat eine so erkennbare Opfergeschichte und nirgendwo sonst ist der moralische Statusgewinn sichtbarer. Das Paradox besteht darin, dass das Opfersein verstetigt wird, je größer der Gewinn ist, der sich daraus ziehen lässt. Und das Paradox besteht in der Blindheit der Fürsorge, die die Folgeprobleme ihrer Statusspiele nicht sehen will, wenn sie beispielsweise Slogans propagiert, in denen »no borders« verlangt werden, ohne die Überforderung der Gesellschaften zu realisieren.
Der menschliche Wunsch, kein Opfer sein zu wollen, wird abgelöst von dem Wunsch, als Opfer besondere Aufmerksamkeit zu genießen. Und die Fürsorge wird zur Bestätigung des Grünen Milieus, eine höherwertige Moral zu haben, die um den Preis erkauft wird, die Gesellschaft zu belasten. Das Opfer-Paradox führt zu der unendlichen Produktion von Opferberichten, in denen Leid ausgeführt und Anklagen gegen die Mehrheitsgesellschaft erhoben werden.8 In der besonderen Achtung vor der Opferidentität suchen die neuen Individuen nach einer Erlösung aus all ihren Paradoxien. Man ist anspruchsvoll und unglücklich, doch man ist ein guter Mensch, da man mit den Opfern fühlt.
Der wundersame Mechanismus in einer Gesellschaft der Singularitäten besteht also darin, dass Widersprüche in dem Maße produziert werden, wie sie überwunden werden sollen. Den Kräften des Individualismus scheint eine Dialektik innezuwohnen, die immer neue Probleme findet, je mehr von den alten Abhängigkeiten aufgelöst werden. Im Zeitalter der Singularitäten ist die Individualisierung in ein Stadium geraten, in dem es durch eine Steigerung der Sensibilität und eine bessere Befriedigung der Ansprüche keine Erlösung mehr gibt. Die politisch gefährliche Folge der ausbleibenden Erlösung besteht darin, dass die emanzipatorischen Anstrengungen umso mehr Kränkungen verursachen, je mehr sie den Wünschen des Einzelnen gerecht werden wollen.
Die Dialektik von Selbsterhöhung und Erniedrigung nennt der Soziologe Andreas Reckwitz das »Ende der Illusionen«. Die Illusion besteht darin zu glauben, dass durch Emanzipation das Leben glücklicher und die Gesellschaft gerechter würde. Doch diese Illusion löst sich nicht nur nicht ein, sondern sie endet sogar im Gegenteil: Je höher der Wert der Emanzipation bewertet wird, desto größer ist die Erschöpfung und desto tiefer gehen die Kränkungen.
Alle diese Paradoxien münden in dem grundlegenden Widerspruch, der zwischen den Ansprüchen des neuen Individuums an die Welt und den ökologischen Folgen für die Welt entsteht. Je mehr sich das Individuum als anspruchsberechtigtes Opfer behauptet, umso mehr gerät die soziale und ökologische Umwelt in die Rolle des Dienstleisters. Je mehr Grüne Politik das neue Individuum stärkt, indem sie seine Interessen vertritt, umso größer wird der Widerspruch zu den Folgeproblemen seiner Ansprüche.
Das Milieu der Singularitäten ist kein Irrläufer menschlicher Entwicklung, sondern es entspricht den Anforderungen, die eine herrschende Klasse in der Spätmoderne erfüllen muss. Es ist gebildet, weltoffen, kreativ, und zugleich setzt es seine Interessen durch, indem es den vorpolitischen Raum mit seinen Ideen und Werturteilen dominiert. War einst das Bürgertum mit seinem Besitz an Produktionsmitteln und der Adel mit seinen Privilegien dazu legitimiert, politische Entscheidungen zu fällen, reklamiert diese Macht heute das Milieu der kreativen akademischen Klasse für sich.
Das Grüne Paradigma
Paradigmen sind leitende Gedanken und Sinnzusammenhänge, die für eine bestimmte Zeit allgemein anerkannt werden. Mit der 68er-Bewegung entstand das postmaterialistische Paradigma.9