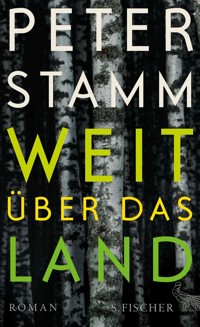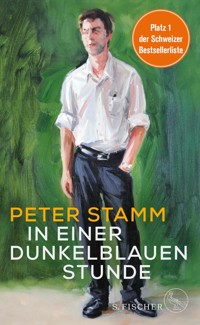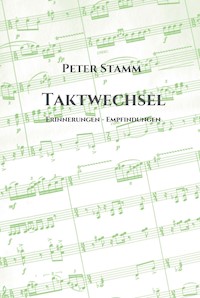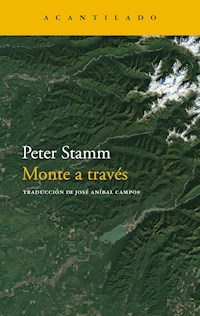8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
›In fremden Gärten‹ ist eine Sammlung von Erzählungen, jede für sich ein Buch, so dicht, brillant und nuancenreich hat sie Peter Stamm erzählt, der nach seinen großen Erfolgen – ›Agnes‹, ›Sieben Jahre‹ und ›Seerücken‹ – mit Raymond Chandler und Richard Ford verglichen wird. Die Helden kommen aus den unterschiedlichsten Orten. Sie leben zu zweit, allein, haben eine Familie und Kinder – oder auch nicht. Manche sind jung, andere alt. Alle sind sie irgendwohin unterwegs, alle scheinen sie auf etwas zu warten. Auf einen Zug oder auf ein Schiff, auf eine Geste der Liebe oder einfach auf das Ende, wie die kranken Reisenden auf dem Weg nach Lourdes. Lebensgeschichten, die man nicht missen möchte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 143
Ähnliche
Peter Stamm
In fremden Gärten
Erzählungen
FISCHER E-Books
Inhalt
Er blickte zum Fenster hinaus
und sah in einem fremden Garten
viele Menschen beisammen,
von denen er einige sogleich erkannte.
Johann Wolfgang von Goethe»Wilhelm Meisters Lehrjahre«, Siebtes Buch
Der Besuch
Das Haus war zu groß. Die Kinder hatten es ausgefüllt, aber seitdem Regina allein darin wohnte, war es größer geworden. Ganz langsam hatte sie sich aus den Räumen zurückgezogen, war ihr ein Zimmer nach dem anderen fremd geworden und schließlich abhanden gekommen.
Nachdem die Kinder ausgezogen waren, hatten sie und Gerhard sich ein wenig ausgebreitet. Vorher hatten sie das kleinste Zimmer im Haus bewohnt, jetzt war endlich Platz für alles, für ein Arbeitszimmer, für ein Näh- und ein Gästezimmer. Dort würden die Kinder schlafen, wenn sie zu Besuch kamen, die Enkelkinder. Aber es gab nur ein Enkelkind. Martina war die Tochter von Verena, die mit einem Schreiner verheiratet war im Nachbardorf. Als Martina klein war, hatte Regina sie ein paarmal gehütet. Aber Verena wollte immer, dass die Mutter zu ihr komme. Auch Otmar und Patrick, Reginas Söhne, blieben nie über Nacht. Lieber fuhren sie spätabends in die Stadt zurück. Schlaft doch hier, sagte Regina jedes Mal, aber die Söhne mussten früh zur Arbeit am nächsten Tag oder fanden sonst einen Grund zu fahren.
Erst hatten die Kinder noch Schlüssel gehabt zum Haus. Regina hatte sie ihnen fast aufgedrängt, die großen alten Schlüssel. Es war selbstverständlich gewesen für sie. Aber mit den Jahren hatte eines nach dem anderen seinen Schlüssel zurückgegeben. Sie hätten Angst, sie zu verlieren, sagten sie, sie könnten ja klingeln, die Mutter sei doch immer zu Hause. Und wenn etwas passierte? Sie wussten ja, wo der Kellerschlüssel versteckt war.
Einmal blieben die Kinder dann doch über Nacht, alle drei, als Gerhard im Sterben lag. Regina hatte sie angerufen, und sie kamen, so schnell sie konnten. Sie kamen ins Krankenhaus und standen um das Bett herum und wussten nicht, was sagen oder tun. Die Nacht über lösten sie sich ab, und wer nicht im Krankenhaus war, war im Haus. Regina bezog die Betten und entschuldigte sich bei den Kindern, weil in Verenas Zimmer die Nähmaschine stand und bei Otmar der große Schreibtisch, den Gerhard für wenig Geld hatte kaufen können, als die Firma neue Büromöbel anschaffte.
Regina hatte sich hingelegt, um sich etwas auszuruhen, aber sie konnte nicht schlafen. Sie hörte die Kinder in der Küche leise reden. Am Morgen gingen sie alle zusammen ins Krankenhaus. Verena schaute immer wieder auf die Uhr, und Otmar, der Älteste, telefonierte mit seinem Mobiltelefon, um Termine abzusagen oder zu verschieben. Gegen Mittag starb der Vater, und Regina und die Kinder gingen nach Hause und taten, was zu tun war. Aber schon an diesem Abend fuhren wieder alle. Verena hatte gefragt, ob es in Ordnung sei, ob die Mutter zurechtkomme, und versprach, früh am nächsten Tag dazusein. Regina schaute den Kindern nach und sah, wie sie vor dem Haus miteinander redeten. Sie fühlte sich ihnen ausgeliefert. Sie wusste, worüber sie sprachen.
Nach Gerhards Tod war das Haus noch leerer. Im Schlafzimmer öffnete Regina die Läden tagsüber nicht mehr, als fürchte sie sich vor dem Licht. Sie stand auf, wusch sich und machte Kaffee. Sie ging zum Briefkasten und holte die Zeitung. Das Schlafzimmer betrat sie den ganzen Tag über nicht. Irgendwann, dachte sie, würde sie nur noch das Wohnzimmer und die Küche bewohnen und durch die anderen Räume gehen, als lebten Fremde darin. Dann fragte sie sich, welchen Sinn es überhaupt gehabt hatte, das Haus zu kaufen. Die Jahre waren vorübergegangen, die Kinder wohnten jetzt in ihren eigenen Häusern, die sie nach ihrem Geschmack eingerichtet hatten und die praktischer waren und voller Leben. Aber auch diese Häuser würden sich irgendwann leeren.
Im Garten gab es ein kleines Vogelbad, und im Winter fütterte Regina die Vögel, lange bevor Schnee lag. Sie hängte kleine Fettkugeln in den Japanischen Ahorn, der vor dem Haus stand. In einem sehr kalten Winter erfror der Baum, im nächsten Frühling schlug er nicht mehr aus und musste gefällt werden. Im Sommer ließ Regina nachts die Fenster im oberen Stock offen stehen und hoffte, ein Vogel oder eine Fledermaus verirre sich in die Räume oder niste sich ein.
Wenn ein Geburtstag zu feiern war, lud Regina die Kinder ein, und manchmal hatten wirklich alle Zeit und kamen. Regina kochte das Mittagessen und wusch ab in der Küche. Sie machte Kaffee. Als sie in den oberen Stock ging, um eine Packung Kaffee zu holen, standen die Kinder da in ihren alten Zimmern wie Museumsbesucher, scheu oder unaufmerksam. Sie lehnten an den Möbeln oder hockten auf dem Fensterbrett und redeten über Politik, über die letzten Ferien, über ihre Arbeit. Beim Essen hatte Regina immer wieder versucht, das Gespräch auf den Vater zu bringen, aber die Kinder waren dem Thema ausgewichen, und schließlich hatte sie es aufgegeben.
Diese Weihnachten war Verena zum ersten Mal nicht nach Hause gekommen. Sie verbrachte die Feiertage mit ihrem Mann und Martina in den Bergen, im Ferienhaus der Schwiegereltern. Regina hatte die Geschenke wie immer auf dem Kleiderschrank im Schlafzimmer versteckt, als könne jemand danach suchen. Sie bereitete das Weihnachtsessen vor. Sie leerte die Abfälle auf den Komposthaufen, auf dem noch ein Rest Schnee lag. Es hatte vor einer Woche etwas geschneit und war seither kalt gewesen, trotzdem war der meiste Schnee verschwunden. Regina versuchte, sich zu erinnern, wann es zum letzten Mal weiße Weihnachten gegeben hatte. Dann ging sie wieder ins Haus und stellte das Radio an. Auf allen Kanälen lief Weihnachtsmusik. Regina stand am Fenster. Sie hatte kein Licht gemacht. Sie schaute hinüber zu den Nachbarn. Als sie das Licht schließlich einschaltete, erschrak sie und machte es gleich wieder aus.
An Reginas fünfundsiebzigstem Geburtstag kam die ganze Familie zusammen. Sie hatte alle in ein Restaurant eingeladen. Das Essen war gut, es war ein schönes Fest. Otmar und seine Freundin gingen als Erste nach Hause, Patrick ging kurz danach, und dann verabschiedeten sich auch Verena und ihr Mann. Martina hatte ihren Freund mitgebracht, einen Australier, der für ein Jahr als Austauschschüler mit ihr aufs Gymnasium ging. Sie sagte, sie wolle noch nicht heim. Es gab Streit, da sagte Regina, Martina könne doch bei ihr übernachten. Und ihr Freund? Sie habe ja genug Zimmer, sagte Regina. Sie begleitete Verena und ihren Mann hinaus. »Du passt auf, dass sie keine Dummheiten macht«, sagte Verena.
Regina ging zurück in die Gaststube und bezahlte die Rechnung. Sie fragte Martina, ob sie noch irgendwo hingehen wolle mit ihrem Freund, sie könne ihr einen Schlüssel geben. Aber Martina schüttelte den Kopf, und der Freund lächelte.
Zu dritt gingen sie nach Hause. Der Australier hieß Philip. Er sprach kaum Deutsch, und Regina hatte seit vielen Jahren kein Englisch mehr gesprochen. Als junge Frau hatte sie ein Jahr in England verbracht, kurz nach dem Krieg, hatte bei einer Familie gewohnt und sich um die Kinder gekümmert. Es war ihr damals gewesen, als käme sie erst richtig auf die Welt. Sie lernte einen jungen Engländer kennen, ging an ihren freien Abenden mit ihm in Konzerte und in Pubs und küsste ihn auf dem Nachhauseweg. Vielleicht hätte sie in England bleiben sollen. Als sie in die Schweiz zurückkehrte, war alles anders.
Regina schloss die Tür auf und machte Licht. That’s a nice house, sagte Philip und zog die Schuhe aus. Martina verschwand im Bad, um zu duschen. Regina brachte ihr ein Handtuch. Durch das Milchglas der Duschkabine sah sie Martinas schlanken Körper, den in den Nacken gelegten Kopf, das lange dunkle Haar, ein Fleck.
Regina ging in die Küche. Der Australier hatte sich an den Tisch gesetzt. Er hatte einen winzigen Computer auf den Knien. Sie fragte ihn, ob er etwas trinken wolle. Do you want a drink, sagte sie. Der Satz klang wie aus einem Film. Der Australier lächelte und sagte etwas, was sie nicht verstand. Er winkte sie zu sich und zeigte auf den Bildschirm seines Computers. Regina trat zu ihm und sah das Luftbild einer Stadt. Der Australier zeigte auf einen Punkt. Regina verstand nicht, was er sagte, aber sie wusste, dass er dort wohnte und dass er dorthin zurückkehren würde, wenn das Jahr hier vorüber war. Ja, sagte sie, yes, nice, und lächelte. Als der Australier auf eine Taste drückte, entfernte sich die Stadt, und man sah das Land und das Meer, ganz Australien und schließlich die ganze Welt. Er schaute Regina mit einem triumphierenden Lächeln an, und es war ihr, als sei sie ihm viel näher als ihrer Enkelin. Sie wollte ihm näher sein, weil er Martina verlassen würde, wie Gerhard sie verlassen hatte. Diesmal wollte sie auf der Seite der Stärkeren sein, auf der Seite derer, die gingen.
Regina bezog das Bett in Otmars Zimmer. Martina war heraufgekommen. Sie hatte sich wieder angezogen.
»Soll ich dir einen Pyjama geben?«, fragte Regina.
»Wir können in einem Bett schlafen«, sagte Martina, als sie sah, dass Regina zögerte. »Du musst es Mama ja nicht auf die Nase binden.«
Sie legte der Großmutter den Arm um die Schultern und küsste sie auf die Wange. Regina schaute ihre Enkelin an. Sie sagte nichts. Martina folgte ihr die Treppe hinunter und in die Küche, wo Philip etwas in seinen Computer tippte. Martina stellte sich hinter seinen Stuhl und legte ihm die Hände auf die Schultern. Sie sagte etwas auf Englisch zu ihm.
»Wie gut du das kannst«, sagte Regina. Martina kam ihr sehr erwachsen vor in diesem Augenblick, vielleicht zum ersten Mal, erwachsener als sie selbst, voll von der Kraft und Zuversicht, die Frauen brauchten. Regina sagte gute Nacht, sie gehe zu Bett. Da saßen Martina und Philip noch in der Küche, als sei es ihre Küche, als sei es ihr Haus. Aber das störte Regina nicht. Seit langer Zeit hatte sie wieder das Gefühl, das Haus sei voll. Sie dachte an Australien, wo sie nie gewesen war. Sie dachte an die Luftaufnahme, die Philip ihr gezeigt hatte, und dann an Spanien, wo sie ein paarmal Urlaub gemacht hatten mit den Kindern. Regina stand im Bad und putzte sich die Zähne. Sie war müde. Als sie in den Flur trat und unter der Küchentür das Licht durchscheinen sah, war sie froh, dass Martina und Philip noch wach waren.
Regina lag im Bett. Sie hörte, wie Philip ins Bad ging und duschte. Sie wollte noch einmal aufstehen und ihm ein Handtuch bringen, dann ließ sie es bleiben. Sie stellte sich vor, wie er aus der Dusche kam, sich mit dem feuchten Handtuch von Martina abtrocknete, wie er durch den Flur zur Küche ging, wo Martina auf ihn wartete. Die beiden umarmten sich und gingen in den oberen Stock und legten sich zusammen ins Bett. Dummheiten, hatte Verena gesagt, und sie solle aufpassen. Aber das waren keine Dummheiten. Alles ging so schnell vorbei.
Regina stand noch einmal auf und trat in den Flur, ohne Licht zu machen. Sie stand in der Dunkelheit und lauschte. Nichts war zu hören. Sie ging ins Bad. Von einer Straßenlaterne drang etwas Licht in den Raum. Das Frottiertuch hing über dem Rand der Badewanne. Regina nahm es und drückte es an ihr Gesicht. Es fühlte sich kühl an auf der Stirn und hatte einen fremden Geruch. Sie legte es hin und ging zurück in ihr Zimmer.
Als sie wieder im Bett lag, dachte sie an Australien, das sie nie sehen würde. Auch Spanien würde sie wohl nicht mehr sehen, dachte sie, aber eine Reise würde sie noch machen.
Die brennende Wand
Aus dem Fernseher war nur Rauschen zu hören. Henry stellte den Ton so laut es ging und trat ins Freie. Es war immer noch heiß. Er drehte an der Satellitenschüssel, die auf einem selbstgebastelten Holzgestell auf dem Asphaltplatz stand. Er kannte die ungefähre Position des Satelliten, Südost. Westen war da, wo die Sonne unterging. Dann war das Rauschen plötzlich verschwunden, und Henry hörte Stimmen und Musik. Er stieg die Metalltreppe hoch. Es war stickig in dem kleinen Verschlag hinter der Fahrerkabine, seinem Zuhause. Ein Bett, ein Stuhl, ein Fernseher, ein Kühlschrank, alles, was man braucht. Fenster gab es nicht, aber an den Wänden hingen zwei amerikanische Flaggen, eine Marlboro-Reklame und das Plakat einer Erotikmesse, das Henry von irgendeiner Bretterwand gerissen hatte. Er schaltete den Fernseher aus, nahm den Klappstuhl und setzte sich vor den Wagen in die Abendsonne. Die aufeinandergestapelten Container warfen lange Schatten.
Die Wohnwagen der anderen standen noch im Nachbardorf, wo gestern Vorstellung gewesen war. Sie hatten den ganzen Tag gebraucht, um die Autos und alles andere hierherzubringen und die Tribüne aufzubauen. Am Mittag hatte es geregnet, aber Joe war schon vorher schlechter Laune gewesen. Einmal so, einmal so, das war Joe. Und Charlie war sonstwo gewesen, und Oskar hatte irgendwas an seinen Motorrädern geklempnert. Henry hatte wieder einmal die ganze Arbeit allein gemacht. Henry, der Feuerteufel. In Wirklichkeit war er Mädchen für alles, Idiot für alles, der Nachtwächter, der dumme Hund. Nur während der Vorstellungen war er der Feuerteufel, der auf dem Dach des Autos lag, wenn Oskar durch die brennende Wand fuhr.
Die anderen hatten schöne Hänger, den von Joe konnte man nach allen Seiten ausziehen, eine richtige Wohnung war das, mit Polstergruppe und Video und allem Drum und Dran. Henry wollte auch so einen Hänger. Und eine Frau wollte er und ein Kind. So viel Zeit hatte er nicht mehr bis vierzig, und der Chef hätte auch nichts dagegen, wenn es die Richtige wäre. Eine wie die Jacqueline von Oskar, die Verena von Charlie, eine wie die Petra von Joe, die auch für Henry kochte und manchmal seine Kleider wusch. Die anderen hatten alles, und er hatte nichts. Aber eine Frau kostete mehr als eine neue Hose.
Henry konnte nicht klagen. Er hatte seine Ruhe, und er kam herum. Eigentlich konnte er es nicht besser haben. Was brauchte er denn schon? Es ging ihm gut jetzt, besser als damals in der DDR. Da war er Melker gewesen. Nach dem Fall der Mauer war er arbeitslos geworden. Beschissen und betrogen hatte man ihn. Er hatte herumgelungert, hatte Streit angefangen und das bisschen Geld, das er vom Sozialamt bekam, im Spielsalon verloren. Dann war eines Abends Joe mit seinen Leuten in die Stadt gekommen, und nach der Vorstellung ging Henry zu den Artisten und half ihnen beim Abbauen der Tribüne. So einen wie ihn könne man gebrauchen, sagte Joe, und Henry grinste. Das hatte man nicht oft zu ihm gesagt. Da schloss er sich der Truppe an, fuhr einfach mit, als sie die Stadt am nächsten Morgen verließen. Und seither zog er mit ihnen durchs Land, von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf. Er stellte seine Antenne auf, bewachte die Autos und knallte jeden Abend mit dem Kopf durch die brennende Wand.
Der Feuerteufel, das war Petras Idee gewesen, Henry, der Feuerteufel. Seit sechs oder sieben Jahren war er bei der Truppe, lebte er in seinem Verschlag. Dieses Jahr kriegst du einen Hänger, hatte Joe ihm versprochen, aber dann hatte er gesagt, er wolle nicht, dass es bei ihnen aussehe wie bei den Zigeunern. Und jemand müsse schließlich die Autos bewachen in der Nacht. Irgendwann, sagte Joe, suchst du dir eine Frau. Dann werden wir sehen. Und Oskar versprach, Henry beizubringen, wie man auf zwei Rädern fuhr.
Henry hörte ein Geräusch, einen leisen, satten Knall. Er stand auf und ging zu den Autos hinüber. Der Asphalt glänzte noch vom Regen, und als Henry durch die enge Schlucht zwischen den Containern lief, kam er sich vor wie ein Indianer im Grand Canyon. Es knallte noch einmal. Henry rannte zu den Autos und sah gerade noch einen Stein durch die Luft fliegen und gegen die Heckscheibe eines der Wagen prallen. Er lief in die Richtung, aus der der Stein gekommen war, blieb stehen. Dann sah er die Kinder wegrennen. Er fluchte und nahm einen Stein vom Boden und warf ihn nach ihnen. Aber sie waren schon hinter den Containern verschwunden.
Henry stand an den Gleisen, die sich in beiden Richtungen in der Ferne verloren. Er schaute nach links und nach rechts und rannte los. Auf der anderen Seite des Bahndamms blieb er stehen. Er wartete lange, bis ein Güterzug kam. Er zählte die Waggons wie damals, als er noch ein Kind war. In Amerika gab es Leute, die auf die Güterzüge sprangen und im ganzen Land herumfuhren. Henry fragte sich, wohin der Zug fuhr. Zweiundvierzig Waggons zählte er. Kies.
Die Sonne war hinter der nahen Hügelkette verschwunden, aber es war noch hell. Henry lief den Bahndamm entlang bis zu einem Feldweg, der zur Hauptstraße führte. Schon von weitem sah er das gelbe M und, als er näher kam, den lebensgroßen Plastikclown, der vor dem Imbiss auf einer Bank saß und lächelte.
In einer Ecke des Lokals saßen drei Forstarbeiter an einem der kleinen Tische. Hinter der Theke stand eine junge Frau. Manuela, stand auf ihrem Namensschild. Henry bestellte einen Hamburger und eine Cola. Bier hätten sie keines, hatte Manuela gesagt. Einen Moment.
»Sind Sie aus dem Osten?«, fragte sie, als er zahlte.