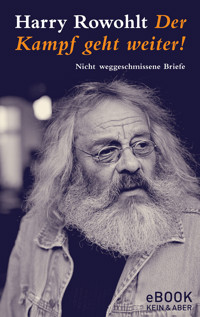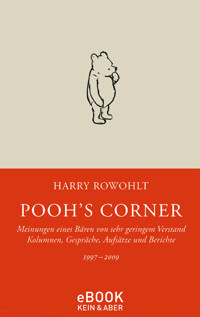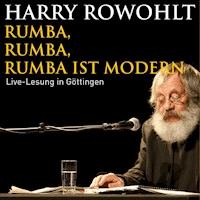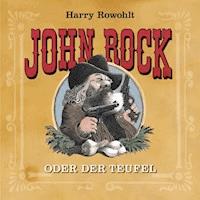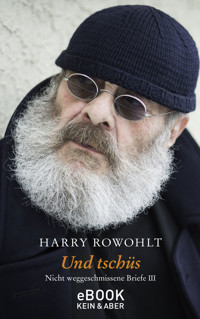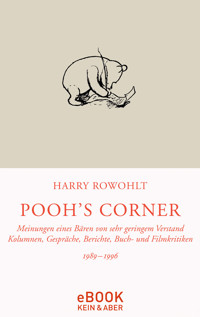7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fuego
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Harry Rowohlt erzählt aus seinem krummen Leben inmitten einer bemerkenswerten Familie. Er erzählt voller Hochachtung und honigsüß, manchmal spöttisch und sarkastisch, aber immer hinreißend von seinem Großvater Fränzchen Pierenkämper, der 1917 einer der führenden Köpfe im Arbeiter-und Soldatenrat von Wilna war, von seiner Mutter, der extravaganten Schauspielerin, die ohne Ariernachweis einmal Tischdame von Goebbels gewesen war; von seinem Vater, der mit dem Rowohlt-Verlag fünfmal pleite ging, weshalb Harry Rowohlt immer noch froh ist, nicht in den Verlag eingetreten zu sein, weil er diese Tradition als erstes wiederbelebt hätte; von der Kindergartentante Renate, in die er so verknallt war, daß er einen Türpfosten ableckte. Natürlich geht es auch um die Leiden eines preisgekrönten Übersetzers, seine Schauspielerei in der "Lindenstraße" und um seine mittlerweile legendären Lesungen. Dieses Buch beantwortet aber auch dringende Fragen wie: Warum ist Freddy Quinn nicht schwul? Oder: Wie ist es um das Nachtleben von Eutin bestellt? Harry Rowohlt schweift dabei gerne ab, aber sein "In Schlucken-zwei-Spechte" kompetenter Gesprächspartner Ralf Sotscheck hält ihn auf Kurs, sortiert Harrys mäanderndes Leben nach biographischen Schwerpunkten und steuert selbst jede Menge Anekdoten, absurde Begebenheiten und die reinste Wahrheit bei, die die Handlung aufs entschiedenste voranbringen und vor allem zeigen, daß sich Ralf Sotscheck in Hochform befindet. 4. überarbeitete Auflage mit nagelneuem Kapitel: "Acht Jahre danach"
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Harry Rowohlt
erzählt Ralf Sotscheck sein Leben
von der Wiege bis zur Biege
In Schlucken-zwei-Spechte
Mit einem nagelneuen Kapitel
»Acht Jahre danach«
Fotos von Ulla Rowohlt
Nachwort von Wiglaf Droste
Vignetten von F. W. Bernstein
FUEGO
- Über dieses Buch -
Harry Rowohlt erzählt aus seinem krummen Leben inmitten einer bemerkenswerten Familie. Er erzählt voller Hochachtung und honigsüß, manchmal spöttisch und sarkastisch, aber immer hinreißend von seinem Großvater Fränzchen Pierenkämper, der 1917 einer der führenden Köpfe im Arbeiter-und Soldatenrat von Wilna war, von seiner Mutter, der extravaganten Schauspielerin, die ohne Ariernachweis einmal Tischdame von Goebbels gewesen war; von seinem Vater, der mit dem Rowohlt-Verlag fünfmal pleite ging, weshalb Harry Rowohlt immer noch froh ist, nicht in den Verlag eingetreten zu sein, weil er diese Tradition als erstes wiederbelebt hätte; von der Kindergartentante Renate, in die er so verknallt war, daß er einen Türpfosten ableckte.
Natürlich geht es auch um die Leiden eines preisgekrönten Übersetzers, seine Schauspielerei in der "Lindenstraße" und um seine mittlerweile legendären Lesungen. Dieses Buch beantwortet aber auch dringende Fragen wie: Warum ist Freddy Quinn nicht schwul? Oder: Wie ist es um das Nachtleben von Eutin bestellt?
Harry Rowohlt schweift dabei gerne ab, aber sein "In Schlucken-zwei-Spechte" kompetenter Gesprächspartner Ralf Sotscheck hält ihn auf Kurs, sortiert Harrys mäanderndes Leben nach biographischen Schwerpunkten und steuert selbst jede Menge Anekdoten, absurde Begebenheiten und die reinste Wahrheit bei, die die Handlung aufs entschiedenste voranbringen und vor allem zeigen, daß sich Ralf Sotscheck in Hochform befindet.
»Ein Buch wie sehr guter Whiskey, dessen Qualität selbst Nichtkenner ahnen.«
(Christian von Zittwitz, in: Focus)
»Harry Rowohlt hat einen ausgefeilten Sinn fürs extra Komische.«
(Der SPIEGEL)
»Harry Rowohlt gehört zu den großen Tieren, was Herz und Witz und Verstand und Trinkvolumen anbetrifft.«
(Elke Heidenreich)
»Über dieses Buch hat der Rezensent so oft gelacht, daß er die Behauptung wagt, hier liege das lustigste Buch des Herbstes vor. So ist denn das Buch die schönste Abschweifung dieser Buchsaison.«
(Michael Naumann, in: Die ZEIT)
»Einmaliges Meisterwerk. Das Buch des Jahres.«
(FAS)
»Lange nicht mehr so was Schönes gelesen. Das sollte unbedingt eine Fortsetzung finden.«
(Gerd Haffmanns)
»Ich bin aufgewacht, habe begonnen zu lesen, bin zwischendurch 15 km in 1.41 h gelaufen und habe dann weitergelesen, und habe heute nichts gemacht, außer dieses wunderbare Buch zu lesen. Danke. Ganz groß.«
(Bernd Gieseking)
Vorwort
zur 4. Auflage
Acht Jahre sind vergangen, seit Harry Rowohlt und ich eine Woche lang an der irischen Westküste ein Dutzend Tonbandkassetten vollgequatscht und dabei Unmengen Tee getrunken haben.
Vieles hat sich verändert, manches nicht. Die wichtigste Änderung: Harry trinkt (fast) keinen Alkohol mehr. Das liegt an seiner Polyneuropathie. Was das ist, erklärt er in dem neuen Kapitel, das dieser Neuauflage angehängt ist. Einen Vorteil hat die Krankheit: Weil er nicht mehr so viel tingeln kann, schreibt Harry wieder seine Kolumne »Pooh’s Corner« in der Zeit.
In Irland war Harry Rowohlt seit damals nicht mehr, denn er boykottiert die Insel, seit in den Pubs Rauchverbot herrscht. So reiste ich diesmal nach Hamburg, und wir saßen mit unserem Tonbandgerät bei Nieselregen im Garten der Eppendorfer Bar Italia, denn in Hamburg darf in den Wirtshäusern inzwischen auch nicht mehr geraucht werden. Aber seine Heimatstadt kann Harry ja nicht boykottieren.
Anderes ist unverändert geblieben. Ich bin immer noch neun Jahre und neun Tage jünger als Harry und wünsche mir zu meinem 60. Geburtstag eine ähnliche Party, wie Harry sie 2005 hatte. Alle waren gekommen, das Fest dauerte bis in die Morgenstunden, und als Höhepunkt wurde eine Palette mit Büchern angeliefert: »Der Große Bär und seine Gestirne. Freunde und Weggefährten grüßen, dichten und malen zum 60. Geburtstag von Harry Rowohlt.«
Harry spielt noch immer den Penner in der »Lindenstraße«, er übersetzt weiterhin bienenfleißig, und er erzählt nach wie vor gerne Anekdoten, die dank ihrer wunderbaren Pointen auch dann amüsant sind, wenn man die Protagonisten nicht kennt. Einmal hat es ihm aber doch die Sprache verschlagen: Als er mir im Garten der Bar Italia stolz seine neuen, maßgeschneiderten Stiefel zeigte, sagte ich: »Schick! Gibt’s die auch für Herren?«
Ralf Sotscheck
August 2009
Vorwort
zur 1. Auflage
Als Harry Rowohlt mich vor ein paar Jahren am Hamburger Hauptbahnhof abholte, hatte er Frank McCourts Buch »Die Asche meiner Mutter« unter dem Arm, frisch von ihm übersetzt. »Ein Vorabexemplar«, sagte er, »das Buch kommt nächste Woche in die Läden.« Zehn Stunden später, in denen er mir die Kneipenszene seiner Heimatstadt anhand von praktischen Beispielen erläuterte, hatte ich die Plastiktüte mit meiner Reiselektüre längst verloren, doch Harry Rowohlt hatte seinen McCourt noch immer unter dem Arm. Da wußte ich, daß es ein außergewöhnliches Buch sein mußte.
Was in den zehn Stunden dazwischen geschehen war, ist mir nur bruchstückhaft in Erinnerung. Angefangen hatte es in einem Hamburger Irish Pub, wo ein Länderspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft übertragen wurde. Bertis Buben verloren, was wir mit mehreren Guinness begingen, bevor wir zügig zum Whiskey überwechselten. Schließlich war Harry Rowohlt gerade »Ambassador of Irish Whiskey« geworden, und solch ein Titel verpflichtet. Beim Lokalwechsel hatten wir in der S-Bahn den gleichen Gedanken: »Nächste Station. Egal, was sich uns in den Weg stellt.« Mit entleerter Blase ging es weiter. Zum Schluß landeten wir in »Nummer Sieben«, einer Hafenkneipe, und an unserem Tisch stand eine Babsi im engen, giftgrünen Kleid und wurde hinterrücks von ihrem Freund angegrabbelt. Babsi sagte mit tonloser Stimme: »Ich glaub’, ich krieg’ die Krise.«
Man muß aber nicht unbedingt mittrinken, es ist fast so schön, Harry Rowohlt beim Trinken zuzusehen. »Schausaufen mit Betonung«, so nennt er seine Lesungen, bei denen er aus übersetzten Werken liest oder seine eigenen Kolumnen vorträgt, die in der Rubrik »Pooh’s Corner« unregelmäßig in der Zeit erschienen. Sie hießen »Hippie Lehmann, die Sofa-Schnute«, oder »Ich bin das Ohr eines Mannes aus Connaught«, oder auch »Im Speisewagen mit Jutta Ditfurth«, und es standen Sätze drin wie: »Früher, wenn man sich keine Namen merken konnte, hieß das vergeßlich. Inzwischen heißt das Alzheimer. Und wieder muß man sich einen Namen merken.«
Wer zu Harry Rowohlts Lesungen geht, sollte sich für den Rest des Abends nichts vornehmen, unter fünf Stunden kommt man nicht weg. »Ich kann euch nur bewundern«, rief er dem Publikum einmal zu. »Das könnte ich nie, so lange sitzen und zuhören.« Sagen Sie hinterher nicht, Sie seien nicht gewarnt worden.
Aber eigentlich ist Harry Rowohlt Übersetzer, und das kann er gut, er gewinnt jedes Jahr einen Preis, auch wenn er nicht angemessen dafür bezahlt wird. »Meine Herren. Meine Damen. Meine sehr verehrten Personen«, schrieb er. »Ich beantrage – und wenn Sie morgens noch nicht so fett mögen, schlage ich vor –, daß Sie es sich noch ein paarmal überlegen, bevor Sie Übersetzer werden. Zu dreifuffzich die Stunde.«
Vor einer Weile hat Harry Rowohlt sein hundertstes Buch übersetzt, »Killoyle« von Roger Boylan, einem Iren. Und um einen weiteren Iren, der aber nicht mehr lebt, hat er sich besonders verdient gemacht: Flann O’Brien, the drinking man’s Joyce. »Diese Art Journalismus, der das Medium der seriösen Tageszeitung mißbraucht, um hemmungslos hellsichtigen Schabernack zu treiben, hat es vorher und nachher nicht gegeben«, sagte Rowohlt über O’Brien. Die beiden hätten sich gut verstanden.
Schauspieler ist Harry Rowohlt auch, nämlich in der »Lindenstraße«, und weil er soviel erlebt hat und zahlreiche wichtige Menschen kennt, kam der Verleger Klaus Bittermann auf die Idee zu diesem Buch: »Ihr sitzt doch ohnehin immer in der Kneipe und erzählt euch gegenseitig Geschichten. Laßt doch einfach mal ein Tonband mitlaufen.« Wir haben die Gespräche an sieben Tagen im Juli 2001 aufgenommen – allerdings nicht im Wirtshaus, sondern im Garten eines Cottages in Ballyvaughan an der irischen Westküste, und zwar bei zahlreichen Kannen Tee. Jawohl: Tee.
Übrigens sind sowohl der Verleger, als auch Harry Rowohlt und ich Widder mit Aszendent Schütze. Was das bedeuten mag, weiß ich aber nicht. Und noch etwas: Fragen Sie Harry Rowohlt, ob er etwas mit dem Rowohlt-Verlag zu tun hat. Für diese Frage, die ihm ständig gestellt wird, berechnet er fünf Euro und verdient sich ein nicht zu verachtendes Zubrot. Andererseits können Sie das Geld auch sparen: Diese und andere Fragen werden auf den nächsten Seiten beantwortet.
Ralf Sotscheck
Februar 2002
1. Tag
Kindheit
RALF SOTSCHECK: Als wir uns vor vielen Jahren kennenlernten, hatte ich noch einen Bart, und deiner war schwarz. Jetzt bin ich glattrasiert und dein Bart ist grau. Hast du mal erwogen, ihn zu färben, damit man die Essensreste nicht sieht?
HARRY ROWOHLT: Das habe ich schon mal gemacht, aber nicht wegen der Essensreste. Damals war ich Lehrling im Suhrkamp-Insel-Verlag und als solcher auch Praktikant bei der Firma »Clausen und Bosse« in Leck in Nordfriesland. Alle anderen Suhrkamp-Insel-Lehrlinge gingen zum Druckerei- und Setzerei-Praktikum nach Heidelberg und belegten Gastvorlesungen. Ich mußte in die dem Rowohlt Verlag assoziierte und von ihm auch gegründete Druckerei »Clausen und Bosse« in Leck. Das war aber nicht so schlimm. Ich fühlte mich wie in Dodge City. Leck war früher eine Cowtown. Da wurden Rinder aus Dänemark auf dem Weg zum Schlachthof durchgetrieben, weshalb es dort mehr Kneipen als Häuser gab. Manchmal gab es in einem Haus sogar zwei Kneipen. Ich hatte den Eindruck, irgendetwas muß ich von diesem Aufenthalt mitbringen, weshalb ich mir einen Bart stehen ließ. Den sah man nur im Gegenlicht, weil da nur weißblonder Flaum war. Also habe ich meine Nichte Muschi bestochen, daß sie mir in der Drogerie Polycolor-Färbe-Shampoo holt. Sie hat mir in die Hand versprochen, daß sie das niemandem sagt. Ich färbte mir diesen Bartflaum mit Polycolor dunkel, und seitdem ist der Bart sichtbar. Er blieb seltsamerweise dunkel. Der Bart hatte also gemerkt, was von ihm erwartet wurde.
Ich habe mir wegen Guinness den Bart abrasiert. Die Brauerei hat nämlich herausgefunden, daß jedes Jahr über 150.000 Pints Guinness in den Schnurrbärten der Trinker hängen bleiben. Bevor ich dem Guinness verfallen bin, hatte ich mir schon mal aus Neugier den Bart abgenommen, aber dann erkannte mich meine Tochter nicht mehr, und in die DDR wollten sie mich nicht einreisen lassen, weil ich keine Ähnlichkeit mit meinem Paßfoto hatte.
Ich sollte mal für das Zeit-Magazin einen Report über die Kneipenszene am Prenzlauer Berg machen. Der Fotograf war vierzehn Tage vor mir dagewesen und hatte die wunderschönen Kneipen fotografiert, und als ich hinkam, waren diese Kneipen, bis auf eine, aus baupolizeilichen Gründen geschlossen worden. Eine ganze Serie über eine einzige Kneipe machen, das ging ja nicht. Also hat sich die Reportage zerschlagen. In der einzigen Kneipe, die es noch gab, war ein richtiger Kellner, der sogar eine Kellnermontur trug. Eine Dame beschwerte sich: »Mein Sprudelwasser sprudelt gar nicht.« Der Kellner sagte: »Was glauben sie, weshalb ick schwarz trage.« Die DDR gab es zwar noch, aber nicht mehr lange. Überall war die Perestroika ausgebrochen, und ich bin in Ostberlin mit der S-Bahn gefahren. Der ganze Waggon diskutierte leidenschaftlich, und ein älterer Herr sagte, auf mich deutend: »Dieser junge Mann zum Beispiel hat sich, weil er mit den herrschenden Verhältnissen nicht einverstanden ist, einen Bart stehen lassen. Zu seiner Zeit trug ich ein Menjoubärtchen, det hat die Frauenzimmer wild gemacht.«
Hast du jemals erwogen, dir den Bart abzurasieren, um zu sehen, was darunter ist?
Ich hab mir mal die Stirnhöhlen, beziehungsweise die Nebenhöhlen fenstern lassen. Man kann auch Stirnnebenhöhlen sagen. Ich tendiere zu Stirnnebenhöhlen. Wenn schon, denn schon. Kurz vorher war in Hamburg ein Mann unter Vollnarkose gestorben, weil man ihn wegen des Bartes nicht beatmen konnte. Der ganze wertvolle Sauerstoff verlor sich im Bart. Also mußte der Bart ab, weshalb ich mich seit Jahrzehnten zum ersten Mal rasiert habe. Bei dieser Gelegenheit stellte ich fest, daß das Kinngrübchen, das in meinem Wehrpaß noch zu sehen ist, nicht mehr da war – ein Grübchen wie das von Kirk Douglas. Ich hatte auch kein Kinn mehr. Es war verkümmert, weil es jahrzehntelang niemand gesehen hatte. Das gibt es oft bei Organen, die nicht verwendet werden. Ich sah mit meinen blöden langen Haaren aus wie Frau Ponnwitz, so daß ich mir auch noch die Haare abgeschnitten habe. Kurz danach hatte ich eine Lesung in Braunschweig, in der Buchhandlung Leporello. Die wollten mich nicht lesen lassen, weil auf dem Plakat jemand anderes abgebildet war. Am nächsten Tag hatte ich eine Lesung in Hamburg-Barmbek beim U- und S-Bahnhof. Ich tupfte mir die Nase immer mit einem Tempotaschentuch, weil wegen der Operation noch Blut rann. In der Pause sagte eine Dame zu mir: »Ich finde das ein bißchen affig, daß so ein knorriger Typ wie Sie sich immer fein das Näschen mit einem Papiertaschentuch betupft, noch dazu mit einem Papiertaschentuch mit aufgedruckten Röschen.« Da habe ich ihr gezeigt, was es mit den Röschen auf sich hatte. Sie ist dann rückwärts in eine Zinkbadewanne voller Wasser mit Eiswürfeln und Guinness-Pullen gefallen.
Jedenfalls bist du nicht mit Bart geboren worden, sondern als unbehaartes Kriegsbaby.
Ich wurde in der Hochallee 1 in Hamburg 13 geboren. Im Luftschutzkeller, als Zehn-Monats-Kind. Immer, wenn ich soweit war, begann der Fliegeralarm, und ich dachte mir, ich bin doch nicht doof. Ich hab mir jetzt ausbedungen, daß in Kurzviten nicht mehr irgendetwas Kreatives steht. Da steht nur noch Harry Rowohlt, geboren 1945 in Hamburg 13, lebt in Hamburg Eppendorf. Für Kenner ist das ein leichter Abstieg, aber noch nicht die schiefe Bahn, man braucht sich also noch keine Sorgen zu machen.
Bei dem Nachnamen sowieso nicht. Das ist doch deine Lieblingsfrage: »Haben Sie etwas mit dem Rowohlt Verlag zu tun?« Jeder, der sie stellt, muß fünf Mark an eine Wohltätigkeitsorganisation spenden, oder?
Jawohl. Es ist eine Last, wenn man Rowohlt heißt. Im Hamburger Telefonbuch stehen, außer dem Rowohlt Verlag, meiner Mutter und mir, noch zwei weitere Rowohlts, und irgendwann abends habe ich die beiden angerufen, ganz leicht angeheitert und mit entsprechend erhöhter Risikobereitschaft. Ich telefoniere eigentlich nur, wenn ich ganz leicht angeheitert bin. Wenn ich nicht betrunken bin, habe ich keine Lust, weil ich dann übersetze. Aber manchmal will man sich halt ein bißchen mitteilen. Ich habe schon erwogen, einen Alkoholmelder am Telefon anbringen zu lassen, aber dann würde ich ja gar nicht mehr telefonieren. Ich rief also die beiden übrigen Rowohlts im Hamburger Telefonbuch an, um sie zu fragen, ob es ihnen auch so auf den Wecker geht, immer gefragt zu werden, ob sie etwas mit dem Rowohlt Verlag zu tun haben? Der eine ist Weinhändler und sagte: »Nö, ich habe mich daran gewöhnt, ich weiß ja, wer ich bin.« Und der andere hieß Jörg Rowohlt, war damals Leiter der Hamburger Schwuleninitiative e.V. und klang wie jemand, der bösartig Fritz J. Raddatz nachmacht: »Was wollen Sie überhaupt von mir?«
Aber als du geboren wurdest, hattest du einen anderen Nachnamen.
Geboren wurde ich als Harry Rupp, weil meine Mutter damals in dritter und vorletzter Ehe mit dem Kunstmaler Max Rupp aus Idar-Oberstein verheiratet war. Dessen Wirken läßt sich in Idar-Oberstein immer noch verfolgen. Er hat Kunst am Bau gemacht und furchtbar herumgewütet, ganz grauenvoll. Deshalb hieß ich zunächst Harry Rupp. Als sich meine Mutter scheiden ließ, hieß ich Harry Pierenkämper-Rupp, nach dem Mädchennamen meiner Mutter. Ich war schon als Kleinkind eine männliche Doppelnamen-Tusse. Als ich schreiben lernte, gab es gewisse Probleme. »Harry« konnte ich bereits nach dem ersten Schultag schreiben. Mein Lehrer, Herr Stawitz, erklärte mir das so: Das H ist eine kurze Leiter. Das kleine a ist ein Reifen, der kaputt gegangen ist. Der Spengler repariert ihn, aber nicht besonders gut, und schon hat man ein a. Dann kommen zwei Spazierstöcke, und das y hatte ich ganz exklusiv für mich allein. Ich weiß nicht mehr, wie er das y erklärt hat, aber das konnte ich auch sofort. Nur mit dem Nachnamen haperte es, weil ich nie wußte, wie ich gerade hieß. Heute behauptet meine Mutter, sie hätte Max Rupp nur geheiratet, um ihm zwei Wochen Heimaturlaub verpassen zu können. Während der fraglichen Zeit, als ich gezeugt wurde, war er bereits in sowjetischem Gewahrsam, vulgo Kriegsgefangenschaft, weshalb er als Vater rundherum nicht in Frage kam.
Harry Rupp – das klingt wie ein Fußballreporter. »Wir schalten um ins Westfalenstadion zu Harry Rupp. Harry Rupp, bitte melden!« Wie war das nochmal mit dem Luftschutzkeller?
Ich hatte gutes Glück, daß ich nicht im Krankenhaus, sondern im Luftschutzkeller geboren worden bin. Ich war vor ein paar Jahren mal in dem lokalen Kinderkrankenhaus, das inzwischen eine halboffene Gemeindeklapsmühle ist.
Du warst in der Klapsmühle?
Nur zu Besuch. Sie hatten ein Jubiläum und eine Fotoausstellung. Ich hab mir das angesehen und dabei festgestellt, daß in diesem Krankenhaus Babys eingesammelt wurden. In der Fotoausstellung im Treppenhaus sah ich, was ich als geschichtlich interessierter Mensch hätte wissen können, daß in diesem Krankenhaus die Transporte mit den Babys zusammengestellt wurden, die wegen Euthanasie ins Gas geschickt wurden. Und meine Mutter hatte keinen Ariernachweis. Bis heute nicht. Das hat sie irgendwie verschlampt. Meine Oma mütterlicherseits war eine italienische Zigeunerin, wobei mir eine jüdische Großmutter noch lieber gewesen wäre. Da wäre ich ein bißchen plietscher, aber auf diese Weise habe ich wenigsten den Rhythmus im Blut. Kein Schwein durfte wissen, daß sie eine italienische Zigeunerin war, und deshalb hat es auch niemand erfahren. Wenn sie einen ihrer gefürchteten Ausbrüche hatte, sagte mein Opa Franz Pierenkämper immer begütigend: »Naja, dat is dat französische Blut.« Damals im Ruhrgebiet hatte man als italienische Zigeunerin, selbst wenn das geheim gehalten wurde, nicht viele Volksgruppen, auf die man herabblicken konnte, weshalb ich heute noch einen Merkvers von ihr beherrsche: »In Kruppsche Baracken, da wohnen Polacken, da laufen die Kakerlaken die Polacken in Nacken. Da nehmen die Polacken die Pickhacken und tun die Kakerlaken kaputt hacken.«
Herrje, Bochumer Büttenpoesie.
Immerhin. Was man meiner Oma gar nicht zutraute: Sie war Vegetarierin, sie kochte wie eine gesengte Sau. Um ihren Fraß nicht fressen zu müssen, habe ich irgendwann gesagt: »Ich esse alles, was auf den Tisch kommt, wenn Oma kocht«, weil ich wußte, daß sie das hören wollte. Danach hatte ich den Freibrief, den Kram meiner Oma nicht fressen zu müssen. Das Problem war nur: Ich war unterernährt und rachitisch und hatte einen stark geschrumpften Magen. Wasser und Brot waren das einzige, was ich mochte, weshalb ich hoffte, möglichst bald ins Gefängnis zu kommen. Das hat sich inzwischen leider alles sehr geändert.
Mochtest du deine Oma, abgesehen von ihren Kochkünsten?
Sie war oft im Knast, abwechselnd wegen »politisch« und Engelmacherei. Am meisten hat sie sich vor der Anstaltskleidung gegraust. Sie war ein sehr reinlicher Mensch. Einmal sagte sie: »In dem Kittel war Monate altes Unwohl drin!« Das letzte Mal ist meine Oma mütterlicherseits im Wartesaal Bonn Hauptbahnhof verhaftet worden. Sie wetterte mal wieder über Politik, und ein Herr sagte: »So eine alte Dame sollte sich um Politik nicht mehr bekümmern.« Da stieg meine Oma auf einen Stuhl und schrie: »Und der Adenauer, der alte Bock?« Und schon machte es klick. Die Bahnpolizei hatte sie verhaftet. Aber danach passierte nichts mehr. Im Krieg hat sie sich gut über Wasser gehalten. Sie hatte eine Ruine, eine alte Mühle im Hunsrück, gekauft, weil sie zu Recht annahm, daß die nicht bombardiert würde. Sie hat, weil sie Zigeunerin war und das offenbar konnte, den Bauern die Karten gelegt und ihnen geweissagt. Einmal sagte sie einer Bäuerin, ihr kleiner Sohn solle sich vor Wasser hüten, genauer gesagt, vor warmem Wasser, noch genauer, vor heißem Wasser. Und zwar in der allernächsten Zukunft, genauer gesagt, jetzt. Die Bäuerin rannte so schnell sie konnte nach Hause. Da war ihr kleiner Sohn schon in den siedend heißen Waschkessel gefallen und verbrüht. Daraufhin wurde meine Oma zum Pfarrer bestellt. Er sagte, sie solle gefälligst aufhören, diesen Aberglauben zu verbreiten. Sie hat ihn gefragt: »Warum behandeln Sie mich eigentlich so schlecht? Wir sind doch Kollegen.«
Hat sie denn an die Karten geglaubt?
Ja, meine Oma hat, im Gegensatz zum Pfarrer, an ihren Hokuspokus geglaubt. Sie plante immer, im Gegensatz zu mir, ihre Memoiren zu schreiben. Titel: »Die Königin vom Longkamperbach«. Sie konnte nicht ahnen, daß sie bei den Bauern im Hunsrück den Spitznamen »der Teufel zu Fuß« hatte. So wie meine Mutter später »der Teufel mit dem Auto« hieß. Meine Mutter ist jetzt 91, sie hat sich leider ein neues Auto angeschafft. Die Landbevölkerung ist in heller Aufregung. Sie kannten das Geräusch ihres alten Autos, das sie nur im ersten Gang fuhr, und konnten sich in Sicherheit bringen. An das neue Auto müssen sie sich erst noch gewöhnen. Sie hatte sogar mal einen BMW, den sie auch nur im ersten Gang gefahren ist. Sie fand auch nie die richtige Autobahnabfahrt. Sie ist eben Schauspielerin gewesen, und Schauspieler sind nun mal nicht allzu helle. Nach den Stücken, in denen sie mitgespielt hat, kann man sie aber noch fragen. »Käthchen von Heilbronn« hat sie noch einigermaßen drauf. Außerdem bezieht sie seit Jahrzehnten den Kalender »Mit Goethe durch das Jahr«. Meine Oma hatte einen furchtbar stacheligen Schnurr- und Kinnbart. Sie küßte einen ganz laut und aß Knoblauchpastillen, um ihr Leben zu verlängern. Sie sagte, die seien so gut, weil sie völlig geruchlos seien. Bei dem Wort »geruchlos« blätterte die Tapete von den Wänden, und auf dem Adventskranz brachen die Kerzen in Stichflammen aus, so sehr stank es nach Karbid. Meine Oma wurde nur 88, meine Mutter ist schon 91. Der Mann meiner Großmutter, Fränzken Pierenkämper, war Sitzredakteur beim Bochumer Volksblatt, das heißt, er war verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes. Wenn im Bochumer Volksblatt irgendwas erschienen war, was der Obrigkeit nicht paßte, ging er dafür in den Kahn. Sobald er im Kahn war, fing er an, Lyrik zu schreiben. Außerhalb des Knastes nur Prosa, innerhalb des Knastes nur Lyrik.
Wenn also ein Romancier mal Lyrik schreiben möchte, wäre diese Methode durchaus zu empfehlen.
Ja. Fränzken Pierenkämper war 1917 einer der führenden Köpfe im Arbeiter- und Soldatenrat von Wilna, und das als Goi. Da mußte man ganz schön was zwischen den Ohren haben. Später war er einer der ersten Minister der jungen Sowjetmacht. Da hat er sich aber nach einer Woche wieder abgeseilt – mit der Begründung: »Sind mir zu links, die Brüder.« Er hat aber später die USPD mitgegründet. Sein Sohn Harry Pierenkämper, nach dem ich benannt wurde, hatte eine Hasenscharte und stotterte, weshalb er Pantomime wurde.
Eine weise Entscheidung.
Außerdem war er Mitbegründer des Spartakus. Man kann sich vorstellen, wie muffelig es bei denen zu Hause zuging, denn es gibt ja nichts Unversöhnlicheres als Kommunisten und linke Sozis. Sie wohnten in Bochum-Weitmar, in einer Arbeitersiedlung mit lauter Häusern bis zum Horizont. Eins sieht aus wie das andere, die unterschieden sich genau wie heute nur durch die Vorgärten. Eines Morgens maulte der Alte seinen Sohn an: »Ich gehe morgen auf eine Vortragsreise, und wenn ich in zehn Tagen zurück bin, und der Vorgarten ist nicht tip-top in Ordnung, dann hast du deine Beine die längste Zeit unter meinen Tisch gestreckt.« Da hat sich der Sohn von niederländischen Genossen gelbe und rote Tulpenzwiebeln besorgt, den Vorgarten gejätet, die Tulpenzwiebeln gesteckt, und als die hervorschossen, oder was immer die so machen, sah man wunderschön deutlich einen fein säuberlichen und gelb umrandeten roten Sowjetstern mit gelbem Hammer und gelber Sichel. Der Alte sagte zähneknirschend: »Na, immerhin sieht das ordentlich aus.« Sie sind glücklicherweise beide pünktlich vor 1933 gestorben. An denen hätten die Nazis noch viel Spaß gehabt.
Deine Mutter war Schauspielerin. Wo hat sie damit angefangen?
In Bochum. Damals gab es ja noch das Fach »Jugendliche Sentimentale«: bei dem legendären Saladin Schmitt, dem Erfinder der expressionistischen dunklen Bühne, weshalb er von jedem »Saladin mit der Schlummerlampe« genannt wurde. Seine Inszenierung von Schillers »Die Räuber« hieß allgemein »Bruderzwist auf Sohle Sieben«. Er hatte eine stehende Redewendung gegenüber weiblichen Ensemblemitgliedern, indem er sie anschwulte: »Meine liebste, beste, teuerste Freundin, gehen Sie weg. Ich kann Sie nicht mehr sehen.« Sehr viel später wurde meine Mutter als Tischdame von Goebbels eingeteilt. Das wußte sie vorher nicht. Sie kam wie immer zu spät und bekam einen Wahnsinnsschreck, als nur noch neben Goebbels ein Platz frei war und ihr nichts anderes übrigblieb, als sich dorthin zu setzen. Goebbels mußte sich damals von seiner Freundin, der tschechischen Schauspielerin Lida Baarova, trennen, weil sie Halbjüdin war. Weil meine Mutter von weitem genauso aussah wie Lida Baarova, hatte man sie als Tischdame ausgesucht. Glücklicherweise saß ihr ein alter Kollege aus Bochumer Zeiten gegenüber. »Maria«, sagte der, »mach doch nochmal den Saladin Schmitt.« Also schwulte sie: »Meine liebste, beste, teuerste Freundin, gehen Sie weg. Ich kann Sie nicht mehr sehen.« Plötzlich Totenstille, weil Goebbels glaubte, sie hätte ihn nachgemacht. Auf diese Weise hat sich das mit Goebbels und meiner Mutter zerschlagen. Leider. Die hätte ich ihm nämlich gegönnt. Es wäre doch schön gewesen, wenn er sich nach einer Halbjüdin eine Halbzigeunerin eingehandelt hätte. Da hätten seine Kumpel aber irgendwann mal gedacht: »Der Goebbels, der hat aber auch einen seltsamen Weibergeschmack.«
Wann hat sie denn deinen Vater kennengelernt?
Mein Vater war im Ersten Weltkrieg in der Kavallerie gewesen, wie sich das gehört. Er war als einer der ersten dabei, als die Luftwaffe erfunden wurde. Daß er geflogen ist, hat man seiner Autofahrerei angemerkt. Glücklicherweise hatte er später einen Chauffeur. Er ist immer wieder mit seinem Verlag pleite gegangen, insgesamt fünf Mal. Deshalb bin ich auch ganz froh, daß ich nicht in den Rowohlt Verlag eingetreten bin, denn diese Tradition hätte ich als erstes wiederbelebt. Im Zweiten Weltkrieg emigrierte er zunächst nach Brasilien, obwohl man nicht so genau weiß, ob es sich wirklich um eine Emigration oder nicht vielleicht doch nur um einen Abenteuerurlaub handelte. Er kam erst zurück, als Deutschland die Sowjetunion überfallen hatte. Er dachte, daß es ja wohl nicht mehr lange dauern könne. Er ist auf einem Blockadebrecher zurückgekommen, weil er nicht erst zurückkehren wollte, nachdem Deutschland verloren hatte. Er wollte noch ein bißchen mitmischen. Es hat aber sehr viel länger gedauert, als er angenommen hatte, so daß er wieder zur Luftwaffe mußte.
Auf Kreta hat er gegen die Engländer gekämpft. Und wie! Er merkte ziemlich bald, daß die Griechen, die seit Jahren Bürgerkrieg hatten, schon seit Jahrzehnten mit denselben Spielkarten spielten, so daß jeder wußte, welches Blatt der andere hatte, so abgewetzt waren die Karten. Er hat sich mit seinen alten Verlegerbeziehungen von der Altenburger Skatkartendruckerei neue Spielkarten kommen lassen und hat sie gegen Ouzo und Retsina verscherbelt. Zweitens hat er mit Dynamit gehandelt. Aus den Bomben, die er auf die Engländer abwerfen sollte, hat er etwa vier Fünftel des Schießpulvers abgezweigt – die Bomben konnte man ja ganz leicht aufschrauben – und es gegen Naturalien an die Griechen vertschintscht. Er wußte natürlich, daß die Griechen auch noch etwas anderes damit gemacht haben, als das Dynamit zum Fischen zu verwenden, aber das war ihm auch ganz recht. Anschließend hat er brav seine Bomben ins Gelände geschmissen, wo sie kein Unheil anrichten konnten, und sie haben auch schön geknallt, aber sonst waren sie harmlos.
Eine dieser Bomben hat er aus Versehen auf eine englische Feldküche geschmissen, die so gut getarnt war, daß man sie beim besten Willen aus der Luft nicht sehen konnte. Die machte »Peng«, ganz zaghaft zwar, aber sie hat dennoch einigen Schaden angerichtet. Da hatte er ein so schlechtes Gewissen, daß er den nächsten Fliegerangriff auf der Tragfläche mitflog, weil er dachte, wenn es ihn herunterwehen würde, hätte er selbst schuld – Gottesgericht sozusagen. Seine Einstellung wurde schließlich ruchbar, und zu einer Zeit, als sie bereits Kinder und Greise einzogen, wurde er wegen politischer Unzuverlässigkeit unehrenhaft aus den Heeresdiensten entlassen und langweilte sich fortan in Grünheide bei Berlin.
Mein Vater hätte den Zweiten Weltkrieg fast verpaßt, weil man ihn mit seinem Vater verwechselt und ihn für tot erklärt hatte. Nach einem kurzen Einsatz in Nordafrika bekam er dann Tropenfieber und verbrachte den Rest des Krieges im Lazarett in Italien. Wie ist es deinem Vater denn zum Kriegsende ergangen?
Weil mein Vater immerhin in zwei Weltkriegen Erfahrungen gesammelt hatte, wurde er Hauptmann. Das war er, glaube ich, schon im Ersten Weltkrieg, im Zweiten ist nicht viel dazukommen. In Friedenszeiten wird man ja schneller befördert als in Kriegszeiten. Nun sollte er den Volkssturm von Berlin-Grünheide organisieren. Mein Vater kannte niemanden in Grünheide. Sein Nachbar, ein sozialdemokratischer Tischler, hat zwei Listen angefertigt, eine mit Nazis und eine mit Nicht-Nazis. Mit den Nazis ist mein Vater in den Wald gegangen und hat sie Griffe kloppen lassen. Er hat ihnen die Eier geschliffen, bis ihnen das Arschwasser in der Kimme kochte. Der Tischler requirierte mit den Nicht-Nazis Nahrungsmittel, weil ein Volkssturm ja von irgend etwas leben mußte. Abends lagen die Nazis auf ihren Betten, verbanden sich ihre Wunden und Blasen, stöhnten und hatten Muskelkater. Mein Alter, der Tischler und die Nicht-Nazis soffen währenddessen die Nahrungsmittel weg, die sie tagsüber requiriert hatten.
War deine Mutter damals bei ihm in Grünheide?
Nein, sie hatte sich nach Hamburg abgesetzt. Nach der Schließung des Schiller-Theaters wurde es plötzlich wichtig, ob man einen Ariernachweis hatte, aber sie war ohnehin zu schwanger, um noch das Gretchen spielen zu können, obwohl das natürlich gut gepaßt hätte, bei dieser Kindsmörderin. Zum Emigrieren war es auch schon viel zu spät, und da haben ihr alle geraten, nach Hamburg zu gehen. »Das ist fast so gut wie emigriert, denn die Hamburger fiebern den Engländern entgegen, um sich endlich ergeben zu dürfen.« So bin ich Hamburger geworden.
Und dein Vater ist 1945 nachgekommen?
Er hat sich von seinem Volkssturm in Grünheide abgesetzt. Den sozialdemokratischen Tischler ernannte er zu seinem Nachfolger mit dem dienstlichen Befehl, beim ersten Russen, den sie sehen, sofort weiße und wenn möglich auch ein paar rote Fahnen zu hissen. Auf diese Weise ist der Volkssturm in Grünheide bei Berlin geschlossen in sowjetische Kriegsgefangenschaft gegangen und geschlossen zwei Tage später wieder entlassen worden, weil er so vorbildlich die Waffen gestreckt hatte. Insofern sehe ich in meinem Alten durchaus einen Kriegshelden. Er ging dann mehr oder weniger zu Fuß nach Hamburg, um zu sehen, was da läuft. Geheiratet haben meine Eltern erst, als ich schon zehn Jahre alt war. Ich fand das immer noch verfrüht. Nur weil ein Kind da ist, tut man das doch nicht.
Seitdem heißt du Rowohlt?
Wenn ich Bücher signiere, die ich aus dem irischen Englisch übersetzt habe, und ich nicht immer ein Harry Rowohlt hinsetzen will, schreibe ich auch manchmal Harry auf irisch. Wie man das macht, habe ich in Dublin in der »Harry Street« abgekupfert. H E A R A I D H. Es ist also ganz einfach. Und dann schreibe ich Hearaidh FitzRowohlt, wobei Fitz als Präfix für uneheliche Geburt steht. Meine Eltern haben mich dann leider doch ehelich gemacht.
Und wo bist du aufgewachsen, als du noch unehelich warst?