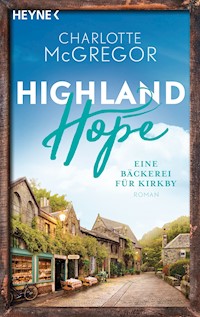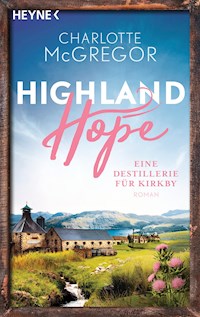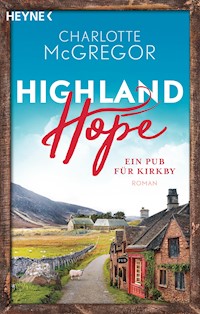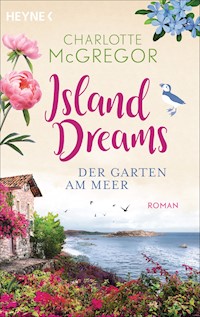
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Island-Dreams-Reihe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Ein unerwarteter Neuanfang im Paradies
Philippa Gordon hat alle Brücken hinter sich abgebrochen und steht kurz davor, das nasskalte Schottland ein für alle Mal zu verlassen. Doch als ihre Schwester bei einem tragischen Unfall stirbt, muss Philippa ihren Lebenstraum jäh aufgeben. Ihr dreijähriger Neffe Rufus braucht sie – und sie ist mit der Situation völlig überfordert. Da bietet sich ihr eine überraschende Job-Option: Der »Tresco Abbey Garden« auf dem winzigen Scilly-Archipel sucht dringend eine Botanikerin. Kurzerhand ziehen Philippa und Rufus in das englische Insel-Paradies südwestlich von Cornwall. Sie liebt die Arbeit mit der üppigen Pflanzenwelt, und auch der Insel-Alltag mit Rufus pendelt sich langsam ein. Und dann ist da noch der Meeresbiologe Harry, der Philippas Herz schneller schlagen lässt. Bis ein Mann auftaucht, der behauptet, Rufus‘ Vater zu sein …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 507
Sammlungen
Ähnliche
Das Buch
Philippa Gordon steht kurz davor, das nasskalte Schottland zu verlassen und ihren Traum zu leben. Doch als ihre Schwester bei einem tragischen Unfall stirbt, muss Pippa ihre Pläne jäh aufgeben. Ihr dreijähriger Neffe Rufus braucht sie! Da bietet sich ihr eine überraschende Job-Option: Der Tresco Abbey Garden sucht dringend eine Botanikerin. Kurzerhand ziehen Pippa und Rufus in das englische Insel-Paradies südwestlich von Cornwall. Sie liebt die Arbeit mit der üppigen Pflanzenwelt, und auch der Alltag mit Rufus pendelt sich langsam ein. Und dann ist da noch Meeresbiologe Harry, der Pippas Herz schneller schlagen lässt. Alles läuft gut. Bis ein Mann auftaucht, der behauptet, Rufus’ Vater zu sein …
Die Autorin
Mit Sehnsuchtsorten kennt sich Charlotte McGregor aus. Schon in frühester Kindheit fühlte sie sich zu Städten und Ländern hingezogen, die sie nur aus Büchern oder Filmen kannte. Kein Wunder, dass sie aus ihrem Fernweh einen Beruf gemacht hat. Die Journalistin schrieb jahrelang Reiseberichte für Zeitungen und Magazine, ehe sie ihre Lieblingsorte auch in Romanen verewigte. Ihr Herz schlägt derzeit besonders für Inseln – vor allem wenn sie gänzlich unbekannt sind und von wilden Wellen umtost werden. Wenn sie dann auch noch mit überraschender Fauna und Flora und schrulligen Bewohnern aufwarten, ist ihr Glück perfekt.
Lieferbare Titel
Highland Hope 1 – Ein Bed & Breakfast für Kirkby
Highland Hope 2 – Ein Pub für Kirkby
Highland Hope 3 – Eine Destillerie für Kirkby
Highland Hope 4 – Eine Bäckerei für Kirkby
CHARLOTTE McGREGOR
DER GARTEN AM MEER
Roman
WILHELMHEYNEVERLAGMÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Originalausgabe 05/2022
Copyright © 2022 by Charlotte McGregor
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Michael Gaeb
Copyright © 2022 dieser Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Julia Funcke
Covergestaltung: ZeroMedia GmbH, München, unter Verwendung von © iStockphoto (Svetlana Vorontsova, ksushsh), FinePic®, München
Karte auf U2: © Livi Gosling
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-28930-0V002
www.heyne.de
FERNWEH
»Willst du wirklich den schottischen Frühling gegen den südafrikanischen Herbst eintauschen, Philippa?«
Ich hatte nicht bemerkt, dass mein Chef John Harper ins Büro gekommen war, und sah ertappt von dem Karton auf, in den ich gerade meine restlichen Sachen packte. Der Leiter des Royal Botanic Garden lächelte mich an, doch ich konnte die Wehmut in seinem Blick erkennen. Eine Wehmut, die ich sogar ein wenig teilte, schließlich hatte ich fast zwanzig Jahre hier mit ihm zusammengearbeitet, und wir hatten einiges auf die Beine gestellt.
»Hm, der schottische Frühling hat mich noch nie sonderlich reizen können«, entgegnete ich mit einem vielsagenden Blick auf das Dach des angrenzenden Gewächshauses, auf das ein heftiger Regenschauer niederprasselte wie Gewehrsalven. Der ohrenbetäubende Lärm war vermutlich auch der Grund gewesen, warum ich John nicht hatte reinkommen hören.
»Als gäbe es in Kapstadt keinen Regen«, brummte er.
»Längst nicht so viel wie hier jedenfalls.« Ich grinste – auch wenn meine vorherige Aussage dreist gelogen war. Ich liebte den schottischen Frühling nämlich sehr. Wie ich Frühling überhaupt liebte. Es war immer ein Zeichen der Erneuerung und der Hoffnung, wenn die Natur aus ihrer Winterstarre erwachte und neues Leben sprießte. Und, ja, es fiel mir auch schwer, ausgerechnet zu dieser Jahreszeit zu gehen. Viel lieber hätte ich Edinburgh schon im Herbst verlassen, vor den langen dunklen, nasskalten Monaten, doch mein Traumjob startete erst Anfang Mai, in gut einer Woche.
Ich hatte vor mehr als zwanzig Jahren in Kapstadt Biologie studiert und mich während meines ersten Praktikums im Botanischen Garten Kirstenbosch in die einzigartige Flora der Kapregion verliebt. Am liebsten hätte ich gleich nach meinem Studienabschluss angefangen, fest dort zu arbeiten – was für mein weiteres Leben sicher die bessere Entscheidung gewesen wäre. Doch eine kleine innere Stimme hatte mich dazu gebracht, meiner Heimat und meiner Familie noch eine zweite Chance zu geben. Ich schüttelte unmerklich den Kopf, um diesen Gedanken loszuwerden. Er hatte keine Bedeutung mehr. In wenigen Tagen würde ich endlich zurück an meinem Sehnsuchtsort sein und konnte dann einen dicken, endgültigen Schlussstrich unter all das andere Elend ziehen.
»Ein bisschen wirst du uns aber schon vermissen, oder?«, nahm John den Gesprächsfaden wieder auf und schaute zu, wie ich meine heiß geliebte Kaktustasse in den Karton packte. Die hatte mir vor Jahren ein Kollege mit den bitteren Worten »Du bist so stachelig wie ein alter Kaktus« überreicht. Das »Geschenk« war als Beleidigung gedacht gewesen, doch der schreiend grüne Pott hatte sich in mein Herz geschlichen. Jedenfalls deutlich mehr als der verschmähte Verehrer, dessen Namen ich längst vergessen hatte.
»Ein bisschen«, gab ich lächelnd zu. »Aber vielleicht besucht ihr mich einfach mal – im Winter, wenn hier nicht viel zu tun ist, in Afrika aber alles blüht?« Vor meinem inneren Auge sah ich schon, wie ich John und eine Handvoll Kolleginnen und Kollegen, die mir über die Jahre zu engen Freunden geworden waren, über die verschlungenen und üppig blühenden Pfade von Kirstenbosch führte. Ihnen die prächtigen Proteen zeigte, von denen die Königsprotea sicherlich die bekannteste, in meinen Augen aber nicht unbedingt die schönste war. Ich dachte an die winzigen Nektarvögel, die einen Teil der Bestäubungsarbeit übernahmen, wie es bei uns Bienen und Hummeln taten.
»Sag das nicht zu laut, sonst kommen wir tatsächlich und überfallen dich.«
»Ich würde mich sehr freuen.« Mit einem doch erstaunlich melancholischen Seufzer schaute ich mich noch einmal um, ob ich auch wirklich nichts vergessen hatte. Dieser Raum war eine Mischung aus Gemeinschaftsbüro und improvisiertem Gewächshaus. Auf fast jedem Schreibtisch standen Anzuchtschalen, und in einem riesigen Stahlschrank lagerte Saatgut aus aller Herren Länder, das wir von Besuchern bekommen oder aus privaten Urlauben selbst mitgebracht hatten, das aber nicht in die öffentliche Ausstellung passte. Außerdem hatten wir ein Terrarium, in dem eine Kragenechse namens Penny hauste, die wir eines Tages in einem Gewächshaus gefunden hatten. Offenbar hatte ein Besucher sein Haustier loswerden wollen.
Das hier war viele Jahre lang meine berufliche Heimat gewesen und gleichzeitig die Kulisse für allerlei persönliche Dramen. Paare hatten sich gefunden – manche waren Symbiosen eingegangen wie einige unserer Pflanzen, andere hatten sich als so toxisch erwiesen, dass wir sie in unserem Giftschrank hätten lagern können. Kollegen waren gekommen und gegangen, manche waren zu Freunden geworden, andere nicht. Kurz: das pralle Leben auf geschätzt fünfzig Quadratmetern.
»Aber du kommst nachher noch in den Pub, oder?« John hatte mich während meines stummen Abschiednehmens nicht aus den Augen gelassen und erinnerte mich jetzt wieder an die Farewell-Party, die er für mich organisiert hatte.
»Natürlich«, bestätigte ich. Im Feiern waren wir auch immer gut gewesen, deshalb würde ich mir die Fete um keinen Preis entgehen lassen. Auch wenn mich diese gefühlt endlose Verabschiedung zunehmend zermürbte und ich zudem meine kleine Schwester Frances würde enttäuschen müssen. Die hatte mich nämlich zur Vernissage ihrer Ausstellung eingeladen, auf die sie unglaublich stolz war.
Unser Familienküken, das einzige Mitglied meiner dysfunktionalen Sippe, zu dem ich wenigstens etwas Kontakt pflegte, war Künstlerin und hatte es offensichtlich geschafft, eine Galerie von ihrem Talent zu überzeugen. Ich wusste nicht viel über Malerei. Nein, das war noch stark übertrieben, ich hatte nicht die geringste Ahnung davon. Aber ich mochte Frances’ Bilder, auch wenn ich die abstrakten, kühnen Pinselstriche nicht verstand. Sie waren mal düster, mal vordergründig lieblich, aber immer lag ein gewisser Subtext darunter, der mich seltsam berührte. Doch das würde er auch morgen oder übermorgen noch tun. Und ich hatte zweifellos mehr davon, wenn ich mir die Ausstellung ohne Gewühl anschaute und mir die Bilder von ihr erklären lassen konnte. Außerdem kannte ich kaum jemanden von ihren Freunden, und in der Kunstszene war ich ungefähr so fremd wie eine Protea in den schottischen Highlands. Frances würde das bestimmt verstehen.
»Gut, dann sehen wir uns nachher.« John rieb sich die Hände und verschwand im Gewächshaus.
Der Regen hatte aufgehört, zumindest momentan, und ich beschloss, die Gunst der Stunde zu nutzen, um es einigermaßen trocken zum Auto zu schaffen. Die Tränen, die sich urplötzlich in meinen Augen sammelten, zählten nicht, oder?
»Pippa, du musst einfach kommen«, flehte mir Frances durchs Telefon ins Ohr. Dieser Tonfall war die letzte Eskalationsstufe bei ihren Bemühungen, mich umzustimmen. Aus Erfahrung wusste ich, dass ich nur noch wenige Augenblicke würde durchhalten müssen, bis sie klein beigab. »Du ahnst gar nicht, wie wichtig dieser Abend für mich ist, und ich würde mich so sehr freuen, wenn wenigstens ein Familienmitglied zur Eröffnung meiner Ausstellung käme«, betonte sie jedoch und hatte mich damit fast weichgekocht.
»Frannie …« Ich seufzte hilflos und suchte im Geiste schon nach Möglichkeiten, beide Events zu verbinden. Den Pub-Abend mit meinen Kollegen – Pardon: Ex-Kollegen – und die Vernissage, die mich nicht im Geringsten interessierte, aber … Himmel, sie war nun mal meine kleine Schwester und das einzige Mitglied unserer kaputten Sippe, das mir wirklich etwas bedeutete.
»Es haben sich ein paar Journalisten angekündigt, sogar ein TV-Team, und Runa hat Einladungen an ihre komplette Kundenkartei verschickt. Sie hat auch ein tolles Catering bestellt, weil sie mit einem Riesenerfolg rechnet«, sprach Frances weiter, und ich konnte den Stolz in ihrer Stimme hören.
»Das ist wirklich unglaublich toll«, gab ich zu, allerdings mit wieder gestärkten Abwehrkräften. Bei so einem Massenauflauf würde sie mich garantiert nicht vermissen – und ich mich nur unwohl fühlen. »Ich finde, du hast die ungeteilte Aufmerksamkeit der Kunstszene Edinburghs, ach was, von ganz Schottland verdient. Mindestens. Und ich bin auch wahnsinnig gespannt auf deine neuen Bilder. Ich war ja länger nicht mehr bei dir im Atelier und bin gar nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Aber ich glaube, ich hätte mehr davon, wenn wir beide morgen in Ruhe durch die Galerie laufen und du mir alles erklären kannst. Heute Abend wäre ich nur fehl am Platz mit meinen ahnungslosen Fragen.«
Ich hörte ein Geräusch durch die Leitung, das wie ein resigniertes Schnauben klang, doch dann sagte Frances mit erstaunlich aufgeräumter Stimme: »Ich musste es versuchen, und es war sehr erhellend, mir deine Argumente dafür anzuhören, dass du nicht kommen willst.«
»Von ›nicht wollen‹ kann gar keine Rede sein«, behauptete ich. »Eher …«
»Von Prioritäten. Ich versteh schon.«
»Nein, das glaube ich nicht. Aber während ich mir morgen oder übermorgen oder die ganze nächste Woche jeden Tag deine Bilder ansehen und mich über die tollen Zeitungs- und Fernsehberichte mit dir freuen kann, ist heute eben die einzige Chance, mich von den Menschen zu verabschieden, mit denen ich fast zwanzig Jahre zusammengearbeitet habe. John hat Andeutungen gemacht, dass sie sich etwas Besonderes überlegt haben.« Es war wirklich vertrackt und eine Entscheidung zwischen Pest und Cholera, aber diesen geschmacklosen Vergleich würde ich ganz sicher nicht aussprechen. »Das alles ändert aber nichts daran, dass ich wahnsinnig stolz auf dich bin und ahne, was für ein großer Moment deine erste eigene Ausstellung sein muss. Ich bin jedoch überzeugt davon, dass noch viele folgen werden.«
»Du redest dich immer mehr um Kopf und Kragen, Schwesterherz«, entgegnete Frances und klang amüsiert. »Mach dir nicht zu viele Gedanken. Ich hätte es schön gefunden, wenn du dabei gewesen wärst, aber ich verstehe auch, dass du lieber mit deinen Freunden feierst. Das ist für dich ja auch ein großer Moment. Wir sehen uns dann morgen.«
»Darf ich dich und Rufus vielleicht zum Brunch einladen, und danach gehen wir in die Galerie und schauen uns deine Bilder an?«, schlug ich als versöhnliche Geste vor.
Nun lachte Frances laut auf. »Klar, dafür ist ein Dreijähriger ja die ideale Begleitung. Erst schick brunchen und dann in eine Kunstausstellung. Weißt du, was? Komm einfach gegen zehn zu mir. Bis dahin habe ich Rufus auch schon bei seinem Kumpel abgeholt, wo er heute übernachtet. Wir frühstücken dann bei mir und überlegen uns anschließend, ob wir Lust auf die Ausstellung haben, ja?«
»Klingt nach einem Plan«, antwortete ich lahm, denn der unausgesprochene Subtext nagte schon wieder an mir. Du interessierst dich nicht für meine Kunst, nicht für mein Kind und nicht für mein Leben, hörte ich klar und deutlich zwischen den Zeilen heraus. Das eigentlich Schlimme daran war, dass es stimmte. Also, nicht in dieser Absolutheit, aber eben doch. Frances führte ein völlig anderes Leben als ich. Das war auch vollkommen okay, und ich wusste, dass ich mich deswegen nicht schlecht fühlen sollte, aber ganz kam ich aus meiner Haut eben nicht heraus. Es wurde wirklich Zeit, dass ich das alles hinter mir ließ. »Viel Erfolg heute Abend und bis morgen dann«, verabschiedete ich mich und legte auf.
Frustriert von mir und der ganzen Situation setzte ich mich auf den wackeligen Küchenstuhl, der als einzige Sitzgelegenheit in meiner Wohnung verblieben war. Ich hatte meine gesamte Einrichtung in den letzten Wochen verkauft oder verschenkt, denn es wäre Unsinn gewesen, Möbel nach Südafrika verschiffen zu lassen. In den ersten Wochen dort konnte ich in einem möblierten Zimmer direkt am Park wohnen und mir in Ruhe eine schöne Wohnung suchen, entweder in Kapstadt oder in einem der hübschen kleinen Orte am Tafelberg. Und selbst wenn ich mich dort komplett neu einrichten musste, war das immer noch günstiger, als meine alten Sachen mit einem Container um die halbe Welt zu schicken.
Auch sonst hatte ich gründlich ausgemistet – in meinen Sachen und in meinem Leben. Ich hatte mich von all dem Plunder getrennt, den man im Laufe der Zeit so ansammelt: Nippes, Krimskrams, Bücher, falsche Freunde, erkaltete Lieben und giftige Familienmitglieder. Mein neues Leben sollte ein echter Neuanfang werden – unbeschwert und voller Möglichkeiten, eine jungfräulich weiße Leinwand. Nur noch eine Woche, redete ich mir ein, um gegen das Gefühl der Beklemmung anzukämpfen, das in mir aufstieg. Nur noch eine Woche im düsteren grauen Schottland samt seinen dunklen Geistern und gierigen Zwischenweltwesen. Dann würde alles gut werden, unter der Sonne Südafrikas.
Vor mir standen drei große Kartons, zwei Koffer und zwei Reisetaschen. Selbst das war noch zu viel, also würde ich mich noch von einigen Dingen trennen müssen. Ich schnappte mir ein großes Fotoalbum, das wie ein Relikt aus längst vergangener Zeit wirkte. Wer machte sich heutzutage denn noch die Mühe, Fotos ausdrucken zu lassen und sie in ein Album zu kleben? Das höchste der Gefühle waren Fotobücher von schönen Reisen oder anlässlich irgendwelcher Familienfeiern, doch die meisten Schnappschüsse vegetierten für alle Ewigkeiten auf den Speicherchips von Smartphones dahin.
Mit dem Album hatte ich während meiner Schulzeit begonnen. Meine Mitschülerinnen im Internat hatten alle liebevoll gestaltete Alben gehabt, in denen die denkwürdigen Momente ihrer Familien dokumentiert waren, da hatte ich nicht zurückstehen wollen. Also hatte ich mir selbst ein Album besorgt, als ich ungefähr elf oder zwölf gewesen war, und hatte meine Eltern um Fotos aus meiner frühen Kindheit angebettelt. Sie hatten natürlich keine Zeit gehabt, sich darum zu kümmern, doch Mildred, die langjährige Hausdame unseres Hotels, hatte sich erbarmt und in alten Unterlagen gestöbert.
Meine Eltern hatten das alte Herrenhaus, das formal mein Zuhause war, sich aber nie so angefühlt hatte, schon Jahre vor meiner Geburt zu einem feudalen Luxushotel umgebaut. Auch heute noch, knapp fünfzig Jahre nach seiner Eröffnung, zählte es zu den absoluten Topadressen in Schottland. Für die Gäste war es ein Highlight, dort abzusteigen. Dort aufzuwachsen, war jedoch die Hölle gewesen.
Wobei »aufwachsen« sowieso völlig übertrieben formuliert war. Mit fünf Jahren war ich ins Internat gekommen, meine jüngeren Geschwister ebenso, sodass wir uns praktisch nie gesehen hatten und uns daher bis heute ziemlich fremd waren. Mildred jedenfalls war nicht nur die gute Seele des Hotels gewesen, sondern hatte sich auch immer um uns Kinder gekümmert, wenn wir in den Ferien oder gelegentlich an den Wochenenden zu Hause gewesen waren. Und Mildred hatte ein paar Fotos aufgetrieben. Aus meiner Kindheit, von der Geburt bis ungefähr zu meinem zehnten Lebensjahr, gab es im Album stolze siebzehn ungestellte Schnappschüsse. Die übrigen Motive waren Familienporträts, die meine Eltern zu Weihnachten und Ostern hatten anfertigen lassen, um der restlichen Verwandtschaft einen Hauch von heiler Welt vorzuspielen.
Wenn ich mir diese Bilder heute anschaute, spürte ich eine Mischung aus Groll und Traurigkeit. Formal gesehen hatte ich eine Familie, tatsächlich aber fühlte ich mich selbst der neuesten Praktikantin im Royal Botanic Garden näher als meinen Eltern und meinen Brüdern Sean und Dominic. Nur mit Frances lief es etwas besser, obwohl sie fast zehn Jahre jünger war als ich. Vermutlich hatte ich mich für sie verantwortlich gefühlt und hatte ihr eine ähnlich triste Kindheit ersparen wollen, wie unsere Brüder und ich sie gehabt hatten. Natürlich hatte das nicht geklappt, schließlich war ich mit achtzehn zum Studieren nach Südafrika gegangen. Doch als ich vier Jahre später zurückkehrte, hatte sie die Wochenenden lieber bei mir in Edinburgh verbracht als im Hotel meiner Eltern.
Ich entdeckte ein paar Fotos von dem Tag, an dem ich sie und einige ihrer Freundinnen nach der offiziellen Öffnungszeit in ein Exoten-Gewächshaus eingeschleust hatte, für eine improvisierte Geburtstagsparty mit Picknick unter Palmen. Auf wenigen Bildern jenseits der krampfigen Familienfotos waren auch Sean und Dominic zu sehen. Sean, der Zweitjüngste der Familie, war ähnlich künstlerisch talentiert wie Frances und hatte zum Entsetzen unserer Eltern am Central Saint Martins College in London Materialkunde mit Schwerpunkt Keramik studiert. Soweit ich wusste, hatte er mit seinen Skulpturen einige Achtungserfolge erzielt, aber seit ein paar Jahren lebte er zurückgezogen in einem Nest in den Highlands und stellte neben seinen Objekten nun auch Gebrauchsgegenstände wie Geschirr her. Ob und wie gut man davon leben konnte, war mir ebenso unklar wie meinen Eltern, doch bei unseren seltenen Telefonaten wirkte Sean durchaus zufrieden. Dominic hatte ich seit Jahren nicht mehr zu Gesicht bekommen. Er war wie ich zum Studium ins Ausland gegangen – in seinem Fall Informatik in Berkeley –, aber anders als ich war er geblieben und hatte eine ziemlich imposante Karriere im Silicon Valley hingelegt. Burn-out und Sinnkrise inklusive, wie ich mir aus seinen spärlichen Nachrichten zusammenreimen konnte. Derzeit schien er sich jedoch ebenfalls umzuorientieren und hatte sich in einen kleinen Ort auf Vancouver Island zurückgezogen.
Meine Brüder hatten schon vor Jahren instinktiv das Richtige getan und sich möglichst weit von unserem toxischen Familienleben entfernt. Ich hätte damals einfach auch in Kapstadt bleiben und den Job annehmen sollen, den man mir angeboten hatte. Ich blätterte zurück zu den Fotos aus dieser Zeit. Wir waren eine coole, bunte, internationale Clique gewesen, und so unbeschwert, wie ich auf den Bildern strahlte, hatte ich mich seit vielen Jahren nicht mehr gefühlt, selbst wenn damals auch nicht alles rosig gewesen war. Ob die Leichtigkeit zurückkommen würde? Ich würde es bald herausfinden.
Entschlossen klappte ich das Album zu. Ich würde es auf jeden Fall mitnehmen und hoffentlich einige weitere farbenfrohe Erinnerungen hinzufügen können. Doch nun wartete die Abschiedsparty im Pub auf mich.
»Ihr seid absolut verrückt!« Ich hatte große Mühe, meine Rührung zu verbergen. John und meine Lieblingskollegin Kaya hatten mir und allen Gästen im Pub soeben das Abschiedsgeschenk präsentiert – ein mehrminütiges Video, das auf allen Fernsehbildschirmen der Sportkneipe abgespielt wurde. Sie hatten sämtliche Kolleginnen und Kollegen im Royal Botanic Garden dazu gebracht, ein paar warme Worte für mich in die Kamera zu sprechen. Bei manchen war es lediglich die eine oder andere freundliche Floskel, andere hatten sich als wahre Komödianten entpuppt und lustige Anekdoten aus unserer gemeinsamen Zeit zum Besten gegeben. Dazwischen wurden reichlich Fotos von mir in mal mehr, mal weniger schmeichelhaften Posen eingeblendet – und der Clip, in dem ich einer Horde Grundschüler etwas über fleischfressende Pflanzen erzählen wollte, aber ständig von haarsträubenden Kinderfragen aus dem Konzept gebracht wurde, war natürlich auch dabei. Dieses Filmchen war schon bei unserer Weihnachtsfeier vor ein paar Jahren der große Lacher gewesen – vorwiegend für die anderen. Ich erinnerte mich immer noch mit Schaudern an den grauenhaften Vormittag, an dem ich bei der Kinderführung hatte einspringen müssen. Zum ersten und zum letzten Mal.
»Wir wollten sichergehen, dass du dich immer an die Highlights der letzten Jahre erinnerst und uns nicht vergisst«, sagte Kaya grinsend und zog mich dann herzhaft in die Arme. »Du wirst uns fehlen.«
»Ihr mir auch«, schniefte ich und schluckte gegen die Tränen an. »Und ich hoffe, ihr besucht mich alle mal am Kap!«
»Du wirst dir noch wünschen, diese Einladung nicht ausgesprochen zu haben«, warf John mit einem verschmitzten Grinsen ein. »Meine Frau checkt schon Flüge für November.« Dann überreichte er mir eine winzige Schachtel im Tartanmuster. »Falls du Heimweh nach Schottland bekommst«, erklärte er.
»Was ist da drin?«, fragte ich und wog das Kästchen in meiner Handfläche. Es war federleicht, und als ich es schüttelte, hörte ich ein rieselndes Geräusch.
»Mach’s auf«, forderte John mich auf, und die anderen Kollegen versammelten sich um uns.
Ich hob den Deckel hoch und starrte auf ein gutes Dutzend Samenkörner. Nun konnte ich die Tränen nicht mehr zurückhalten. Es waren Distelsamen – die schottische Nationalblume. Auch wenn ich mich im Gegensatz zu vielen meiner Mitmenschen nie sonderlich patriotisch gefühlt hatte und einer südafrikanischen Protea jederzeit den Vorzug vor einer stacheligen Distelblüte geben würde, brachte mich dieses kleine Geschenk vollends aus der Fassung.
»Nur für den unwahrscheinlichen Fall, dass du im Paradies Heimweh nach grauer schottischer Tristesse bekommst«, sagte Kaya betont munter und orderte dann eine weitere Runde. »Und nun lass uns dafür sorgen, dass du heute nicht nüchtern in dein Bett fällst.«
Die Gin Tonics nahmen dem Abschiedsschmerz tatsächlich etwas die Spitze, und ich verbrachte einen ausgesprochen fröhlichen Abend. Der Film wurde noch zwei weitere Male gezeigt, bis auch der letzte unbescholtene Gast des Pubs wusste, was für eine Niete ich im Umgang mit kleinen, wissbegierigen Kindern war und wie gut ich dagegen mit schweigsamen Rhododendren und Kragenechsen konnte. Ich überlegte gerade, ob ich noch einen weiteren Drink bestellen oder lieber aufbrechen sollte, als mein Handy klingelte. Neugierig, wer um alles in der Welt mich gegen Mitternacht anrief, angelte ich mir das Telefon und schaute aufs Display. Es war eine Nummer aus Edinburgh, aber keine, die ich kannte oder einprogrammiert hatte. Vielleicht ein Kollege, der schon gegangen war, aber etwas vergessen hatte? »Hallo?«, meldete ich mich.
»Spreche ich mit Philippa Gordon?«, entgegnete eine etwas unpersönliche Frauenstimme.
»Wer will das wissen?«, fragte ich stirnrunzelnd zurück. Für einen Marketinganruf war es eine ungewöhnliche Zeit.
»Polizei von Edinburgh, mein Name ist Karen McVie. Sind Sie Philippa Gordon?«
Polizei? Mein Mund wurde schlagartig trocken. »Ja«, gab ich knapp zurück.
»Sie sind der Notfallkontakt von Frances Gordon«, sagte die Polizistin. »Zumindest entnehmen wir das der Kontaktliste in Ms. Gordons Telefon. Ich nehme an, Sie sind ihre Schwester?«
Notfallkontakt? Frances? Das Denken fiel mir schwer, und ich hatte Mühe, mir einen Reim auf die Worte der Frau zu machen. Die fröhliche Pub-Kulisse war dabei auch nicht besonders hilfreich. Kaya und John warfen mir fragende Blicke zu, und ich ging ein paar Schritte Richtung Ausgang. »Ja, die bin ich«, krächzte ich schließlich. »Ist etwas passiert?«
»Ihre Schwester hatte einen schweren Unfall. Sie wird gerade in der Notaufnahme des Royal Infirmary behandelt. Es sieht sehr kritisch aus. Wenn Sie ihre nächste Angehörige sind …«
Was die Polizistin weiter von sich gab, hörte ich kaum noch. »Ich komme so schnell wie möglich.«
KATASTROPHENSTIMMUNG
Schrilles Dauerpiepsen, grelles Licht, unglaubliche Hektik – ich nahm das alles wie durch eine dicke Glasscheibe wahr. Ich hatte mal einen Science-Fiction-Film gesehen, da war die Heldin in einer Art Zeit- oder Phasenverschiebung gefangen gewesen. Sie war zwar weiterhin im selben Raum gewesen, aber alles war seltsam verzerrt und verschwommen bei ihr angekommen, und sie hatte sich auch nicht mit anderen Menschen verständigen können. Genau so fühlte ich mich jetzt. Ich stand in dem Raum, in dem zwei Ärztinnen und einige Pfleger um das Leben meiner Schwester rangen, und ich fühlte mich vor allem verwirrt.
Nach dem Anruf der Polizistin hatte ich wie auf Autopilot funktioniert. Ich hatte Kaya kurz Bescheid gegeben, meine Zeche gezahlt, mir ein Taxi gerufen und war zum Krankenhaus gefahren. So reimte ich es mir jedenfalls zusammen, erinnern konnte ich mich nicht daran. Die Polizistin war ebenfalls im Krankenhaus, mit einigen anderen Kollegen. Wegen Befragungen oder so. Es war mir nicht ganz klar – sie hatte es mir erklärt, aber ich hatte es nicht begriffen. In meinem Kopf dröhnte es. Eine Kakofonie von Fragen, die ich nicht verstand. Wie ich überhaupt nichts verstand in diesem Moment.
Hatte ich nicht vor wenigen Stunden erst mit Frances telefoniert? Wir waren doch morgen zum Frühstücken verabredet. Warum war sie nicht in der Galerie, bei ihrer Vernissage? Warum lag sie hier – blutend? Mit mehr gebrochenen Knochen im Leib als unversehrten? Wie war ich hierhergekommen? Warum …? Und was war mit Rufus? Musste ich etwas tun? Konnte ich etwas tun? Wie lange war ich schon hier? Wie viel Zeit war seit dem Anruf vergangen?
»Ms. Gordon.«
Das Piepsen hatte aufgehört. Schon vor einiger Zeit. Das war ein gutes Zeichen, oder?
»Ms. Gordon!«
Jemand legte mir eine Hand auf die Schulter, und ich zuckte erschrocken zusammen. Der Nebel lichtete sich für einen Moment. »Hm?« Mehr brachte ich nicht hervor. Ich versuchte, den Menschen wahrzunehmen, der offensichtlich mit mir sprechen wollte und dessen Hand immer noch auf meiner Schulter lag. Es war eine der Ärztinnen. Der gelbe Plastikkittel, den sie über ihrem OP-Anzug trug, war blutig und … Ich musste wieder wegsehen. Sie schob mich sanft zur Tür hinaus, in einen angrenzenden Wartebereich, und lotste mich zu einem Stuhl.
»Ms. Gordon, es tut mir wahnsinnig leid, aber Ihre Schwester hat es nicht geschafft.«
Hat. Es. Nicht. Geschafft.
Ich verstand die Worte, doch die Bedeutung wollte sich nicht einstellen. Die dicke Glaswand war wieder da. Und Watte. Viel Watte um mich herum. War das normal? »Okay«, murmelte ich, weil ich das Gefühl hatte, irgendwie reagieren zu müssen, und doch keine Ahnung hatte, wie genau.
»Ms. Gordon«, diesmal klang die Ärztin eindringlicher. »Haben Sie mich verstanden? Ihre Schwester ist tot. Sie ist an ihren schweren Verletzungen gestorben. Mein aufrichtiges Beileid.«
»Was?«, krächzte ich und schien auf einmal keine Luft mehr zu bekommen. Die Watte war einer eiskalten, schweren Metallkette gewichen, die sich um meinen Hals und um meinen Brustkorb zusammenzog. Mir wurde schwindlig, aber gleichzeitig begriff ich plötzlich mit vollkommener Klarheit, dass Frances tot war. Meine kleine Schwester war an einem der wichtigsten Tage ihres Lebens gestorben. Ich versuchte aufzustehen, um zu ihr zu laufen, doch meine Beine gehorchten mir nicht, und außerdem nahm die Ärztin nun meine Hand.
»Sie haben einen Schock, Ms. Gordon«, sagte sie mit sanfter Stimme.
»Aber ich muss zu ihr.«
»Wir bringen sie gleich in einen ruhigen Raum, dann können Sie und andere Angehörige Abschied nehmen. Sollen wir für Sie jemanden informieren?«
Ich schüttelte den Kopf und tastete mit fahrigen Fingern nach meinem Telefon. Ich musste meinen Brüdern Bescheid geben und unseren Eltern und … o Gott, was war mit Rufus? Ein Schluchzer entfuhr mir.
»Mein aufrichtiges Beileid, Ms. Gordon«, erklang eine andere Stimme. Es war die Polizistin, die mich vorhin angerufen hatte und die jetzt wieder vor mir stand.
»Ich versteh einfach nicht …« Mir versagte die Stimme. Ich verstand tatsächlich nicht viel, aber das wenige überforderte mich schon völlig. Frances war tot.
»Wir haben den Tathergang inzwischen aufgrund von Zeugenaussagen ziemlich eindeutig rekonstruieren können«, fuhr die Polizistin fort.
»Tathergang? Ich dachte, es war ein Unfall?« Ich sah, wie die Polizistin mit der Ärztin Blicke wechselte.
Die Ärztin drückte meine Hand und stand dann auf. »Ich bin gleich wieder bei Ihnen.«
»Nach allem, was wir bisher wissen, haben Ihre Schwester und ihr Begleiter Kevin Coolidge die Galerie RunArt gegen dreiundzwanzig Uhr verlassen. Beide waren ziemlich angetrunken und offenbar im Streit miteinander, der zunehmend handgreiflicher wurde. Mr. Coolidge hat Ms. Gordon geschubst, dadurch kam sie ins Straucheln, ist auf die Fahrbahn gestolpert und wurde dort von einem Taxi erfasst, das nicht mehr bremsen konnte. Mr. Coolidge ist daraufhin ebenfalls auf die Straße gerannt und wurde von einem anderen Fahrzeug leicht gestreift. Alle Unfallbeteiligten wurden in die Klinik gebracht, meine Kollegen haben die Ermittlungen übernommen. Es waren sehr viele Menschen unterwegs, weshalb es kaum Zweifel am Ablauf gibt. Unklar ist uns jedoch noch, in welchem Verhältnis Ihre Schwester zu Kevin Coolidge stand. Können Sie uns da vielleicht weiterhelfen?«
Ich schüttelte den Kopf. Ich hatte keine Ahnung, wer dieser Kerl war. Frances hatte ihn nie erwähnt, wobei das nichts heißen musste bei ihrem enormen Verschleiß an Männern. »Ich weiß es nicht«, sagte ich daher.
»Kevin ist ein einflussreicher Kunstblogger«, mischte sich nun eine andere Stimme ein. Ich blickte nach oben und sah in das kalkweiße Gesicht einer Frau, von der ich, ohne sie zu kennen, wusste, dass es die Galeristin sein musste. Zumindest erfüllte sie jede klischeehafte Vorstellung in meinem Kopf. Sie trug einen schwarzen Rollkragenpullover, hatte einen akkurat geschnittenen, kinnlangen, dunkelrot gefärbten Pagenkopf, und unter dem schnurgeraden Pony dominierte eine schwarz umrandete Brille ihre dunkel geschminkten Augen.
»Und Sie sind?«, erkundigte sich die Polizistin.
»Ich bin Runa Robertson. Ihre Kollegen haben mich die halbe Nacht lang befragt, aber nun möchte ich endlich wissen, was mit Frances geschehen ist. Wie geht es ihr?«
»Ms. Gordon ist vor wenigen Minuten an ihren schweren Verletzungen gestorben«, entgegnete die Polizistin sachlich, wenn auch mit einem Hauch von einstudiertem Mitgefühl in der Stimme. Aber vielleicht spielte mir meine Wahrnehmung auch nur Streiche.
»Was? Nein! O Gott«, japste Runa vollkommen schockiert und ließ sich auf den freien Stuhl neben mir plumpsen.
»Sie sagten, dass Sie Kevin Coolidge kennen«, redete die Beamtin weiter. »Wissen Sie auch etwas über das Verhältnis der Verstorbenen zu ihm? Warum hatten sie Streit?«
Einem kleinen rationalen Teil von mir war klar, dass die Frau nur ihren Job machte. Ich hatte genügend Krimis gesehen, um zu wissen, dass es für Ermittlungsbehörden wichtig war, möglichst schnell an möglichst viele Informationen zu kommen. Doch ich fand es einfach nur unerträglich. Meine kleine Schwester war gestorben, was für sich genommen schon fast nicht zu begreifen war. Ich konnte mir nicht auch noch diese schrecklichen Fragen anhören. »Ich kann das nicht«, murmelte ich und rappelte mich mühsam hoch. Diesmal hielten meine Beine durch. Ich sah, wie die Polizistin den Mund aufmachte – zweifellos, um mich aufzuhalten –, doch da kam ein älterer Pfleger mit einem warmherzigen Lächeln auf mich zu.
»Wenn Sie wollen, bringe ich Sie jetzt zu Ihrer Schwester«, sagte er und wies mir den Weg.
Ich folgte ihm schweigend in einen kleinen, nur spärlich beleuchteten Raum. Darin stand ein Bett, in dem Frances lag. Man hatte ihr das Blut vom Gesicht gewaschen, und sie wirkte beinahe so, als würde sie schlafen. Ich streckte meine Hand aus, um eine ihrer vorwitzigen Locken zur Seite zu streichen, wie ich es früher immer getan hatte, doch dann zuckte ich im letzten Moment erschrocken zurück.
»Sie können sie gerne anfassen«, bemerkte der Pfleger hinter mir. »Vielen Menschen hilft das beim Abschiednehmen. Es ist buchstäblich …«
»… ein Begreifen«, vervollständigte ich leise seinen Satz. Dann setzte ich mich auf den Besucherstuhl und tastete nach Frances’ Hand. Sie war kühl, aber längst nicht so eisig wie meine eigene – und dann brachen bei mir alle Dämme.
Ich zuckte zusammen, als mein Telefon läutete, offensichtlich war ich eingenickt. Mein Bruder Dominic rief endlich zurück. Nach der ersten Tränenflut hatte ich es bei meinen Brüdern versucht. Sean hatte ich erfolgreich aus dem Schlaf geklingelt, er hatte sofort ins Auto springen und nach Edinburgh kommen wollen. Doch Dominic war nicht an sein Telefon gegangen. »Frances ist tot«, sagte ich zu ihm, und das schockierte Schweigen schallte lauter als die Worte, die dann folgten: »Ich nehme das nächste Flugzeug!« Keine Fragen, keine Ausflüchte, keine Vorwürfe, nur das Versprechen, dass er kommen würde.
»Wie viele Jahre haben wir ihn nicht mehr gesehen, Frannie?«, fragte ich die leblose Gestalt meiner Schwester. Dominic war schon ewig nicht mehr hier in Schottland gewesen – er hatte noch nicht einmal Rufus, unseren dreijährigen Neffen, kennengelernt. Beim Gedanken an den Kleinen wurde mir erst heiß und dann furchtbar kalt. Was würde jetzt mit ihm geschehen? Und wo war er im Moment?
Dunkel erinnerte ich mich an das Telefonat mit Frances gestern Abend. Unser letztes Telefonat, bei dem wir uns zum Frühstücken verabredet hatten. Rufus sei über Nacht bei einem seiner Freunde und dessen Familie, hatte sie gesagt, doch natürlich hatte ich keine Ahnung, wo und bei wem. O Gott, warum war ich nicht zur Vernissage gegangen, sondern hatte lieber mit meinen Freunden gefeiert? Vielleicht hätte ich das alles hier verhindern können. »Es tut mir so leid, Frannie«, würgte ich hervor und wurde von einer neuen Welle von Trauer und Verzweiflung geschüttelt.
Ihre Haut wirkte inzwischen wächsern und kalt. Meine Schwester war nicht mehr da – und ich musste sehen, wie ich damit klarkam. Mit meinen Schuldgefühlen und …
»Wir haben die Sachen Ihrer Schwester zusammengepackt.« Der Pfleger war zurückgekehrt und reichte mir eine dunkle Plastiktüte und separat ein Smartphone. »Es hat schon ein paarmal geklingelt. Vielleicht sollten Sie …? Und außerdem würde die Polizeibeamtin gerne noch einmal mit Ihnen sprechen, falls Sie sich dazu in der Lage fühlen.« Ich nickte mechanisch und holte ein paarmal tief Luft, um mich zu sammeln. »Wenn Sie sich vorher noch frisch machen wollen, die Damentoilette ist den Gang runter links.« Er reichte mir ein in Folie verpacktes türkisfarbenes Stoffpaket, mit dem ich nichts anfangen konnte. »Ich kann Ihnen auch einen Kaffee oder Tee besorgen.«
»Ein Tee wäre toll«, entgegnete ich und ging dann zur Toilette. Ich fühlte mich entsetzlich – und sah noch schlimmer aus. Mein Make-up war völlig verschmiert, und an meiner hellen Blümchenbluse prangte ein riesiger dunkler Blutfleck. Frances’ Blut, das irgendwie dahin gekommen sein musste, als ich bei ihr gewesen war, während die Ärzte noch um ihr Leben gekämpft hatten. Mir wurde übel, und einen Moment lang hatte ich Angst, mich übergeben zu müssen. Doch der Brechreiz klang wieder ab. Ich zog die Bluse aus, stopfte sie in den Mülleimer und wusch mir das Gesicht mit kaltem Wasser. Besser. Aber nur im BH konnte ich wohl kaum unter Leute gehen. Wo war eigentlich meine Jacke geblieben? Mein Blick fiel auf das flache türkisfarbene Paket, das sich bei näherem Hinsehen als OP-Shirt herausstellte. Rasch zog ich es über und raffte meine und Frances’ Sachen zusammen, um mich der nächsten Herausforderung zu stellen.
Als ich mich dem Warteraum näherte, in dem ich die Polizistin vermutete, piepste Frances’ Smartphone. Mit zitternden Fingern öffnete ich die Nachricht einer gewissen »Ethan-Mum Danielle«. Das Bild eines grinsenden Rufus und eines weiteren kleinen Jungen – beide in Pyjamas – leuchtete mir entgegen. Darunter stand der Text: Guten Morgen! Hoffe, du hattest einen genauso tollen Abend wie die Jungs. Melde dich, wenn du ausgeschlafen hast. Bei uns gibt’s jetzt Pancakes. Bis dann, D.
Meine Hände begannen, heftig zu zittern. Ich musste jetzt wohl …
»Kommen Sie«, drang eine resolute Stimme an mein Ohr, und eine kräftige Hand nahm meinen Arm und führte mich in den Warteraum. Es war wieder der Pfleger, der mir mehr und mehr wie mein persönlicher Schutzengel erschien. »Trinken Sie einen Schluck Tee, der wird Ihnen guttun.«
Was mir dagegen nicht so guttat, war der neuerliche Auftritt von Sergeant Karen McVie, die herbeieilte und mir in ihrer dunklen Uniform eher wie ein Racheengel vorkam.
»Ich habe wirklich andere Dinge zu tun, als Ihre Fragen zu beantworten«, sagte ich zu ihr und trank einen Schluck von dem starken, heißen Tee. »Zumal ich Ihnen ohnehin nicht helfen kann. Ich kenne diesen Mann nicht, der Schuld an Frances’ Tod hat, und ich kann Ihnen auch nichts über das Verhältnis der beiden erzählen. Aber ich muss eine Beerdigung organisieren, und vor allem muss ich mich um Rufus kümmern.«
»Ich hatte eigentlich keine weiteren Fragen mehr«, entgegnete sie matt, und mit einem Mal tat es mir leid, dass ich sie so angefahren hatte. Auch sie hatte eine harte Nacht hinter sich, mit einem Fall, der kaum das Zeug dazu hatte, Freude zu bereiten. »Ich wollte Sie nur darüber informieren, wie es weitergeht. Die Zeugenaussagen waren konsistent. Mr. Coolidge hat Ihre Schwester im Streit geschubst. Ob er damit gerechnet hat, dass sie auf die Straße stürzt, wissen wir nicht. Er macht bislang von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Es wird auf jeden Fall ein Ermittlungsverfahren gegen ihn geben. Ihre Schwester wird später noch rechtsmedizinisch untersucht, auf irgendwelche Auffälligkeiten …«
»Wollen Sie damit andeuten, dass meine Schwester im Drogenrausch ausgetickt ist?«, fuhr ich die Polizistin an.
»Ich will gar nichts andeuten, das sind die ganz normalen Abläufe in Fällen wie diesem, auch wenn es für die Angehörigen schwer zu ertragen ist«, versuchte sie, mich zu beschwichtigen.
»Da haben Sie recht. Es ist unerträglich. Und ich kann Ihnen versichern, dass Frances nicht unter Drogen stand. Mag sein, dass sie ein wenig betrunken war, schließlich hat sie ihre erste Ausstellung gefeiert. Aber Drogen nimmt sie nicht. Nahm sie nicht«, korrigierte ich mich selbst und spürte, wie mich die Erkenntnis, dass meine kleine Schwester wirklich tot war, wie eine eiskalte, harte Faust in den Magen boxte.
Sergeant McVie bedachte mich mit einem merkwürdigen Blick und schien mit aller Macht ein Seufzen zu unterdrücken. »Sie standen sich wohl sehr nahe? Wie gesagt, es ist keine böswillige Unterstellung, sondern reine Routine, und aus Erfahrung wissen wir leider, dass auch nahe Angehörige nicht immer über alles Bescheid wissen.«
Der nächste Faustschlag, denn damit hatte die Beamtin leider recht. Ich nickte nur.
»Sie haben einen Rufus erwähnt«, fuhr sie nun fort. »Wer ist das? Ein Partner? Ein Haustier?«
»Rufus ist Frances’ dreijähriger Sohn.«
»Oh. Ich … äh …« Das hatte sie offensichtlich aus dem Konzept gebracht. Sie blätterte in ihrem Notizbuch herum, in dem zweifellos alle möglichen Erkenntnisse und Zeugenaussagen standen, doch offensichtlich nichts darüber, dass Frances Mutter war. »Das wusste ich nicht. Gibt es … ähm … einen Vater zu dem Kind?«
»Biologisch ganz sicher, ansonsten nicht«, erwiderte ich schlicht. Frances hatte mir nie erzählt, wer Rufus’ Vater war. Gut möglich, dass sie es selbst nicht genau wusste oder dass sie diese Information aus anderen Gründen für sich behalten wollte.
»Und wer wird sich nun um das Kind kümmern?«
Das war in der Tat die große Frage. Mir kam der Tag von Rufus’ Geburt in den Sinn. Frances hatte mich angerufen, als der Kleine frisch auf der Welt gewesen war, und ich hatte die beiden sofort im Krankenhaus besucht. In genau diesem Krankenhaus, wie mir jetzt einfiel, und ich musste schon wieder hart schlucken. Frannie war erschöpft, aber glückselig gewesen, als sie mir das kleine Bündel Mensch gezeigt hatte. Doch dann war sie ganz ernst geworden und hatte zu mir gesagt: »Falls mir irgendwann mal etwas zustößt, Pippa, dann will ich, dass du dich um Rufus kümmerst. Niemand sonst. Ich vertraue keinem anderen Menschen so sehr wie dir.«
»Ich«, antwortete ich daher mit rauer Stimme. »Ich werde mich um ihn kümmern.«
Die Beamtin nickte und machte sich Notizen. »Wir werden diese Information ans Jugendamt weiterleiten, und man wird sich zweifellos mit Ihnen in Verbindung setzen. Aber leibliche Verwandte werden bei der Betreuung immer bevorzugt behandelt. Ich brauche von Ihnen jetzt nur noch Ihre vollständigen Personalien und Ihre Anschrift, dann …« Sie zögerte kurz, und ich hatte das Gefühl, dass sie nach geeigneten pietätvollen Worten suchte. »Dann habe ich für den Moment keine weiteren Fragen mehr an Sie.«
Ich zog meinen Ausweis aus dem Portemonnaie und nannte ihr meine Adresse. »Die gilt aber nur noch bis Ende der kommenden Woche …«
»Ziehen Sie um? Dann brauche ich bitte auch die neue Anschrift.«
»In Südafrika? Mein Flug nach Kapstadt geht am Freitag.«
Sergeant McVie sagte nichts, sondern sah mich nur an – und da wurde mir klar, dass in dieser Nacht nicht nur meine Schwester gestorben war, sondern auch mein Lebenstraum.
»Ich weiß nicht, wie ich das packen soll.« Ich starrte in das Whiskyglas, das mir Dominic in die Hand gedrückt hatte, doch die goldgelbe Flüssigkeit hatte auch keine Lösung für mich parat.
»Ich kann dir nur noch mal anbieten, zu mir in die Highlands zu kommen«, erklärte Sean. »Schon klar, dass das nicht dein Traum ist – und schon gar nicht Südafrika –, aber ich hätte Platz genug, und für Rufus wäre es vielleicht auch ganz schön.« Er schaute vielsagend zur Tür des Kinderzimmers, hinter der unser Neffe vor einer halben Stunde endlich eingeschlafen war.
»Ich weiß das echt zu schätzen«, entgegnete ich. »Aber was soll ich im Norden? Da finde ich im Leben keinen Job und …« Mir versagte schon wieder die Stimme.
Fünf Tage waren vergangen. Heute hatten wir Frances beerdigt, und langsam wurde mir das Ausmaß des Horrors so richtig bewusst. Bisher war ich vor allem damit beschäftigt gewesen, alles zu organisieren. Meine beiden Brüder hatten mich dabei tatkräftig unterstützt – unsere Eltern nicht. Wenn ich an ihre Reaktionen dachte, wurde mir immer noch ganz übel. Ich hatte immer angenommen, dass es für einen Menschen nichts Schlimmeres geben konnte als den Tod des eigenen Kindes, doch auch da wurde ich wieder eines Besseren belehrt. Sie waren schon seltsam emotionslos gewesen, als ich ihnen am Telefon von Frances’ Tod berichtet hatte. Sean war am selben Tag zu ihnen gefahren und ebenfalls nur auf kühle Ablehnung gestoßen. Das Timing sei ungünstig, hatten sie ihn wissen lassen. Am Abend gäbe es ein Charity-Event von nationaler Bedeutung im Haus, und für das kommende Wochenende stünde eine große Hochzeitsfeier an. Da könne man ihnen nicht zumuten, sich auch noch um die Organisation der Beerdigung und der Trauerfeier zu kümmern. Das Timing? Ernsthaft?
Also hatten wir alles geplant, zusammen mit einigen von Frances’ Freunden und ihrer Galeristin Runa. Das hatte unseren Eltern natürlich auch nicht gepasst, denn schließlich konnte das ja nichts Vernünftiges werden. Vorgestern waren Sean, Dominic und ich noch einmal gemeinsam zum Hotel gefahren und hatten mit ihnen reden wollen, doch das Gespräch mit den beiden war derart haarsträubend und gruselig gewesen, dass es mich regelrecht schüttelte, wenn ich nur daran dachte. Falls sie trauerten, wussten sie auch diese Gefühle gut zu verbergen. Aber eines war mir klar geworden: Ich wollte und würde mit diesen Menschen nichts mehr zu tun haben. Sie waren vorhin bei der Beerdigung gewesen, das immerhin. Aber sie hatten danach nicht mit uns geredet und waren direkt wieder abgefahren. Nicht einmal ihr einziges Enkelkind hatten sie zur Kenntnis genommen.
Was vermutlich auch besser war, denn Rufus war schon durcheinander genug. Ich wusste nicht, ob er verstand, dass seine Mummy tot war. Ob er überhaupt ein Konzept dafür hatte. Ich war völlig überfordert mit der Situation, denn von Kindern hatte ich noch weniger Ahnung als von Kunst. Ja, er war mein Neffe, und ich hatte ihn regelmäßig gesehen, aber ich hatte nie allein Zeit mit ihm verbracht. Ich wusste gar nichts. Nicht, was er gerne aß, nicht, wann er schlafen sollte, nicht, in welchen Kindergarten er ging.
Danielle, die Mutter seines Freundes Ethan, bei dem Rufus in der Unglücksnacht geschlafen hatte, war ein junges Ding von Mitte zwanzig. Sie war natürlich total schockiert gewesen und hatte mir sofort ihre Unterstützung angeboten, aber sie war alleinerziehend und hatte ganz offensichtlich selbst Probleme genug. Frances’ übriger Freundeskreis gehörte überwiegend zur Künstlerszene und bestand aus jungen, hippen und kinderlosen Menschen, die zum Teil nicht einmal gewusst hatten, dass Frances Mutter gewesen war.
Das Jugendamt hatte sich tatsächlich sehr schnell bei mir gemeldet und mir mitgeteilt, dass ich das vorläufige Sorgerecht für Rufus bekäme, sie aber versuchen würden, den leiblichen Vater des Kindes ausfindig zu machen. Solange dieser Prozess in der Schwebe hing, durfte ich das Land nicht verlassen. Zumindest nicht mit Rufus. Das war es dann auch offiziell mit meinem Traum, ein neues Leben in Südafrika zu beginnen. Mein neuer Chef hätte sich darauf eingelassen, dass ich zwei oder drei Wochen später anfing. Ich hätte auch Rufus mitbringen können. Aber es war absolut unklar, wie lange es dauern würde, bis die Behörden den Kindsvater ausfindig machten oder mir offiziell die Befähigung zur Betreuung eines verwaisten Kleinkindes bestätigten. Nach meiner Einschätzung würde Letzteres wohl nie passieren, und Ersteres war verdammt unwahrscheinlich. Doch ich hatte Frances mein Wort gegeben, dass ich mich um Rufus kümmern würde.
»Was willst du denn dann machen, wenn du nicht zu Sean in die Highlands ziehen möchtest?«, fragte mich Dominic. »Ich würde dich sofort nach Kanada mitnehmen, aber das geht ja genauso wenig wie Südafrika.«
Ich schüttelte den Kopf. »Ich hab keine Ahnung«, gab ich zu. »Vermutlich werde ich meinen Ex-Boss anrufen und ihn bitten, mich im Park als Aushilfe einzustellen.«
»Aushilfe? Du hast da doch fast zwanzig Jahre gearbeitet!«, rief Sean.
»Ja, aber es gibt natürlich einen Nachfolger für meinen Job. Alle Stellen sind im Moment besetzt, das ist für John auch nicht so einfach. Ich war die letzten Jahre ja vor allem in der Forschung tätig, aber ich würde auch als normale Gärtnerin arbeiten.« Ich seufzte und sah, wie sich meine Brüder besorgte Blicke zuwarfen. »Keine Sorge, ich finde eine Lösung«, behauptete ich.
»Lass mich dich finanziell unterstützen«, sagte Dominic. »Bis alles sortiert ist und du wieder eine eindeutige Perspektive hast. Du musst nicht im Dreck wühlen.«
»Zufällig liebe ich es, im Dreck zu wühlen«, entgegnete ich spitz. »Und ich brauche keine Almosen. Ich finanziere mein Leben seit zwanzig Jahren allein, das schaffe ich auch jetzt.«
»Das weiß ich doch. Aber es geht nicht nur um dich, sondern auch um Rufus. Er ist auch mein Neffe. Und …« Er verstummte, als ich abwinkte.
»Ich krieg das hin!«, beharrte ich. »Ich habe Frannie versprochen, dass ich mich im Notfall um ihren Sohn kümmern werde, und das habe ich auch vor. Egal, wie schwierig es wird. Aber ihr seid beide herzlich eingeladen, echte Onkel zu sein, denn ich habe nicht die leiseste Ahnung, wie man mit Kindern umgeht.«
»Das habe ich von mir auch immer gedacht, aber in Wirklichkeit ist es gar nicht so schwer. Man muss ihnen nur das Gefühl geben, dass man sie ernst nimmt«, behauptete Dominic, und ich meinte ein kleines Lächeln in seinen Mundwinkeln zu erkennen.
»Seit wann bist du denn Kinderexperte?«, fragte ich ihn überrascht.
»Seit er auf Vancouver Island eine komplizierte Geschichte am Laufen hat«, warf Sean mit einem verschmitzten Grinsen ein, das ihm aber gleich wieder verging. »Wäre das schön, wenn wir jetzt einfach nur über das Liebesleben unseres Bruders spekulieren könnten, was?« Er seufzte wehmütig.
»Das haben wir noch nie gemacht. Warum sollten wir jetzt damit anfangen?«, brummte ich harscher als beabsichtigt. Mir war wirklich nicht nach Klatsch und Tratsch – obwohl es durchaus angenehmer wäre, über triviale Dinge zu sprechen als über die Realität.
»Ist es nicht total traurig, dass wir das noch nie gemacht haben?«, bemerkte Dominic überraschenderweise. »Sean und ich haben vorhin schon festgestellt, wie schade es ist, dass wir so wenig voneinander wissen und uns so fremd sind.«
»Da haben unsere Erzeuger ganze Arbeit geleistet«, erwiderte ich kalt. Ich brachte es nicht mehr über mich, von den beiden als Eltern oder gar als »Mum und Dad« zu sprechen. Nicht angesichts ihres Verhaltens seit Frannies Tod. So wie die beiden ging man nicht mit anderen Menschen um. Schon gar nicht, wenn diese anderen Menschen die eigenen Kinder waren.
Plötzlich wurde mir heiß und kalt. Rufus – für ihn war ich jetzt der Mensch, der einem Elternteil am nächsten kam. War ich in der Lage, dem kleinen Kerl genug Sicherheit und Zuversicht zu geben, dass er zu einem weniger verkorksten Menschen heranwachsen würde, als ich und meine Brüder welche waren? Vermutlich nicht. Ich hatte es ja nie anders gelernt. Ich wusste nicht, wie man liebevoll und warmherzig mit Kindern umging. Ich wusste überhaupt nicht, wie man mit Kindern umgehen sollte. Meine Brüder wussten es auch nicht – okay, Dominic neuerdings angeblich schon. Wäre Rufus nicht besser dran, wenn er zu einer Pflegefamilie käme, zu Menschen, die sich mit den Bedürfnissen von Kindern auskannten? Die nicht in Panik gerieten, wenn ein Dreijähriger weinte? Oder trotzig tobte? Ganz sicher wäre es besser. Aber ich hatte Frances mein Wort gegeben – auch wenn ich damals nicht damit gerechnet hätte, es jemals einhalten zu müssen.
Frances hatte zweifellos ebenfalls nicht damit gerechnet. Sie hatte sich immer schlappgelacht, wenn ich mich mit Rufus ungeschickt und hilflos angestellt hatte. Genauso wie sie sich herzlich über die desaströse Kinderführung im Botanischen Garten amüsiert hatte. Vor diesem Hintergrund wäre es ihr womöglich auch lieber, wenn sich andere, bessere Menschen um ihr Kind kümmerten.
»Ja, das haben sie tatsächlich«, bestätigte Dominic meinen Kommentar bezüglich unserer Eltern. »Das bedeutet aber nicht, dass wir diesem Einfluss hilflos ausgeliefert sind. Wir können uns weiterentwickeln und eigene Erfahrungen machen. Genau genommen tun wir das doch schon seit Jahren. Vermutlich müssen wir uns nur noch von den mentalen Fesseln unserer Eltern befreien und endlich so leben, wie es für uns richtig ist. Ich habe echt lange gebraucht, um das zu begreifen. Genau genommen bin ich erst in allerjüngster Vergangenheit darauf gekommen. Aber es lohnt sich. Und ich würde mir wünschen, dass wir uns in Zukunft näherkommen. Ich will alles von euch wissen, und ich will auch mein Leben mit euch teilen.«
Ich starrte ihn fassungslos an, und auch Sean schien beeindruckt zu sein. So eine leidenschaftliche Rede hatte ich aus dem Mund meines sonst leicht verschroben wirkenden Bruders noch nie gehört. Erstaunlicherweise bewegten seine Worte sogar etwas in mir. Ich war mir nicht sicher, ob ich ihm glauben und vertrauen konnte, aber ich merkte, dass ich es um jeden Preis wollte. Ich wollte mich mit meinen Brüdern als Familie fühlen und wollte das Gefühl haben, nicht allein auf der Welt zu sein. »Das fände ich schön«, sagte ich daher. »Aber wie soll das gehen? Du wohnst in Kanada. Wäre alles normal gelaufen, wäre ich jetzt auf dem Weg nach Südafrika, und Sean lebt in den schottischen Highlands, was praktisch ohnehin das Ende der Welt ist.«
»Echte Nähe hat nichts mit geografischer Distanz zu tun«, behauptete Dominic und fügte zuversichtlich hinzu: »Wir schaffen das. Wenn wir es wirklich wollen, dann schaffen wir es auch. Genauso, wie du das mit Rufus schaffen wirst. Und wenn du Hilfe brauchst, dann melde dich. Wir sind für dich da.«
HOFFNUNGSSCHIMMER
»Wir sind für dich da.« Der Satz meines Bruders hallte mir immer noch in den Ohren. Es war eine schöne Aussage, aber eben leider auch sehr theoretisch. Faktisch war Dominic längst wieder in Kanada und Sean in seinem Highland-Nest. Ja, wir hatten mehr Kontakt als früher. Wir schickten uns gelegentlich Textnachrichten, und auch telefoniert hatte ich schon mit beiden. Das änderte aber nichts daran, dass ich hier allein in Edinburgh saß – ohne nennenswerte Perspektiven, dafür mit endlos vielen Problemen.
Die begannen bei organisatorischen Dingen wie meinem Umzug in Frances’ Wohnung – der zugegebenermaßen kein großes Drama und mit einer Autofahrt erledigt war. Komplizierter waren da schon die Gespräche mit ihrem Vermieter gewesen, der sich noch vorbehielt, ob er das Mietverhältnis, das er mit Frances eingegangen war, so einfach auf mich übertragen wollte. Je nachdem, in welche Richtung sich seine Überlegungen entwickelten, konnte es sein, dass ich demnächst auch noch obdachlos war. Fast noch störrischer war man im Kindergarten: Dort hatte ich Rufus am Montagmorgen nach Frances’ Tod zwar hinbringen können, aber beim Abholen später am Tag hatte man ihn mir nicht wieder aushändigen wollen. Schließlich stand ich nicht auf Frances’ Kontaktliste für befugte Abholer – und daran änderte auch nichts, dass sie tot war. Danielle hatte mir aus dieser Zwickmühle herausgeholfen, aber ich brauchte eine Bestätigung des Jugendamtes, dass man mir das vorläufige Sorgerecht für meinen Neffen übertragen hatte, damit ich ihn vom Kindergarten abholen durfte.
Womit ich schon bei meinem größten Problem wäre: Rufus selbst. Dominic hatte mir versichert, das Geheimnis bei Kindern sei, ihnen das Gefühl zu vermitteln, man nähme sie ernst. So weit, so gut. Und so unmöglich. Denn wie sollte ich jemanden ernst nehmen, der so … irrational war? Mir war natürlich klar, dass man das einem dreijährigen Kind nicht vorwerfen konnte, aber es schien unmöglich zu sein, Rufus zu vermitteln, dass seine Mum nie wieder zurückkommen würde. Jeden Tag fragte er nach ihr. Jeden Tag weinte er, wenn ich ihn vom Kindergarten abholte, weil er Frances erwartet hatte und doch nur wieder ich auftauchte.
Manchmal war er süß und kuschelte sich zutraulich wie ein junger Hund an mich, aber viel häufiger wechselten sich heftige Wutattacken und verzweifeltes Weinen ab. Danielle hatte einen anderen Rat als Dominic: Ich solle Rufus einfach nur lieben, dann werde sich alles finden. Doch das war fast noch schwieriger als das Ernstnehmen. Ja, er war mein Neffe. Ich kannte ihn seit dem Tag seiner Geburt und hatte ihn immer niedlich und oft auch drollig gefunden. Aber lieben? Er war alles, was von meiner Schwester geblieben war, und damit war mir Rufus wichtig und teuer. Ich würde alles dafür tun, dass es ihm gut ging und er in Sicherheit war – allein schon, um Frances’ Vertrauen in mich zu ehren. Aber wie konnte ich diesen kleinen Menschen lieben, der abwechselnd begeistert sein Kackhäufchen in der Toilettenschüssel bewunderte und mir in einem trotzigen Wutanfall »Ich hasse dich! Ich hasse dich! Ich hasse dich!« entgegenschleuderte?
Das Internet war inzwischen mein bester Freund und gleichzeitig mein schlimmster Feind. Die Stunden, die ich nach endlosen Behördengängen oder in meinen schlaflosen Nächten im Netz verbrachte, um nach praktikablen und nachvollziehbaren Gebrauchsanweisungen für den Umgang mit Kleinkindern zu suchen, taten meiner geistigen Gesundheit nicht gut. Wer der Meinung war, dass es schädlich sei, nach Krankheitssymptomen zu googeln, hatte sich noch nie auf Elternseiten getummelt. Da gab es Websites und Foren, die meiner Meinung nach in eine besonders dunkle Ecke des Netzes verbannt werden sollten. Als Wissenschaftlerin war ich es gewohnt, Problemstellungen methodisch und überlegt anzugehen, aber diese Herausforderung war zu groß für mich. Wenn man drei Menschen um eine Meinung in puncto Kindererziehung bat, bekam man mindestens fünf verschiedene – und selbstredend komplett widersprüchliche – Ratschläge zurück. Wie sollte ich mich da zurechtfinden? Wie sollte Rufus das überstehen?
Vorhin war ich so verzweifelt gewesen, dass ich die zuständige Sachbearbeiterin des Jugendamtes hatte anrufen und sie für Rufus um einen Platz in einer Pflegefamilie hatte anflehen wollen. Ich hatte schon das Telefon in der Hand gehabt, als es geklingelt hatte. Meine Kollegin Kaya war dran gewesen. Nein, meine Ex-Kollegin natürlich. Sie hatte eigentlich nur kurz nachfragen wollen, wie es mir ging, hatte sich dann aber eine halbstündige verzweifelte, tränengeschwängerte Tirade anhören müssen.
Sie hatte mich mit einem recht pragmatischen »Jetzt mach dich mal locker« zum Schweigen gebracht. Kaya war Ende vierzig, aber bereits Großmutter und hatte eine erstaunlich lässige Einstellung, was den Umgang mit kleinen Kindern betraf. »So schnell gehen die nicht kaputt!«, war ihre Kernaussage. »Natürlich ist er verzweifelt, verwirrt und unglücklich, was erwartest du? Aber einem Dreijährigen brauchst du nicht mit rationalen Erklärungen zu kommen. Sorg lieber dafür, dass er ein bisschen Spaß hat. Idealerweise mit dir zusammen. Das hilft euch beiden.« Außerdem hatte sie mir noch den guten Rat gegeben, das Internet in nächster Zeit zu meiden. Zumindest die einschlägigen Mamaseiten. Stattdessen hatte sie mir das Versprechen abgenommen, mit Rufus nach dem Kindergarten in den Botanischen Garten zu kommen. Ob das für ihn so spaßig werden würde, wusste ich zwar nicht, aber ich freute mich trotzdem darauf. Womöglich war auch John da, und ich könnte persönlich mit ihm über einen neuen Job sprechen. Vor ein paar Tagen am Telefon hatte er mir zwar keine allzu großen Hoffnungen machen können, aber vielleicht hatte ich ja doch Glück.
Pünktlich um vier Uhr nachmittags stand ich an der Tür des Kindergartens – zusammen mit all den Müttern und Vätern, die mich nach wie vor halb misstrauisch, halb mitleidig beäugten. Nach Rufus’ Weinattacken und Wutanfällen in den letzten Tagen war das kein Wunder. Sie gaben mir mit ihren Blicken das Gefühl, keine von ihnen zu sein, nicht dazuzugehören. Zweifellos hatten sie damit recht. Aber unter Umständen bildete ich mir das alles auch nur ein. Danielle, die Einzige aus der Mamariege, die überhaupt mit mir sprach, hatte mir nämlich schon mehrfach versichert, es sei alles eine »Mindset«-Sache. Also musste ich wohl an meiner Einstellung arbeiten. So knipste ich ein hoffentlich fröhlich-warmherziges Lächeln an und fragte Danielle, was sie denn für den restlichen Nachmittag und das Wochenende geplant hatte.
»Wir fahren gleich zu meinen Eltern nach Perth«, erklärte sie mir. »Tut mir leid, dass ich dir Rufus am Wochenende nicht abnehmen kann.«
Ich runzelte die Stirn. Wieso nahm sie an, dass sie mir Rufus am Wochenende abnehmen sollte? Und warum wirkte sie so erleichtert darüber, dass sie eine gute Entschuldigung dafür hatte? »Kein Problem. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir gehen gleich in den Royal Botanic Garden und überlegen uns dann, was wir die nächsten Tage so anstellen«, sagte ich leichthin. »Ich habe an den Zoo gedacht. Oder vielleicht auch ein Picknick im Grünen. Das Wetter soll ja schön bleiben«, plapperte ich weiter und versuchte, ihren vielsagenden Blick zu ignorieren.
Glücklicherweise wurde in diesem Moment die Tür geöffnet, und wir durften hinein zu unseren Schützlingen. Rufus’ Gesicht verfinsterte sich prompt, als er mich sah, doch er überraschte mich, indem er weder weinte noch herumbrüllte, sondern energisch das Kinn nach vorn reckte und verkündete: »Ich hab ein Bild für Mummy gemalt. Damit sie wiederkommt.« Er hielt mir stolz das bunt bekritzelte Stück Papier unter die Nase, und ich versuchte mit aller Macht, den Kloß in meinem Hals hinunterzuschlucken.
»Das hast du sehr schön gemacht, Rufus«, lobte ich ihn und verstrubbelte ihm hilflos die dunkelblonden Haare. Kurz überlegte ich, ob ich ihm zum hundertsten Mal erklären sollte, dass seine Mummy nicht mehr zurückkommen würde, doch ich brachte es nicht übers Herz. »Weißt du, was wir gleich machen?«, fragte ich ihn stattdessen.
Er schüttelte den Kopf und schaute mich mit großen Augen an.
»Wir besuchen Penny.«
»Wer ist Penny?«
»Penny ist eine Kragenechse, die in einem Terrarium im Botanischen Garten wohnt. Sie ist sehr wählerisch und lässt sich nicht von jedem streicheln, aber ich glaube, du könntest Glück bei ihr haben.« Das war ausgemachter Unsinn, denn Penny war ausgesprochen zutraulich – wenn man das bei einem Reptil überhaupt sagen konnte – und genoss es, am Hals gekrault zu werden. Doch das Blitzen in Rufus’ Augen bewies mir, dass ich die richtige Formulierung gewählt hatte.
»Echt? Was ist eine Kagen-Exe?«, wollte er wissen.
»Das ist ein kleiner Minidrache.«
»Cool! Spuckt der Feuer?« Nun strahlte er richtig, und mein Herz machte einen irrationalen kleinen Hüpfer.
»Ich bin mir nicht sicher. Bisher hat sie es nicht getan, aber wir können sie ja gleich mal fragen, was meinst du?«
Rufus nickte heftig, zog sich in Windeseile seine Schuhe an und schlüpfte in die Jacke.
»Bye, Rufus«, sagte Danielle lächelnd zu ihm, als wir an ihr und ihrem Sohn Ethan vorbeikamen.
»Wir gehen zu Penny«, verkündete Rufus feierlich. »Die ist ein echter Drache. Mit Feuer und so.« Dann nahm er meine Hand und zog mich zum Ausgang.
Kleine Siege, dachte ich dankbar. Kleine Siege.
Erwartungsgemäß war Rufus begeistert von Penny, die sich ihrerseits gerne von ihm streicheln ließ, seinen Aufforderungen zum Feuerspucken allerdings nicht nachkommen wollte.
»Er macht doch einen ganz fidelen Eindruck«, sagte Kaya zu mir und reichte mir eine Tasse Kaffee.
»Ablenkung scheint tatsächlich das Mittel der Wahl zu sein. Er hat heute zum ersten Mal nicht geweint, als ich ihn vom Kindergarten abgeholt habe.«
»Siehst du, das wird. Ihr gewöhnt euch schon aneinander.« Kaya saß auf ihrem Schreibtischstuhl, ich lehnte an ihrem Tisch und ließ meinen Blick etwas bekümmert durch den großen Raum gleiten, der so lange mein Arbeitsplatz gewesen war.
Ein Seufzer entrang sich mir, und ich war mir nicht sicher, wem oder was er genau galt. Meinem alten Job? Meinem geplatzten Lebenstraum? Oder Rufus? Vermutlich allem. Es gehörte ja auch irgendwie alles zusammen. »Muss ja«, antwortete ich daher, denn was war die Alternative?
»Ich weiß, dass dein Leben komplett aus den Angeln gehoben wurde, aber du kriegst das ganz bestimmt hin. Manchmal sind solche Veränderungen ja auch ein echtes Geschenk«, behauptete Kaya.
»Ich habe nichts gegen Veränderungen. Eigentlich wäre ich jetzt ja seit einer Woche in meinem neuen Job in Südafrika. Viel mehr Veränderung geht doch nicht, oder?« Ich schluckte gegen die Bitterkeit an, die wieder in mir aufstieg. Niemand hatte Schuld daran, dass es anders gekommen war – am wenigsten Rufus –, und irgendwie musste ich jetzt lernen, damit fertigzuwerden.
»Also, ich finde es schön, dass du nicht am anderen Ende der Welt lebst, sondern mir als Freundin weiterhin erhalten bleibst«, stellte Kaya fest. »Und wer weiß, vielleicht sogar bald wieder als Kollegin?«
»Hat John irgendwas gesagt?« Ein zarter Hoffnungsfunke zuckte in mir auf.