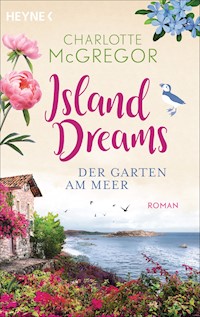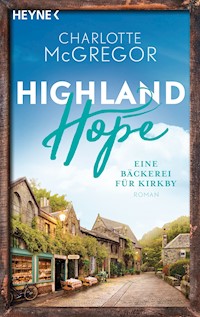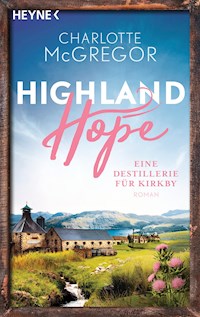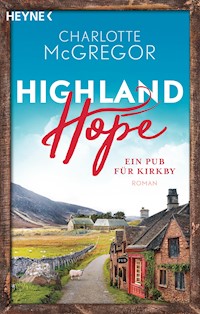7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Island-Dreams-Reihe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Bienen sind fleißig, haben klare Aufgaben und brauchen keine Männer. Ähnlich wie Imkerin Hazel. Oder?
Hazel Armstrong liebt ihre Arbeit als Imkerin auf den Scilly-Inseln. Seit gut drei Jahren kümmert sie sich um die Bienen, schleudert Honig und führt Touristen durch die Ruinen von Tresco. Hazel ist mit ihrer fröhlichen Art und ihrem aufgedrehten Terrier Toby bei den Einheimischen allseits beliebt. Von der dunkelsten Zeit in ihrem Leben ahnt niemand etwas. Ihre beste Freundin Pippa bohrt immer wieder nach und stößt auf die unnachgiebige Mauer, die Hazel errichtet hat, um sich zu schützen. Als jedoch mit dem Bodyguard Benedict und dem Fotografen Chris gleich zwei Männer auftauchen, die ihrem Geheimnis gefährlich nahe kommen, muss sie sich der Vergangenheit stellen. Dass sie starke Gefühle für beide Männer entwickelt, hilft dabei nicht unbedingt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 480
Ähnliche
Das Buch
Hazel Armstrong liebt ihre Arbeit als Imkerin auf den Scilly-Inseln. Seit gut drei Jahren kümmert sie sich um die Bienen, schleudert Honig und führt Touristen durch die Ruinen von Tresco. Hazel ist mit ihrer fröhlichen Art und ihrem aufgedrehten Terrier Toby bei den Einheimischen allseits beliebt. Von der dunkelsten Zeit in ihrem Leben ahnt niemand etwas. Ihre beste Freundin Pippa bohrt immer wieder nach und stößt auf die unnachgiebige Mauer, die Hazel errichtet hat, um sich zu schützen. Als jedoch mit dem Bodyguard Benedict und dem Fotografen Chris gleich zwei Männer auftauchen, die ihrem Geheimnis gefährlich nahekommen, muss sie sich der Vergangenheit stellen. Dass sie starke Gefühle für beide Männer entwickelt, hilft dabei nicht unbedingt …
Die Autorin
Mit Sehnsuchtsorten kennt sich Charlotte McGregor aus. Schon in frühester Kindheit fühlte sie sich zu Städten und Ländern hingezogen, die sie nur aus Büchern oder Filmen kannte. Kein Wunder, dass sie aus ihrem Fernweh einen Beruf gemacht hat. Die Journalistin schrieb jahrelang Reiseberichte für Zeitungen und Magazine, ehe sie ihre Lieblingsorte auch in Romanen verewigte. Ihr Herz schlägt derzeit besonders für Inseln – vor allem wenn sie gänzlich unbekannt sind und von wilden Wellen umtost werden. Wenn sie dann auch noch mit überraschender Fauna und Flora und schrulligen Bewohnern aufwarten, ist ihr Glück perfekt.
Lieferbare Titel
Highland Hope 1 – Ein Bed & Breakfast für Kirkby
Highland Hope 2 – Ein Pub für Kirkby
Highland Hope 3 – Eine Destillerie für Kirkby
Highland Hope 4 – Eine Bäckerei für Kirkby
Island Dreams – Der Garten am Meer
CHARLOTTE McGREGOR
DIE IMKEREI AM MEER
Roman
WILHELMHEYNEVERLAGMÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Originalausgabe 05/2024
Copyright © 2024 by Charlotte McGregor
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Michael Gaeb.
Copyright © 2024 dieser Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Julia Funcke
Umschlaggestaltung: zero-media.net unter Verwendung von iStockphoto (Litvalifa), FinePic, München
Karte auf U2: © Livi Gosling
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-31016-5
www.heyne.de
DIE KÖNIGIN UND DER PRINZ
Eine neue Königin bedeutete immer Ärger.
Ich stand unter dem dicht belaubten Apfelbaum im Garten von Elderberry Cottage und starrte missmutig hinauf zu einer schwer erreichbaren Astgabel. Dort hatte sich ein summender und bebender Klumpen aus mehreren Tausend Bienen zusammengefunden. Ein obdachlos gewordenes Volk, das seiner Königin ins unfreiwillige Exil gefolgt war. Offensichtlich war in einem Bienenstock außerplanmäßig eine neue Königin geschlüpft und hatte die alte in die Flucht geschlagen. Das kam gelegentlich vor – warum, wusste niemand so genau –, und nun musste ich zusehen, dass ich die Tiere einfing und sie in einem neuen Stock unterbrachte.
Ich würde allerdings wiederkommen müssen, denn natürlich hatte ich keine Ausrüstung dabei. Als ich den Anruf erhalten hatte, war ich noch im Supermarkt beschäftigt gewesen. Nachdem sich die letzten Kunden für heute verabschiedet hatten, war ich sofort hergeradelt, um mir ein Bild von der Lage zu machen.
»Kriegst du das hin?« Caruso, das grauhaarige Faktotum des Anwesens, klang skeptisch. Natürlich hieß er nicht wirklich Caruso, sondern Peter Carlsen, aber er bildete sich viel auf seine Stimme ein, die er bei jeder sich bietenden Gelegenheit über das winzige Inselchen Tresco schallen ließ.
»Na klar. Nur brauche ich dafür eine Leiter, eine Fangkiste und vor allem Schutzkleidung. Ich habe aber in einer halben Stunde Gäste für eine Ruinenwanderung und könnte erst danach wiederkommen. Oder morgen.«
»Nein, das muss unbedingt noch heute sein!«, beharrte er nervös.
»Hat sich hoher Besuch angekündigt?«, wollte ich wissen. In Elderberry Cottage stiegen gerne mal Mitglieder der königlichen Familie ab, wenn sie für ein paar Tage ihren erlauchten Pflichten entfliehen wollten, ohne dafür das Land verlassen zu müssen. Zwischendurch wurde das hübsche Häuschen auch an andere solvente Urlaubsgäste vermietet, in der Regel irgendwelche neureichen, aber medienscheuen Unternehmer mit bürgerlichen Wurzeln, die nicht auf einen heruntergekommenen familiären Landsitz zurückgreifen konnten und die Zurückgezogenheit der Scilly-Inseln schätzten. Solche Gäste waren häufig anstrengender als die Royals, die sich im Allgemeinen erstaunlich unkompliziert und volksnah gaben und meist nach wenigen Tagen wieder verschwanden. Die reichen Emporkömmlinge blieben oft viel länger und brachten nicht selten das Inselleben durcheinander.
»Irgendjemand kommt morgen, aber natürlich hat man mir nicht mitgeteilt, wer und wann«, brummte Caruso, und ich war mir nicht sicher, ob das die Wahrheit oder nur Koketterie war. »Jedenfalls müssen die Bienen bis morgen verschwunden sein, nicht, dass irgendwas passiert.«
Ich nickte. Bienen waren zwar verhältnismäßig friedlich, wenn man sie nicht provozierte, aber ein heimatloser Schwarm zeigte sich häufig nervös. Die Arbeiterinnen wollten um jeden Preis ihre Königin schützen und taten alles dafür, ein neues Quartier zu finden. Da war es allemal besser, wenn ich sie gezielt umsiedelte. Trotzdem passte das überhaupt nicht in meinen heutigen Zeitplan. Nach der Wanderung war ich noch mit meinen Freundinnen aus dem Gig-Boot-Team im Pub verabredet. Wir wollten über unser desaströses Abschneiden beim Weltcup am vergangenen Wochenende sprechen und uns eine neue Strategie überlegen.
»Weltcup« war ein großes Wort für das jährlich stattfindende Rennen, zu dem vor allem Teams aus Cornwall anreisten und ein paar besonders enthusiastische Freaks von weiter weg. Ansonsten unterschied sich diese Veranstaltung kaum von unseren wöchentlichen Inselrennen. Leider galt das auch für unsere Performance. Als Teamkapitänin sollte ich eigentlich eine klare Ansage an die Besatzung der Hope machen – so hieß unser Boot –, aber nach Lage der Dinge musste ich wohl erst ein Bienenvolk umsiedeln. »Ich komm so gegen acht«, kündigte ich also an.
»Das ist schlecht, da habe ich einen Termin«, brummte Caruso.
»Sorry, ich kann nicht früher. Kann mir vielleicht sonst jemand aufmachen?« Ich wusste genau, dass Carusos wichtiger Termin sein Altherrenstammtisch im Pub war.
Er kramte einen Schlüsselbund aus seiner Latzhose, wie man ihn eher in einem alten Herrenhaus vermutet hätte. Umständlich löste er einen großen, altmodischen Schlüssel von den anderen und drückte ihn mir in die Hand. »Damit kommst du durch das hintere Gartentor rein. Nicht verlieren«, schärfte er mir ein. »Und bring ihn mir morgen zurück.«
»Keine Sorge.« Ich wog den riesigen und erstaunlich schweren Schlüssel in der Hand. Er war warm, und ich wollte gar nicht so genau wissen, wo an Carusos ausladendem Körper er die Temperatur angenommen hatte. Gleichzeitig fragte ich mich, wieso mir solche idiotischen Vorstellungen in den Sinn kamen.
Kurz entschlossen stopfte ich den Schlüssel in die Vordertasche meines Rucksacks und pfiff dann nach meinem Hund Toby, der durch den Garten stromerte.
»Toby, los, wir müssen zu den Ruinen.« Ich nickte Caruso noch einmal zu, bevor ich durch das Haupttor zur Straße lief, wo mein Fahrrad wartete. In fünf Minuten war ich am Hafen von Old Grimsby mit einer Wandergruppe verabredet, mit der ich dann die Ruinen im weitgehend unbewohnten Norden der Insel erkunden würde.
Immerhin war meine Truppe gut zu Fuß und tatsächlich interessiert, was längst nicht immer der Fall war. So verging die Zeit schneller als gedacht, und es war schon fast halb acht, als wir an der malerischen Ruine von King Charles’s Castle ankamen – nicht die Burg des aktuellen Amtsinhabers, sondern die seines gleichnamigen Urahns. Der neue König schätzte es dann wohl doch eine Spur weniger zugig.
Während die Besuchergruppe eifrig Fotos schoss, nutzte ich die Gelegenheit und rief meine Freundin Pippa an. »Ich kann heute nicht in den Pub kommen, ich muss desertierte Bienen einfangen, die sich in einem Apfelbaum bei Elderberry Cottage ein Zwischenquartier gesucht haben«, kündigte ich ohne Vorrede an und seufzte tief. »Sagst du den Mädels Bescheid?«
»Den Bienenmädels oder den anderen?« Pippa kicherte. Sie fand es albern, dass ich von meinen Bienen immer als »die Mädels« sprach, genau wie von unserem Ruderteam. Den jugendlichen Elan, den die Bezeichnung nahelegte, ließen die Rudermädels allerdings wirklich vermissen.
»Den geschätzten Damen unseres Teams!«
»Die werden wie ich froh sein, dass wir einen netten Abend verbringen können. Ganz ohne sinnlose Abreibung deinerseits. Mir tut übrigens immer noch alles weh.«
Ich sparte mir einen passenden Kommentar über die schlappe Kondition von Pippa und den anderen und sagte nur: »Freut euch nicht zu früh. Wenn es gut läuft mit den Bienen, komme ich anschließend noch auf einen Absacker vorbei.«
»Kann man dir beim Einfangen helfen?«, erkundigte sie sich.
»Nein, das ist lieb, aber das krieg ich schon hin«, gab ich zurück. Hilfe wäre zwar tatsächlich ganz erfreulich, aber nicht von Laien. Und auch wenn Pippa ansonsten recht unerschrocken war und keine große Angst vor Bienen hatte, war das dann doch eine andere Herausforderung als meine üblichen Aufgaben.
»Okay, aber gib bitte wirklich Bescheid. Ich kann dir auch Harry vorbeischicken.«
»Wirklich nicht nötig«, beharrte ich. Ich mochte Pippas brandneuen Ehemann sehr, aber für den Meeresbiologen galt das Gleiche: Er mochte sich mit Robben und Papageientauchern auskennen, aber nicht mit Bienen. Außerdem brauchte ich keinen Mann für meinen Job, da ging’s mir irgendwie auch ums Prinzip. »Aber du meintest doch, dass du gerne einen Bienenstock bei euch im Garten haben möchtest. Ich könnte den Schwarm bei euch ansiedeln.« Das wäre sogar ausgesprochen praktisch, denn dann müsste ich die summende Transportkiste nicht über die halbe Insel kutschieren, sondern könnte sie einfach die paar Meter weiter zu Pippas Haus bringen.
»Ja, klar, gerne. Am besten bei den Beerensträuchern. Ich sag es Harry, dann hilft er dir wenigstens dabei.« Pippa klang aufrichtig erfreut.
»Gut, dann mach ich das so. Ich muss jetzt los und meine Wanderung zu Ende bringen. Vielleicht bis später. Und die Strategiebesprechung ist nur verschoben, nicht aufgehoben!« Ich beendete das Gespräch und wandte mich wieder meiner Gruppe zu. »Wir laufen jetzt noch den Hügel runter zum Cromwell Castle, und dann habt ihr euch ein Pint im Pub redlich verdient«, verkündete ich forciert munter und marschierte los.
Natürlich hatte alles doch länger gedauert als geplant, und so war es bereits kurz vor neun, als ich mit Sack und Pack und in voller Schutzmontur durch das versteckte Gartentor von Elderberry Cottage trat und mich dem Apfelbaum näherte. Glücklicherweise war es noch hell genug, dass ich auf meine Stirnlampe verzichten konnte. Ich lehnte die Leiter gegen einen ausladenden Ast, sodass ich gut an die Stelle herankommen würde, wo die Bienen, in einem Pulk um ihre Königin zusammengerottet, nach wie vor saßen. Oder wenigstens einigermaßen gut, denn wenn ich ehrlich war, wäre eine zweite Person schon verdammt hilfreich. Die könnte die große Kiste unter die Bienentraube halten, während ich fest auf den Ast schlug, damit der Insektenklumpen hineinfiel. Aber es half nichts, das musste ich jetzt irgendwie allein schaffen – idealerweise ohne mir dabei den Hals zu brechen.
Die späte Stunde kam mir insofern gelegen, als die Bienen nicht mehr ganz so aktiv waren. Ich besprühte sie zusätzlich noch mit etwas Wasser, was eine ähnlich beruhigende Wirkung hatte wie der Rauch, den ich manchmal bei der Arbeit an den Stöcken verwendete. Dann schlang ich zwei Spanngurte um den Ast und befestigte die Kiste auf diese Weise direkt unter dem Bienenvolk.
Ich kletterte die Leiter wieder hinunter, um den Deckel der Kiste zu holen. Wenn alles lief wie geplant, würde ich nach einem kräftigen Schlag auf den Ast rasch den Deckel draufschieben und könnte die Kiste wieder abmontieren. Ich schwitzte unter meinem weißen Schutzoverall und fantasierte schon von einem kühlen Bier als Belohnung. In einer halben Stunde könnte es bereits so weit sein. Entschlossen schnappte ich mir den Deckel und erklomm die ersten Sprossen der Leiter – und dann brach die Hölle los.
Toby begann, hysterisch zu kläffen, während mich plötzlich ein greller Lichtstrahl mitten ins Gesicht traf und eine herrische Männerstimme »Hände hoch und keine Bewegung!« brüllte.
»Ähm?« Ich blinzelte gegen das blendende Licht, konnte den Rufer aber nicht erkennen.
»Ich sagte: Hände hoch!«
Zaghaft hob ich die Hand mit dem Deckel. Was hatte der Typ bitte für ein Problem?
»Waffe fallen lassen!«, blaffte er.
»Welche Waffe?« Ich fand, das war eine berechtigte Frage, denn außer einem Styropordeckel hatte ich nichts in der Hand.
»Kommen Sie mir nicht blöd«, drohte die Stimme, und der dazugehörige Mann tauchte nun endlich in meinem Blickfeld auf. Er war schwarz gekleidet, jung, mit kantigem Kinn und grimmigem Blick, und er hielt eine Pistole umklammert.
Vermutlich ein Bodyguard der Mieter, die morgen anreisen wollten, dachte ich und verfluchte innerlich diese neureichen Spinner, die ernsthaft glaubten, hier auf den Scilly-Inseln würde irgendeine Bedrohung auf sie warten. Es war vollkommen absurd, aber angesichts der Furcht einflößend aussehenden Knarre sparte ich mir einen launigen Kommentar und versuchte mich stattdessen an Deeskalation. »Ich kann Ihnen versichern, dass ich keine Waffe habe«, erklärte ich im ruhigsten Therapeutentonfall, der mir angesichts meiner misslichen Lage möglich war. »Ich möchte nur einen wilden Bienenschwarm einfangen, der sich hier im Apfelbaum niedergelassen hat. Dazu habe ich bereits eine Transportkiste befestigt und hier lediglich den passenden Deckel in der Hand, damit der Schwarm und vor allem die Königin nicht wieder entkommen kann.«
»Erzählen Sie mir keine Märchen!«, schnauzte mich der Typ jedoch weiter an. »Das ist doch alles Tarnung. Sie sind eingebrochen, um hier im Baum eine Kamera zu installieren. Es widert mich an, zu was für Maßnahmen ihr Paparazzi greift. Bienenschwarm, meine Fresse!«
»Warum sollte ich eine Kamera installieren?« Ich schüttelte verwundert den Kopf, was unter meiner Montur aber wohl kaum zur Geltung kam. »Haben Sie irgendwas geraucht oder so?« Unsachlich konnte ich auch.
»Werden Sie bloß nicht unverschämt, die Liste der Vorwürfe gegen Sie ist schon lang genug. Und jetzt lassen Sie endlich die Waffe fallen!«
»Ich habe keine Waffe. Das ist ein Styropordeckel, mit dem ich niemanden verletzen kann«, entgegnete ich, wieder etwas beherrschter, und ließ das fragliche Teil aus meiner Hand fallen.
»Was haben Sie da am Gürtel?«
Ich sah an mir herunter. »Das ist eine mit Wasser gefüllte Sprühflasche. Damit kann man die Bienen beruhigen.«
»Ich wette, da ist Nervengift drin«, schäumte der Mann, und ich erkannte, dass sich Schweißperlen auf seiner Stirn bildeten. Prima, da waren wir schon zu zweit, ich triefte inzwischen.
Toby flippte langsam endgültig aus, und sein ohnehin schon schrilles Organ klang von Sekunde zu Sekunde unerträglicher. Außerdem hüpfte er wie ein Irrer um den Security-Fritzen herum und schien drauf und dran zu sein, ihn ins Bein zu zwicken. Das wäre zwar sehr heroisch von ihm, aber potenziell tödlich. Wer wusste schon, wie locker dem Kerl die Kugel im Lauf saß? Der Gedanke sorgte gleich für den nächsten Schweißausbruch.
»Schluss jetzt, Toby! Hör auf mit dem Scheiß«, rief ich ärgerlich, was meinen Terriermix jedoch überhaupt nicht beeindruckte und den Ordnungshüter nur noch wütender machte.
»Wie reden Sie mit mir?«, brüllte er und richtete die Waffe abwechselnd in meine und in Tobys Richtung.
Clever gemacht, Armstrong, tadelte ich mich stumm und wunderte mich kaum, dass meine innere Stimme genauso klang wie die meines früheren Supervisors. Etwas, woran ich jetzt nicht zurückdenken wollte. »Ich habe nicht Sie gemeint, ich wollte nur meinen Hund beruhigen«, sagte ich möglichst beherrscht über das infernalische Getöse hinweg. »Wenn ich herunterkommen darf, können wir das Ganze vielleicht wie zivilisierte Menschen klären?«
Der Bodyguard schien seine Optionen abzuwägen. »Erst die Flasche mit dem Nervengift fallen lassen«, bestimmte er schließlich. »Aber ganz langsam. Und kommen Sie bloß nicht auf die Idee, mich damit anzusprühen. Bevor das Gift wirkt, habe ich Sie längst erschossen.«
Wie in Zeitlupe nestelte ich die Sprühflasche von meinem Gürtel, was mit einer Hand gar nicht so einfach war. Irgendwo hatte der arme Narr recht – es war tatsächlich eine Art Nervengift darin, wenn man davon ausging, wie sehr seine eigenen Nerven gerade litten. Das Gift mochte lediglich in seiner Vorstellung existieren, doch die menschliche Psyche war die machtvollste Waffe überhaupt, wenn sie gegen einen selbst gerichtet war. Oder, wie in unserem Fall, auch gegen andere, denn der junge Rambo fuchtelte ja mit einer scharfen Waffe vor mir herum. Mit spitzen Fingern und betont darauf achtend, bloß keinen Tropfen entweichen zu lassen, hielt ich die Flasche von mir weg und ließ sie auf den Boden fallen. Toby, der nichts so sehr liebte wie »verbotenes Spielzeug«, also jene Gegenstände, die ich für meine Arbeit brauchte und die für ihn tabu waren, schnappte sie sich umstandslos und rannte damit übermütig durch den Garten. Immerhin war er dabei wenigstens still.
»Darf ich jetzt runterkommen?«, bat ich. Rambo sah meinem Hund mit wachsender Faszination zu und schien eine spontane Selbstentzündung zu erwarten.
»Aber ganz langsam!« Mit einiger Mühe wandte er mir wieder seine ungeteilte Aufmerksamkeit zu, und ich stieg die Sprossen hinunter.
Dann sah ich ihn erwartungsvoll an. »Und nun?«
»Der Hund zerbeißt die Flasche«, sagte er. Offenbar waren Tobys Eskapaden doch deutlich spannender als ich.
»Das habe ich befürchtet.« Ich seufzte. »Es ist meine letzte Sprühflasche. Wissen Sie, wie schwierig es ist, hier auf den Inseln Ersatz zu finden?«
»Wenn er mit dem Gift in Berührung kommt, wird er vermutlich gleich sterben.« Täuschte ich mich, oder hatte Rambo glasige Augen?
»Das wäre zweifellos so, wenn Gift in der Flasche wäre. Da ist aber wie gesagt nur Wasser drin. Simples Leitungswasser«, wiederholte ich. Doch er hörte mir gar nicht zu, sondern beobachtete angespannt, wie Toby hingebungsvoll an der hellgrünen Flasche herumnagte. Blöderweise war die Pistole immer noch auf mich gerichtet, sonst hätte ich einen beherzten Rettungsversuch gestartet, um dem frechen Terrier seine Beute zu entwinden.
»Gibt’s ein Problem?«, hörte ich plötzlich eine weitere Männerstimme, die mir vage bekannt vorkam.
Auf Rambos Gesichtszügen machte sich eine Mischung aus Stolz und Erleichterung breit. »Ich habe einen Saboteur gestellt, Sir«, berichtete er dem Neuankömmling, den ich noch nicht sehen konnte, weil er sich vom Haus her und damit in meinem Rücken näherte. »Diese Frau war gerade dabei, eine Überwachungskamera im Baum zu installieren und womöglich auch eine Vorrichtung für ein Nervengift«, sprach Rambo eifrig weiter.
»Und warum trägt sie dabei einen Imkeranzug?«, erkundigte sich sein Vorgesetzter, der nun in mein Gesichtsfeld kam und mich interessiert musterte.
»Imkeranzug? Das ist doch eindeutig ein Overall zum Schutz gegen Bio-Kampfstoffe«, blähte sich Rambo wieder auf.
»Nur wenn man Bienen als Bio-Kampfstoff betrachtet«, sagte ich und wusste langsam nicht mehr, ob ich schallend lachen oder schreien sollte. War das hier eine Aufzeichnung für Versteckte Kamera oder so? Wobei, diese Frage sollte ich wohl lieber nicht aussprechen, denn »Kamera« war bestimmt ein massives Triggerwort für den armen Irren. »Wenn man allergisch gegen Bienengift ist, kann man es natürlich so sehen«, fügte ich hinzu. »Gegen flüssige oder gasförmige Substanzen ist das Netz vor meinem Gesicht dagegen vollkommen nutzlos. Darf ich?«, fragte ich und deutete auf den Reißverschluss, der den Netzschleier des Hutes mit dem Overall verband. Ich war mir inzwischen fast sicher, wer der zweite Mann war, und hoffte, dass er mich auch erkennen würde, sobald ich meinen Gesichtsschutz abgenommen hatte.
Er nickte zustimmend und legte Rambo eine Hand auf den Arm, sodass dieser endlich die Waffe sinken ließ.
Mit vorsichtigen Bewegungen, um den leicht reizbaren Waffennarren nicht wieder zu provozieren, öffnete ich langsam den Reißverschluss und befreite meinen Kopf. »Guten Abend, die Herren.«
»Sie sind die Inselimkerin«, stellte der zweite Mann grinsend fest.
»So ist es. Das habe ich Ihrem Kollegen auch gesagt, doch er fand meine Erklärung offenbar zu abwegig.«
»Und was genau ist die Erklärung?«, fragte er nach, und ich zermarterte mir den Kopf nach seinem Namen. Er gehörte jedenfalls zum Stab von Prinz William, und ich hatte ihn letzten Sommer kurz getroffen, als sich der Prinz und seine Familie im TrescoAbbey Garden die dortigen Bienenstöcke hatten zeigen lassen. Prinz George hatte damals sogar ganz mutig eine Wabe gehalten, während Prinzessin Charlotte die Bienen mit dem Rauchverteiler beruhigt hatte.
»Eine Bienenkönigin und ihr Volk haben sich in diesem Apfelbaum niedergelassen. Ich wollte sie einfangen, damit sich niemand Sorgen machen muss«, erklärte ich.
»Das ist doch eine haarsträubende Ausrede«, blähte sich Jung-Rambo wieder auf. »Was für ein absurder Zufall soll das denn sein? Überhaupt habe ich das noch nie gehört, dass Bienen …« Er klappte den Mund schlagartig wieder zu, als er den Blick seines Vorgesetzten sah. Benny? Bennet? Irgendwie so hieß er.
»Es passiert immer mal wieder, dass in einem Stock plötzlich eine neue Königin auftaucht. Entweder kommt es dann zum Krieg zwischen der alten und der neuen, und eine stirbt, oder die alte Königin zieht aus und nimmt einen Teil des Volkes mit. Es ist wie im richtigen Leben, da kann es in einem Land auch nur eine einzige Königin geben«, scherzte ich noch lahm.
Der Ben-Mann schaute nun zur fraglichen Astgabel hoch, wo man außer meiner Kiste nicht viel erkennen konnte.
»Ich habe eine Transportbox unter dem Bienenvolk anmontiert, das sich zu einem kompakten Klumpen zusammengerottet hat, um seine Königin zu schützen«, führte ich meine Erklärung fort.
»Und wie geht es dann weiter?«
»Dann wollte ich auf den Ast schlagen, sodass der Bienenklumpen in die Box fällt, die Kiste mit dem Deckel verschließen und sie zu einem vorbereiteten neuen Bienenstock bringen, in den sie einziehen können.«
»Aber die Biester können doch wegfliegen, die werden sich doch nicht einfach in die Kiste fallen lassen.« Er runzelte die Stirn.
»Natürlich werde ich nicht alle erwischen, und das gefällt ihnen auch nicht. Daher mein Schutzanzug und die Sprühflasche. Wasser auf den Flügeln macht sie träge. Ich muss aber auch nicht alle erwischen, sondern vor allem die Königin und ihren engsten Hofstaat. Sobald die im neuen Stock sitzen, werden die entkommenen Arbeiterinnen von den Pheromonen angelockt und fliegen ebenfalls in die neue Residenz.«
»Spannend«, befand Ben.
»Humbug«, brummte Rambo.
»Ich hab mir das nicht ausgedacht, aber es ist eine Technik, die funktioniert«, erwiderte ich schulterzuckend. »Also, soll ich die Bienen jetzt einfangen oder nicht? Wenn wir noch lange diskutieren, wird’s nämlich zu dunkel. Ich könnte mir übrigens vorstellen, dass es dem Prinzen und seiner Familie nicht gefallen wird, wenn ein heimatloses Volk von schätzungsweise zwanzigtausend Bienen seinen Ferienhausgarten belagert«, gab ich zu bedenken.
»Niemand hat etwas von einem Prinzen gesagt«, knurrte Rambo.
»Jetzt reißen Sie sich mal zusammen, Lieutenant«, fuhr Ben ihn an. »Ich kenne die Frau. Wir haben uns letztes Jahr im Abbey Garden getroffen, als sie der Familie die Bienen gezeigt hat. Leider kann ich mich nicht mehr an Ihren Namen erinnern.« Er warf mir einen entschuldigenden Blick zu.
»Hazel. Hazel Armstrong«, stellte ich mich vor und reichte ihm die Hand. »Ich fürchte, ich habe Ihren Namen auch vergessen.«
»Captain Benedict Sullivan.« Bei der Art, wie er mich anlächelte, war ich mir einen Moment nicht sicher, ob er sich daran erinnern konnte, dass wir letztes Jahr nicht nur über Bienen gesprochen hatten. Sondern über Bienchen und Blümchen …
Schnell wischte ich den einigermaßen störenden Gedanken wieder weg, denn daran wollte ich mich gerade ganz sicher nicht erinnern. »Und ihr etwas übermotivierter junger Mitarbeiter ist wohl auf seinem ersten Scilly-Einsatz?«, fragte ich stattdessen.
»So ist es. Lieutenant Tobias Hanson ist noch ganz neu in der Truppe«, sagte Benedict durchaus freundlich, doch nicht nur ich nahm den Subtext in seinen Worten wahr: Und wenn er so weitermacht, ist das auch sein letzter! Ich verstand es klar und deutlich – und sein Untergebener wohl ebenfalls, denn sein erschrockener Gesichtsausdruck sprach Bände.
»Tobias? Toby? Also wie mein Hund?« Ich kicherte. Das erklärte natürlich auch seine Reaktion auf meinen Ausruf vorher. »Das muss am Namen liegen, dass die, die ihn tragen, ein wenig … nun ja … übermotiviert sind. Aber sie meinen es bestimmt gut.« Ich linste zu meinem schwarz-weißen Untier hinüber, das die schöne Sprühflasche inzwischen fast vollständig geschreddert hatte. »Und glücklicherweise bellen sie nur und beißen nicht.« Mein Blick fiel auf Hansons Pistole, und trotz meines fröhlichen Tonfalls wurde mir wieder bewusst, dass das vorhin eine verdammt knappe Kiste gewesen war.
»Das mag für den Hund gelten …« Captain Sullivan alias Ben sprach den Satz nicht zu Ende, und fast bekam ich Mitleid mit dem jungen Kerl.
»Die Bienen?«, wechselte ich das Thema und deutete auf den Ast.
»Können wir irgendwie helfen?«, erkundigte sich Benedict und bedeutete dem Lieutenant, die Waffe zu sichern und in sein Holster zu stecken.
»Nein, vielen Dank, ohne Schutzanzüge ist das nicht zu empfehlen. Die Damen werden ziemlich verärgert sein, wenn ich sie gleich von ihrem Ruheplatz wegscheuche.« Ich zippte mir wieder den Netzhut an den Overall. »Sie könnten allerdings mit Ihren Suchscheinwerfern ins Geäst leuchten, damit ich besser sehen kann«, bat ich, schnappte mir den Styropordeckel und kletterte zum hoffentlich letzten Mal an diesem Abend auf die Leiter.
Oben angekommen, holte ich tief Luft, schaute noch einmal nach der Bienentraube, in der erfreulicherweise eine Art Abendruhe eingekehrt war, und schlug dann kräftig auf den Ast. So stark, dass sogar die Leiter leicht ins Wackeln geriet und ich die nächste Nahtod-Panik unterdrücken musste. Mit einer Hand hielt ich mich am Ast fest, mit der anderen schob ich den Deckel auf die Kiste – und war froh, dass ich auch Handschuhe trug, denn die aufgescheuchten Bienenarbeiterinnen waren ganz klar auf Krawall gebürstet. Sobald ich mein Gleichgewicht wiedergefunden hatte, löste ich einen Spanngurt vom Ast und verschloss damit den Deckel. Dann entfernte ich den zweiten Gurt und kletterte mit der Kiste nach unten.
»Geschafft«, keuchte ich und fand mich Benedict gegenüber wieder, der stoisch die Bienen ertrug, die ihn umschwirrten. Aus einiger Entfernung hörte ich Japsen und kaum unterdrücktes Gefluche. Offenbar musste Tobias/Rambo noch ein wenig an seiner Contenance arbeiten.
»Tut mir leid, wenn mein Kollege Ihnen Ärger gemacht hat«, sagte Benedict.
»Schon vergessen«, behauptete ich großzügig. »Er war um seinen Prinzen besorgt, ich um meine Königin. Ich schätze, wir sind quitt.«
Benedict lachte leise. »Und wie geht es jetzt weiter?«
»Ich bringe die Bienen zu ihrem neuen Stock, und dann habe ich Feierabend«, hörte ich mich antworten. Warum hatte ich das mit dem Feierabend so betont?
»Und nach Feierabend geht man hier …?«
»Nach Hause. Oder vielleicht noch in den Pub.« Ich konnte ein Grinsen nicht unterdrücken. Dann hob ich die zerbissenen Teile der Sprühflasche auf und stopfte sie in meinen Rucksack. Die Leiter schob ich handlich zusammen und verstaute sie auf meinem Lastenrad, genau wie die summende Transportbox. »Mr. Carlsen hat mir den Schlüssel für das Gartentor gegeben«, sagte ich. »Wollen Sie ihn vielleicht an sich nehmen?« Ich wartete nicht auf eine Antwort, sondern drückte ihm den Schlüssel kommentarlos in die Hand. »Einen schönen Abend noch, Captain Sullivan.«
»Wir haben zu Neptun und der Bienenkönigin gebetet, dass du heute nicht mehr kommst«, rief mir Amelia mit gespielt verzweifeltem Gesichtsausdruck zu, als ich eine knappe Stunde später den Pub betrat. Ich hatte beinahe nicht mehr damit gerechnet, meine Gig-Boot-Besatzung noch anzutreffen, denn es war inzwischen schon recht spät, und alle mussten früh aufstehen. Mir selbst hatte ich nach der Tortur aber wenigstens ein Bier gönnen wollen.
»Eure Gebete wären fast erhört worden«, sagte ich, als ich mit meinem frisch gezapften Pint zum Tisch kam und mich auf einen freien Stuhl setzte. »Toby und ich wären nämlich um ein Haar erschossen worden.«
»Was?«, riefen Amelia, Pippa und Bree wie aus einem Mund, und worüber auch immer sie vor meiner Ankunft gesprochen hatten, es war schlagartig in den Hintergrund getreten.
»Ein etwas übermotivierter Security-Typ hat mich wahlweise für einen Saboteur, einen Attentäter oder eine Paparazza gehalten. Die naheliegende Erklärung, dass ich als Imkerin eine Bienenkönigin mit ihrem Schwarm einfangen wollte, schien er dagegen für total abwegig zu halten.« Ich prostete meinen Freundinnen zu und lehnte mich dann zurück. War das ein Tag gewesen!
»So naheliegend finde ich das mit den Bienen auch nicht«, sagte Bree und schauderte sichtlich. Sie konnte Insekten aller Art nicht leiden und geriet in Panik, wenn eine Biene angesummt kam.
»Es ist aber nun mal die Wahrheit«, betonte ich und berichtete den dreien von meinem vollkommen abstrusen Abend. »Der hat sich ernsthaft eingebildet, dass in meiner Wasserflasche Nervengift wäre.«
»Wahnsinn.« Pippa schüttelte den Kopf und gähnte dann herzhaft. »Wo ist eigentlich Toby?«
»Bei dir zu Hause, nehme ich an. Als ich die Bienen zu ihrem neuen Stock in eurem Garten gebracht habe, hat er mit eurem Scotty gespielt. Kannst ihn ja heimschicken, wenn er dich nervt.« Ich war es gewohnt, dass mein Hund gerne mal Extratouren machte. Meist war er zwar in meiner Nähe und begleitete mich überallhin, aber wenn sich eine Gelegenheit für Spiel, Spaß und Unsinn bot, nutzte er sie weidlich aus.
Pippa verdrehte die Augen. »Ehrlich, ich versuche nach Kräften, unseren Hund zu einem halbwegs zivilen Mitglied der Gesellschaft zu erziehen, aber Toby macht all meine Bemühungen im Handstreich wieder zunichte.«
»Es tut mir aufrichtig leid«, log ich und grinste die Botanikerin mit den rotbraunen Haaren an. Pippa lebte inzwischen seit einem guten Jahr auf Tresco, arbeitete im Abbey Garden und war mir in dieser Zeit zur engsten Freundin geworden. Wir waren uns in vielen Aspekten des Lebens sehr ähnlich, nur dass sie eine rasante Transformation vom Single zur Ehefrau und Mutter hingelegt hatte – Dinge, die für mich komplett ausgeschlossen waren. Aber ich hatte ja auch keine Schwester, deren Kind ich »erben« konnte, und mit Harry hatte sie sich den letzten akzeptablen und freien Kerl auf dem Archipel geschnappt. Bei so viel durchaus verdientem Glück konnte sie an der Hundefront ruhig ein wenig leiden, wobei ihr junger vierbeiniger Teufelsbraten das auch ohne die Assistenz meines Köterichs hinbekam.
»Ich glaub dir kein Wort«, entgegnete Pippa und gähnte erneut. »Aber ich geh jetzt heim. Sehen wir uns morgen im Park?«
»Auf jeden Fall. Ich denke nämlich, dass in einem der Parkstöcke eine neue Königin geschlüpft ist und die alte in die Flucht geschlagen hat. Das werde ich mir mal näher anschauen.«
»Also dann, ihr Lieben, gute Nacht.«
»Schlaf gut«, rief ich und sah ihr hinterher, während sie sich zwischen den eng gestellten Tischen im Gastraum hindurchschlängelte. Auf der Höhe des Tresens stoppte sie kurz und drehte sich noch einmal zu mir um, mit fragendem Gesicht und einem diskret auf einen Bier trinkenden Gast gerichteten Finger.
Mir wurde schlagartig heiß, denn der Mann war niemand anders als Captain Benedict Sullivan, der meinen Blick zu spüren schien und mit beeindruckender Lässigkeit in meine Richtung schaute. Er trug jetzt nur noch Jeans und T-Shirt, und schlagartig fielen mir alle Details unserer Begegnung im letzten Jahr wieder ein. Pippa formte mit den Händen ein Herz und grinste mich vielsagend an, ehe sie verschwand.
Amelia und Bree hatten glücklicherweise nichts mitbekommen, sondern waren wieder in ein Gespräch über ihren Nachwuchs vertieft. Sie würden mich sicher nicht vermissen. Also nahm ich mein Glas, verabschiedete mich knapp und schlenderte zum Tresen. Die Aufregungen des Abends waren offensichtlich noch nicht vorbei.
O CAPTAIN, MEIN CAPTAIN
»Na, da sieht aber jemand verträumt aus.« Mit diesen Worten riss mich Pippa am nächsten Morgen aus meinen Gedanken.
»Eher müde«, gab ich unumwunden zu. Meine Nacht mit Captain Benedict war kurz gewesen. Gegen drei Uhr morgens hatte er sich auf den Heimweg zu seinem Quartier gemacht, doch statt noch ein paar Stündchen zu schlafen, hatte ich mich um Toby kümmern müssen, der praktisch zeitgleich mit Bens Abgang mit einem blutigen Riss im Ohr nach Hause gekommen war. Offenbar hatte er eine nächtliche Auseinandersetzung hinter sich gebracht. Einen Hinweis darauf, wer sein Kontrahent gewesen war, blieb er mir allerdings schuldig. Typisch.
»Ich will alle Details wissen«, verlangte Pippa sensationslüstern. Sie lotste mich von meinen Bienen weg und zu unserem Lieblingsplatz im Abbey Garden, einer versteckten und kaum einsehbaren Laube. »Ich hab dir sogar einen Kaffee mitgebracht.« Sie reichte mir einen Thermosbecher, den ich dankbar annahm.
»Toby tauchte heute Nacht mit einer Verletzung am Ohr und sehr leidend auf«, lenkte ich ab. »Weißt du vielleicht mehr?«
»Nein, als ich heimgekommen bin, lag Scotty schlafend auf der Couch, von deinem Hund war nichts zu sehen«, entgegnete Pippa schulterzuckend. »Aber ich will auch nicht über dein Untier reden, sondern über den heißen Bodyguard.«
»Da gibt’s nicht viel zu erzählen …« Glatte Lüge, doch ich hatte wirklich keine Lust, mit Pippa über mein Liebesleben zu diskutieren. Wobei »Liebesleben« ohnehin übertrieben war. Seit ich auf den Scilly-Inseln lebte, gab es keine Liebe in meinem Leben, nur gelegentlichen unverbindlichen Spaß. Aber das war mir nur recht, und ich hatte nicht vor, etwas daran zu ändern.
»Ich glaub dir kein Wort.« Meine Freundin runzelte die Stirn. »Das war doch der Hottie, der schon letztes Jahr mit William, Kate und den Kindern im Park war und dir während deiner Bienenshow glühende Blicke zugeworfen hat.«
Bei den glühenden Blicken war es auch im letzten Jahr nicht geblieben. Aber während sich das im letzten Sommer wie ein heißer One-Night-Stand angefühlt hatte – ohne jede Hemmung, weil man sich ja ohnehin nie wieder sehen würde –, war es gestern … anders gewesen. »Vielleicht sollte ich Harry mal stecken, dass du ein Auge auf andere Männer wirfst«, erwiderte ich lahm.
»Tu ich nicht, ich stelle nur das Offensichtliche fest. Und ich stelle ebenfalls fest, dass du womöglich deine eiserne Regel gebrochen hast.« Pippas Augen blitzten, und es sprach wirklich Bände, dass mein Kurzzeit-Kissenkumpan hier auf Tresco die aufregendste Nachricht der Woche zu sein schien.
»Ich konnte doch nicht ahnen, dass er noch mal auf die Insel kommt. Und wir dann wieder …« Ich seufzte. Ben hatte mich nämlich gefragt, ob wir uns in den nächsten Tagen weiterhin treffen könnten. Was eindeutig ein Verstoß gegen meine Prinzipien wäre.
»Und ihr dann wieder was? Hell lodernd füreinander entflammt?«
»Du solltest mal über deine Gutenachtlektüre nachdenken. Was liest du für einen Mist, wenn du Dinge wie ›hell lodernd entflammt‹ sagst?« Ich lachte, doch Pippa ließ sich weder aus dem Konzept noch von ihrer Fährte abbringen.
»Erzähl mir nichts, ich habe deinen Blick gesehen – und seinen Bizeps.« Sie kniff die Augen zusammen. »Ich mag dich noch nicht lange und auch nicht besonders gut kennen, was vor allem an deiner … nennen wir es ›diskreten Art‹ … liegt, aber ein paar Dinge weiß ich über dich. Dein Beuteschema ist ziemlich eindeutig.«
»Ich habe kein Beuteschema!« Jedenfalls kein offizielles.
»Doch. Hast du. Gut gebaut und nicht verfügbar«, brachte es Pippa erschütternd präzise auf den Punkt. »Und die Tatsache, dass du und der Bodyguard jetzt schon zum zweiten Mal …« Sie hob vielsagend eine Braue. »Das spricht in deiner Welt schon fast für eine ernsthafte Beziehung.«
In meiner Welt? Ich schüttelte den Kopf, denn so recht meine Freundin auch hatte, sie wusste nicht wirklich, was »meine Welt« war. Was auch gut war und bitte schön für alle Zeiten so bleiben sollte. Meine Welt war in London zurückgeblieben. Ich war ihr gerade noch rechtzeitig entflohen. Hier auf den Scilly-Inseln war ich einfach die leicht durchgeknallte Bienen-Hazel, die nebenbei im Supermarkt jobbte, Touristen zu den Ruinen auf Tresco führte und ein verdammt mieser Coach für das Gig-Boot-Team war. Diese Hazel war seit gut drei Jahren meine Realität, und ich mochte sie viel lieber als die alte.
Pippa schien mein Schweigen jedoch als Zustimmung aufzufassen, denn ihr eben noch sensationslüsternes Grinsen nahm eine fast liebevolle und warmherzige Note an. »Ich würde mich so sehr für dich freuen, wenn du jemanden findest. Ehrlich, ich hab diese Einsame-Wölfin-Nummer ja selbst jahrzehntelang durchexerziert und war überzeugt davon, dass es die beste Lebensform für mich ist. Aber mit Rufus und Harry hat sich mein Leben so krass geändert, wie ich es niemals für möglich gehalten hätte. Zum Besseren geändert, möchte ich betonen, auch wenn es mit den Jungs echt verdammt anstrengend ist.« Sie seufzte theatralisch, doch das glückliche Leuchten in ihren Augen wurde dadurch nicht getrübt. »Wir Menschen sind soziale Wesen und nicht dafür gemacht, allein zu sein.«
»Es mag sein, dass das für die Mehrheit gilt, aber ganz sicher nicht für mich!«, sagte ich mit fester Stimme, die hoffentlich keinen Widerspruch provozierte. »Und glaub mir, ich weiß, dass es besser ist, wenn ich allein bleibe.«
»Für wen? Für dich?«
»Für alle Beteiligten.« Die Bitterkeit meiner Worte stieß mir selbst auf, aber es war leider die traurige Wahrheit. »Doch das ist im aktuellen Fall auch ganz egal, denn Captain Sullivan ist ja nur kurz hier und definitiv kein Kandidat für eine gemeinsame Zukunft«, sprach ich rasch weiter und bemühte mich wieder um einen lockeren Tonfall. »Aber solange er hier ist, werde ich seinen Bizeps und sein überragendes Durchhaltevermögen genießen. Und jetzt sollte ich zusehen, dass ich jemanden finde, der mich nach St. Agnes schippert, denn ich muss endlich mal wieder die Bienenstöcke dort überprüfen. Hab einen schönen Tag.« Ich trank meinen Kaffee aus, winkte Pippa noch einmal kurz zu und lief rasch zurück zum Parkbienenhaus, um meine Sachen einzupacken.
Gestohlene Stunden in den Nächten. Heimliche Küsse. Und Blicke, die versuchten, in meine Seele zu schauen. Benedict machte mich nervös – und nicht auf die gute Art. Ich lag im Bett, an seine tatsächlich sehr beeindruckende Brust geschmiegt, und lauschte seinem tiefen, schläfrigen Atem und dem gleichmäßigen Herzschlag. Ich atmete seinen Duft ein, der mir nach vier Nächten verstörend vertraut war, und merkte, wie sich in mir zwei widerstreitende Gefühlswelten einen erbitterten Kampf lieferten. Ein Teil wollte sich einfach nur in der wohligen Sicherheit seiner Arme verlieren und endlich einschlafen, der andere wurde von Sekunde zu Sekunde panischer und suchte verzweifelt nach einem Ausweg aus dieser Situation.
»Du weißt, dass ich morgen wieder abreise«, hörte ich plötzlich seine raue Stimme an meinem Ohr. Er schlief also doch nicht.
»Hmm«, murmelte ich nur und versuchte, mir darüber klar zu werden, ob mich diese Ankündigung erleichterte oder traurig machte. Irgendwie eine Mischung aus beidem.
»Ich …«, begann er, doch ich legte ihm einen Finger auf die Lippen.
»Du musst nichts erklären. Ich wusste von vornherein, was mich erwartet. Und es ist gut, wie es ist.«
»Nein, ist es nicht«, sagte er jedoch. »Du bist mir seit letztem Jahr nicht aus dem Kopf gegangen.«
»Du konntest dich nicht mehr an meinen Namen erinnern«, stellte ich fest und lachte, um die Situation aufzulockern.
»Du dich an meinen auch nicht«, konterte er.
»Ich war fast so weit, dass er mir eingefallen wäre. Ich wusste, dass es irgendwas mit ›Benny‹ war.« Neckend zupfte ich an seinen Brusthaaren, die genauso dunkelblond waren wie seine kurzen Haare.
»Ich mach das nicht ständig«, fuhr er ernsthaft fort, ohne auf meine forcierte Fröhlichkeit einzusteigen. »Also, dass ich mir bei Einsätzen eine Frau suche und …«
»Spaß mit ihr hast?«
»Du weißt, was ich meine.«
»Ehrlich gesagt nicht.« Ich rollte mich von seiner Brust und stützte mich auf einem Ellbogen ab, um ihm in die Augen sehen zu können. »Es war doch genau das: Wir hatten Spaß miteinander. Wenn ich für mich sprechen darf, sogar viel Spaß, aber mehr war es nicht und kann es auch nie sein.«
»Warum nicht?« Zu meiner größten Irritation schien Benedict die Frage vollkommen aufrichtig zu meinen.
»Weil …« Ich stieß geräuschvoll Luft aus. Musste ich ihm wirklich das Offensichtliche erklären? Ich hatte ihn eigentlich für schlauer gehalten. »Du hast einen anspruchsvollen Job, der dich ständig an andere Orte bringt. Du bist quasi ununterbrochen in Rufbereitschaft und kannst nie sicher sein, wo genau du morgen oder auch nur in einer Stunde sein wirst. Das ist nicht kompatibel mit einer Beziehung. Zumal ich auch gar kein Interesse an einer habe. Ich lebe hier auf Tresco und bin zufrieden mit meinem Leben.«
»Viele Kollegen führen eine Beziehung und haben Familie«, behauptete er.
»Ernsthaft? Und wie erfolgreich?«
»Was ich damit sagen will, ist, dass es Möglichkeiten gäbe. Ich habe auch mal Urlaub und …« Er zögerte und scannte mich mit dem durchdringenden Laserblick aus seinen grauen Augen. Warum nur hatte ich vorhin das Licht nicht ausgeknipst?
»Und?«, spielte ich die Coole und Ahnungslose.
»Und vielleicht bist du ja nicht vollkommen darauf fixiert, hier auf Tresco zu leben. Dauerhaft, meine ich. In London hätten wir ganz andere Optionen …«
Ich legte ihm eine Hand auf die Brust, um ihn zu unterbrechen. »Tresco ist mein Lebensmittelpunkt. Ich werde hier nicht mehr weggehen. Zumindest nicht in absehbarer Zeit. London ist meine Vergangenheit, hier ist meine Gegenwart.« Ich hoffte, Ben nahm das Zittern in meiner Stimme nicht wahr.
»Und wo liegt deine Zukunft?«, fragte er sanft.
»Ebenfalls hier!« Ich seufzte. Warum musste dieser Kerl derart die Stimmung killen? Was wollte er von mir? Er kannte mich doch gar nicht. Die Tatsache, dass die Chemie zwischen uns stimmte – jedenfalls auf körperlicher Ebene –, konnte er doch nicht als Argument dafür nehmen, dass da mehr war. Ich hatte ihm ganz sicher nie den Eindruck vermittelt, dass ich an einem »mehr« interessiert war.
»Hazel, du faszinierst mich. Alles an dir. Ich weiß, es muss sich total verrückt anhören, aber ich habe das Gefühl, dass ich für dich auch total verrückte Dinge tun würde.«
»Es hört sich tatsächlich irre an. Das sind nur die Hormone«, versuchte ich, ihn einzunorden, und verfluchte mich innerlich dafür, dass ich mich auf eine mehrfache Wiederholung des One-Night-Stands eingelassen hatte. Allerdings war mir nicht klar gewesen, dass das Bindungshormon Oxytocin auch auf Männer so eine Wirkung haben konnte.
»Es sind ganz sicher nicht nur die Hormone!«, beharrte er. »Da ist mehr zwischen uns.«
»Vielleicht«, gab ich zu meiner eigenen Überraschung zu. Das hatte ich nicht sagen wollen, aber nun war es raus. »Ich mag dich, sehr sogar. Nur ändert das nichts an den ungünstigen äußeren Umständen. Außerdem bin ich, wie ihr Männer es sonst immer gerne ausdrückt, emotional nicht verfügbar. Es ist also ziemlich aussichtslos.« Das war die nackte Wahrheit, und doch hörte sich der Satz selbst in meinen Ohren hohl und völlig idiotisch an.
Prompt lachte er auf. »Ich war bei Einsätzen im Irak und in Afghanistan. ›Aussichtslos‹ ist für mich eher ein Ansporn als eine Abschreckung. Weißt du, wie selten es vorkommt, dass man jemanden findet, den man so sehr mag? Für mich ist das eine verdammte Rarität.«
»O Captain! My Captain!«, murmelte ich, statt darauf einzugehen. Der Anfang des Walt-Whitman-Gedichts, das durch den Film Der Club der toten Dichter geradezu ikonisch geworden war, war mir absolut unpassend durch den Kopf geschossen. Der Teil von mir, der sich vorhin gern vertrauensvoll an Benedict geschmiegt hätte, übernahm erschreckenderweise gerade die Vorherrschaft. Es war mehr als schmeichelhaft, dass ein Mann wie er sich für mich interessierte. Also ernsthaft interessierte. Und ja, es wäre wunderbar, wenn ich mich darauf einlassen könnte.
Hätte ich meine Lebensgeschichte ab heute auf einem blütenweißen neuen Blatt Papier fortschreiben dürfen, hätte ich vermutlich keine Sekunde gezögert. Doch es gab die vergangenen vierundvierzig Jahre, in denen ich schon sehr viel Text angesammelt hatte. Narben, Dunkelheit und Schmerz. Benedict konnte das nicht wissen, er kannte nur die Tresco-Hazel. Und das war auch gut so.
»Our fearful trip is done«, zitierte er weiter. »Unsere angstvolle Reise ist vorbei. Ich liebe das Gedicht, auch wenn es sehr traurig ist. Und es hat nichts mit mir, nichts mit uns zu tun. Ich lebe noch und habe nicht vor, an diesem Zustand in absehbarer Zeit etwas zu ändern.«
»Darüber bin ich sehr froh.« Ich robbte wieder auf ihn und küsste ihn mit atemloser Vehemenz, um ihm zu beweisen, wie dankbar ich für seinen warmen, lebendigen Körper war. Und wie wenig ich über alles Weitere sprechen wollte.
»So, die Damen, ich will jetzt keine Ausreden mehr hören, sondern Einsatz sehen!«, tönte ich Stunden später markig am Strand. »Blut, Schweiß und Tränen. Notfalls alles auf einmal. Ich kann es nicht länger mit meinem Ego vereinbaren, dass wir so ein mieses Team sind!« Meine Crew hatte sich vollzählig am Strand neben unserem lindgrün gestrichenen Gig-Boot Hope versammelt, wirkte aber nicht so, als wäre sie beeindruckt.
»Kannst du deinem Ego nicht ein anderes Betätigungsfeld suchen?«, schlug Amelia stöhnend vor. »Ich habe den ganzen Tag Tomatenpflanzen beschnitten, und mir tut alles weh. Blut, Schweiß und Tränen habe ich heute gefühlt schon literweise abgesondert. Das hier ist für mich Spaß und ein Ausgleich zu Farm und Familie. Wir geben immer unser Bestes, aber eigentlich ist es doch egal, wie wir bei den Rennen abschneiden, oder nicht?« Sie schaute sich Beifall heischend in der Truppe um.
Rachel und Sally zucken mit den Schultern und warfen sich etwas betretene Blicke zu, doch Bree pflichtete Amelia bei. »Sehe ich auch so. Haz, wir sind einfach keine Topathletinnen, sondern hart arbeitende Frauen mit sehr wenig Freizeit. Wir schaffen es mit Ach und Krach einmal in der Woche zum Training und haben dann mittwochs unsere Rennen. Manchmal läuft es besser, manchmal halt nicht. Ehrlich, ich liebe unser Team, aber vor allem, weil ich da für ein paar Stunden meine Familie los bin und mit erwachsenen Frauen quatschen kann. Das Rudern steht dabei nicht im Vordergrund.«
»Das mag ja alles sein«, hielt ich dagegen, »aber wenn wir regelmäßig von den Seniorinnen-Teams sämtlicher Inseln abgehängt werden, finde ich das ausgesprochen frustrierend.« Der mangelnde Ehrgeiz meiner Truppe machte mir wirklich zu schaffen.
»Die haben alle mehrere Jahrzehnte Trainingsvorsprung vor uns«, warf Rachel ein. »Und sie trainieren mindestens zweimal, eher dreimal in der Woche. Das kriegen wir niemals hin, und da hilft es auch nicht, dass wir alle ein paar Jahre jünger sind.«
»Wollt ihr denn nicht auch mal gewinnen?«, fragte ich und ärgerte mich, weil ich mich so kläglich anhörte.
»Gewinnen ist doch nicht so wichtig«, fiel mir nun ausgerechnet Pippa in den Rücken. »Es geht doch in erster Linie um das Gemeinschaftserlebnis und um Spaß. Der Weg ist das Ziel.«
»Noch jemand einen Kalenderspruch auf Lager, ehe ich beantrage, dass unser Boot von Hope zu Despair umbenannt wird? ›Verzweiflung‹ trifft es nämlich deutlich besser«, brummte ich genervt. Ich wusste, ich war unfair, denn natürlich hatten meine Freundinnen recht. Keine von ihnen musste sich Bestätigung über einen albernen Ruderwettbewerb holen. Sie waren mit ihren Jobs und ihren Familien genug gefordert und nutzten unsere Montagseinheiten und die Rennen als Sporttraining und fröhliche Freizeitbeschäftigung. Ich dagegen – ja, was eigentlich? Ich hatte drei Jobs plus die Ruderei und trotzdem nicht das Gefühl, dass es reichte.
»Hat deine innere Dramaqueen mal wieder das Sagen?«, wollte Amelia wissen und hörte sich dabei weniger sarkastisch als mitfühlend an, was mich gleich noch fuchsiger machte. Vor allem, weil es stimmte.
Mir steckte das nächtliche Gespräch mit Benedict noch in den Knochen. Er war irgendwann im Morgengrauen verschwunden – ohne sich zu verabschieden und ohne eine Nachricht zu hinterlassen. Ich wusste nicht, wann genau er abreiste. Womöglich war er schon weg. Wahrscheinlich sogar. Und vor allem wusste ich nicht, warum mich das so dermaßen irritierte. Ich hatte ihm klipp und klar gesagt, dass ich nicht verfügbar war und kein Interesse an Dingen hatte, die über unverbindlichen Sex hinausgingen. Schon gar nicht an einer Beziehung, die allein wegen der äußeren Umstände wahnsinnig kompliziert wäre – von den inneren ganz zu schweigen. Nach dem, was er erzählt hatte, war er in mindestens zwei Kriegsgebieten stationiert gewesen. Vollkommen unbeeindruckt ließ das niemanden, und wenn ich eine Sache ganz sicher nicht konnte, dann war das, mich mit den Dämonen anderer Menschen auseinanderzusetzen. Das hatte ich ziemlich eindeutig bewiesen. Und trotzdem …
Ich unterdrückte einen Seufzer, der sich aus der Tiefe meiner Lunge nach oben arbeitete, und schob diese ganze unbefriedigende Angelegenheit mental beiseite. Jetzt ging es nicht um mich, sondern um eine größere Sache: um die Ehre von Tresco und das Ansehen der Hope. Daher antwortete ich recht kühl auf Amelias Kommentar: »Nein, es ist meine innere Domina. Und sie hat ihre Peitsche eingepackt. Also los!«
Mit vereinten Kräften schoben wir das schwere Holzboot ins Wasser, kletterten hinein und begannen mit unserer üblichen Tour. Kaum waren wir halbwegs in Schwung gekommen, schloss eines der Männerteams von unserer Nachbarinsel Bryher neben uns auf. Natürlich genau die Mannschaft, die vor einer guten Woche eine Top-Ten-Platzierung beim Weltcup-Spektakel eingefahren hatte und seitdem noch unerträglicher war als sonst.
»Vielleicht solltet ihr euch lieber aufs Stricken konzentrieren, so wie ihr rudert«, rief Kevin bissig herüber und lachte sich halb tot über seinen lahmen Gag.
»Oder aufs Putzen und Bügeln«, fügte Michael unter dem Gelächter seiner Kollegen süffisant hinzu.
Mir würde gleich der Kragen platzen, und ich hatte große Lust, den Kerlen ihr selbstgefälliges Gespött mit meinem Paddel aus dem Leib zu dreschen, aber blöderweise war ich überzeugte Pazifistin und lehnte jede Form von Gewalt ab. Meine Mitstreiterinnen schienen jedoch ähnlich verärgert zu sein, denn ausgerechnet Amelia knurrte: »Los, Mädels, denen zeigen wir’s!«
Ich wunderte mich im Stillen, dass stumpfe männliche Provokation offenbar für deutlich mehr Motivation sorgte als meine liebevolle, freundschaftliche Stichelei, aber ich wollte es auch nicht hinterfragen. Zumindest im Moment nicht, denn wir rissen uns alle buchstäblich am Riemen, gaben mit einer erstaunlichen und kaum jemals da gewesenen Synchronizität Gas – und ließen die verdutzten Kerle hinter uns.
Am Südzipfel von Bryher schickten sich die Männer schließlich an, ihre Insel zu umrunden, während wir weiter auf St. Mary’s zusteuerten. Viel länger hätten wir wohl auch nicht durchgehalten, aber ein paar Dutzend Züge machten wir noch in diesem Irrsinnstempo – und ernteten wilden Applaus von einem Motorboot in der Nähe.
»Bravo«, rief eine bekannte dunkle Stimme, die ich zuletzt heute Nacht in meinem Schlafzimmer gehört hatte.
»Ihr wart ganz schön schnell«, lobte uns ein kleines Mädchen enthusiastisch, das ich auf den zweiten Blick als Prinzessin Charlotte identifizierte. Offenbar war »die Familie« doch noch hier und damit auch ihre Security-Mannschaft, denn neben der Prinzessin sah ich auch die beiden Prinzen, den schießfreudigen Tobias und eine Frau, die vermutlich die Nanny der Kinder war.
»Vielen Dank!« Wir nahmen das royale Lob huldvoll, wenn auch keuchend und zweifellos mit hochroten Köpfen entgegen.
»Die Männer sind bestimmt nur abgebogen, weil sie nicht gegen Frauen verlieren wollen«, bemerkte die Prinzessin keck.
»Nee, die hätten sie gleich eingeholt«, behauptete ihr älterer Bruder, durchaus wahrheitsgemäß, doch davon wollte Charlotte nichts wissen.
»Niemals!«, rief sie im Brustton der Überzeugung, und ich bekam gleich ganz warme Gefühle für das kleine Ding.
»Wir hätten uns jedenfalls nicht so einfach geschlagen gegeben«, entgegnete ich, als ich halbwegs wieder atmen konnte, und stellte fest, dass Benedict den Jungs verschwörerisch zuzwinkerte. Frechheit.
»Gutes Training noch«, sagte er. »Wir müssen langsam zurück.« In seinem Blick lag jedoch eindeutig eine Frage: Sehen wir uns gleich noch?
»Ich kann nicht mehr«, jammerte Bree, als das Motorboot mit der königlichen Besatzung außer Hörweite war. »Können wir bitte ganz entspannt zurückrudern?«
»Besser wird’s heute nicht mehr«, pflichtete ihr Amelia bei, ebenfalls schwer atmend, aber mit einem sehr zufriedenen Gesichtsausdruck – wie mein komplettes Team.
»Habt ihr euch gemerkt, wie es sich anfühlt?«, fragte ich sie. »Wie gleichmäßig wir im Takt waren und wie jede alles gegeben hat? Genau das will ich immer sehen. Es muss nicht gleich diese mörderische Geschwindigkeit sein, aber der Teamgeist. Wir haben uns bewegt wie eine gut geölte Maschine.«
»Die jetzt einen Kolbenfresser hat«, stöhnte Pippa und ließ ihre offensichtlich schmerzenden Schultern kreisen. »Ich fürchte, das war eine einmalige Aktion.«
»Nein, das war der Auftakt zu den großen Erfolgen, die die Hope ab sofort feiern wird«, beharrte ich. »Gebt es zu, es hat Spaß gemacht. Es hat sich gut angefühlt. Machtvoll. Triumphierend. Erinnert euch an das Gefühl, und speichert es tief in euch ab, damit wir es jederzeit abrufen und reproduzieren können. Wir wissen jetzt, was wir können, und wenn wir es einmal geschafft haben, können wir es jedes Mal schaffen«, schloss ich meine Motivationsrede.
»Wir wollten den Idioten doch nur zeigen, wohin sie sich ihre Stricknadeln stecken können«, brummte Rachel grimmig. So kannte ich sie gar nicht. Normalerweise war sie die Stillste und Freundlichste von uns.
»Wenn es hilft, dann heuere ich jetzt zu jeder Trainingseinheit und zu jedem Rennen ein paar Idioten an, die uns als Stricklieseln und Bügelmuttis beschimpfen.«
»Bloß nicht. Reicht schon, wenn ich mir solche Sprüche zu Hause anhören muss.« Sally verdrehte genervt die Augen.
Ich sparte mir einen Kommentar darüber, dass man auch in langjährigen Beziehungen an der Binnenkommunikation arbeiten konnte und dass es vielfach nur deshalb knirschte, weil Absender und Empfänger sich erfolgreich aneinander rieben. Das wollte Sally im Moment bestimmt nicht hören. »Dann denkt einfach daran, wie gut es sich angefühlt hat, über das Wasser zu gleiten – beinahe mühelos und synchron.«
»Also, mühelos war es jetzt nicht gerade«, stellte Bree fest. »Aber ich weiß, worauf du hinauswillst. Es war tatsächlich cool und beinahe so, als würden wir mit demselben Hirn denken und mit einem Körper handeln. Irgendwie spooky, aber ziemlich spektakulär.«
»Genau das meine ich!«, rief ich triumphierend. »Wir haben uns als Einheit gefühlt und uns dabei wie eine Einheit bewegt und nicht wie lauter Individuen. Das ist das Geheimnis. Nicht denken, einfach nur fühlen und handeln.«
»Apropos Handeln, was will der Bodyguard von dir?«, wechselte Amelia abrupt das Thema. Dann hatte sie Benedicts unausgesprochene Frage also auch mitbekommen? Interessant. Und irgendwie unheimlich.
Ich warf Pippa einen verstohlenen Blick zu, was bei den anderen im Team natürlich nicht unbemerkt blieb.
»Ha!« Amelias Augen wurden riesig. »Sag bloß, da ist was im Busch zwischen dir und ihm? Und du hast nur Pippa davon erzählt! Das widerspricht unserem Ehrenkodex.«
»Welcher Ehrenkodex?«, wich ich aus.
»Wir sind ein Team, eine Einheit, ein einziger Organismus – das hast du gerade selbst gesagt. Wie kann es dann sein, dass du mit so wichtigen Infos hinterm Berg hältst?«
»Das eine hat mit dem anderen nicht das Geringste zu tun – und um deine Frage zu beantworten: Ich weiß nicht, was er von mir will. Zumindest nicht genau. Ich schätze, er will sich von mir verabschieden. Und sich vielleicht nach den Bienen erkundigen«, fügte ich noch rasch hinzu.
»Klar, die Bienen«, bemerkte Rachel voller Sarkasmus. »Darum hat er dich auch angesehen, als wärst du ein besonders leckeres Honigbrot.«
Ich schüttelte den Kopf, leicht fassungslos darüber, was meine Freundinnen sich da zusammenfantasierten. Das war eindeutig der Nachteil an den Scilly-Inseln: Es passierten viel zu wenig aufregende Dinge, sodass man sich zwangsläufig sehr für seine Mitmenschen interessierte. Und wenn auch nur ein Hauch von Klatsch in der Luft lag, stürzte man sich darauf wie ein ausgehungerter Geier. Vermutlich durfte ich es ihnen nicht übel nehmen, denn ehrlich gesagt hatte ich mir dieses Verhalten in den letzten Jahren ebenfalls angeeignet. Aber ich war es nicht gewohnt, so sehr im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen.
»Simon hat an den letzten drei Abenden gesehen, wie ein dunkel gekleideter Mann zu dir ins Haus gehuscht ist«, informierte mich Sally. »Immer so gegen dreiundzwanzig Uhr, wenn Simon noch mal mit dem Hund draußen war.«
Meine Wertschätzung für den Ehemann meiner Freundin schwand gleich noch mehr. Nicht nur, dass er Sally offensichtlich am liebsten als Hausmütterchen sah, sondern er ging nachts noch mit dem Hund raus und spionierte in Blockwartmanier die Nachbarn aus. Gut, die beiden wohnten in meiner unmittelbaren Nähe, doch welcher Bewohner von Tresco ging um diese Zeit ernsthaft noch mal mit seinem Hund Gassi? Wofür hatte man einen Garten? Mal abgesehen davon, dass die meisten Vierbeiner ohnehin lieber ohne ihre Menschen unterwegs waren.
»Dein Schweigen spricht Bände«, befand Amelia.
»Ich wundere mich nur«, entgegnete ich mit einem nonchalanten Schulterzucken. »Über viele Dinge.«
»Das war jetzt streng genommen keine Antwort«, stellte Bree grinsend fest. »Aber ich schätze, die ist auch nicht nötig.« Sie kicherte. »Du und der königliche Bodyguard – das ist ja mal eine Geschichte!«
»Wenn du meinst …« Ich seufzte. »Ich finde, ihr solltet euch alle ein paar neue Hobbys zulegen. Rudern fiele mir da beispielsweise ein. Dann hättet ihr nicht so viel Zeit dafür, euch über derart absurde Dinge Gedanken zu machen.«
»Absurd finde ich nur, dass du uns nichts erzählt hast.« Amelia ließ nicht locker. »Ich meine … hallo! Der Bodyguard von William und Kate!«
»Und genau das ist auch schon das Ende der Geschichte. Sein Job. Und jetzt lasst uns zurückrudern«, bestimmte ich.
»Genau«, mischte sich Pippa ein. »Damit wir mit eigenen Augen bezeugen können, was da vor sich geht.«
Ich sagte nichts mehr, sondern staunte nur milde über den nächsten Ehrgeizschub, den mein Team offensichtlich verspürte, denn wieder fielen wir alle in einen gleichmäßigen Rhythmus und ruderten zielstrebig zurück zum Strand von New Grimsby.
Als wir unseren Zielort erreichten, war von der Besatzung des Motorbootes jedoch nichts zu sehen – und wieder wusste ich nicht, ob ich enttäuscht oder erleichtert sein sollte. Dafür erwartete uns ein schwanzwedelnder Toby, der uns enthusiastisch begrüßte und sich speziell über mich sehr zu freuen schien. Aber vielleicht hatte er auch nur Hunger?
»Das finde ich jetzt schon ein bisschen schade«, bemerkte Bree bedauernd und linste hinüber zu dem Motorboot, als würde sie erwarten, dass sich dort plötzlich ein dunkelblonder Hüne materialisierte. Tat er aber natürlich nicht.
»Wie gesagt …«, begann ich und ließ das Satzfragment dann im Nichts austrudeln. Denn genau genommen war ja nichts zu sagen gewesen. Außerdem hatte ich etwas an Tobys Halsband entdeckt. Es schien fast so, als wäre dort mit einem Gummiband ein Zettel befestigt. »Ich freu mich ja auch so sehr, dich zu sehen«, begrüßte ich meinen Hund und herzte ihn. Dabei nestelte ich das zusammengefaltete Stückchen Papier herunter. Ob mein rasender Puls allein von der strammen Ruderei kam?
Mit zitternden Fingern öffnete ich die Botschaft. Dort stand in akkuraten Blockbuchstaben geschrieben: ESWARMIREINEFREUDE, HYACINTH. WIRSEHENUNS. B.
AUS DEN AUGEN, AUS DEM SINN
Hyacinth? Mein Herz stolperte. Woher kannte er diesen Namen? Meinen zweiten Vornamen, den ich in einem anderen Leben verwendet hatte. Einem Leben, das lange vorbei war. Einem Leben, das keine Bedeutung für mein heutiges Ich hatte. Einem Leben, von dem hier niemand wusste, niemand wissen durfte. Würden meine Freundinnen und Nachbarn ahnen, wer Hyacinth Harris war, würden sie mich vermutlich mit anderen Augen betrachten – mit ganz anderen. Und das konnte und wollte ich nicht zulassen. Ich zuckte zusammen, als ich eine Hand auf meiner Schulter spürte.
»Alles in Ordnung?«, erkundigte sich Pippa und musterte mich mit besorgtem Blick.
Ich wollte nicken, doch unwillkürlich schüttelte ich den Kopf – was wohl ziemlich absurd wirken musste, denn Pippas Stirnrunzeln nahm noch zu.
»Hast du dir einen Nerv im Nacken verklemmt?«
»Nein.« Ich schluckte und rang um Fassung. Ich traute mir gerade selbst nicht über den Weg. Wenn ich nicht aufpasste, bestand die Gefahr, dass mir Sätze entfleuchten, die ich nie mehr würde zurücknehmen können. Allerdings musste ich wohl irgendeine Erklärung liefern, die Pippa von weiteren Nachforschungen abhielt. »Er hat mir einen Abschiedsgruß hinterlassen«, krächzte ich hervor und räusperte mich dann.
»Oh. Lass mich raten: ein lapidares ›War schön, wir sehen uns‹?«, mutmaßte sie.
»So ungefähr.«