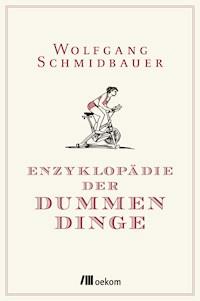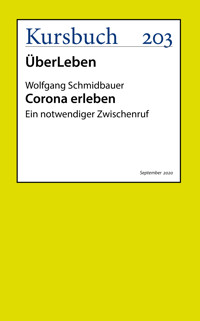9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Politik befaßt sich mit dem, was menschliche Gruppen tun, um ihr Zusammenleben nach innen und ihr Verhalten nach außen zu regeln. Therapie befaßt sich damit, wie menschliche Individuen ihr inneres und äußeres Verhalten so regeln können, daß sie sich besser fühlen. Was haben diese beiden Bereiche miteinander zu tun? Etwa: In der Politik wie in der Therapie liegt der Ruf nach einem starken und gütigen Helfer nahe. Wolfgang Schmidbauer geht dieses facettenreiche Thema von den verschiedensten Aspekten her an, denn er fühlt sich in doppelter Weise betroffen: als Staatsbürger und als Therapeut. Aus dem Inhalt: • Die Faszination der Gewalt • Der Psychoanalytiker und das Irrationale • No nature, no future? • Der Don Juan • Über den Mißbrauch der Gefühle in der Politik
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 266
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Wolfgang Schmidbauer
Ist Macht heilbar?
Therapie und Politik
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Politik befaßt sich mit dem, was menschliche Gruppen tun, um ihr Zusammenleben nach innen und ihr Verhalten nach außen zu regeln.
Therapie befaßt sich damit, wie menschliche Individuen ihr inneres und äußeres Verhalten so regeln können, daß sie sich besser fühlen.
Was haben diese beiden Bereiche miteinander zu tun? Etwa: In der Politik wie in der Therapie liegt der Ruf nach einem starken und gütigen Helfer nahe.
Wolfgang Schmidbauer geht dieses facettenreiche Thema von den verschiedensten Aspekten her an, denn er fühlt sich in doppelter Weise betroffen: als Staatsbürger und als Therapeut.
Aus dem Inhalt:
• Die Faszination der Gewalt
• Der Psychoanalytiker und das Irrationale
• No nature, no future?
• Der Don Juan
• Über den Mißbrauch der Gefühle in der Politik
Über Wolfgang Schmidbauer
Wolfgang Schmidbauer, geboren 1941 in München, studierte Psychologie und promovierte 1968 über «Mythos und Psychologie». Tätigkeit als freier Schriftsteller in Deutschland und Italien. Ausbildung zum Psychoanalytiker. Gründung eines Instituts für analytische Gruppendynamik. 1985 Gastprofessor für Psychoanalyse an der Gesamthochschule Kassel; Psychotherapeut und Lehranalytiker in München.
Bei Rowohlt veröffentlichte er:
«Selbsterfahrung in der Gruppe»
«Die hilflosen Helfer»
«Alles oder nichts»
«Die Ohnmacht des Helden»
«Helfen als Beruf»
«Die Angst vor Nähe»
«Die subjektive Krankheit»
«Jugendlexikon Psychologie»
«Weniger ist manchmal mehr»
Inhaltsübersicht
Einleitung
Was andere Menschen über uns denken, erfahren wir leider oft nur auf Umwegen und sind dann in einer direkten Auseinandersetzung durch die Loyalität zum Zwischenträger behindert. So habe ich mich auch mit der Meinung eines prominenten Psychoanalytikers beschäftigen müssen, es sei verwerflich von mir, die helfenden Berufe zu kritisieren und dennoch selbst in einem solchen Beruf zu arbeiten. Mehr noch: sowohl mit dem Schlechtmachen der Helfer in Büchern wie auch mit der therapeutischen Tätigkeit Geld zu verdienen, das sei der Gipfel des Zynismus. Ich gebe zu, daß ich dazu neige, aus der Phalanx der Experten herauszutreten, gewissermaßen die Lanze in die Erde zu stecken, mich beiseitezusetzen und für eine Weile mit Notizbuch und Zeichenblock zu beobachten. Aber wenn Zynismus das Verleugnen von Schwäche und Mitgefühl bedeuten soll, das Vermarkten von Widersprüchen, wie bei den Waffenfabrikanten, die zwei Kampfparteien beliefern, dann vermag ich mich in einem solchen Bild nicht wiederzufinden.
Vielleicht kann die Vielfalt der in diesem Taschenbuch enthaltenen Essays zum Thema «Therapie und Politik» deutlicher als die beiden kritischen Bücher über die «hilflosen Helfer» zeigen, daß eine konsequente Reflexion des psychotherapeutischen Expertenstatus neue und differenziertere Formen einer politischen Auseinandersetzung erschließt. Wieviel meine Gesichtspunkte der ökologischen Bewegung verdanken, dürfte ebenfalls deutlicher werden. Der Aufbau führt dabei von den stärker «internen» auf die Psychotherapie und Psychoanalyse bezogenen Überlegungen zu Fragen von allgemeinem Interesse (Sexualität, Autorität, Charakterbilder, Umweltpsychologie). Die verschiedenen Texte sind durchweg von mir noch einmal überarbeitet worden, wobei ich immer von meinem ursprünglichen Manuskript ausging, nicht von einzelnen, bereits veröffentlichten Abschnitten. Ungefähr ein Drittel des hier publizierten Materials ist bisher ungedruckt, darunter auch der Essay über Therapie und Politik, der den Anfang macht. Ich habe ihn während einer Gastprofessur an der Gesamthochschule in Kassel für die Kollegen vom Fachbereich verfaßt und mit ihnen diskutiert. Ihnen, vor allem Ariane Garlichs und Heinrich Dauber, danke ich für die gute (und leider zu kurze) Zusammenarbeit während dieser Zeit, die mir half, über einige Fragen mehr Klarheit zu gewinnen. Der Aufsatz über den Psychoanalytiker und das Irrationale ist von Hans Peter Duerr angeregt worden, der Text über den Mißbrauch der Gefühle in der Politik von Horst Stern. In allen Fällen gebührt ihnen der Dank dafür, daß sie mich auf eine Spur gesetzt haben. Was ich jedoch auf dieser fand, dafür tragen sie keine Verantwortung.
München, Februar 1986
W.S.
1. Therapie und Politik
Politik befaßt sich damit, was menschliche Gruppen tun, um ihr Zusammenleben nach innen und ihr Verhalten nach außen zu regeln – Gemeinden, Städte, Länder, Nationen, Staatenbünde. Therapie befaßt sich damit, wie menschliche Individuen, die sich als gestört oder krank erleben, ihr inneres und äußeres Verhalten so regeln können, daß sie sich besser fühlen. Was haben diese beiden gesellschaftlichen Bereiche miteinander zu tun? In einer Zeit, in der Krankheits-Metaphern viel verwendet werden, um politische Entwicklungen zu beschreiben (etwa «Rüstungswahnsinn»), liegt der Ruf nach einem gleichzeitig starken und gütigen Helfer nahe, der Heilung bringt. Er gleicht ein wenig der Sehnsucht nach dem «starken Mann» oder dem «braccio forte» (italienisch für den «starken Arm»), mit dem wir im Nationalsozialismus und im Faschismus keine guten Erfahrungen gemacht haben. Ich will im folgenden diese Thematik kritisch untersuchen. Die Beziehung zwischen Therapie und Politik läßt sich in vier Bereichen verfolgen:
1. Die Anwendung therapeutischer Theorie und Methodik auf politische Probleme.
2. Die den Therapie-Konzepten innewohnende, möglicherweise in der Art eines «heimlichen Lehrplans» sich selbst verborgene Politik.
3. Die politische Bedeutung der therapeutischen Praxis.
4. Die Berufspolitik der Therapeuten.
Alle diese Bereiche hängen miteinander zusammen, doch scheint es sinnvoll, sie zu trennen, um analytische Einsichten zu gewinnen. Ich will im Folgenden zunächst so vorgehen, daß ich Äußerungen von Therapeuten, die mir typisch erscheinen, kritisch überprüfe und ihre möglichen Konsequenzen verfolge.
Auf dem Höhepunkt der Kuba-Krise schlug der Leiter des Psychodrama-Instituts in New York, J.L. Moreno, vor, Kennedy und Chruschtschow sollten mit ihm psychodramatisch arbeiten, um ihren Konflikt zu bewältigen. Die politischen Folgen dieser Aufforderung sind mir nicht bekannt. In Therapeutenkreisen wird sie manchmal als Hinweis auf «manische» oder «größenwahnsinnige» Züge in Morenos Persönlichkeit gedeutet – wohl ein Hinweis auf Zusammenhänge mit Punkt 4 (im Sinn der Rivalität konkurrierender therapeutischer Schulen und Konzepte).
Zur Zeit des Höhepunkts der Proteste gegen die Nachrüstung mit Pershing-Raketen in Westdeutschland schrieb der Herausgeber der Zeitschrift «Integrative Therapie», Hilarion Petzold, im Editorial eines Heftes über Psychotherapie und Friedensarbeit: «Warum scheuen sich Psychotherapeuten, Atomrüstung als Ausdruck von gemütloser Psychopathie zu kennzeichnen?, warum den ‹Krieg der Sterne› als gefährliche Grandiositätsphantasie von Frühgestörten zu demaskieren? Warum analysieren sie nicht die Biographien der lebenden Potentaten (die Pathographie Hitlers kam zu spät), wo doch heutzutage die Lebensdaten unserer Regierenden offen und leicht zugänglich sind? Mir ist keine psychoanalytische bzw. psychotherapeutische Studie zur Charakterstruktur von Spitzenpolitikern bekannt! Wenn Psychotherapie eine Legitimation finden kann, dann hier.»[*]
Dem Psychiater Ernst Kretschmer wird folgender Spruch über die Psychopathen zugeschrieben: «In Friedenszeiten diagnostizieren wir sie, in Kriegszeiten regieren sie uns.»
Nachdem wir inzwischen in einer Zeit der kriegerischen Friedenszeiten oder der kalten Kriege leben, ließe sich Kretschmers Ausspruch zusammenfassen: Wir diagnostizieren sie, und sie regieren uns. Gut gemeint, drücken Vorschläge wie die von Moreno und Petzold in wissenschaftlicher Sprache dasselbe aus wie die sogenannte Stammtischpolitik. Wie wollten wir die öffentlichen Dinge lenken, wenn wir nur die Macht hätten! Da wir sie nicht haben, bleibt das Sprechen und Planen Phantasie. Solche Phantasien mögen eine entlastende Bedeutung haben. Sie mildern den Druck der Ohnmacht angesichts überwältigender Strukturen. Aber damit schlagen sie letztlich eher als unpolitische, d.h. nicht öffentlichkeitswirksame Äußerungen zu Buche. Sie werden nicht ernst genommen und mindern die öffentliche Geltung derer, die da ohne jedes Empfinden für Machtverhältnisse und Wirklichkeiten ihre Patentrezepte verkaufen wollen. In den westlichen Demokratien, zu deren Struktur solche Äußerungen psychosozialer Experten gehören, ist die öffentliche Geltung ein sehr empfindliches Gut. (In den sogenannten sozialistischen Ländern habe ich noch keine Anzeichen eines solchen Anspruchs psychotherapeutischer Experten gesehen. Wo die Politik ideologisch geordnet ist, muß die Therapie ihren emanzipatorischen Anspruch durchweg an sie abtreten.)
Neben diesen Einwänden lassen sich noch andere erheben. Versteht sich eine Therapierichtung wie die Psychoanalyse nicht nur als Hilfe bei neurotischen Störungen, sondern als eine kritische Theorie menschlicher Subjektivität, dann kann sie ihren Geltungsbereich nicht unbegrenzt ausweiten, will sie nicht unglaubwürdig werden. Das subtile Instrument des analytischen Dialogs ist nicht geeignet, Widerstände zu brechen, wie es die rohen Waffen des politischen Kampfes zumindest in seinen bisherigen Formen vorgeben. Das heißt, daß man nicht dem amerikanischen Präsidenten und den hinter ihm stehenden Rüstungs-Lobbies gerecht wird, wenn man ihr Verhalten mit dem frühgestörter Patienten vergleicht, die sich grandiosen Allmachtsphantasien vom Sternenkrieg hingeben. Sondern man wird nur den Patienten ungerecht, bei denen sich durch einen von wechselseitiger Einfühlung getragenen Dialog der Zusammenhang zwischen ihrem Größenselbst und ihrem Kindheitsschicksal herstellen läßt. Denn solche Einsichten über Entwicklungszusammenhänge menschlicher Subjektivität gewinnen ihren Sinn nicht durch das Urteil eines überlegenen Fachmanns über einen Patienten, der nur Material liefert, sondern durch wechselseitiges Einverständnis im Rahmen einer zwischenmenschlichen Beziehung. Wer dort sinnvolle Begriffe in Waffen des politischen Kampfes umschmieden will, gibt den emanzipatorischen Gehalt auf und fällt auf eine beklagenswerte, in der Psychiatrie verbreitete Umgangsform mit anderen Menschen zurück, in denen ein Experte seine Opfer klassifiziert und damit versachlicht.
Die öffentlichen, d.h. politischen Folgen solcher Versuche habe ich bereits angedeutet. Der Therapeut wird zum Narren, weil er durch sein eigenes Verhalten das öffentliche Vorurteil zu bestätigen scheint, daß sich Irrer und Irrenarzt sowieso nur durch den weißen Kittel und den Besitz des Hausschlüssels unterscheiden. Er beweist, daß er in einem Schonraum, einer Nische lebt, in der er Narrenfreiheit hat, die er aber nicht überschreiten darf, weil er sich in der Öffentlichkeit nicht zurechtfindet und mit ihr nicht umgehen kann.
«Infolge ihrer unbewältigten Allmachts- und Größenphantasien scheitert jede neue Elterngeneration daran, ihre Kinder bei der Integration der Aggressivität zu unterstützen. Damit wird diese Pathologie ewig neu reproduziert. Aber die Folge sind nicht etwa nur stereotyp wiederkehrende Erziehungsschwierigkeiten, sondern darüber hinaus gesellschaftliche Fehlentwicklungen von größter Tragweite … In psychoanalytischer Sicht bedeutet das Abschreckungsdogma einen Rückfall auf das Denksystem der analsadistischen Entwicklungsstufe: In dieser primitiven Perspektive kann man sich als Mittel zur Friedenssicherung nur die unfriedlichsten aller Instrumente vorstellen.»[*]
Während Moreno die Politiker mit direkter psychologischer Einflußnahme zur Räson bringen will, spricht Horst-Eberhard Richter für eine Bewegung «von unten» und fordert aktive Teilnahme an politischen Initiativen der Friedensbewegung, verbunden mit einer Aufklärung über die psychologischen Hintergründe der Friedlpsigkeit. Sie definiert er (nach einer Anregung Carl Friedrich von Weizsäckers) als «seelische Krankheit». Neben meiner Solidarität für Richters (standes)politische Forderungen, wie etwa die Verweigerung einer atomkriegsbezogenen Fortbildung von Ärzten, finde ich viele seiner Aussagen widersprüchlich. Richter vermischt immer wieder «Basis» und «Überbau», strukturelle Gegebenheiten und psychologische Entwicklungen. Damit entsteht ein ahistorischer Generationskreis, dessen tödliche Konsequenz eine zwar den «Gotteskomplex» analysierende, diese Analyse jedoch nicht auf sich selbst anwendende Psychoanalyse zu durchbrechen verspricht – wodurch? Durch moralische Aufforderung, durch Appell an das Gewissen, beides schätzenswerte bürgerliche Maßnahmen, die aber nicht eben viel Selbstreflexion ausdrücken.
Verstehen wir die hochgerüsteten Supermächte besser, wenn wir sie mit dem anal-sadistischen Kind in seinem Machtkampf mit den Eltern vergleichen, das die eigene Aggression auf sein Gegenüber projiziert? Subjektiv schwanken wir zwischen Allmachts- und Ohnmachtsgefühlen. Objektiv haben wir eine geringe, individuell verschiedene Einflußmöglichkeit. Beides sollte getrennt untersucht werden, um nicht unklar zu werden. Richter hingegen versucht, dem einzelnen Leser einen Cocktail aus diesen subjektiven und objektiven Bedingungen zu verabreichen mit dem gutgemeinten Ziel, ihn sowohl mit der Bedrohung zu konfrontieren, wie ihm Mut zum Handeln zu machen. So wird vieles, was er sagt, mythisch – großartig und unbestimmt:
«Die winzige Rolle, in der die nivellierten Wesen in der Masse mitfunktionieren, macht sie blind dafür, welche ungeheuere Gefahr in der millionenfachen Bündelung der abgespaltenen destruktiven Triebkräfte liegt, die in archaischer Weise längst in die große Politik eingebrochen sind und auf den Weg unserer Zivilisation einen verhängnisvollen Einfluß gewonnen haben.»[*]
Nach dem Allmachts-Angebot, mit dem Moreno Kennedy und Chruschtschow auf den Weg des Friedens zurückbringen wollte, finden wir hier ein Allwissenheitsangebot. Wenn die Öffentlichkeit nur dem Psychologen zuhören wollte, könnte er ihr genau erklären, worin die Krankheit Friedlosigkeit begründet liegt – in welchen Tiefen der Subjekte welche abgespaltenen, destruktiven Kräfte ihre Macht auf die Politik ausüben. Hier treten an die Stelle wissenschaftlicher Aussagen poetische Metaphern, die sich in ihrer Ausdrucksform an eine wissenschaftliche Sprache anlehnen, als ob politisches Handeln durch solche Sprachformen legitimiert werden müßte. Damit gerät Richter in einen Widerspruch, den er an anderen Stellen durchaus aufgreift: daß nämlich die Hoffnung trügen muß, Experten könnten und würden Kraft ihrer Sachautorität die Rüstungsdynamik bremsen. Um die militarisierte Politik zu humanisieren, sollen sich die therapeutischen Experten nicht mehr in Kulturgettos um ihre humanitären Ideale kümmern, sondern sich praktisch-politisch einmischen, fordert Richter. Wichtig scheint mir, sich hier bewußt zu machen, daß im Werben für die Politisierung der Therapeuten ein Psychoanalytiker Umgangsformen übernimmt, die eine Regression auf voranalytische Leitbilder (den ärztlichen oder priesterlichen Rat) enthalten.
«Die Psychoanalyse war von Anfang an sowohl eine revolutionäre Theorie als auch eine Theorie der Revolution.»[*]
Thea Bauriedl beruft sich auf die psychoanalytischen «Revolutionäre» Otto Groß und Wilhelm Reich. Sie zitiert eine Aussage von Otto Groß, die unmittelbar an die Forderungen von Richter anknüpft:
«Die Psychologie des Unbewußten ist die Philosophie der Revolution … sie ist berufen, zur Freiheit innerlich fähig zu machen, berufen als die Vorarbeit der Revolution … Es ist jetzt möglich geworden, sich selbst zu erkennen. Damit ist eine neue Ethik geboren, die auf dem sittlichen Imperativ zum wirklichen Wissen um sich und um den Nächsten beruhen wird.»[1]
Mir scheint bereits der Ausgangspunkt problematisch. Die Psychoanalyse hat sich in der von Freud begründeten Form nicht revolutionär gegen die bürgerliche Gesellschaft gerichtet. Sie hat eher versprochen, den unerfüllbaren Anspruch dieser Gesellschaft doch noch zu ermöglichen (als analytische Therapie), die desintegrierenden Folgen der Sexualverdrängung zu mildern. Als kritische Theorie des Subjekts ist sie keineswegs eine kritische Theorie der Gesellschaft, wie Freuds eigene Äußerungen vielfach belegen. Bauriedl überschätzt die «revolutionäre» Potenz von Gefühls- und Triebbefreiungen. Die Konsumgesellschaft ist fähig, gerade die Aufhebung emotionaler Hemmungen zu einem letztlich nur subtileren Unterdrückungsgeschäft zu machen. Bauriedl tadelt an Groß und Reich, daß sie die Konsequenzen der psychoanalytischen Theorie in revolutionären Handlungsanweisungen suchten, womit sie der bürgerlichen Unterdrückungsideologie eine neue Ideologie entgegensetzten. Damit wurde durch das Mittel (Stiftung einer Ideologie) die Erreichung des Zieles (Befreiung von Ideologien) unmöglich gemacht. Die gescheiterten psychoanalytischen Revolutionäre haben danach gestrebt, das Herr-Knecht-Verhältnis umzukehren, statt zu versuchen, es aufzuheben. Dies sei aber, so Bauriedl, der eigentliche, emanzipatorische Auftrag der Psychoanalyse: «Revolution als Erkennen und Auflösen der eigenen Beteiligung an der Unterdrückung.»
Mir scheint, daß auch in dieser Auffassung Reste der therapeutischen Allmachtsvorstellung aufzufinden sind. Durch einen eher selbstquälerischen, nicht mehr nach außen, sondern gegen die Therapeuten (bzw. mit dem «dialektisch-emanzipatorischen Prinzip» Identifizierten) gerichteten Impuls scheint diese Allmachtsvorstellung gemildert. Aber die in Freuds Motto steckende Grandiosität «Flectere si nequeo superos, acheronta movebo» beansprucht auch Bauriedl für sich: «Ich brauche die Oberen, die ‹Feinde› nicht zu beugen, wenn ich es zulassen kann, daß sich meine Unterwelt bewegt.»[*] Während sich bei Moreno der Therapeut anbietet, im großen Politik-Theater als Psychodrama-Leiter die von allen ersehnte und von keinem gefundene Lösung zu bringen, unterzieht er sich bei Bauriedl selbst dem schmerzhaften Emanzipationsprozeß und verändert dadurch die Politik. Man könnte das erste das Gottvater-Prinzip nennen, das zweite das Gottsohn-(oder -tochter)-Prinzip. In beiden Fällen wird die bürgerlich-individuelle Omnipotenzvorstellung geweckt, im zweiten allerdings zu ihrer ständigen eigenen Aufhebung bestellt. Daher gibt es für Bauriedl auch nur einen unberechtigten Vorwurf des Psychologisierens. Man kann sozusagen nicht genug psychologisieren:
«Wendet ein Psychoanalytiker dieses Prinzip außerhalb des Rahmens seiner therapeutischen Tätigkeit an, indem er versucht, etwa in irgendwelchen Verhandlungen, in wissenschaftlichen Diskussionen oder auch im Kollegenkreis ein bestimmtes Verhalten auf die Konfliktlage der sich verhaltenden Person zu beziehen, d.h. die Person – vielleicht sich selber – hinter dem Verhalten wieder erkennbar zu machen, dann trifft ihn oft der Vorwurf des Psychologisierens. Dieser Vorwurf und die hinter ihm stehende Angst machen deutlich, wie bedrohlich intrapsychisch und interpsychisch das Erkennen von Konflikten als Grundlage von Verhalten ist.»[2]
Bauriedl möchte mit ihrer Forderung, das Herr-Knecht-Verhältnis durch Erkennen der eigenen Beteiligung daran aufzulösen, nicht in die (naheliegende) Verwandtschaft zu dem Prinzip geraten, die Schuld bei sich selbst zu suchen und nicht jemand anderem zuzuschreiben. Sie möchte, daß Schuldzuschreibung überhaupt aufhören kann, weil nicht mehr entschieden werden muß, wer «krank» oder «schuld» ist, Individuum oder Gesellschaft, Patient oder Eltern.
Dem meiner Ansicht nach naiven Optimismus, daß politisches Engagement sich nicht als Verhalten, sondern als Beziehung zur Umwelt verstehen läßt, setzt Bauriedl gar noch hinzu, daß – dialektisch-emanzipatorisches Vorgehen des Psychotherapeuten vorausgesetzt – auch die Patienten «automatisch kritischer und damit auch politisch engagierter» werden.[3] Und weil Fürstenau einmal gesagt hat, die Psychoanalyse sei «trotz ihrer umfassenden Perspektive auf die gesellschaftlich-geschichtliche Welt des Menschen … nicht politisch anwendbar im Sinne einer Verwertung für kollektive Neunormierungen menschlicher Lebensverhältnisse»[4], wird ihm vorgehalten, er arbeite «pädagogisch und manipulativ», wodurch er «die bestehenden Verhältnisse aufrechterhält».[5]
Daß Bauriedl hier zu den alten Feindbildern greift und nicht von ihren Ängsten vor dieser Auffassung der Psychoanalyse spricht, wie es ihrer selbstgesetzten Vorgabe entspräche, gehört zu den Widersprüchen, die in dem Land zwischen Therapie und Politik siedeln wie Disteln auf Bahndämmen. Weder die psychoanalytische Theorie noch die psychotherapeutische Praxis lassen sich ohne solche Widersprüche in ein grundsätzlich emanzipatorisches Geschehen umwandeln. Dabei scheint mir Parins vorsichtiger Versuch, «Gesellschaftskritik im Deutungsprozeß»[6] unterzubringen, aussichtsreicher als Bauriedls Beziehungsanalyse.
Parin erinnert den Analytiker daran, daß er auch ein kritischer Intellektueller sein und Aufklärung betreiben soll, indem er die Einflüsse der Makrosozietät aufgreift und z.B. schichtspezifische Verhaltensmuster klärt. Das heißt auch, daß eine materialistische Gesellschaftstheorie eine wichtige Grundlage der analytischen Arbeit ist. Sie enthält Möglichkeiten, auch die eigene Rolle als bürgerlicher Experte kritisch zu reflektieren, wie sie Bauriedl anscheinend nicht wahrnimmt. Sie sieht hier nur die Gefahr, daß der linke Psychoanalytiker, statt auf den natürlichen Auftrieb des Unbewußten zu vertrauen, Macht ausübt und ideologische Vorstellungen suggeriert. Obschon ich mir das schwer vorstellen kann und auch Bauriedls Literaturnachweis für dieses Vorgehen (nämlich Holzkamps «Kritische Psychologie») nicht verstehe, finde ich das praktische Vorgehen schwierig. Auch ich hoffe, daß z.B. die Beschäftigung eines depressiven CSU-Stadtrats mit seinem Kindheitsschicksal als Flüchtling dazu führen kann, daß er seine politischen Positionen weniger doktrinär vertritt. Aber mir ist klar, daß meine therapeutische Priorität darin liegt, die Beziehung zu meinem Klienten aufrechtzuerhalten. Das heißt auch, daß ich mich sehr wenig «emanzipatorisch» und oft sehr «systemstabilisierend» erlebe. Leider gibt Bauriedl keine Fallbeispiele, die einen praktischen Eindruck von dem vermitteln, was sie für emanzipatorisch hält. Ich vermute aber, daß sich ihre Praxis weniger von meiner unterscheidet als ihre Deutung dieser Praxis. Eine materialistische Gesellschaftstheorie mit ihrer Einordnung der problematischen Position des Intellektuellen erleichtert mir das Verständnis des Mißverhältnisses zwischen meinen Wünschen, z.B. politische Einstellungen zu verändern, und den kleinen Schritten, die tatsächlich möglich sind, wenn man nicht den emotionalen Kontakt und das therapeutische Arbeitsbündnis (die ja beide zwei Seiten einer Medaille sind) verlieren will. Es wäre schön, wenn Therapeuten – wie Bauriedl behauptet – das bestehende System der Industriegesellschaften (die als einzige diesen Berufsstand hervorgebracht haben) dadurch verändern könnten, daß sie in den kleinen Systemen der von ihnen behandelten Klienten, Paare, Gruppen dafür sorgen, daß «entsprechende lebenserhaltende Maßnahmen noch rechtzeitig möglich werden», weil «der Wunsch zu leben und die Angst vor der realen Bedrohung im kollektiven Bewußtsein und im Bewußtsein jedes einzelnen so deutlich zugelassen werden».[*] Aber leider scheint es mir oft so, daß wir uns und unseren Überzeugungsgenossen immer nur unser kritisches Bewußtsein bestätigen, aber darüber hinaus nur sehr geringe Wirkungen entfalten. Und ich halte es für besser, sich zu fragen, wie diese geringen Wirkungen verbessert werden können, als alles, was wir tun, bereits als Schritte auf dem richtigen Weg auszugeben, weil wir ja die «emanzipatorische Beziehung» zu unserer Umwelt haben oder doch anstreben.
Ein elementarer politischer Bezug ergibt sich für den Therapeuten wie für jeden anderen Spezialisten daraus, daß er die Notwendigkeit seiner Existenz öffentlich rechtfertigen muß. Solche Legitimationen sind vielfältig und abgestuft. Oft reicht allein das Angebot einer begehrten Ware (wer Brot bäckt, wird vom Hungrigen nicht nach seinem Meisterbrief gefragt). In der differenzierten bürgerlichen Gesellschaft haben sich viele Regeln und Einschränkungen entwickelt. Vorgeblich oder tatsächlich um die Qualität der Arbeit zu sichern, gewiß auch, um eine stabile Verteilung von Ressourcen und Macht zu erreichen, wurde z.B. die handwerkliche Produktion in Zünften organisiert. Durch die Entwicklung der kapitalistischen Industriegesellschaft sind noch viel kompliziertere Geflechte beruflicher Legitimation entstanden, in denen zum Beispiel Schulen, Hochschulen, Krankenhäuser, ständische Kammern (zum Beispiel Ärztekammer), Behörden (Gesundheitsämter), öffentlich-rechtliche und private Organisationen (z.B. Krankenkassen) zusammenwirken. Nur wer die Legitimationsansprüche dieser Einrichtungen erfüllt, kann in einem modernen Industriestaat Psychotherapie betreiben.
Doch ist diese bürokratische Rechtfertigung nicht die einzige Form. Sie bietet zwar relativ starre, oft nahezu unverlierbare Privilegien, aber sie muß durch eine mehr oder weniger deutliche Einwirkung auf die Öffentlichkeit auch aufrechterhalten werden. Zum Beispiel werden die Gymnasiallehrer oder die Ärzte durch ihre Standesvertretungen protestieren, wenn ihr öffentliches Ansehen in Frage gestellt wird, obwohl sie keine unmittelbaren, sondern allenfalls nur sehr langfristig wirkende Nachteile zu befürchten haben. In diesem Zusammenhang ist auch eine Trennungslinie bedeutsam, die sich zwischen Gruppen von Experten ziehen läßt, die etwas vermehren sollen (zum Beispiel Wissen, technisches Können usw.), und einer anderen Gruppe, die etwas vermindern oder einschränken soll (zum Beispiel Krankheit oder Kriminalität). Die Experten der ersten Gruppe müssen sich vor allem dann erhöhten Legitimationsansprüchen stellen, wenn sie von anderen Staaten übertroffen werden (zum Beispiel Sputnikschock). Die Experten der zweiten Gruppe – und zu ihnen gehören die Therapeuten – stehen in einem unlösbaren Dilemma. Um sich selbst zu legitimieren, muß das gesellschaftliche Übel, das sie bekämpfen, von ihnen gleichzeitig vermindert werden und fortbestehen.
Die Dynamik solcher Legitimationen ist meines Erachtens ein wesentlicher Grund für die politische Unbeweglichkeit der Industriegesellschaften, die ihrem rasanten technischen Fortschritt Hohn zu sprechen scheint, tatsächlich aber eng mit ihm verknüpft ist. Subjektiv werden die Experten so sozialisiert, daß ihnen der Verzicht auf Privilegien unmöglich scheint. Ihr starres Festhalten lähmt dann ihre gesellschaftliche Wirkung. (Z.B. sind Rüstungsexperten um so notwendiger, je mehr der Gegner rüstet, obwohl ihre eigentliche Aufgabe doch darin liegt, sich überflüssig zu machen.) Die übliche Lösung dieses Legitimationswiderspruchs bei Therapeuten sieht so aus, daß sie ihren Expertenstatus eher verleugnen und das von ihnen behandelte Problem der seelischen Störungen individualisieren, d.h. aus seinem gesellschaftlichen Kontext herauslösen. (Diese Aussage ist natürlich extrem verkürzt: es handelt sich nicht um willentliche Entscheidungen, sondern um die Entwicklung von Theorien, die sich meist als «wissenschaftliche» Untersuchung eines Ausschnitts der gesellschaftlichen Wirklichkeit darstellen.) Das Individuum, vielleicht noch seine Eltern oder seine Ehepartner sind Gegenstand der therapeutischen Aufmerksamkeit. Die vermittelten Inhalte als Produkte der gesellschaftlichen Umwelt treten gegenüber den Formen zurück – war die Mutter einfühlend?, der Vater streng?
Der Experte muß in seiner Sozialisation lernen, die eigene Unterwerfung unter einen Legitimationszusammenhang, der ihm aufgezwungen ist, auszublenden. Seine Aufmerksamkeit richtet sich darauf, wie weit sich der Klient auf die «Übertragung» oder «therapeutische Beziehung» einläßt und was innerhalb dieses relativ geschützten Rahmens an heilsamen Erfahrungen möglich ist. Zu dieser Sozialisation paßt, was sich an den oben untersuchten politischen Äußerungen von Petzold, Richter, Moreno und Bauriedl feststellen ließ: die Neigung, die Gesellschaft eher als den eigenen Klienten aufzufassen, Politiker zu deuten, und nicht die eigenen Anpassungs- und Legitimationszwänge zu politisieren.
Sicherlich erleidet der Therapeut eine narzißtische Einbuße, die ihm als Experten schwer erträglich scheinen mag, wenn er wie jeder andere Bürger Politik z.B. als Parteiarbeit macht und auf die Vorrechte seiner Position verzichtet. Für ihn ist dieser Schrumpfungsprozeß vielleicht sogar besonders schwierig, ist er doch wenig geübt, Ablehnung und Widerstand gegen seine Position hinzunehmen. Seine Praxis übt insofern einen verwöhnenden Einfluß auf ihn aus, weil der hilfesuchende Klient bereit ist, weit mehr von den Anschauungen, Deutungen, offenen oder versteckten Gedanken des Therapeuten zu übernehmen als der politische Gegner, ja selbst der Gesinnungsgenosse. Daher gehört zum heimlichen Schicksal der politischen Verhaltensweisen von Therapeuten der gekränkte Rückzug vielleicht noch mehr als der engagierte Auftritt.
Wer die Länge eines Marsches kennt, wird größere Aussicht haben, sein Ziel zu erreichen, als jemand, der die Strecke verkürzt, weil er sich sehnlichst wünscht, rasch anzukommen. Mir scheint, daß dieses Gleichnis für die subjektiven Schwierigkeiten einer Verwirklichung politischer Vorstellungen bei Therapeuten nützlich ist. Die Ansätze von Richter und Bauriedl sind gegenüber den alten Sexpol-Konzepten Reichs oder den psychodramatischen Rezepten Morenos realistischer und erfolgversprechender. Beide betonen ausdrücklich den Verzicht auf schnelle Lösungen und die ständige Auseinandersetzung mit eigenen Ängsten und Zweifeln. Ich hoffe, daß mein Bemühen um Verständnis und Solidarität hinter meiner Kritik deutlich geblieben ist. Die Orientierung an dem gemeinsamen Ziel, Leben und Lebensvielfalt auf diesem gefährdeten Planeten zu erhalten, sollte alle therapeutischen Berufe verbinden und der Gefahr vorbeugen, Sündenböcke für die von allen gemeinsam zu tragende, geringe Einflußmöglichkeit zu suchen und in die Wüste zu schicken.
So scheint es mir für eine politische Auffassung der therapeutischen Praxis wesentlich, den Fehler zu vermeiden, einer «guten» Gruppe der Engagierten die «böse» Gruppe der Passiven und Abstinenten gegenüberzustellen (eine Neigung, die mir zumindest Richter nicht fremd zu sein scheint). Denn es gibt auch gemeinsame Ziele, die alle Therapeuten politisieren könnten. Eines wäre der Kampf gegen die in amerikanischen Wahlfeldzügen öffentliche, hierzulande wohl eher heimliche Disqualifizierung politischer Gegner oder Rivalen durch Hinweise auf eine psychiatrische oder psychotherapeutische Behandlung. In unserer Psychoszene begegnen wir nur selten den krassen Vorbehalten und Vorurteilen, die in den Machtstrukturen immer noch herrschen. Sie verhindern aber, daß Therapeuten politisch ernst genommen werden. Seelisches Leistungsversagen (zum Beispiel eine Depression) wird in unserer Gesellschaft immer noch vorwiegend moralisch bewertet, als Unzuverlässigkeit, Geistes- oder Mannesschwäche. Solche Meinungen zu bekämpfen, ist eine wesentliche politische Aufgabe des Therapeuten. Seine Rolle ist insofern oft schwierig, weil er einerseits seinen Expertenauftrag erfüllen soll, der Gesellschaft die unmittelbare Auseinandersetzung mit abweichendem, «verrücktem» oder «versagendem» Verhalten zu ersparen. Andrerseits lebt der Therapeut ständig in Gefahr, mit dem identifiziert zu werden, was er behandeln soll, wie ein Werkzeug, das radioaktives Material handhabt und am Ende selbst für verseucht erklärt und weggeworfen wird. Als kürzlich in München ein Psychiater von seinen beiden Söhnen brutal umgebracht wurde, weil diese sich von ihm verfolgt fühlten und keine andere Wahl zu haben glaubten, griffen die Massenmedien die offensichtlich wahnhaften Beschuldigungen als «real» auf und erklärten das Verhalten der Söhne zu einem «normalen» Umgang mit dem «Psychoterror» von seiten des Vaters. (Da ich einen Teil der in diese Tragödie verwickelten Personen kannte, glaube ich mich zu dieser Auffassung berechtigt: wie immer bei solchen Konflikten tragen alle Beteiligten zu ihnen bei, aber die Richtung der Sündenbocksuche verrät viel über das öffentliche Bewußtsein.)
Den Spruch Kretschmers abwandelnd, könnte man sagen: In gewöhnlichen Situationen behandelt der Therapeut Kranke, in auffälligen Situationen ist er selbst nicht mehr von diesen zu unterscheiden. Es ist z.B. unwahrscheinlich, daß jemals ein Psychotherapeut eine führende Position in einer ärztlichen Standesvertretung außerhalb seiner eigenen Berufsgruppe erhält oder daß ein Psychoanalytiker zum Rektor einer Universität gewählt wird. Die gesellschaftliche Abständigkeit und die Vorurteile gegenüber abweichendem Verhalten stecken die damit befaßten Experten auf subtile Weise an. Reformen wie etwa die der Psychiatrie in Italien, wo die Ärgernisse abweichenden Verhaltens wieder der Öffentlichkeit zurückgegeben werden sollten, sind immer auch ein wichtiger Schritt zu einer Politisierung der betroffenen Experten.
Betrachten wir den Umgang der Therapeuten mit dieser Situation, so kommen wir auch zum letzten Punkt: unserer Berufspolitik. Sie ist vielfältig und verwirrend, die verschiedensten Gruppen konkurrieren miteinander um die Gunst der Öffentlichkeit (die leicht zu erreichen und launisch ist) und um die Durchsetzung gegenüber der Bürokratie (die ihre Entscheidungen um so langsamer trifft, je mehr Interessen sie auf einen Nenner bringen muß). Merkwürdig mag es einen anmuten, daß eben jene Psychodrama-Leiter (um ein Beispiel zu erfinden, das durchaus auch passiert sein könnte), die sich anbieten, in der UNO-Arena erfolgreiche Konfliktlösung zu exerzieren, gruppeninterne Schwierigkeiten oder Konflikte mit anderen Therapierichtungen keineswegs so glatt bewältigen.
Ich habe schon darauf hingewiesen, daß die dauernde Verwöhnung der therapeutischen Situation dazu führen mag, die Toleranz für Konflikte zwischen Gleichgestellten zu vermindern. Vorbildliche zwischenmenschliche Umgangsformen sucht man hier jedenfalls manchmal vergeblich – nicht viel anders, als es in anderen, hochidealisierten Bevölkerungsgruppen sein mag (zum Beispiel unter kritischen Intellektuellen oder unter Christen). Aber hier ergibt sich auch ein konkretes Wirkungsfeld. Alles, was eine möglichst übergreifende Solidarität der verschiedenen im therapeutischen Bereich tätigen Gruppen ermöglicht, wird die öffentliche, d.h. politische Position dieser Gruppen festigen. Alles, was nach kleinlichem Gezänke zwischen Ärzten und Psychologen, Pädagogen und Sozialarbeitern aussieht, wird das öffentliche Ansehen schwächen und es den politisch Einflußreichen erleichtern, mit kritischen oder protestierenden Einwirkungen aus diesem Bereich fertig zu werden. Andrerseits können solche Argumente auch zu einer inneren Unterdrückung mißbraucht werden.
Die auch für Außenstehende verständlichen Rivalitäten zwischen standespolitischen Gruppen (etwa Ärzten, Krankenschwestern, Psychologen, Sozialarbeitern) werden im Therapiesektor noch dadurch kompliziert, daß es «Schulen» gibt, die solche Differenzen umgestalten und zu schwer durchschaubaren Bündnissen führen (wenn zum Beispiel psychoanalytisch ausgebildete Ärzte und Nichtärzte gemeinsam gegen die Zulassung von Gestalttherapie zur kassenärztlichen Versorgung kämpfen). Solche Phänomene weisen darauf hin, daß in diesem Bereich die Universitäten und Fachhochschulen nicht die berufsprägende Kraft entfalten, die ihnen in anderen gesellschaftlichen Bereichen zukommt. Mir scheint, daß die z.B. der Psychoanalyse innewohnenden gesellschaftskritischen und emanzipatorischen Möglichkeiten besser in konkrete Berufspolitik umgesetzt werden könnten, wenn die heute sehr eingeschränkten Chancen für Nicht-Ärzte und Nicht-Psychologen wieder stärker genutzt würden, als sogenannte «Laienanalytiker» tätig zu werden. Eine gründliche Kritik unserer geschlossenen Berufs- und Expertensysteme sollte auch an diesem Punkt ansetzen. In unserem begrenzten standespolitischen Bereich gibt es also konkrete Schritte, die mehr Kreativität in einem erstarrten System ermöglichen. Der Sinn solcher Schritte sollte nicht an großen gesellschaftlichen Perspektiven gemessen werden, sondern an einer Bereicherung unserer Alltagswelt, die unsere politische Kultur bestimmt.
2. Die Faszination der Gewalt
Der Frieden hat gute Theorien, aber eine schlechte Praxis. Alle reden von ihm, und je mehr er im Munde geführt wird, desto weniger scheint es ihn zu geben. Es kostet mich daher Überwindung, etwas zu diesem Thema zu schreiben: die Vernunft des einzelnen scheint ohnmächtig gegenüber einem System, das rational zu funktionieren vorgibt und Mehrfachsprengköpfe produziert. Wie schön wäre es, im Räsonieren über einen angeborenen oder erlernten Aggressionstrieb sich Lösungen zu versprechen – Scheingefechte auszutragen, wo die tatsächlichen Gefahren nicht auf einer Ebene individueller Triebe zu finden sind. Das ist doch gerade das Vertrackte: die persönlichen «guten Eigenschaften», wie Kontrolle von Jähzorn, Faulheit, Angst, kreatürlichem Überlebenswillen, machen einen organisierten Krieg erst möglich. Die Tugenden der Soldaten sind viel gefährlicher als ihr Aggressionstrieb, und sei er auch noch so gestaut.
In der Autobiographie eines Mannes, der als Kind von Indianern entführt wurde und dann bei ihnen aufwuchs, wird von der chaotischen Art ihrer «Feldzüge» berichtet. Eine Gruppe redet sich in Wut. Die verhaßten Feinde müssen einen Denkzettel erhalten, große Worte fallen. Eine Anzahl Krieger bricht auf. Aber bald läßt ihre Kampfeslust nach. Der Weg ist weit, sie sind müde, einige kehren um. Der Führer kann sie nur beschimpfen, aber nicht aufhalten – man findet die Feinde nicht, aber erbeutet einen Büffel, auch gut (Tanner