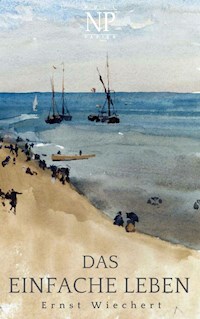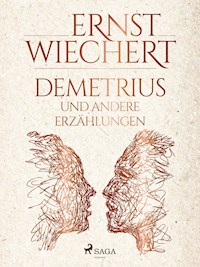Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Aufrichtig und demütig reflektiert Ernst Wiechert sein Leben beginnend mit der Jugendzeit und seinem Studium, bis hin zum Exil aus Deutschland. "Jahre und Zeiten" zeigt, wie der Dichter und Autor sich selbst sah und macht Facetten seines Denkens sichtbar, welche sein literarisches Werk lange verborgen hielt. -
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 656
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ernst Wiechert
Jahre und Zeiten - Erinnerungen
Saga
Jahre und Zeiten - Erinnerungen
Coverbild/Illustration: wikipedia
Copyright © 1949, 2021 SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788726927597
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
Dieses Werk ist als historisches Dokument neu veröffentlicht worden. Die Sprache des Werkes entspricht der Zeit seiner Entstehung.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - ein Teil von Egmont, www.egmont.com
Zum Geleit
Vor vierzig Jahren um diese Zeit und diese Stunde sahen die Fischer am Frischen Haff, die ihre Netze von den Pfählen nahmen, einen jungen Studenten jeden Morgen durch die betauten Wiesen nach dem hohen Walde gehen. Die Sonne stieg gerade auf, der Tau funkelte auf den Gräsern, und die ersten Reiher flogen von ihren Schlafbäumen nach der weiten, rötlich schimmernden Wasserfläche. Der Kuckuck rief, die heilige Frühe stand feierlich über der Welt, und die Fischer machten sich ihre schwerfälligen Gedanken über den jungen Menschen, der vor Tau und Tag ein sicheres, warmes Haus verliess, um über die nassen Wiesen zu streifen. Der ab und zu stehen blieb, um den Reihern nachzusehen oder nur in den grossen, leeren Himmelsraum zu blicken, als höre er dort Stimmen, die sie nicht hörten, und sehe Gestalten, die sie nicht sahen. Und der dann schliesslich in dem fernen blauen Walde verschwand, der den Horizont umsäumte, wie ein Wanderer verschwindet, oder ein Gerufener oder ein Verzauberter.
Der junge Student war der Hofmeister zweier nicht viel jüngerer baltischer Barone, die bei der lettischen Revolution mit ihren Eltern die Heimat hatten verlassen müssen und nun hier sesshaft geworden waren für ein paar Jahre. Er trug einen schäbigen Jagdanzug, ein Gewehr über der Schulter und in seiner Tasche ein kleines Buch, in das er von Zeit zu Zeit Bilder oder Gespräche aus dem ersten Roman eintrug, an dem er schrieb. Und da er ein Kind der grossen Wälder war, von Kind an gewohnt, Freuden und Schmerzen unter den hohen Wipfeln mit sich auszumachen, da auch sein Dienst nicht allzuschwer war und nicht zu früh begann, so verliess er an jedem Morgen das schlafende Haus, von jungen Plänen und Gesichten bedrängt, und dachte, eine Seite der Unsterblichkeit schon heimzubringen, ehe Leben und Arbeit auf dem Gutshofe und in dem Hause erwachten.
Denn seiner Unsterblichkeit war er als ein junger, ungeprüfter Mensch so ziemlich gewiss.
Der Roman hiess „Der Buchenhügel“, und er hatte ihn begonnen, als er Frenssens „Jörn Uhl“ gelesen hatte. Es hatte ihm geschienen, als könnte dieses Buch viel besser geschrieben werden, und eben damit war er beschäftigt.
Vierzig Jahre später nun, um die gleiche Zeit und die gleiche Stunde, sitze ich auf der Altane über dem Garten und beginne, an diesen Blättern zu schreiben. Die Sonne geht gerade auf und wirft ein rötliches Licht auf die Zweige der Apfelbäume, die über das Geländer hängen und mit einer verwirrenden Fülle von Blüten überschüttet sind. Der Kuckuck ruft wie damals aus dem nahen Walde, und das Gebirge liegt blau und grossartig am Saume der schweigenden Welt. Die heilige Frühe steht über der Erde wie damals, aber es sind keine Fischer da, die Reiher fliegen nicht nach einem grossen Wasser, und auch der Unsterblichkeit ist der Schreibende nicht mehr ganz so gewiss. Ja, er denkt mit einem stillen Lächeln an dieses grosse Wort, und wenn er einen Blick auf das Manuskript jenes ersten Romans wirft, das neben ihm liegt, auf die grosse, deutliche, kindliche Handschrift eines schlafwandlerisch Beginnenden, und den Blick von dort zurückwendet auf die winzige, kaum leserliche Schrift dieser Blätter, die er nun beginnt, ermisst er schon daran, wie Jahre und Jahrzehnte dahingegangen sind. Die Zeit, die grosse schweigende Zeit, die über Handschrift und Pläne schweigend hingegangen ist. Das Wandelnde, das Verändernde, das still Begrabende und still wieder Aussäende. Und er streift mit der linken Hand leise über den Apfelblütenast und meint, dass alles Notwendige wohl gut und in der guten Ordnung sei.
Wozu schreibt einer sein Leben auf, wenn es nun langsam zur stillen Neige geht? Die Narren schreiben ihre Weisheit auf und die Weisen ihre Irrtümer. Die Kinder ihre Träume vom Grosssein und die Grossen ihre Kinderzeit. Und aus allem webt sich wohl das Gewebe, das wir das Leben nennen, das grosse, schöne, schwere und ganz und gar rätselhafte Leben. Und da wir nicht fertig geworden sind damit, keiner von uns, so lassen wir es wie ein Feld, das wir nicht beendet haben zur Nacht, und lassen den Spaten oder den Pflug darin stehen und denken, dass wir morgen ihn wieder in die Hand nehmen werden, oder ein anderer werde es tun, ein Sohn oder ein Enkel, oder ein Fremder, der sich des verlassenen Feldes erbarmen werde.
Wir fangen immer nur an, wir sind immer nur in der heiligen Frühe, und das Beste, was wir tun oder schreiben können, ist immer eine unvollendete Symphonie in moll.
Nur die Toren werden denken, dass einer um des Ruhmes oder der Eitelkeit willen schreibt. Die anderen aber wissen, dass unser Werk und Ziel die Aussage ist, wie eines anderen Werk und Ziel ein Acker ist, oder die Berechnung der Sternenbahnen, oder die angebliche Lenkung einer Stadt oder eines Volkes. Die Aussage über ein Stück Schicksal eben, das Auseinanderflechten und Durchsichtigmachen, und Knoten und Fehler sind so wichtig wie Glanz oder Farbe. Dass einer es einmal lesen kann, heute oder in kommenden Tagen, wenn das Herz ihm schwer ist und die Augen ratlos sind. An einem Herbstabend vor dem Kamin etwa, wenn die Toten still an den Wänden sitzen, die Verlassenen, die Gekränkten; oder auch in der Dämmerung eines Kerkers, wenn das letzte Klirren der Schlüssel verstummt und die lange, schwere, hoffnungslose Nacht kommt. Dass er ein bisschen Klarheit daraus gewinne, die Erkenntnis einer Art von Gesetzlichkeit, eines Wachstums, eines stillen Werdens. Und aus allem diesem doch einen bescheidenen Trost. Dass der Mensch nicht ganz verloren sei auf dieser dunklen und gewaltsamen Erde, wenn er nur still und geduldig einem Gesetz folge, und möge er es auch selbst aufgerichtet haben über seinem staubigen Weg.
Wir dürfen nichts hinzusetzen und nichts verschweigen, ebenso wie vor einem Tisch der Richter. Und wie vor diesem Tisch sollten wir wohl vor unsrem Leben und vor einem solchen Bud über das Leben nichts anderes sagen als die schwere und einfache Formel: „So wahr mir Gott helfe!“
Der Vorläufer dieses Buches hiess „Wälder und Menschen“, und der Glanz der Jugend war noch über seine Blätter gebreitet. Die Wälder sind noch da, verlorene und nie mehr zu betretende Wälder. Von den Menschen sind die meisten dahingegangen, wie „Schatten auf Erden“. Und statt des Glanzes der Jugend ist nun das andere in diesen Blättern, das sich Verwirrende und Verdunkelnde, das sich nun langsam wieder in das klare Abendlicht hebt. Das Leben, wie wir es heissen. Arbeit und Amt, Liebe und Tod, Irrtum und Schuld, Saat und Ernte.
Und am Ende das grosse Bereitsein zum grossen Abschied.
„Denn wir sind von gestern her und wissen nichts, weil unsre Tage nur ein Schatten auf Erden sind.“
1 Im Vorhof
„Denn wir sind von gestern her . . .“
Aber was sollte das Hiob-Wort mir vor mehr als vierzig Jahren bedeuten, als ich an jenem Frühlingsabend unter der breiten Schirmkiefer am Waldrande stand und der Frau nachsah, die ich liebte? Sie hatte mir nichts versprochen und hat mir ihr Leben lang nichts anderes erwiesen als eine stille Zuneigung durch allen Wechsel der Jahre und Schicksale. Heute weiss ich, dass das viel ist. Damals aber, als ich unter den nassen und dunklen Wipfeln heimging, war mir, als sei die Welt so gross und wunderbar vor mir aufgetan wie vor Gösta Berling, und als würde ich das alles gewinnen, das wie eine goldene Stadt im Abendrot vor mir aufgeleuchtet hatte, wenn ich auf den Waldbergen gestanden war: Lorbeer des Dichters und Liebe der Frauen, Ruhm eines grossen Amtes und die Hand, mit der man die Herzen der Menschen bewegt oder das Wasser des Lebens findet.
Es mag wohl die Gnade aller Jugend sein, dass der dunkle Wald des Lebens, so voller Grauen und Gefahr, ihr unbedenklich erscheint, wenn man nur ein tapferes Herz in die dunklen Schatten trägt, und dass sie sich dazu ausersehen meint, zu besiegen, was niemand besiegt, und zu erringen, was niemand errungen hat. Denn sie glaubt von ihren Kräften, dass sie unendlich, und von den bösen Mächten, dass sie endlich seien. Und wenn sie nach dreissig oder vierzig Jahren erfahren hat, dass gerade die bösen Mächte unendlich und ihre eigenen Kräfte, ach, so endlich sind, vermag sie doch nicht ohne Rührung auf jene Gestalt des Anfangs zurückzublicken, so schmal, so töricht, so heldenhaft, wie sie, mit einer Blume in der Linken und einer Hirtenschleuder in der Rechten, sich lächelnd in das Unwegsame stürzt, um die Riegel des Zauberschlosses zu sprengen.
Für mich war es nun also beschlossen, dass ich durch die Tore der Universität eintreten sollte in das Heiligtum des Geistes. So schien es mir damals, als müsste es dort zu finden sein, ja, als müsste es alle Säle und Korridore des grauen, nüchternen Baues erfüllen und durchdringen, dass man es schon einatmen würde, wenn man nur eine der grossen eichenen Türen öffnete. Wohl war ich nicht mehr das Kind, an dessen Herzen ein junger Kranich schlief und das zauberbefangen zu Tante Veronikas Füssen sass. Man hatte mich „nach Aegypten verkauft“, ehe ich dessen gewahr geworden war. Ich trug nicht mehr Eisen unter den Absätzen, und sieben Jahre in der grossen Stadt hatten den Blütenstaub von der Stirn gestreift, der als ein unvergängliches Erbteil des Paradieses jede Kinderstirn bedeckt.
Aber die Ehrfurcht vor dem Geist war bewahrt geblieben in mir, und in allen Menschen meiner Landschaft lebte sie als ein unverbrüchliches Gesetz. Noch hatte niemand bei uns die grossen Ordnungen angetastet, die der Religion oder des Staates oder der Erde, und die „hohen Schulen“ der Wissenschaft waren in der Vorstellung der Waldleute noch immer von einer unsichtbaren Krone geschmückt.
Ich weiss nicht, wie viele schlaflose Nächte meine Eltern gehabt haben mögen, wenn sie an das Geld dachten, das für mich aufzuwenden war. Sicherlich lebte auch in ihnen der Ehrgeiz der Armen, der die Lebensbahn ihres Kindes aus dem Mühseligen und so Begrenzten ihres Tagwerkes sich aufheben sah wie eine Sternenbahn. Aber darüber hinaus war es doch wohl die Liebe, die reine Liebe, die unter unsäglichen Opfern nicht das Ihrige sucht, sondern nur das Glück des andern. Es lag wohl im schon leise Entartenden jener Zeit, dass man das Glück in der „Karriere“ sah und der Meinung war, es sei vom Geiste her zu erringen.
Und da meinem Bruder die ersehnte Entscheidung im Burenkrieg versagt geblieben war und er nun bei einem Regiment der Feldartillerie in der Hauptstadt den bescheidenen Weg eines Soldaten zu gehen begann, eines einfachen Kanoniers und nicht einmal den eines „Einjährig-Freiwilligen“, so war es wohl zu verstehen, dass alle Liebe und Hoffnung meiner Eltern sich auf mich warfen als auf den einzigen Auserwählten, der Namen und Geschlecht zu unerhörtem Glanze tragen sollte.
Ich wusste wohl nicht viel davon, als ich an einem Frühlingsmorgen am Fenster der Eisenbahn stand und meinen Vater in dem kleinen Wagen wieder über die Felder zurückfahren sah. Einen einsamen, stillen Mann, der wieder zu seinen Wäldern heimkehrte, um zu pflanzen und zu pflegen, indes ich immer weiter und weiter fortging, um die Hand nach dem Kranze auszustrecken.
Ich sah ihn und sah die blaue Linie der Wälder am Horizont. Ich fuhr in die Freiheit und das, was mir als die kommende Grösse erschien. Aber wenn mein Vater mir aus der Ferne zugewinkt hätte, dass er sich besonnen habe und ich ein Förster werden dürfte wie er, so würde ich aus dem fahrenden Zuge gesprungen sein und würde Freiheit und Grösse hinter mir gelassen haben wie den Staub eines falschen Weges.
Aber er winkte mir nicht.
Ich fand ohne Mühe eine der tausend „Buden“, die man in der Hauptstadt an Studenten vermietete. Sie hatte ein rotes Plüschsofa und zwei Sessel, einen Schreibtisch und ein Bett, und an der Wand einen der schrecklichen Oeldrucke, die den Kaiser oder eine Alpenlandschaft oder eine feenähnliche Frauengestalt in erstaunlichem Gesundheitszustand darzustellen versuchten. Es war die „gute Stube“ kleiner Leute, der wichtigste Posten in ihrem Wirtschaftsplan, und Semester für Semester zog einer der tausend Studenten ein oder wieder aus, jung oder betagt, farbentragend oder ungeschmückt, still oder lärmend, fleissig oder betrunken und faul.
Mein Wirt war ein Schuhmacher, ein stiller, schwerer Mann, den ich setzten sah und von dem ich nur die leisen Hammerschläge vernahm, mit denen er wie ein verborgener und unterirdischer Erdgeist an seinem dunklen Schicksal pochte. Seine Frau war es wohl zufrieden mit ihrem stillen Mieter, ohne eine besondere Herzlichkeit an eine so ephemere Erscheinung, wie ein Student sie darstellte, zu wenden.
Und eines Tages öffnete dann auch ich eine der schweren Eichentüren und stand verwirrt auf den Steinfliesen des riesigen Treppenhauses und noch verwirrter vor den unabsehbaren Flächen der „Schwarzen Bretter“, auf denen unverständliche Vorlesungen in unverständlicher Sprache angekündigt waren, Bekanntmachungen und Verfügungen, Wohnungsangebote und Mittagstische, eben die ganze vielfältige Welt eines kleinen Staates. Und ich sah Hunderte von jungen Menschen, verwirrt wie ich oder mit blasiertem Hochmut von einer der oberen Stufen dieses ganze Getriebe überblickend. Und auf der höchsten Stufe einen würdigen, gänzlich unnahbaren Mann, der wohl einer der Pedelle sein mochte, ein „Zivilversorgungsberechtigter“, der zwölf Jahre lang Herr einer Schreibstube oder eines Kasernenhofes gewesen sein mochte und vor dessen kalten Augen wir alle nicht viel mehr als ein „Sauhaufen“ waren, unwürdig einer Freiheit, die die Universität in unbegreiflicher Verblendung uns gewährte und der von keinem anderen in Zaum gehalten werden konnte als eben von ihm, der die Schule militärischer Zucht vom bitteren Anfang bis zum ehrenvollen Ende ohne Makel durchlaufen hatte.
Waren dieser und seine zwei Gefährten also veritable „Zwölfender“, wie man heute zu sagen pflegt, so war der Leiter der Universitätskanzlei eine echte „deutsche Eiche“. Ein grosser, schöner Mann mit dunklem Vollbart und strahlenden blauen Augen. Ein im Formalen des Betriebes Allwissender und damit unentbehrlich für Rektor, Dekane und Fakultäten, die in den reinen Sphären des Geistes lebten. Damit aber auch ein gefährdeter Mann, und ein paar Jahre später hiess es, dass er durch Bestechlichkeit sein Amt verloren und somit ein schimpfliches Ende seiner gottähnlichen Würde gefunden habe.
Von dem lauten und fröhlichen Amtszimmer dieses Mannes gelangte man in die eisige Sphäre der Quästur, wo kein Herz schlug, ausser dem der Armen, die wie ich die Höhe der Kolleggelder erfuhren, sondern nur Federn raschelten und Goldmünzen klirrten. Das trockene, leblose Gesicht des Quästors schien nicht aus dem Lehm der Erde, sondern aus Subtraktionen gebildet. Seine Stimme war die eines sich in die Ewigkeit drehenden Rades, und in seinen kalten Augen lag ein Widerschein allen Metalls, das tagaus tagein durch seine Finger glitt. Auch konnte ich später an ihm bemerken, dass Studenten, die wie ich eine Stundung ihrer Kolleggebühren erhielten, für ihn unsichere und zweitrangige Existenzen waren, die man scharf ansehen musste, damit sie nicht von vorneherein den Entschluss fassten, ihre Schulden nie zu bezahlen.
Waren dieses nur die Erdgeister des grossen Baues sozusagen, deren Handwerk noch menschliche Züge trug und in deren Praxis man wenigstens einen Blick tun konnte, so waren die Welten der grossen Lehrer mir vorläufig ganz und gar verschlossen, und nur ab und zu sah ich eine seltsame Gestalt die Treppen herunterkommen, vor der die Studenten höflich oder lächelnd auswichen. Ein Riesenhaupt unter einem Riesenhut etwa, den unordentlichen Mantel unordentlich über die Schultern geworfen, unsichtbare Augen hinter einfachen oder doppelten Brillen, und in Haltung, Gang oder Gebärde einer fremdartigen Welt oder einem anderen Stern angehörig. Damals sah ich noch nicht, dass bei vielen Eitelkeit die Wurzel dieses „Andersseins“ war, der Wunsch eben, originell zu erscheinen, der einem Amt entgegenkam und natürlich war, in dem eben eine bestimmte Originalität des Geistes gefordert wurde. Damals hatte ich bei der Erscheinung alles Fremdartigen kaum einen anderen Weg, als mir diese Gestalten in meinen Wäldern vorzustellen und bei einem der Handwerke, das darin zu betreiben war, wenn man bestehen wollte, und von da aus gesehen, spielten die mächtigen „Individualitäten“ nun allerdings eine seltsame Rolle, wenn ich sie etwa in meinen Flachkahn zum Fischen versetzte, oder auf eine schlanke, himmelhohe Kiefer, wo es galt, einen Hühnerhabichthorst auszunehmen. Der Primat des Geistes hatte seine reine Form in mir noch nicht erreicht, und ich mag wohl als ein seltsamer Tor unter den Hunderten dagestanden haben, die andere Massstäbe in sich trugen als die eines Jägers oder Hirten.
War dieser Anfang also schon verwirrend und fast betäubend für mich, da ja diese Welt in ihren Formen sich ganz und gar von der subalternen der Schule unterschied, so habe ich bei meinen ersten Vorlesungen oft gedacht, dass alle Welt mich überschätzt hätte und dass ich niemals etwas von dem begreifen würde, was sich hier vor mir auftat. Auch wurde ich von niemandem beraten, und so trieb in der ersten Zeit die Neugier mich von Hörsal zu Hörsal, von Fremdheit zu Fremdheit, und es fiel mir schwer, mir einzugestehen, dass alles doch nun so ganz anders war, als ich es in meiner kindlichen Welt mir vorgestellt hatte.
So unbewandert war ich in dieser seltsamen Hierarchie, dass ich zu Tode erschrak, als gleich zu Beginn der ersten Vorlesung, die ich hörte, die zahlreichen Studenten nachdrücklich mit den Füssen zu scharren begannen, weil die Stimme des Professors nur wie das Flüstern eines Abendwindes in einem Schilfwald war. Ebenso gut hätte nach meiner Meinung jemand inmitten einer Predigt Trompete blasen können. Wer in der Zucht aufgewachsen war wie ich, musste Freiheit als Zügellosigkeit betrachten, und ich hielt mich dann also ganz still, um den schrecklichen Ausgang dieser Revolte über mich hingehen zu lassen.
Aber es geschah nichts, als dass die leise Stimme für eine Minute sich erhob und dann wieder in das Wesenlose versank.
Der Mann auf dem Katheder war der alte Geheimrat Schade, ein berühmter Germanist, der ein althochdeutsches Wörterbuch geschrieben hatte und der nun über Wolframs „Parzival“ las. Er hockte hinter dem hohen Pult wie eine uralte Eule, den schönen, ehrwürdigen Kopf tief über seine Blätter geneigt, und es sah aus, als hätte er ebenso gelesen, wenn statt hundert lebendiger junger Menschen hundert Speerschäfte zwischen den Bänken gestanden hätten. Die schreckliche Beziehungslosigkeit der Wissenschaft, insbesondere der philologischen, zum Herzschlag des Menschen hat sich mir damals auf eine unverlierbare Weise eingeprägt.
Da war ein anderes Kolleg über „Gotisch“, in das ich geriet und das ich verzweifelt verliess. Und eines über die Geschichte der Pädagogik, von einem uralten Greise murmelnd vorgetragen, als bete er zu seinen Penaten, aber als sollte jedermann von diesem Gebet ausgeschlossen sein.
Es fällt mir heute schwer, mich zu erinnern, weshalb ich mich damals zu dem Studium eben dieser Philologie entschloss. Wahrscheinlich geschah es aus einem sanften Zwang und nicht aus meinem freien Willen. Ich würde gern das Forstfach studiert haben, aber dazu fehlte es durchaus an Geld. Ich würde gern Arzt geworden sein, aber auch dieses Studium war zu teuer. So hielt ich mich an die Naturwissenschaften, weil ich meinte, ich könnte dabei doch einen Hauch der Welt bewahren, die ich hatte verlassen müssen. Und dass ich die Germanistik dazunahm, war ja für einen kommenden grossen Dichter nur selbstverständlich.
Langsam also begann das Dickicht des Urwaldes sich vor mir zu lichten, und ich belegte nach vielem Bedenken die Anfangskollegs in Botanik, Zoologie, Chemie, Mineralogie und Philosophie und alles, was ich ausser diesem Stundenplan an germanistischen Vorlesungen hören konnte. Um diesen Stamm der Wissenschaft rankten sich ein paar seltsame Gewächse: Gerichtsmedizin, Theologisches und Juristisches, was ich so nebenbei ergreifen konnte, und als ich am Abend meinen Stundenplan betrachtete, schien mir der Schüler im „Faust“ ein Waisenkind gegen mich, und ich konnte bei einiger Phantasie und Urteilslosigkeit mich auf dem geraden Wege wähnen, „zu werden wie Gott und zu wissen, was gut und böse sei“.
Und nachdem ich eine ausreichende Menge von Kollegheften, Bleistiften und Federn erworben hatte, machte ich mich an einem sonnigen Maimorgen vor zweiundvierzig Jahren auf den Weg zum botanischen Institut, das wie alle Gebäude der Naturwissenschaften fern der Universität am Rande der Stadt lag. Langsam und wahrscheinlich eine Zigarre rauchend, ging ich durch die morgenstillen Strassen, die so unähnlich den betauten Waldwegen meiner Kinderzeit waren, mit einem bedrückten Herzen vermutlich, und ich erinnere mich deutlich, dass ich eine stille Ktraft und Gewissheit aus der Vorstellung gewann, dass meine Eltern und alle mir vertrauten Menschen meiner Heimat mir nun schweigend aus der Ferne zusahen. Dass mein Vater auf seinem Waldgang den Schritt anhielt und für eine Minute dem Rauschen der Wipfel zuhörte oder dem Kuckucksruf, der über die Schonungen herüberklang; dass meine Mutter die Hand mit den Körnern sinken liess, die sie den Hühnern ausstreute; dass Tante Veronika das Kapitel im Prediger Salomo aufschlug und beim Lesen leise die Lippen bewegte: „Steine sammeln und Steine zerstreuen; Herzen und ferne sein von Herzen . . .“; dass alle Waldarbeiter und Mädchen den Pflanzspaten sinken liessen und auf die kleinen Kiefernpflanzen niederblickten, die sie in die sandige Walderde setzten. Und ich gelobte mir und ihnen allen, auf meinem Wege nicht innezuhalten und nicht zu verzagen, damit ich einstmals heimkehrte, wie sie dachten in ihrem einfältigen Sinn, dass ich heimkehren würde: wie Saul, der auszog, um eine Eselin zu gewinnen, und eine Königskrone gewonnen hatte.
Der Professor der Botanik war ein alter, schmaler, gebeugter Mann mit einem zerstörten Gesicht, der mit zitternder Band Namen und Pflanzenbilder an die Tafel schrieb, und es hiess von ihm, dass er Morphinist sei. Ob seine Wissenschaft ihm lebendig war, weiss ich nicht, aber dass er zu uns sprach, als ob wir Tote wären, weiss ich noch sehr wohl. An keiner Stelle der Universität hat die Eiseskälte der Wissenschaft und der vielen, die sie lehrten, mich so angerührt wie dort, und was mir mein junges Leben lang als ein lebendiger Zauber oder ein Gottesspiel erschienen war: Blatt und Blüte und Baum, war hier in eine tote Systematik eingereiht, in Tabellen geordnet, mit Buchstaben und Ziffern, und selbst Entwicklung, Werden und Vergehen waren wie von einem eisigen Hauch bedeckt, aus der Schöpfung herausgenommen und aus den Bezirken der Schönheit und des Wunders in die einer froststarrenden Gesetzlichkeit übertragen.
Es mochte ein törichtes Urteil sein, und es war wohl auch kein Urteil, sondern nur die Entzauberung einer kindlichen Welt, und aller Wissenschaft mag wohl der Fluch oder die Grösse innewohnen, dass sie das Magische zerbricht, um die kühlen Formen der ratio zu gewinnen.
Vom botanischen Institut ging ich mit bedrücktem Herzen zum zoologischen, ohne eine Aenderung der Atmosphäre zu erfahren. Nur dass der Professor keine zitternde Hand hatte, sondern mit „markigen Knochen“ auf der „festgegründeten Erde“ stand und über seine Würmer so dozierte, als hätte er sie selbst aus dem Nichts erschaffen und als würde es ihnen schlecht bekommen, wenn sie den Versuch machen sollten, sich seinen Klassen und Systemen zu entziehen. Aber darüber hinaus war er ein roher Bursche, ungepflegt an Leib und Seele, wie es ja auch für den Menschen nicht gleichgültig ist, ob er sich sein Leben lang mit Hölderlinschen Hymnen oder mit der Fortpflanzung der Würmer beschäftigt. Und wie ein Viehtreiber nicht Hand oder Gesicht oder Sprache eines Heiligenmalers haben kann, so formt wohl auch eine Wissenschaft ihreJünger, und ich hätte nicht erstaunt oder verletzt zu sein brauchen, wenn ich nicht soviel „Unbedingtes“ in mir getragen hätte.
Damals war gerade den Frauen der Weg zur Universität geöffnet worden, und unter den zahlreichen Hörern, die mit mir auf den Bänken sassen, waren auch drei Mädchen, die die ärztliche Wissenschaft erlernen wollten, hübsche Mädchen aus guten Häusern, die mit Tapferkeit und Würde den dumm erstaunten oder spöttischen oder frechen Blicken ihrer männlichen Kommilitonen standhielten. Und es war nicht ein Ruhmesblatt für die meisten Lehrer der naturwissenschaftlichen und medizinischen Fächer, dass sie diese Mädchen entweder übersahen, als wären sie Luft, oder dass sie kaum eine Gelegenheit ausliessen, bestimmte Gebiete ihrer Wissenschaft mit einer betonten Deutlichkeit und Schamlosigkeit zu behandeln, wobei sie des grinsenden oder gar trampelnden Beifalls der Studenten gewiss sein konnten.
Auch der Zoologe gehörte zu dieser Rotte, und der Widerwille, den ich gegen ihn und seine billige Methode fühlte, mag dazu beigetragen haben, dass ich nach zwei Semestern diese allzu irdischen Götter verliess, um mich reineren zuzuwenden. Es gab in meinem Elternhause und in der Bibel keine Spässe dieser Art, und als ich zehn Jahre später Ordonnanzoffizier bei meinem Bataillon war und mein gutherziger aber gedankenloser Kommandeur mich fragte, weshalb ich zu seinen schönen „Witzen“ niemals lache, erwiderte ich ernst und höflich, dass in meinem Elternhause solche Witze nie gemacht worden seien, vor denen meine Mutter hätte erröten müssen. Er sah mich eine Weile an, und dann sagte er: „Verzeihen Sie, aber ich will versuchen, es mir abzugewöhnen“.
Waren diese beiden Institute schon von einem merkwürdigen Duft des Vergangenen oder leise Verwesenden erfüllt, so roch der chemische Hörsaal nun vollends nach allen Spottgeburten von „Dreck und Feuer“. Geheimnisvolle Adepten in weissen Mänteln hantierten mit betonter Sicherheit an Tiegeln und Retorten, zischende Gebläse entzündeten sich plötzlich unter ihren allmächtigen Händen, und der junge Student hatte das unsichere Gefühl, als könnte die ganze Herrlichkeit plötzlich in die Luft gehen und die Decke des Saales sich vernichtend über alle unheiligen Erforscher des Unerforschlichen stürzen.
Der Chemieprofessor war ein Bruder des grossen Max Klinger, und selbst die äusserliche Aehnlichkeit war unverkennbar. In seinem zugeschlossenen und unbewegten Gesicht gab es merkwürdige, gleichsam unterirdische Bewegungen, sei es des Humors, sei es einer souveränen Welt- und Menschenverachtung, und er war einer der wenigen Lehrer, die immer etwas Rätselhaftes behielten. Von seinem Leben und seiner Trinkfestigkeit wurden seltsame Geschichten erzählt. Mir aber sah er immer aus, als sei er nur durch Zufall in dieses Amt und dieses Laboratorium gekommen und als sei er von der Natur zu etwas ganz anderem bestimmt worden. Zu einem Magier etwa, oder zum Leiter einer grossen Spielbank oder zum Führer einer grossen und unerbittlichen Piratenbande. Und ein Abglanz der grossen und grausigen Phantasien und der Wildheit seines grossen Bruders schien mir auch hinter seiner unbewegten Stirn, mühsam gebändigt, zu leben.
Von dieser rätselhaften, feurigen und rauchenden Welt führte mich ein kurzer Weg in das stille, schweigende Reich der Steine, die ein stiller Mann behütete, der ostpreussischen Dialekt sprach und so bescheiden und unscheinbar aussah wie ein kleiner Handwerker am Sonntagnachmittag. Hier liess ich es mir für drei Viertelstunden wohl sein. Hier waren keine Ansprüche hohen Geistes, keine Originalitäten, keine Königskronen. Auch hier gab es Namen und Tabellen, Zeitalter und ihre Unterabteilungen, aber die Steine lagen still in ihren Glasschränken, unfähig und wohl auch ungewillt, sich zu wehren, und der Atem des Friedens, der durch die Räume ging, schien ihnen angemessen und zugehörig, dem Granit, dem Porphyr, und wie sie heissen mochten. Man hatte sie aus dem Schlaf gehoben und zu einem neuen Schlaf hingelegt, und es war schön, von ihrer glühenden Vergangenheit mit milden Worten sprechen zu hören und die Kreise der Zeit sich ausdehnen zu sehen bis an den Rand einer nicht vorzustellenden Ewigkeit.
War so fast der ganze Vormittag den Reichen der Natur gewidmet oder doch dem, was die Wissenschaft so benannte, so gehörte die letzte Stunde dem Reich des reinen Geistes, und ich hatte schnell den Weg zur Universität zu machen, wo der alte Geheimrat Baumgart über Lessing oder Schiller oder über allgemeine Literaturgeschichte las.
Dieser hochgewachsene Mann mit den halbgeschlossenen Augen war nun wirklich ein Sohn des wahren Humanismus und, was mehr ist, der wahren humanitas. Er war nicht frei von einer dogmatischen Enge in der Beurteilung der Dichtkunst wie anderer Künste, insbesondere der Musik, und das nicht ungefährliche Wort Goethes, dass das Klassische das Gesunde und das Romantische das Kranke sei, war ihm wie seinem Altmeister eine hemmende Schranke in der Beurteilung aller Kunst, die, wie in ihrem wahren Wesen lag, immer neue Wege gehen musste, um dem letzten Geheimnis näher zu kommen. Schon Hebbel war ihm ein „dubioser Bursche“, und was er von Ibsen oder gar von Strindberg und Wedekind hielt, machte sich nur in gelegentlichen Bemerkungen Luft, wie man ja auch von Lustmördern nicht gern und ohne Zwang zu sprechen pflegt. So war ihm auch Bach Anfang und Krone aller Musik, und Beethoven stand schon in dem gefährlichen Zwielicht der Auflöser und Empörer, deren ganz und gar beklagenswertes Opfer etwa Hugo Wolf war.
Er hatte ein grosses Lehrbuch der Poetik geschrieben und einen zweibändigen Faust-Kommentar, in dem auf tausend Seiten der nie zu führende Beweis unternommen wurde, dass die zwei Bände dieses dunklen und langsam gewachsenen und gealterten Werkes eine durchaus einheitliche Dichtung seien.
War er so im Aesthetischen befangen, im Weltanschaulichen und Wissenschaftlichen von äusserstem Konservativismus, so war die Fülle seines Wissens doch so gross und die Vornehmheit seiner menschlichen Haltung so einleuchtend und bezwingend, dass ich dankbar der langen Jahre gedenke, die ich zu seinen Füssen sitzen durfte. Bei allen Mängeln war er ein Lehrer des Echten und Wesentlichen, frei von allem Trachten nach billiger Originalität, nach Genialem oder gar Dämonischem und nach überladener Geistreichelei. Ein pflichttreuer Arbeiter, der nicht nach billigem Ruhm schielte und der ein anderes Goethewort auf eine schöne Weise verkörperte: dass er die Existenz darstellte und nicht den Effekt.
Darüber hinaus oder auch damit verbunden, war er mir die ganzen Jahre hindurch ein immer gütiger Helfer, der mir Freitische und Stipendien verschaffte und einer der nicht zu Vielen, die von mir viel erwarteten und meine immer unsichere Kraft durch ein schönes Vertrauen stärkten und belebten.
Mein Mittagessen nahm ich in der mensa ein, die von der Universität eingerichtet war und wo man für geringes Geld ein liebloses Mahl ausgeliefert bekam. Der Schauplatz war die sogenannten Palästra Albertina, ein grosses Gebäude, das zunächst für Leibesübungen eingerichtet war. In dem grossen Speisesaal bekam man sein Essen von nicht sehr liebenswürdigen Händen, wie ja in meiner Heimat die Leute des kleinen Mittelstandes immer geneigt waren, für die Armen das Gefühl der Verachtung zu hegen. Da das Geistige ihnen ein gänzlich fremder Erdteil war, so beurteilten sie jedermann nur nach Rang oder Vermögen, und die herrschende Schicht eines Koloniallandes ist immer aus dem feudalen Grossgrundbesitz, dem Militär und der Beamtenschaft zusammengesetzt worden.
Sass ich dann an einem der vielen Tische mit Unbekannten zusammen, die während des Essens in eine Zeitung, ein Buch oder ihr Kollegheft vertieft waren, so liess ich meine Blicke gern herumwandern, als wäre es noch der grosse Wald meiner Kindheit, der mich umgab. Ich war völlig einsam, da keiner meiner Schulkameraden sich zu einem so ärmlichen Essen herabliess, und ich war immer auf der Suche nach Gesichtern, in denen die Welt sich auf andere Weise spiegelte als beim Durchschnitt.
Hier nun bildeten das interessanteste Objekt für mich die zahlreichen russischen Studenten beider Geschlechter, die von jenseits der nahen Grenze kamen, um fast ausschliesslich Medizin oder Chemie zu studieren. Die meisten waren Juden, mit scharfen, fremdartigen Zügen, denen das schwarze, reiche Haar in die Stirne fiel, die unaufhörlich russische Zigaretten rauchten und unaufhörlich mit leidenschaftlicher Gebärde Probleme diskutierten, die mir wegen ihrer Sprache fremd blieben. Aber da ich in jener Zeit von der russischen Literatur las, wessen ich nur habhaft werden konnte, hatte ich immer das Gefühl, dass diese fremdartigen Wanderer zwischen zwei Welten nur deshalb so fleissig und hartnäckig im Hörsaal der Chemie sassen, um nachher ihre nihilistischen Bomben mit besonderer Exaktheit füllen zu können, bevor sie sie unter den Wagen eines Grossfürsten oder eines Polizeiministers schleuderten.
Manche der Mädchen waren sehr schön, von einer verschollenen orientalischen Schönheit, und ich konnte sie lange betrachten, um darüber zu grübeln, wie Anmut und Lieblichkeit sich mit einem mörderischen Handwerk und dem Umsturz alles Seienden vereinigen könnten.
Wahrscheinlich war ein grosser Teil dieser Studenten weit von dem entfernt, was meine Phantasie ihnen zuschrieb, und nur ihrem Studium mit Leidenschaft ergeben. Und wenn die Welträtsel und politische Formen sie mehr als ihre deutschen Kommilitonen beschäftigten, so lag es wohl daran, dass der reine Intellekt bei ihnen auf eine schärfere und auch gefährlichere Weise ausgebildet war und dass der Weg ihrer Leiden durch zwei Jahrtausende ihnen eine „Umformung“ der Welt wichtiger erscheinen liess als denen, die in der bürgerlichen Sicherheit eines behaglichen Herkommens ihre Tage verbrachten.
Der Nachmittag nun war in der Hauptsache dem gewidmet, was am Rande meiner Studien lag, ja was oft nicht das geringste mit ihnen zu tun hatte, ausser dass es eben nach der Erkenntnis dessen trachtete, was man wohl „das Ganze“ nennen konnte oder was einem jungen Menschen so erschien, der „Adlers Fittiche“ an sich nehmen wollte und der noch der naiven Meinung war, dass sie an keinem anderen Orte der Welt als eben an einer Universität zu finden seien.
Aber Hörsaal nach Hörsaal blieb hinter mir, ohne dass sich mir etwas von diesem „Ganzen“ erschlossen hätte. Das ganz nüchterne kritische Vermögen, das neben aller romantischen Hingabe so tief in meinem Wesen lag, verhinderte mich daran, Erkenntnisse oder vorgegebene Erkenntnisse gläubig hinzunehmen, und was mich dreissig Jahre später davor bewahrte, den Dilettanten des Marktes zu verfallen, behütete mich schon jetzt davor, einem Lehrer oder einem System blindlings zu folgen und dem verhängnisvollen Irrtum zu unterliegen, dass die Welt aus einem „Prinzip“ zu erklären und zu begreifen sei.
So konnte ich den seltsamen Philosophen, die damals an der Albertina lehrten, nur mit einer kühlen Verwunderung zuhören und zusehen, wie sie mit geschlossenen Augen etwa ihren Kopf in merkwürdigen Rhythmen zur Seite neigten, nicht unähnlich den Eisbären hinter den Gittern des Zoologischen Gartens, und etwa die Schopenhauersche Lehre des Pessimismus als die Kardinallösung aller Welträtsel mit einer Inbrunst ohnegleichen vortrugen.
Oder ich blickte mit leisem Grauen auf die Versuchspersonen, die der Gerichtsmediziner vorführte, Halbirre, Besessene und Psychopathen, die als arme, wehrlose Opfer vor den neugierigen Augen junger Menschen standen und in monotonem oder ekstatischem Tonfall von den Leiden und Gesichten erzählten, die sie verfolgten. Im Namen der Wissenschaft mag zu allen Zeiten gesündigt worden sein, aber wenn ich heute von dem Grauen höre, dem Menschen in den Lagern im Namen eben dieser Wissenschaft unterworfen waren, so stehen vor meiner Erinnerung immer diese „Demonstrationsobjekte“ auf, die man uns damals vorführte, ihre Gequältheit, ihre Gejagtheit und ihr völliges, rettungsloses und ergreifendes Verlorensein.
Und dann ging der lange Tag zu Ende. Die Mauersegler schossen mit ihren schrillen Schreien um die hohen Giebel, weisse Möven zogen hoch über den Dächern dem Haff oder dem Meere zu, der Spirituskocher brannte in meinem kleinen Zimmer, und der Lärm von Menschen und Strassenbahnen erfüllte den lieb- und heimatlosen Raum in allen Winkeln.
Dann nahm ich meine Kolleghefte vor und versuchte, mir Rechenschaft zu geben über mein Tagwerk. Eine kümmerliche Rechenschaft und ein kümmerliches Tagwerk. Nichts, was in der Hand zu halten war und sie warm und ganz erfüllte. Kein Korn, keine Pflanze, keine duftende Erde. Zeichnungen und Namen, Begriffe und Ideen, Zahlen und Abstraktionen. Eine fremde, leblose Welt, und ich sass grübelnd davor, mutlos und verlassen, und sah mich an einem meiner Hirtenfeuer liegen, Pilze oder Kartoffeln in der Asche bratend, und den blauen Zug der Kraniche über mir in dem hohen, vertrauten Himmel. Und ich wusste nicht, ob ich auf dem richtigen Wege sei.
Und dann las ich mehr als die halbe Nacht, Dichtung, Philosophie und Lebensbeschreibungen, und manchmal schrieb ich einen Vers auf oder eine Melodie, und immer vor dem Einschlafen dachte ich, dass sie nun in der Heimat glaubten, ich sei wieder ein Stück näher an die goldene Stadt des Ruhmes gekommen. Und an Winckelmann dachte ich, der das Wort von der „edlen Einfalt und stillen Grösse“ gefunden hatte und der um Mitternacht in seiner armseligen Kammer seine Füsse in eine Wanne eiskalten Wassers gestellt hatte, um nicht müde zu werden über seinen Büchern. Und dass ich seinmüsste wie er, weil so viele arme und gläubige Augen aus der Ferne auf mich blickten.
Ich war wohl ziemlich allein damals. Einer meiner Schulfreunde, der ein grosser „Heldentenor“ werden wollte und nebenbei Naturwissenschaften studierte wie ich, war Korpsstudent geworden und trug die grüne Mütze und das Band mit dem Stolz eines Kronprätendenten. Ab und zu sass ich eine Stunde in seinem Elternhaus und begleitete ihn zu den musikalischen Ekstasen des Schwanenritters, die er unter wohlgefälliger Kontrolle seines Bildes in einem hohen Wandspiegel von sich schmetterte. Wie alle jungen Menschen meiner Generation war ich dem sächsischen Magier damals noch verfallen, und nur von Zeit zu Zeit rollte eine Welle fast instinktiver Kritik und Ablehnung über das Meer dieser süssen und schwelgerischen Töne, die aus Genialität, Brunst und Parfüm so seltsam gemischt waren, und nach jedem solcher „Sakrilege“ folgte eine Periode abgekühlter Freundschaft, weil junge Menschen ja geneigt sind, Kniefälle vor ihren Idolen zu verlangen und Abtrünnige als „Verräter“ zu betrachten. Ein Vorgang, der in der Geschichte der Staaten und Völker nicht ohne Parallelen ist.
Ab und zu auch tauchte in der ersten Zeit eine feierliche Erscheinung in meiner armseligen Bude auf, der Abgesandte einer farbentragenden Verbindung, der es ein Herzensbedürfnis war, den Glanz dieser „Frisia“ oder „Markomannia“ oder „Masovia“ durch meine Mitgliedschaft zu erhöhen. Die Erscheinung sass gerade und mit höchster Korrektheit auf einem der abgeschabten roten Plüschsessel, sah mich mit kühlfreundlichen Augen prüfend und abschätzend an und dozierte mit gemessener Sprache über die unübersehbaren Vorteile einer schlagenden Verbindung, insbesondere aber über die dieser „Frisia“ oder „Masovia“. Das Ganze war gewürzt von mehr diskreten Hinweisen auf „Mannesmut“ und die nicht zu unterschätzenden „Konnexionen“, die man durch eine Mitgliedschaft erwerbe.
Dieses ganze kümmerliche Etwas, das da vor mir sass, aufgezäumt wie ein Paradepferd und von Phrasen und Konventionen durchtränkt wie ein Schwamm, war ja nun leider ein Sinnbild einer deutschen Epoche, die nichts davon ahnte, dass ihre Fundamente schon Risse und Sprünge hatten. Die von der traumhaften Sicherheit der Schlafwandler erfüllt war, von dem Dünkel der „Akademiker“ und schlimmeren Dünkeln, und die immer noch glaubte, was ihre Väter und Grossväter geglaubt hatten: dass Bierverbrauch und Mensuren mitten in das Leben führten und dass ein Staatsexamen dieselbe Bedeutung hätte wie ein Richterspruch vor Gottes Thron. Schon damals war mir die schreckliche Ferne dunkel bewusst, die mich von diesem Staat und diesen Menschen trennte, ohne dass mir ebenso bewusst gewesen wäre, wohin ich denn nun gehörte. Oh vielleicht zu den düsteren Bombenwerfern in der Palästra, oder zu den stillen Leuten aus dem Walde, oder zu den kommenden Rhapsoden einer neuen Weltordnung, oder überhaupt zu niemandem und nichts als meiner eigenen gärenden, uferund grenzenlosen Welt.
Ich setzte dem feierlichen Jüngling höflich auseinander, dass ich weder Zeit noch Geld zu den Pflichten und Vergnügungen einer farbentragenden Verbindung hätte, und scliesslich verabschiedete er sich mit gemessener Kühle, indem er den Arm in einen rechten Winkel brachte und seine bunte Mütze nach streng vorgeschriebenem Ritus vor den jungen Leib hielt.
Nur einmal liess ich mich von dem kommenden Lohengrin bereden, als Gast an einem Kneipabend seines Korps teilzunehmen. Nicht etwa, weil ich in diese Verbindung eintreten wollte, sondern weil ich schon damals keinen Weg versäumen wollte, auf dem mir ein unbekanntes Stück des Lebens erscheinen konnte. Und mochte es auch ein solches sein, das mir immer fremd bleiben würde.
Da war nun wohl Farbe und Glanz, die sich vor meinen Augen auftaten. Seltsame Bräuche und seltsame Reden, Prahlerei und versteckte Kümmerlichkeit, Ansprachen und Lieder, alte Herren, die nach reichlichem Biergenuss die Schnürbänder ihrer Schuhe öffnen mussten, weil ihre Füsse anschwollen, Banner und Bilder und Waschbecken, die besondere Einrichtungen hatten, um die Not des Rausches leichter überstehen zu können. Und am Ende nichts als eine allgemeine und vollständige Betrunkenheit, ein Abgrund von Lärm, Roheit und sentimentalen Tränen, ein Pfuhl primitivster Losgebundenheit, aus dem ich mich schweigend löste, um wie ein Beschmutzter oder Gezeichneter in mein stilles Zimmer heimzukehren.
Es war eine strenge und einmalige Lehre für mich, ebenso wie der Mensurmorgen, zu dem ich mich einmal führen liess. Ich wusste nun für alle Zeit, wohin ich nicht gehörte, ohne allerdings erfahren zu haben, wohin ich gehörte.
Auch ein paar Nachhilfeschüler hatte „Freundchen“ mir verschafft, und ich vertat Zeit und Mühe an die hoffnungslosen Söhne reicher Rentner oder Fabrikanten, denen die höhere Schule sich wegen ihres Geldes öffnete und die wie dunkle Schattenpilze in dem Walde der Wissenschaft vor sich hindämmerten, jede Klasse zwei Jahre auskostend, indem sie in ihrem privaten Leben sich schon Fertigkeiten aneigneten, die aller Schulzucht weit entwachsen waren und vor denen jeder Schulmonarch hätte erröten müssen. Wir kamen gut miteinander aus, da ich Dummheit von früh an als eine Krankheit betrachtet habe, einen Mangel der Schöpfung, und so mit Teilnahme und Mitleid statt mit Hochmut oder Verachtung auf die armen Opfer blickte. Doch schien mir die Zeit mit ihnen vertan, und nur das machte die Last erträglicher, dass ich für das erarbeitete Geld in jeder Woche ein Konzert hören konnte, eine Oper, ein Schauspiel, und dass ich ganz langsam mit der grossen Leidenschaft meines Lebens beginnen konnte: Bücher zu kaufen und sie ganz und gar mein eigen zu nennen.
Wie für alle Einsamen waren die Sonntage die Zeiten drückender Verlassenheit. Meine Plüschmöbel, meine Kolleghefte und die dumm vor sich hinstarrende gemalte Nymphe an der Wand waren mir zum Ueberdruss, und wenn die Berechnung meines Haushaltes es mir nur erlaubte, fuhr ich in den Wald oder an das nahe Meer. Dort ging ich dann weit am Strande hinaus, bis Musik und Menschen hinter mir blieben, und lag bis zum Abend im Sande, den Duft des Thymians über mir, die Augen geschlossen und ganz und gar dem stillen, grossen Rauschen hingegeben, mit dem das Meer sich an die Küste veratmete. Oder ich schlug einen der schmalen Bände auf, die ich mitgenommen hatte, Verse von Keats, oder eine der melancholischen Geschichten Herman Bangs, oder das „Tagebuch eines Jägers“ von Turgeniew, das ich Zeit meines Lebens geliebt habe. Dort war ich nun den Träumen hingegeben, die das Vorrecht und der wunderbare Besitz der Jugend sind. Der unbegrenzte und noch ungepflügte Acker, der einmal Frucht tragen wird, nach Jahren oder Jahrzehnten. Ueber den lautlos Sonne und Wind gehen und jene goldfarbenen Wolken, die das Beste des Lebens sind, weil aus ihnen einmal der warme Regen der Schöpfung fallen wird, der nur auf ein menschliches Herz fällt und nur wenn es still und geduldig und gehorsam auf seine Stunde wartet.
Schöne Abende der Einsamkeit und Verlorenheit, wenn in der Ferne die Dünen der Kurischen Nehrung in einem geisterhaften Licht erglänzten; wenn der warme Seesand durch die Finger rann wie durch eine Sanduhr; wenn das blaue und opalene licht des Sonnenuntergangs über die unendliche Wasserfläche sich breitete und das Ohr des langsam Heimkehrenden von einem der traurigen englischen Verse und dem verklingenden Rauschen des Meeres erfüllt war wie von einem Segen, den ein Gott aus der Wolke hatte hinabfallen lassen in ein durstiges und frommes Herz. So ganz in der Stille bereitet sich ein Menschenleben auf das Eigentliche, das „Ganze“ vor, ohne es zu wissen und meist sogar, ohne es zu ahnen, und nur daran merkt der Heimkehrende in den überfüllten und lauten Zügen, dass etwas Grosses geschehen ist, dass ihn dieses alles nur so anrührt wie eine Unterwasser-Landschaft, wo seltsame Pflanzen sich in der unsichtbaren Strömung wiegen und seltsame Fische wie Geister über schimmernden Abgründen dahinziehen. Er aber ist wie ein Gefeiter, dem kein Zauber etwas anhaben kann, weil eine magische Hand ihn gestreift und berufen hat.
Ich bestand meine Semesterprüfungen mit Auszeichnung, aber was hatte ich viel damit bestanden? Was nahm ich heim in die ersten grossen Ferien, was ich einem unbestechlichen Richter hätte vorweisen können? Fleiss und Pünktlichkeit war wenig, und Namen und Zahlen waren noch weniger. Dem Geduldigen mochten sie als das unentbehrliche Rüstzeug erscheinen, das erworben werden musste wie ein Ziegelstein zu der goldenen Stadt der Zukunft. Aber ich war nicht geduldig. Ich war mein Leben lang nicht geduldig, und erst die harten Prüfungen haben es mich langsam gelehrt. Die des Militärs etwa, oder die des Kerkers, oder der Bücher, die ich geschrieben habe, denn in ihnen liegt mehr Prüfung und Mühe und Entsagung, als die meisten Leser ahnen. „Lord, what a deal of ruined life it takes to make a little peace of art!“ steht bei James Branch Cabell zu lesen.
Ich brachte kein sehr gutes Gewissen heim vor die Augen meiner stillen Waldleute, und ich verbarg es wohl hinter mancher unschuldigen Grossredigkeit. Sie wussten wohl, dass das erste Tagwerk nicht gleich eine Goldmedaille einbringt, und sie fragten auch nicht viel. Mein Vater wollte wohl bescheiden ein paar Pflanzennamen wissen, und meine Mutter wollte wissen, wie es mit dem Essen und dem Zimmer sei, und wie ich es „mit der Religion“ halte. Aber in der Hauptfache waren sie glücklich, dass ich wieder da war, dass die Sünde der Grossstadt mich nicht verschlungen hatte und dass betrunkene Studenten mich nicht totgeschlagen hatten. Für ihren einfachen Sinn war das alles ja wie ein wiedererstandenes Babylon, die Stadt und ihre Sünden, wo es Mörder und Sozialdemokraten gab und eine alte Frau ein Stück Eisen auf den durch die Strassen fahrenden Kaiser warf. Und meine Mutter betete am ersten Abend wohl ein Dankgebet zu ihrem einfachen Gott, dass er mich vor dem Feuerofen bewahrt hatte, in den die Gewalthaber mich hätten werfen können, oder vor der Löwengrube, in der Daniel gesessen hatte.
Und sie sahen ohne Widerspruch zu, wie ich mich wieder den Wäldern ergab. So muss ich es wohl nennen, denn es lag doch eine Art von Rausch und Ekstase darin, wie ich aus dem Leben des Geistes mich in die alte Welt hineinwarf. Wie das Rauschen der Wipfel mir süsser war als alle Musik, die ich in der Stadt gehört hatte und wie ich lange im Moose liegen konnte, das Gesicht in die Wärme der winzigen Pflanzen gepresst, und wie tief im Unbewussten meiner Seele ich fühlte, dass ich so vielleicht dem „Ganzen“ näher war als über den Herbarien des Botanischen Instituts oder den Abstraktionen der Philosophie-Professoren.Was die Theologen verächtlich einen „billigen Pantheismus“ nennen, ist vielleicht nicht so billig, wie sie meinen, und es kann wohl sein, dass unter seinen verstandesmässigen Deduktionen ein uraltes Stück des Menschheitsanfanges liegt, ein Rest jenes schönen Heidentums, in dem das All auf eine tiefere und bescheidenere Weise aufgefasst war als in allen monotheistischen Religionen; und dass in derkindlichen Belebung der Natur eine tiefere Weisheit und auch eine tiefere Frömmigkeit lag als in den nüchternen Ergebnissen der Mikroskope.Vielleicht ist mir mein Leben lang Pan der liebste und wahrste aller Götter gewesen, und vielleicht ist ein künstlerisch so unvollkommenes Buch wie „der Wald“ fünfzehn Jahre später gar kein Roman gewesen, sondern ohne mein Wissen der gewaltsame Versuch, diese dahinschwindende Welt des alten Hirtengottes noch einmal zu beschwören und die Oede der Gegenwart mit dem Goldglanz versunkener Zeitalter zu erfüllen.
Die Roggenfelder wurden gerade gemäht, als ich heimkam, und die sanfte Schwermut des endenden Sommers verzauberte mir das unruhige Herz. Aber die Adler waren noch da, die Reiher, die Kraniche, und die Vogelbeeren reiften für den grossen Dohnenstieg. Wie schön war die stille, so zurückgebliebene Welt! Wie schön und vertraut unter Sonne oder Regen, unter Tag oder Nacht. Wie fern war aller Ehrgeiz, alles Grübeln, alle Spekulation. Und wer heute meine Hingabe an jene dumpfe östliche Welt mit dem gebrechlichen Hochmut der westlichen Zivilisation tadelt, ahnt nicht, dass sie eben eine ganze Welt war, unzersetzt und in ihren Wurzeln noch nicht gelockert, und dass, wer aus ihr hervorging, immer ein Fremdling bleiben musste in der, die diesen Grund verloren hatte.
Von Zeit zu Zeit erinnerte ich mich, dass ich ja ein Student war. Und erinnerte mich des mittelalterlichen Verses: „Ich soll zeigen meinen Fleiss, weil ich ein Studente heiss.“ Sass also auch hin und wieder bei meinen wenigen Lehrbüchern und brachte eines Tages heimlich einen Frosch vom Seeufer mit, den ich mit Widerwillen tötete und mit Widerwillen sezierte, indem ich mit meinem Taschenmesser sein Skelett bloss legte. Aber da sass ich nun ratlos vor dem blassen Wunderbau, dessen Werden und Funktionen ich nicht verstand, und kam mir wie ein heimlicher Mörder vor, der erschlagen hatte, um seine Taschen zu füllen, und es war nun nichts da, womit sie gefüllt werden konnten.
Vielleicht war es eine jener Stunden der Umkehr, die plötzlich an unserer Lebensuhr erscheinen, ohne dass das Pendel sie durch eine Besonderheit des Ganges angekündigt hat. Jene Stunde von Damaskus, die nicht nur den Eiferern schlägt, sondern auch den Blinden oder Verblendeten und mit denen das Schicksal uns befiehlt, anzuhalten, nachzusinnen und umzukehren, weil wir einen Weg gegangen sind, der für viele der rechte sein mag, der aber gegen unsere Natur geht, weil uns nach unserer Anlage zu verehren befohlen war und nicht zu forschen und zu zergliedern.
Ich räumte also still und bedrückt die Spuren meiner wissenschaftlichen Tat fort, im Innersten tief beunruhigt, und ich begann mit einem wachsenden Misstrauen auf die Lehrbücher zu blicken, die sich langsam mit Staub bedeckten. Ich fühlte, dass etwas nicht gut war, aber ich konnte es niemandem sagen, und ich wartete wohl auf einen deutlicheren Hinweis des Schicksals, damit der rechte Weg sich vor mir auftäte.
Und dann zogen langsam die Schwalben fort, die Kraniche, die Wildgänse. Das Jahr ging seinen stillen Gang, die Stoppeln wurden gepflügt, die Nebel standen zwischen den feuchten Kieferstämmen. Meine Mutter legte mit stillem Gesicht meine Wäsche in den alten Koffer, und mein Vater schob mir ein paar Goldstücke über die Tischplatte und sagte leise ein paar Worte über Haushalten und Sparsamsein.
Wieder nahm ich den Hut ab, als wir aus dem Walde herausfuhren, und wieder sah ich meinen Vater zurückfahren über die nebligen Felder, verlassen und gebeugt, und ich stand am Fenster meines Abteils, bis der letzte blaue Waldstreif versunken war.
Der Traum war zu Ende. Der graue Morgen begann.
2 Der Hofmeister
Es war, als knüpfte ich nur an, wo ich vor drei Monaten aufgehört hatte. Dieselbe Bude, dieselben Professoren, das gleiche Tagwerk. Und doch war etwas anders geworden. Ich wusste es nicht. Ich fühlte nur die leise Unruhe sich verstärken, die mich beim Anblick des kleinen Tierskeletts ergriffen hatte. Ich war nicht abergläubisch, und Tante Veronika war fern. Ich begann nun, meinen Schulkameraden als ein Sonderling zu erscheinen, weil ich wie ein Fremder durch dieses Leben ging. Wie einer, der einen Brief erwartet, eine Botschaft, die versiegelt war, und ich würde das Siegel aufbrechen. Es war, was mir mein Leben lang treu geblieben ist: eine dumpfe Ahnung kommender Entscheidungen. Das was mich vor jedem neuen Buch, das ich schreiben will, umtreibt wie in einer leisen Verstörtheit, schweigend und dem Leben abgewendet. Das Irrationale, das unter dem Tage und der Nacht da ist. Seine Gesichte, keine Halluzinationen. Nur ein Befangensein, und man weiss nicht, wovon. Und schwere Träume, in denen das tief Versunkene sich aufwärts tastet wie wehende Pflanzen unter einer grauen Eisdecke.
Ich hatte die Frau, die ich liebte oder zu Lieben glaubte, zu Anfang des ersten Semesters einmal auf der Strasse gesehen. Sie war vor mir hergegangen, elegant gekleidet, wie es ihre Art war, mit einem breiten schwarzen Hut, und es ist mir im Gedächtnis geblieben, dass am Saum ihres Kleides ein schmaler Streifen sich gelöst hatte und hinter ihr herwehte. Meine Mutter würde sich wahrscheinlich empört haben darüber, aber bei der Schuldigen passte es zu ihrer unbekümmerten Art, zu der Freiheit ihres Ganges wie ihres Denkens, und auch zu der rätselhaften Fremdheit, die mir ihr Wesen immer zu erfüllen schien. Mitunter stand sie für mein Gefühl den dunklen Bombenwerfern aus der Palästra näher als mir und meiner ordentlichen Welt. Sie war Jüdin und in Russland geboren.
Wir gingen eine Viertelstunde durch die grünen Anlagen des „Königsgartens“, und sie sprach mit mir wie mit einem jungen Kameraden. Sie war sehr klug, und eine grosse Kühle des Geistes wehte immer durch ihre Gespräche. So wie auch ihre Handschrift von erstaunlicher Klarheit war, durchsichtig aufgebaut wie das stählerne Gitter einer Brücke, durch die der Wind wehen kann. Ich ging wohl immer wie ein Junge neben ihr her, und ich hatte auch keine Neigung, ihr gegenüber erwachsen scheinen zu wollen.
Sie erzählte, dass sie fortging, nach Westpreussen, zu anderen fremden Kindern, die sie unterrichten sollte. Sie erzählte es ohne Traurigkeit, aber sie wollte mir ab und zu schreiben, und zu Weihnachten würde sie wiederkommen, zu ihrer Tante, die hier lebte, und vielleicht könnten wir einander sehen.
Alles kühl, ein bisschen lächelnd, ein bisschen spöttisch, und doch von einer sanften, verborgenen Zuneigung erfüllt. Und kein Zweifel daran, dass sie Grosses von mir erwartete.
Ich habe die Briefe nicht, die ich an sie schrieb. Wahrscheinlich waren es weltschmerzliche Dokumente, ein paar Verse, ein paar Pläne, ein paar schüchterne Hoffnungen. Und sie mag sie wohl lächelnd in der Hand gewogen haben. Mit einer ganz leisen Traurigkeit im Herzen, der Traurigkeit einer unmerklich alternden Frau, die die Leidenschaft eines Knaben wachsen und wieder welken sieht.
Sie kam ein paar Tage vor dem Weihnachtsfest. Es war bitterkalt, und wir sassen den Abend über im „Café Bauer“ am Paradeplatz, das allen Studenten, Malern und Dichtern jener Generation wohlbekannt war. Wir waren wie auf einer verlassenen Insel, um die das Meer eintönig rauscht, jeder mit Wärme an des andern Schicksal hingegeben, und ich las wohl leise ein paar der schlechten Verse, die ich inzwischen geschrieben hatte. Ihre Augen ruhten prüfend auf mir, als müsste ich noch einmal gewogen werden, und dann bat sie mich, eine Stunde bei mir sitzen zu dürfen, wo ich sonst lebte.
Ich kochte Tee, zeigte ihr meine Kolleghefte, sprach von der Unruhe, die mich befallen hatte, und sie hörte zu, wie eine freundliche Aerztin einem Kranken zuhören mochte. Die Stunden schlugen, wir rauchten unzählige Zigaretten, und ich war wohl ein seltsamer Liebender. Es war kein Begehren in dieser Stunde, nur ein schönes, grenzenloses Sichhingeben an einen andern Menschen. Ein Aufbruch aus der grossen Einsamkeit, dem grossen Schweigen, etwas wie eine Hochzeit des Geistes, wenn man es mit einiger Scheu so nennen darf.
Mitunter hustete die Schustersfrau mahnend hinter der Wand, als wollte sie mich von der Sünde zurückhalten, und das Ganze war vielleicht von einer rührenden Komik, weil es mir von einem so rührenden Ernst war.
Was sie dachte, wusste ich nicht und weiss es auch heute nicht. Es könnte billige Hypothesen geben, aber sie würden ihr nicht gerecht werden. Denn plötzlich lehnte sie sich in ihren Sessel zurück, sah den blauen Rauchringen nach und sagte, dass es nun zu Ende sein müsse, das Ganze. Sie habe die Erfahrung gemacht, dass alles Schöne seine Zeit habe, eine kurze Zeit, und dass nachher Ernüchterung und Enttäuschung folge, das Hässliche eben, und dazu sei ich ihr zu wert.
Ich muss sie eine Weile angestarrt haben, ehe ich es begriff. Ebenso hätte die Decke einstürzen können oder ein Erdbeben die ganze Stadt in einen Trümmerhaufen verwandeln. Das Schicksal war da, das lange angekündigte, und sah mich, mit eisigen Augen an.
Ich fragte, ob ich etwas falsch gemacht hätte, ob ich unehrerbietig gewesen sei, und diese Frage hat noch in der Erinnerung etwas Rührendes für mich.
Es bewegte auch sie, und sie stand auf und zog eine Weile meinen Kopf an ihre Brust. „Nein“, sagte sie, „nichts dergleichen . . . Du wirst mir immer teuer bleiben . . .“
Dann strich sie mir einmal über das Haar und streckte die Hand nach ihrem Mantel aus.
Ich begleitete sie schweigend zu ihrem Hause und nahm schweigend Abschied.
Erst nach meiner Rückkehr stürzte die Erkenntnis sich wie ein Eisgebirge über mich. Ich sass lange an meinem Schreibtisch und starrte ins Leere. Ich verstand nichts. Ich war ein reiner Tor. Mir war nur, als hätte jemand mir den sicheren Boden unter den Füssen fortgezogen und ich stürzte tief, unmessbar tief in einen kalten und finsteren Abgrund.
Ein paar Stunden später kam sie wieder. „Es tut mir leid“, sagte sie. „Ich sehe, dass ich unrecht getan habe.“
Wir fuhren hinaus in einen der Vororte und gingen durch den verschneiten Wald. Wir sprachen nicht mehr davon. Sie war gütig und herzlich. Es gab keinen Kuss, keine Umarmung.
Ich habe sie dann noch vier oder fünf Male wiedergesehen, aber durch viele Jahre gingen unsere Briefe hin und her. Sieben Jahre später war sie Gast in meinem Hause zur Zeit meiner ersten Ehe. Ich las ihr ein Kapitel aus der „Flucht“ vor, die ich damals schrieb, und sie weinte beim Zuhören.
Zweimal sah ich sie ein paar Stunden in Berlin, von einer immer noch kühlen Schönheit und von einer völligen Schweigsamkeit über ihr eigenes Leben. Auch das letzte Mal sah ich sie in dieser Stadt, als ich im Juni 1918 nach meiner Verwundung in die Heimat fuhr. Ich hatte einen ganzen Tag Zeit, ehe mein Zug abging, und ich suchte sie auf. Sie lag zu Bett, krank und elend, und ich sass eine Stunde bei ihr. Die ganze Zeit über blickten ihre Augen mich prüfend an, das Veränderte an mir, das Gesicht des Krieges, die Uniform, das Wundpflaster über der linken Schläfe. Sie war herzlicher als früher, und wir sprachen mit Sorgen von der Gegenwart und Zukunft.
Aber was in Wirklichkeit hinter ihrer klaren Stirn vor sich ging, wusste ich auch diesmal nicht.
Jahre später schrieb sie mir wieder aus Berlin. Wahrscheinlich war sie schon „registriert“ worden, und sie war Dienstmädchen in einer jüdischen Familie, wo sie wie eine Sklavin behandelt wurde. Sie schrieb mit völliger Furchtlosigkeit über das „System“, böse, schneidende Formulierungen, zum Teil in französischer und englischer Sprache. Und sie fragte, ob ich ihr einen Auftrag für Uebersetzungen aus dem Englischen verschaffen könnte.
Ich wandte mich an den Goverts Verlag und bekam eine freundliche, aber hinhaltende Antwort.
Gleich darauf wurde ich verhaftet, und der Briefwechsel erlosch für alle Zeit. Ich weiss nichts mehr von ihr, und wahrscheinlich werden die Kammern von Auschwitz sich für sie geöffnet haben.
Es ist mir unsäglich bitter, dieses Ende zu bedenken und mich an den Frühlingsabend zu erinnern, als wir im Regen unter der Schirmkiefer standen und die Welt vor mir lag wie vor Gösta Berling. Der schreckliche Wagen des Dschagannath, der zermalmend über die Stöhnenden rollt. Die blutige Spur, die blind durch das Gras des Lebens geht . . .
Ich habe oft versucht, mir ein Bild ihres Wesens zu machen, aber es ist mir nie gelungen. Geheimnis lag über ihr, und sie war zu stolz oder zu kalt, um es vor mir zu lüften. Ich weiss nicht, was in ihr vorging, wenn ihre Unterrichtsstunden beendet waren. Wie sie auf das Leben, die Pflanzen, die Menschen blickte. Ob sie der Leidenschaft und der jähen Schmerzen fähig war. Ob sie an Gott glaubte oder an Jehova oder an gar nichts. Ich weiss nur, dass sie in der trüben Dämmerung jener Jahre, in denen wir so leicht für immer in die Irre gehen können, ein ferner, flimmernder Stern für mich war, zu dem ich aufblicken konnte und der mir eine Richtung gab.
Und das ist viel für ein junges Leben.
Bald nachdem ich aus den Weihnachtsferien zurückgekehrt war, noch immer leise verstört von dem unbegriffenen Erlebnis, bekam ich einen Brief von „Freundchen“, in dem er mich in der Form eines strengen Befehls anwies, an einem bestimmten Tage und zu einer bestimmten Stunde im Hotel „Berliner Hof“ den baltischen Baron Grotthuss zu erwarten, in dessen Gutshaus ich für etwa zwei Semester Erzieher werden sollte. Ich hätte einige Veränderungen nötig, setzte er trocken hinzu, ich sei auch jung genug, um zwei oder drei Semester hinzugeben, und meine Eltern würden zufrieden sein, wenn ich für diese Zeit keinen Pfennig von ihnen brauchte.
Da war es nun also wieder, was sich leise angekündigt hatte: der Nebenweg, an dem der graue Meilenstein stand, und seine Schrift war nicht zu lesen. Man muss bedenken, was es für mich bedeutete. Es war nicht eine Reise an die Küste des Frischen Kaffes, vierzehn Kilometer lang. Es war die Reise in eine neue Welt, und ich wusste nicht einmal, ob sie dort Russisch sprachen oder Französisch, und ob sie noch Leibeigene hatten, die sie totprügeln konnten.