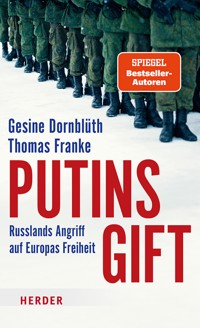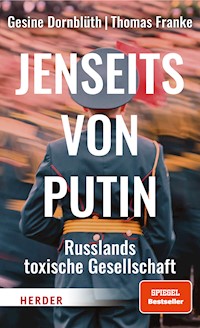
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Als Russland am 24. Februar 2022 die Ukraine angriff, schien das großen Teilen der russischen Gesellschaft egal zu sein. Das ist nicht überraschend. Seit Jahren wird das russische Expansionsstreben davon begleitet, dass gesellschaftlich das Recht des Stärkeren gilt. Gewalt wird von vielen als Mittel der Politik akzeptiert. Gesine Dornblüth und Thomas Franke erklären, wie es dazu kommen konnte. Ihre Reportagen und Analysen führen uns durch drei Jahrzehnte, in denen nationalistische Kräfte über Verfechter demokratischer Werte die Oberhand gewannen. Dabei wird deutlich: Der zukünftige Frieden in Europa hängt davon ab, ob wir Russlands Gesellschaft richtig verstehen und entsprechend handeln.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 269
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gesine Dornblüth/Thomas Franke
Jenseits von Putin
Gesine Dornblüth/Thomas Franke
Jenseits von Putin
Russlands toxische Gesellschaft
Unser Dank gilt Julia Smirnova.
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2023
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Satz: Röser MEDIA, Karlsruhe
E-Book-Konvertierung: Röser MEDIA, Karlsruhe
ISBN Print: 978-3-451-39978-7
ISBN E-Book (EPUB): 978-3-451-82989-5
ISBN E-Book (PDF): 978-3-451-82991-8
Inhalt
Vorwort
1. Wir müssen reden
2. Russland den Russen
3. Sie brauchen einen Führer – Putins jugendliche Machtressource
4. Sie wollen keinen Führer
5. Rechnen mit dem Schlimmsten
6. Meinst du, die Russen wollen Krieg?
7. „Enkel von Opfern und Henkern“
8. Schuld ohne Sühne
9. Der kleine Bruder mit dem Down-Syndrom
10. „Orthodoxe Taliban“
11. Dem Vaterland dienen – Schulalltag 2022
12. Was tun?
Über die Autoren
Vorwort
Als am 24. Februar 2022 Russland in die Ukraine einmarschierte, war die Weltöffentlichkeit schockiert. Russlands Truppen richteten in dem Nachbarland vom ersten Tag an unermessliche Gräueltaten an, beschossen Zivilisten, plünderten, folterten und vergewaltigten, vernichteten alles, was ukrainisch ist. Viele sprachen vom Kriegsbeginn und von „Putins Krieg“. Doch dieser Krieg hat nicht erst im Februar 2022 begonnen, sondern bereits im Februar 2014. Die russische Armee ist zudem seit Langem für ihre zerstörerische Kriegsführung bekannt – und die russische Gesellschaft für ihr Schweigen angesichts der Verbrechen, die in ihrem Namen begangen werden. Es ist deshalb falsch, von Putins Krieg zu sprechen.
„Die Straße nach Auschwitz wurde aus Hass gebaut, aber mit Teilnahmslosigkeit gepflastert“, schrieb der Historiker Ian Kershaw. Der Holocaust war einmalig, doch das Ansinnen, andere Menschen zu vernichten, ist mit dem Dritten Reich nicht verschwunden. Die Teilnahmslosigkeit vieler Russen hat Wladimir Putin seit Beginn des neuen Jahrtausends stark gemacht. Sie verbanden mit ihm die Aussicht auf Stabilität. Nun scheint es, als seien Selbsthass und Enttäuschung vieler Menschen in Missgunst und Hass gegenüber vermeintlich Außenstehenden umgeschlagen, geschürt von einer nahezu übermächtigen Propaganda.
Während wir dieses Buch schreiben, ist nicht sicher, wann und wie dieser Krieg endet. Doch irgendwann wird Wladimir Putin die Macht abgeben. Die russische Gesellschaft wird bleiben. Es ist wichtig zu wissen, was uns dann – jenseits von Putin – erwartet. Wer sind diese Menschen, was hat sie so werden lassen und was treibt sie um?
Wir nähern uns diesen Fragen aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Wir zeigen, wie Rassismus und Chauvinismus in der russischen Gesellschaft zu offizieller Politik werden. Wir schildern, wie Menschen für Demokratie kämpfen und immer weiter marginalisiert und kriminalisiert werden. Wir erklären, wie sich das Recht des Stärkeren und die Aussicht auf Straffreiheit in der Gesellschaft verfestigen. Immer wieder begegnen wir dabei den Folgen von siebzig Jahren unbewältigter Sowjetherrschaft. Heute sind Bestrebungen, ein freiheitliches System aufzubauen, gescheitert. Stattdessen hat sich ein modernisiertes Sowjetsystem mit dem KGB-Mann Putin an der Spitze etabliert.
Als wir Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre begannen, in die Sowjetunion und nach Russland zu reisen, waren wir neugierig auf das bis dahin weitgehend unbekannte Land und die Menschen hinter dem Eisernen Vorhang. Sie begegneten uns ihrerseits mit großer Offenheit, obwohl sie über Jahrzehnte antiwestlicher Propaganda, Geschichtsfälschung und Angst ausgesetzt waren. Einige der Menschen, die wir in diesem Buch zitieren, haben wir im Laufe der letzten dreißig Jahre immer wieder getroffen. Sie haben frei mit uns geredet in einer Zeit, in der das noch nicht gefährlich war. Um sie zu schützen und nicht auf ihre Ansichten verzichten zu müssen, haben wir einige Identitäten verändert.
1. Wir müssen reden
Sommer 2022. Europa diskutiert, ob man weiterhin russische Touristen einreisen lassen sollte. Auf dem Handy poppt eine Nachricht auf. Sie ist von Pawel aus Sankt Petersburg. „Können wir uns mal unterhalten?“, fragt er, „ich möchte gern die Sichtweise der Europäer verstehen.“
Pawel hat ein kleines Unternehmen. Als wir uns vor dreißig Jahren kennenlernten, wollte er Theaterregisseur werden. In den 90er Jahren, als es darum ging, irgendwie durchzukommen, gab er das auf. Es geht ihm wirtschaftlich gut. Drei Kinder, ein Haus am Stadtrand, zwei Autos. Er ist ein typischer Vertreter des russischen Mittelstands, der sich in den 2000er Jahren bildete.
„Deutschland hat nach dem Zweiten Weltkrieg lange Entschädigungen gezahlt, jeder deutsche Steuerzahler hat wirtschaftliche Verantwortung übernommen, selbst deutsche Antifaschisten und Widerstandskämpfer. Ich halte es für logisch, Russland Geld für den Wiederaufbau der Ukraine zu entziehen. Nicht nur die Devisenreserven, die außerhalb Russlands gelandet sind. Zurzeit verkauft Russland Öl an China und Indien mit einem Preisnachlass von bis zu dreißig Prozent, diese Staaten profitieren vom Krieg. Es wäre nicht schlecht, wenn die internationale Gemeinschaft diese Länder zwingen würde, die Hälfte dieses Rabatts der Ukraine zu geben. Auf diese Weise würde Russland durch den Verkauf von Öl (auf den es nicht verzichten kann) nicht nur Putins Krieg, sondern gleichzeitig auch den ukrainischen Widerstand finanzieren. Das ist meine verrückte Idee.Zu den Schengen-Visa: Ich verstehe, wie brechreizerregend es ist, Russen zu sehen, die während eines Krieges Urlaub machen. Aber logischer, als die Visa abzuschaffen, wäre es doch, von jedem russischen Touristen, der in die EU einreist, eine Zwangsgebühr für das Ukrainische Rote Kreuz oder Ähnliches zu erheben. Ich denke, das würde das Problem entschärfen.“
Pawel war nie ein großer Fan von Putin. Zu Protestdemonstrationen ist er aber auch nie gegangen. Zu Beginn des groß angelegten Angriffs auf die Ukraine haben in Russland Tausende Menschen gegen den Krieg protestiert. Viele von ihnen wurden festgenommen, zu protestieren ist immer gefährlicher geworden. Zugleich rufen Scharfmacher in den Staatsmedien zum Töten von Ukrainern auf. In den sozialen Medien verbreiten sich massenhaft Bilder von Russen, die ein Z zeigen, das Symbol des Krieges. Wie stark ist die Zustimmung zum Krieg wirklich? Pawel schreibt:
„Ich denke, auf dem Land stehen neunzig Prozent der Menschen hinter Putin, in kleinen und mittleren Städten fünfundsiebzig bis achtzig Prozent, in den großen Städten sechzig bis siebzig Prozent. Die Herde folgt einfach instinktiv dem Anführer, das logische Denken ist ausgeschaltet. In einem sozialen Netzwerk habe ich eine Gruppe mit meinen Klassenkameraden. Wir sind dort achtzehn Leute. Vier von uns, mich eingeschlossen, sind gegen den Krieg. Die anderen sind vielleicht nicht für den Krieg, aber sie unterstützen Putin. So in der Art: Er weiß es am besten ... Die USA sind schuld ... Für die Kinder, die in den letzten acht Jahren in Donezk getötet wurden ... Nazis haben die Macht in der Ukraine ergriffen und so weiter. Es fällt mir schwer, mit ihnen zu kommunizieren. Ich weiß jetzt viel besser, was ein Bürgerkrieg ist. Mein bester Freund und meine Mutter gehören zu den Putinisten. Ich bin einfach sprachlos. Ich habe jeden Donnerstag eine Sauna-Runde. Alles Männer. Da gibt es einen pensionierten Militär, einen Geheimdienstler, einen ehemaligen Wachmann, mehrere Polizisten und viele Geschäftsleute. Der ehemalige Wachmann und ich sind gegen den Krieg. Der Mann vom Militär und der Geheimdienstler schweigen, die kleineren Geschäftsleute sind für den Krieg. Ich weiß, das ist nicht repräsentativ, aber zwanzig Prozent in der Runde sind gegen den Krieg, achtzig Prozent schweigen oder stimmen zu. So sieht es aus.“
Ein paar Tage später ist Pawel mit dem Auto unterwegs in die Slowakei. Die Überweisungen funktionieren nicht mehr, und er muss Mitarbeitern in Bratislava Geld bringen. Der Weg ist lang geworden, denn er kann nicht mehr durch die Ukraine fahren. Als er wieder in Sankt Petersburg ist, schreibt er: „Wenn ich unterwegs getankt oder geparkt habe, haben die Leute mich und mein Auto angeguckt. Das Auto hat russische Nummernschilder mit einer russischen Flagge darauf. Ich kann nicht jedem erklären, dass ich gegen den Krieg bin, dass ich versuche, meinen Freunden in Russland zu erklären, warum ich dagegen bin, und sie zur Vernunft und zu Mitgefühl zu bringen. Es wäre ideal, wenn die Leute wüssten: Wenn ich in Europa bin, bin ich in Ordnung.“
Ende August spricht Pawel zum ersten Mal von einem Regimewechsel: „Um ein Problem zu lösen, ist das Wichtigste, Prioritäten zu setzen. Meiner Meinung nach besteht das strategische Ziel Nummer eins darin, dass Putin nicht mehr an der Spitze steht. Ich glaube, man braucht etwas Geduld. Denn die Sanktionen wirken. Man sollte warten, bis unter der Last der Sanktionen und des sinkenden Lebensstandards ein Regimewechsel in Russland möglich ist. Gleichzeitig muss man einen psychologischen und ideologischen Krieg gegen Putin und um die Köpfe und Herzen der Russen führen.“
Und die Zigtausenden Toten in der Zwischenzeit?
„Es ist ein Kolonialkrieg. Er ist weit weg von den Metropolen. Die Metropolen erreicht man nur über deren wirtschaftliche Interessen. Russland kann die Ukraine nicht besiegen, und die Ukraine kann Russland nicht mal mit Unterstützung der NATO besiegen, denn um eine Niederlage zu vermeiden, wird Putin die Generalmobilmachung und den totalen Krieg ausrufen. Deshalb, weil weder ein Sieg noch ein Frieden möglich ist, und um das sinnlose Töten von Menschen zu beenden, sollte der Konflikt eingefroren werden. Als Nächstes müssten UN-Truppen entlang der Demarkationslinie postiert werden. Dann wird Putin nicht angreifen.“
Je länger es dauert, desto schwieriger wird es, diese Diskussionen in einem Chat zu führen. Und offensichtlich stocken auch die Gespräche in Russland. Die Gesellschaft schweigt. Mitte September schreibt Pawel: „Seit etwa drei Wochen redet in der Sauna keiner mehr über den Krieg.“
Als Putin am 21. September 2022 die Mobilmachung ausruft, kommt der Krieg in den Familien an. Pawel schickt seine beiden Söhne umgehend ins Ausland. Er selbst bleibt.
2. Russland den Russen
Im August 2022 wendet sich die Ukraine wegen eines unerträglichen Videos an die Vereinten Nationen. Es zeigt einen Mann auf einer Bühne. In der rechten Hand hält er einen Schädel. Triumphierend präsentiert er ihn dem Publikum. Der Schädel gehöre einem Ukrainer, der das Asow-Stahlwerk in Mariupol verteidigt habe. „Soll er in der Hölle brennen“, ruft er. „War das auch ganz bestimmt kein Zivilist?“, fragt eine Stimme im Saal. „Ganz sicher nicht, wir haben ihn ja selbst erledigt.“ Der Mann auf der Bühne grinst. „Kleinrussland muss entukrainisiert werden“, fordert er. Mit Kleinrussland meint er die Ukraine. „Wir müssen unsere Gebiete heimholen. Russland kämpft nicht gegen Menschen, Russland kämpft gegen die Idee der Ukraine als antirussischem Staat. Alle Anhänger dieser Idee müssen vernichtet werden.“
Der Redner mit dem Schädel in der Hand heißt Igor Manguschew und ist Russe. Wir haben ihn zehn Jahre zuvor in Moskau getroffen, als er Jagd auf Gastarbeiter aus Zentralasien machte, sie in den Kellern von Wohnhäusern aufspürte, bedrohte und der Polizei auslieferte.
Die erste Bekanntschaft mit russischen Nazis machen wir 1992 an einem nasskalten Abend kurz vor Silvester in Sankt Petersburg. Ein russischer Kollege hat uns gebeten, ihn zu einem Interview mit Rechtsextremen zu begleiten. „Die kennen mich. Die verarschen mich nur. Ihr aber seid Deutsche. Das finden die super.“ Ende 1992 reisen wir in ein Russland, das die Mangelwirtschaft der späten Sowjetunion noch nicht überwunden hat und in dem die Menschen um ihr Überleben kämpfen. Die Aeroflot-Maschine, die uns hinbringt, muss dringend überholt werden. Die Sitze sind durchgesessen, die Polster zerschlissen. Bei der Landung fällt die Deckenverkleidung in den Gang, und die freien Sitze klappen nach vorn. Kaum berührt das Fahrgestell den Boden, springen die Mitreisenden auf, greifen nach Taschen und Plastiktüten, stürmen nach vorn. Sankt Petersburg heißt seit einem guten Jahr nicht mehr Leningrad, doch überall steht noch der sowjetische Name, auch über dem Eingang zum Flughafengebäude. Drinnen ist der Boden schmierig vom Schneematsch, es riecht leicht nach Müll, Schweiß und Verfall. Im Zwielicht einer Ecke schieben und schubsen sich Menschen. Wir vermuten, dass dort das Gepäckband ist, und kämpfen unsere Rucksäcke frei. In einem ist die Kleidung, im anderen Essen für zehn Tage: Nudeln, eine große Salami, Reis. Kondome für Freunde, Damenbinden, Unterhosen, alles, was in der Sowjetunion knapp war und was es im frisch unabhängigen Russland nicht gibt.
Vor dem Flughafen wartet ein Bekannter mit einem alten Lada. Die Sitze sind noch durchgesessener als im Flugzeug, auch der Rest des Autos ist in keinem guten Zustand. Auf der Fahrt hängt er über dem Lenkrad, umkurvt die tiefen Löcher in der Schnellstraße. An den Straßenrändern sehen wir Plakate, die dafür werben, im ehemaligen Jugoslawien als Söldner für die Serben zu kämpfen.
Den Kollegen treffen wir am nächsten Tag. Er arbeitet für die Tschas Pik. Die Wochenzeitung nutzt die Freiheiten der neuen Zeit, benennt Missstände, stößt Debatten an. Unser Bekannter ist auf Umweltverschmutzung spezialisiert, wo immer er hinkommt, stellt er einen Geigerzähler auf den Tisch, holt einen Stadtplan von Sankt Petersburg aus der Tasche und trägt den Messwert ein. Im Stadtgebiet liegen atomgetriebene U-Boote. Ihr Zustand ist erbärmlich. Berichten zufolge sollen Soldaten ohne Schutzkleidung mit den Reaktoren arbeiten. Die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl 1986 ist noch allgegenwärtig. In Sankt Petersburg stehen Hochhäuser, deren Betonplatten mit Kies aus Müllkippen gegossen wurden, in denen schwach strahlendes Material lag. Es gibt keine freien Wohnungen, in denen die Menschen stattdessen unterkommen könnten.
Am Abend fahren wir zu dritt durch die damals schwach beleuchtete Stadt auf die Wassili-Insel zum Treffpunkt mit den Rechtsextremen in einer alten Fabrik. Als wir ankommen, biegt ein Armeejeep in rasendem Tempo um die Ecke. Vier Männer steigen aus. Unsere Gesprächspartner. „Hier lang“, sagt einer. Wir folgen ihnen über staubige Dielenböden und eine abgewetzte Treppe hinauf in den ersten Stock, durchqueren eine schmutzige Cafeteria und kommen in einen Saal. Auf der Bühne spielt eine Blaskapelle die Hymne der Sowjetunion. „Ruhm der großen Oktoberrevolution“ steht auf einem Transparent.
Die vier schicken die Musiker weg und bringen uns in ein kleines Zimmer hinter dem Saal. Darin ein Tisch, ein paar Stühle, sonst nichts. Vorstellungsrunde: Wladimir Zikarew, Vorsitzender der faschistischen Russkaja Partia, der Russischen Partei. Von Beruf ist er Dichter. Zikarew ist grau gekleidet, trägt einen grau melierten Vollbart und ist etwas untersetzt. Ganz anders sein Stellvertreter Nikolai Bondarik. Atomphysiker, noch unter dreißig, stahlblaue Augen, stahlblauer Scheitel. Alles an ihm wirkt stahlblau. Der Dritte stellt sich als Juri Beljajew vor, Vorsitzender der Völkisch-Sozialen Partei, Abgeordneter im Stadtrat und Offizier der Miliz, wie die Polizei damals noch heißt. Alter Mitte dreißig. Und der Vierte? Der setzt sich aufs Fensterbrett und schweigt. „Wer ist das?“ – „Der ist vom KGB. Beachten Sie ihn am besten gar nicht.“ Der KGB heißt zwar auch schon seit einem Jahr FSB, das Personal ist aber weitgehend das gleiche geblieben. Der Zustand des Geheimdienstes ist so desolat wie alles in Russland zum Jahreswechsel 1992/1993. Und auch Bondarik muss aus einer KGB- oder Armeefamilie stammen, sonst hätte er in der Sowjetunion nur schwer Atomphysik studieren können.
Beljajew erzählt, dass er Freiwillige für den Krieg in Jugoslawien ausbildet. In einer Turnhalle der russischen Miliz in Sankt Petersburg. Auf dem Balkan haben sich die ersten Staaten für unabhängig erklärt, die Regierung in Belgrad versucht, den Zerfall Jugoslawiens mit militärischen Mitteln aufzuhalten. Ende 1992 belagern die Serben Sarajewo. Zu der Zeit kann man sogar Ausflüge buchen, um von den Bergen aus auf Menschen und Häuser in Sarajewo zu schießen. Dazu gibt es Schaschlik und Prostituierte. „Die Serben sind unsere slawischen Brüder“, sagt Beljajew, „sie sind orthodox wie wir. Wir müssen ihnen im Kampf gegen die feindliche Rasse helfen.“ Er zeigt ein Kruzifix. „Das hat mir ein serbisch-orthodoxer Pope für meine Dienste am serbischen Volk verliehen. Ich habe dort auch ein bisschen, sagen wir mal, Sport getrieben.“ Die Männer lachen. Jahrzehnte später werden sich serbische Nationalisten revanchieren und im Krieg gegen die Ukraine auf russischer Seite kämpfen.
Auch Nikolai Bondarik bildet Anfang der 90er Jahre Kämpfer aus, jedoch keine Söldner, sondern eine Wehrsportgruppe der Russischen Partei. „Unser Ziel ist ein ethnisch gereinigtes Großrussland in den Grenzen der Sowjetunion. Dazu müssen wir an die Macht. Entweder über Wahlen oder mit Gewalt.“ Beljajew nickt. „Wenn es so weit ist und wir um die Macht in Russland kämpfen, dann wird uns die Erfahrung unserer Serbienkämpfer nützen“, sagt er. „Binnen vier Stunden können wir bewaffnet sein.“ Eigene Waffenlager hätten sie nicht, beteuern beide, sie würden die Waffen von der Miliz und der Armee bekommen.
„Die Südrepubliken gehören uns. Kasachstan zum Beispiel hat nie als Staat existiert. Wir räumen dort auf. Mit denen werden wir in einer Woche fertig“, verkündet Bondarik mit stahlblauem Blick. 2014, nach der Eroberung der Krim, sagt auch Wladimir Putin: „Die Kasachen hatten nie eine Staatlichkeit.“ Kasachstan ist seit dem Ende der Sowjetunion ein unabhängiger Staat. Nahe der Grenze zu Russland lebt eine große russische Minderheit. Spätestens seit dem Raub der Krim durch Russland nehmen die Kasachen solche Bemerkungen aus Moskau sehr ernst.
„In Amerika gibt es Reservate, in denen Indianer in Würde existieren können“, erläutert Bondarik, „wieso sollen wir so etwas nicht auch für Usbeken und Jakuten einrichten?“ Usbekistan ist zu diesem Zeitpunkt gleichfalls ein unabhängiger Staat. Die Jakuten hingegen zählen zu den Minderheiten auf dem Gebiet der Russischen Föderation. Sie haben schon lange vor den Russen im heutigen Jakutien im Nordosten des Landes gelebt. Für Bondarik macht das alles keinen Unterschied. Die größten Feinde seien allerdings die Juden: „Juden sind ein Fremdkörper in Russland, sie müssen weg.“ Zwischendurch erhebt Wladimir Zikarew, der Dichter, die Stimme, wird aber jedes Mal von den anderen beiden abgewürgt. Er ist offensichtlich betrunken, faselt vom „großen Bruder Russland“. Schließlich wirft er sich in die Brust und stimmt eine von ihm geschriebene Hymne der Russischen Partei an: „Heimat, man hat dich belogen und bestohlen, Zionisten unterdrücken dich, aber heute sind die Russen aufgestanden.“ Beim Refrain steigen seine Mitstreiter mit ein: „Ich bin glücklich, als Russe geboren zu sein!“ Nur der KGB-Mann auf dem Fensterbrett schweigt und lächelt.
Bondarik, Beljajew und Zikarew sind Ende 1992 weit davon entfernt, an die Macht zu kommen. Ihre nationalistischen Ideen fallen jedoch auf fruchtbaren Boden: 23 Prozent der Bewohner Sankt Petersburgs befürworten zu diesem Zeitpunkt den Slogan „Russland den Russen“. Das hat die Lokalzeitung Smena (Wechsel) herausgefunden. Unter Jugendlichen sind es sogar 39 Prozent.
Rassismus und Nationalismus in einem Land, das so sehr unter den Nationalsozialisten gelitten hat? Nationalismus gab es schon in der Sowjetunion. Die Kommunistische Partei beschwor zwar Internationalismus und Völkerfreundschaft, und der Aufruf „Proletarier aller Länder, vereinigt euch!“ aus dem Kommunistischen Manifest von Karl Marx zierte sogar das Staatswappen der Sowjetunion. Bis 1944 war „Die Internationale“, das Kampflied der Arbeiterklasse, die Hymne des „Arbeiter- und Bauernparadieses“. Danach hob die neue sowjetische Hymne die besondere Rolle Russlands hervor. Millionen Sowjetbürger sangen: „Die große Rus (das große Russland) hat die unzerstörbare Union freier Republiken für immer geeint.“ Die Rus war ein mittelalterliches Reich in Osteuropa, Russland sieht sich als dessen Nachfolger. Josef Stalin, selbst Georgier, betrachtete die Sowjetunion als eine Art erweiterten russischen Nationalstaat. Nirgends ist das deutlicher geworden als in seinem „Trinkspruch auf das Wohl des russischen Volkes“ nach dem Sieg über Hitlerdeutschland. Beim Empfang zu Ehren der Truppenbefehlshaber der Roten Armee am 24. Mai 1945 im Kreml hob Stalin sein Glas mit den Worten: „Ich trinke vor allem auf das Wohl des russischen Volkes, weil es die hervorragendste Nation unter allen zur Sowjetunion gehörenden Nationen ist. Ich bringe einen Trinkspruch auf das Wohl des russischen Volkes aus, weil es sich in diesem Krieg allgemeine Anerkennung als die führende Kraft der Sowjetunion unter allen Völkern unseres Landes verdient hat.“ Die Völker der Sowjetunion waren nicht gleichberechtigt. Russland dominierte.
Fast auf den Tag sieben Jahre nach unserer Begegnung mit den Nationalisten in der Sankt Petersburger Fabrikhalle kommt Wladimir Putin an die Macht. In der Silvesteransprache 1999 erklärt sein Vorgänger Boris Jelzin seinen Rücktritt, Putin übernimmt das Präsidentenamt zunächst kommissarisch und wird wenige Monate später zum Staatsoberhaupt gewählt. Putin kommt aus dem Geheimdienst, hält Stalin für einen starken Führer und das Auseinanderbrechen der Sowjetunion für die „größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts“. Er meint damit nicht nur die Niederlage der UdSSR im Wettstreit mit den USA, er hat auch die Millionen Russen in den ehemaligen Sowjetrepubliken im Blick, die auf einmal im Ausland leben.
2001 nimmt die Sängerin Schanna Bitschewskaja den Song „Wir sind Russen“ auf. Sie singt von den „drei slawischen Stämmen“ Russland, Ukraine und Weißrussland, von der letzten Schlacht, von Gott und dem Zaren und vom „heiligen Russland“. Im Refrain heißt es:
„Die Wege, die uns zu Christus führen, sind schmal, Wir kennen Tod, Verfolgung und Gefangenschaft. Wir sind Russen, wir sind Russen, wir sind Russen, Wir werden uns trotz allem von den Knien erheben.“
Das Lied läuft über Jahre in den russischen Radiostationen. Glaubt man Bitschewskaja, gehört sie zu Putins Lieblingsmusikerinnen. In einem Interview hat sie einmal erzählt, Putin habe sie, als er noch beim KGB war, regelmäßig zu Auftritten am „Tag des Tschekisten“ eingeladen.
In den folgenden Jahren boomen solche nationalpatriotischen Lieder. 2022 landet der Sänger Shaman (Jaroslaw Dronow) mit dem Titel „Ich bin Russe“ einen Hit. Das Video wird bei YouTube binnen weniger Wochen mehr als zehn Millionen Mal aufgerufen. Ein Komiker parodiert das Lied, verwandelt den Titel „Ja – Russki“ („Ich bin Russe“) in „Ja – uski“ („Ich bin schmal“) und wird wegen angeblicher Anstachelung zu Hass angeklagt.
Was aber ist ein Russe?
Der Provinzpolitiker Wladimir Schewtschenko liefert uns 2013 eine Definition: „Ein Russe ist, wer russische Bräuche pflegt, den russisch-orthodoxen Glauben teilt und dem Geist nach Internationalist ist im Sinne der Sowjetunion.“ Damit ist ein wesentlicher Teil der Bevölkerung Russlands ausgeschlossen: Muslime, Juden, Buddhisten, Angehörige ethnischer Minderheiten, Menschen, die sich von der Sowjetunion distanzieren. In Russland leben mehr als hundert verschiedene Ethnien. Allein in der Teilrepublik Dagestan im Nordkaukasus sind es mehr als dreißig, sie sprechen 14 verschiedene Sprachen, und das auf einer Fläche, die nicht mal so groß ist wie Bayern. Doch die diffus ethnisch-religiöse Definition begegnet uns immer wieder. „Internationalismus“, erläutert Schewtschenko, „ist das, worauf seinerzeit versucht wurde, die Sowjetunion aufzubauen. Russland war das Bollwerk und das Bindeglied zwischen allen anderen Nationalitäten. Auch wenn einige das heute anzweifeln, haben wir doch im Alltag friedlich zusammengelebt.“
Schewtschenko sitzt im Stadtparlament von Newinnomyssk, einer Stadt mit rund 100 000 Einwohnern in der Region Stawropol im Süden Russlands. Die beiden Hauptstraßen sind schnurgerade und von Plattenbauten gesäumt. Am Stadtrand schleudern die Schlote einer Chemiefabrik Dreck in die Luft. Die Arbeitslosigkeit ist hoch. Irgendjemand hat Hakenkreuze an ein Gebäude geschmiert und „Russia“ daneben geschrieben. Jemand anders hat versucht, das zu entfernen, es dabei aber nur verwischt. Newinnomyssk wurde einst als Kosakensiedlung entlang der damaligen Verteidigungslinie Russlands gegen den Nordkaukasus gegründet. Der Nordkaukasus ist heute Teil Russlands. Die Republiken dort zählen zu den ärmsten des Landes. Viele Menschen suchen das Weite, und wer aus Tschetschenien, Dagestan oder Inguschetien weg will, kommt in der Regel zunächst nach Newinnomyssk, zur Ausbildung oder um zu arbeiten. Schewtschenko ist gegen solche „Zuwanderung“. Er sieht sich immer noch im Abwehrkampf gegen Kaukasier. Deshalb hat er eine Bewegung mit dem Namen „Ja Russki“ gegründet, „Ich bin Russe“.
Newinnomyssk ist seit Jahren immer wieder in den Schlagzeilen, wie die ganze Region. Bereits 2001 entführte ein bewaffneter Mann einen Bus mit vierzig Passagieren, verlangte die Freilassung fünf gefangener Tschetschenen. Eine russische Sondereinheit konnte die Geiseln befreien, der Entführer kam dabei ums Leben. Im Dezember 2007 explodierte ein Bus, zwei Menschen starben, vier wurden schwer verletzt. Im Winter 2012/2013 kommt es in der Stadt zu tagelangen Protesten, angefacht durch angereiste Nationalisten aus anderen Teilen Russlands. Der Grund: In einer Diskothek hat ein junger Mann im Streit einen anderen erstochen. Nationalisten nutzen solche Vorfälle für rassistische Hetze. „Die Leute sind für eine stärkere Kontrolle der Zuwanderung“, sagt der Lokalpolitiker Schewtschenko. „Sie wollen, dass die Polizei endlich gegen jene Elemente vorgeht, die Gesetzesverstöße zulassen; sie sind gegen die Tatenlosigkeit der Polizei.“ Später wird Schewtschenko Mitglied in der Kreml-Partei Einiges Russland.
Russlands Verfassung beginnt mit den Worten: „Wir, das multinationale Volk der Russländischen Föderation ...“. Putin selbst vermied in den ersten Jahren seiner Präsidentschaft nationalistische Töne. Oft betonte er den multinationalen Charakter des Landes, warnte vor Fremdenfeindlichkeit und Rassenhass – wie zum Jahrestags des Sieges über Hitlerdeutschland im Mai 2006. Doch während Putin den Vielvölkerstaat Russland lobte, ließ er die Nationalisten gewähren und förderte sie sogar. Im Jahr 2005 führte Russland auf Betreiben rechtsnationaler Politiker einen neuen Feiertag ein, den „Tag der Einheit des Volkes“ am 4. November. Dafür wurde der „Tag der Verfassung“ zu Ehren der Unabhängigkeit Russlands von der Sowjetunion als arbeitsfreier Tag gestrichen. Der neue Feiertag erinnert an die Befreiung Moskaus von polnisch-litauischer Besatzung im Jahr 1612, und eigentlich sollten an diesem Tag alle Menschen in Russland unabhängig von ihrem Glauben und ihrer Nationalität zusammenrücken. Stattdessen versammelten sich am 4. November 2005 Monarchisten, orthodoxe Christen und Nazis nahezu aller Schattierungen zu einem „Russischen Marsch“. „Zu Ehren der nationalen Einheit“ zogen Tausende mit schwarz-gelb-weißen Zarenflaggen und Hakenkreuzen in allen Variationen durch das Stadtzentrum, darunter Familien mit Kindern. Viele zeigten den Hitlergruß, auch Priester streckten den rechten Arm in die Höhe. Lautstark forderten sie „Russland den Russen“. Die Behörden schritten nicht ein. Der „Russische Marsch“ wurde eine Institution und fand fortan jedes Jahr statt. Auch Nikolai Bondarik und seine Leute liefen mit, ebenso Alexej Nawalny, der spätere Antikorruptionsblogger.
Im Jahr 2006 unterstützen bereits knapp 60 Prozent der Bevölkerung die Parole „Russland den Russen“, und Sankt Petersburg hat sich zu einem Zentrum von Nationalismus und Fremdenfeindlichkeit entwickelt. Anfang der 2000er Jahre sind dort mehrere Menschen aus rassistischen Motiven ermordet worden, darunter mindestens fünf Studenten aus Afrika und Indien, ein neunjähriges tadschikisches Mädchen und der Rechtsextremismusexperte Nikolai Girenko. Er hatte als Gutachter bei der Sankt Petersburger Staatsanwaltschaft dazu beigetragen, dass rechtsextremistische Gewaltverbrecher vor Gericht kamen. Girenko wurde durch seine Wohnungstür hindurch erschossen. Selbst nach offensichtlich nationalistisch und rassistisch motivierten Gewalttaten tun russische Medien, Ermittlungsbehörden und Politiker die Täter als „Rowdies“ ab. Als wären gewalttätige Jugendliche auf der Straße unterwegs und nicht politisch motivierte Rechtsextreme mit Machtanspruch. Proteste gewissenhafter Bürger gibt es kaum, Mahnwachen sind eher lose Treffen einiger weniger.
Desire Deffo leitet 2006 die Afrikanische Einheit, einen Zusammenschluss der etwa zweitausend Afrikaner in der Stadt. Er ist als Student aus Kamerun in die Sowjetunion gekommen. „Natürlich beschäftigen uns die Morde. Wie soll einer ruhig weiterstudieren, wenn er weiß, dass er das nächste Opfer sein kann? Die Menschen sind beunruhigt.“ Deffo mahnt trotz der Mordserie zur Besonnenheit. „Wir blicken nach vorn. Heute ist die Situation schlecht, aber morgen kann alles besser sein. Wir hoffen darauf, denn in Petersburg leben sehr viele Afrikaner, viele haben Familien. Sollen die etwa alle ihre Koffer packen? Natürlich nicht!“ Er habe noch nie ernsthaft daran gedacht, Russland zu verlassen. Denn Rassismus gebe es auch anderswo. Deffo vertraut Putin, der sagt, man brauche in Russland Arbeitskräfte aus anderen Ländern. Das seien keine Lippenbekenntnisse. Er identifiziert sich mit dem russischen Staat, und er verlangt, dass alle gemeinsam daran arbeiten, Intoleranz und Rassenhass zu bekämpfen. Deffo wirbt in Schulen für die afrikanische Kultur. „Heute geht es gegen die Afrikaner, morgen gegen Kaukasier und übermorgen gegen Russen. Was passiert denn, wenn ein Russe komische Haare hat oder die falschen Hosen trägt? Wir Afrikaner sind nur deshalb zu den ersten Opfern geworden, weil wir uns am wenigsten schützen können.“
Deffo sitzt früh am Abend in Anzug, weißem Hemd und roter Krawatte im Keller eines ausgedienten Kinos an einem Tisch, vor sich eine Aktentasche, hinter sich eine Bar, an der ein Barkeeper aus Mali stumm Tee für die beiden einzigen Gäste kocht. Das Kino ist der Treffpunkt der afrikanischen Gemeinde. Oben im Foyer hängen verblichene Filmplakate. Zwei Garderobenfrauen lösen Kreuzworträtsel und bewachen Deffos Mantel. Nur ab und zu werden hier noch Filme vorgeführt, meist für Schulklassen. Deffo winkt den Gast vom Nachbartisch heran. Mara Mane stammt aus dem Senegal. Er ist ein hochgewachsener, schlanker Mann mit kurzen Rastalocken. Vor knapp zwei Jahren kam er mit dem Schiff aus Marokko nach Sankt Petersburg und beantragte politisches Asyl. Über Russland wusste er nichts. Aber schlechter als in seiner Heimat könne es dort nicht sein, dachte er. Nun bereut er den Schritt. „Ich weiß nicht, ob ich in Russland bleiben werde. Seit ich hier bin, ist die Situation permanent schlechter geworden. Das macht mir Angst.“ Mane stützt die Ellbogen auf die Knie, macht sich kleiner, als er ist. Über seinen Asylantrag ist noch nicht entschieden. Er wirkt resigniert. Im Senegal hat er bis zu seiner Flucht für einen Sicherheitsdienst gearbeitet. In Sankt Petersburg macht er sich um seine eigene Sicherheit Sorgen. Mane vermeidet Begriffe wie Nazis, Rassisten, Schläger, Mörder. Diffus spricht er nur von „ihnen“:
„Ich habe einfach Glück gehabt, dass ich noch nicht von ihnen überfallen wurde. Ich bin aber auch vorsichtig. Es gibt Dinge, die würde ich nicht machen, weil sie sie provozieren könnten. Zum Beispiel mit Frauen unterwegs sein. Das mögen sie nicht. Das mache ich nicht. Es gibt sehr dunkle und verlassene Gegenden. Dort gehe ich nicht hin. Es gibt Uhrzeiten, zu denen ich nicht allein auf die Straße gehe. Das sind so ein paar Vorsichtsmaßnahmen, die vielleicht dazu geführt haben, dass mir so etwas noch nicht passiert ist.“
Desire Deffo nickt. Auch er sei noch nie auf der Straße bedroht worden – aber er ist auch immer mit dem eigenen Auto unterwegs. „Wenn einer auf der Straße in meine Richtung sagt: ‚Da geht ein Neger‘, dann beachte ich das gar nicht. Weil ich über die Jahre begriffen habe, dass das nicht unbedingt böse gemeint ist. Oft wissen die Leute gar nicht, was sie da sagen. Sogar gebildete Russen halten ‚Neger‘ für ein neutrales Wort. Wenn ich auf einer Wand irgendwo Aufschriften sehe wie: ‚Neger, haut ab‘ oder ‚Alle Schwarzen raus‘, dann ist das zwar unangenehm für mich. Aber ich sage mir einfach: Das hat ein Mensch geschrieben, der noch nicht auf meinem intellektuellen Niveau ist.“
Die beiden Männer gehen nach oben in das verwaiste Kinofoyer. Letztes Tageslicht fällt auf die vergilbten Filmplakate. Deffo glaubt, dass Wladimir Putin wirklich gegen Rassenhass vorgehen möchte. „Wir von der Afrikanischen Einheit haben als Erste gesagt, dass Rassismus und Diskriminierung in Russland ernst zu nehmen sind. Aber damals, vor sechs oder sieben Jahren, hörten wir nur: ‚Wovon reden Sie? Was für ein Rassismus?‘ Heute dagegen geben die Regierung und die Stadtverwaltung ganz offen zu, dass es dieses Problem gibt. Das ist ein großer Erfolg! Ich durfte sogar in der Stadtverwaltung auftreten!“
Deffo redet schön, was sich bereits abzeichnet. Politiker und Propagandamedien schlagen zunehmend fremdenfeindliche Töne an. Im Herbst 2006 weist Russland mehr als 2300 Georgier aus, von denen sich die meisten legal im Land aufhielten. Human Rights Watch spricht von einer „antigeorgischen Kampagne vor dem Hintergrund von wachsendem Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in Russland“. Desire Deffo geht zur Garderobe, die Frauen reichen ihm seinen Mantel. Dann klemmt er seine Aktentasche unter den Arm und bricht auf. „Bye-bye“, sagt die eine Garderobenfrau. „Do swidania“, erwidert Deffo. „Bye-bye“, wiederholt die andere. Die beiden Frauen lächeln und winken.
„Die Regierung propagiert eine starke Hand. Das fördert die chauvinistischen und fremdenfeindlichen Tendenzen noch“, warnt dagegen Leonid Lwow. Der Rentner sitzt in einem Café in Sankt Petersburg und blickt durch das Fenster auf den Hinterhof, auf dem er selbst als Kind gespielt hat. Mitte der 90er Jahre hat er ein Bildungsprogramm für Lehrer, Hochschuldozenten, Polizisten, Staatsanwälte und Menschenrechtler ins Leben gerufen. Die Teilnehmer diskutieren über Toleranz, über imperialistische Tendenzen in Russland nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, über sogenannte „Hate Crimes“, aus Hass oder aufgrund von Vorurteilen begangene Verbrechen. „Mich hat ein Mitarbeiter der Miliz angerufen“, erzählt Lwow 2006. „Der Milizionär ist für Jugendliche zuständig. Eine Schule in seinem Bezirk bietet neuerdings sogenannte militärisch-patriotische Erziehung an. Das ist eine sehr chauvinistische Angelegenheit.“ Gut fünfzehn Jahre später wird militärisch-patriotische Erziehung an den Schulen zur Regel werden. „Der Milizionär hat mich gefragt, ob ich an der Schule ein Seminar für Toleranz anbieten könne.“ Natürlich hat Lwow zugesagt. Er freut sich über kleine Erfolge. Sie sind selten, die Rückschläge umso herber. Der ermordete Sankt Petersburger Rechtsextremismusexperte Nikolai Girenko war ein enger Freund von Lwow. Zu einem „Marsch gegen Hass“, den er nach dem Mord organisierte, kamen 400 bis 500 Menschen, eine verschwindend geringe Zahl angesichts von mehr als viereinhalb Millionen Einwohnern. Zwei Jahre nach dem Mord sitzen acht Personen unter Mordverdacht in Untersuchungshaft; bewiesen ist aber nichts. „Ich wurde zum Verhör geladen. Hin und wieder verhaften die Ermittler eine Gruppe. Unterm Strich gibt es keine Ermittlungserfolge.“