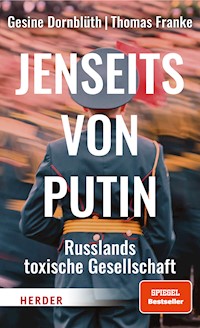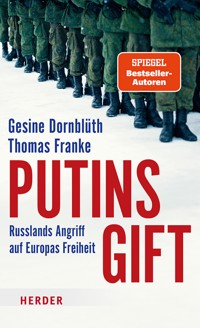Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BeBra Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Am 6. April 1966 stürzte ein sowjetischer Jagdbomber in den West-Berliner Stößensee. Obwohl die beiden Piloten womöglich ihr Leben opferten, um Hunderte Menschenleben zu retten, wurden sie später in Ost und West nur halbherzig geehrt. Dieses Buch rekonstruiert die dramatischen Ereignisse, die damals die Weltöffentlichkeit in Atem hielten, und es zeigt, wie die Erinnerung daran bis heute nachwirkt. Gesine Dornblüth und Thomas Franke nehmen ihre Leser mit an die Schauplätze des Geschehens und erzählen von großem Mut und kleinen Missverständnissen, von der Macht der Propaganda und den offenen Wunden der Vergangenheit. Dabei wird deutlich, warum der Blick auf den Kalten Krieg in Deutschland und Russland immer noch weit auseinandergeht und einem Miteinander im Weg steht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 246
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gesine Dornblüth · Thomas Franke
Ruhmlose Helden
Ein Flugzeugabsturzund die Tücken deutsch-russischerVerständigung
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte vorbehalten.
Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen, Verfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung auf DVDs, CDROMs, CDs, Videos, in weiteren elektronischen Systemen sowie für Internet- Plattformen.
E-Book im be.bra verlag, 2022
© der Originalausgabe:
be.bra verlag GmbH
Berlin-Brandenburg, 2022
Asternplatz 3
12203 Berlin
Lektorat: Gabriele Dietz, Berlin
Umschlag: hawemannundmosch, Berlin
ISBN 978-3-8393-0157-9 (epub)
ISBN 978-3-89809-199-2 (print)
www.bebraverlag.de
Inhalt
Vorwort
1 Der TagEberswalde-Finow
2 Die BergungWest-Berlin
3 Die WitweRostow am Don
4 Das GedenkenWest-Berlin
5 Der SohnMoskau
6 Das MuseumEberswalde-Finow
7 Die Kämpferin für ein DenkmalRostow am Don
8 Der BildhauerMoskau
9 Der BesuchEberswalde-Finow
10 Völkerverständigung
Nachwort
Anhang
Quellen
Bildnachweis
Dank
Die Autoren
Vorwort
Dies ist eine Geschichte aus der heißen Zeit des Kalten Krieges. Hin und wieder wird sie in Dokumentationen über die Sechzigerjahre in Berlin erwähnt. In Wim Wenders’ Film Der Himmel über Berlin sitzen die Engel Damiel und Cassiel in einem Cabriolet. Cassiel liest aus seinem Notizbuch vor: »Sonnenaufgang … Sonnenuntergang … Mondaufgang … Monduntergang … Wasserstand von Havel und Spree … Vor zwanzig Jahren stürzte ein sowjetischer Düsenjäger nahe der Spandauer Heerstraße in den Stößensee …«
Der Absturz der nagelneuen Maschine am 6. April 1966 war ein eher kleines Ereignis in den an gefährlichen Großereignissen reichen Sechzigern. Der Mauerbau lag nicht einmal fünf Jahre zurück, die Kubakrise, in der die Menschheit knapp an einem Atomkrieg vorbeischlitterte, nur vier Jahre. Doch das Unglück in der Frontstadt, der Flugzeugabsturz am Stößensee, hätte einen dritten Weltkrieg provozieren können. Berlins Regierender Bürgermeister Willy Brandt sprach anerkennend von einem »Opfer, durch das eine Katastrophe vermieden wurde.«
Genauso stellte es die Sowjetunion dar: Hätten die sowjetischen Piloten sich mit dem Schleudersitz gerettet, wäre ihre Maschine möglicherweise auf dicht besiedeltes Wohngebiet gestürzt. Geehrt wurden die zwei Piloten, Boris Kapustin und Juri Janow, trotzdem nur halbherzig. Zu Hause blieb ihnen die höchste Auszeichnung »Held der Sowjetunion« verwehrt, da das Flugzeug mit neuester Technik in die Hände des Feindes gefallen war. Schwerer als die Rettung von Menschenleben wog in Moskau, dass die Briten das Wrack ausschlachten und in den Besitz geheimer Technik kommen konnten.
Der Berliner Bezirk Spandau rang sich erst nach der Wende durch, die Piloten zu ehren, und das auch nur gegen Widerstände. In Eberswalde in Brandenburg, wo Kapustin und Janow stationiert waren, pflegen Mitglieder der ehemaligen Deutsch-Sowjetischen Freundschaft einen Gedenkstein, allerdings erst seit 2006. In Russland schließlich wollen junge Leute den Piloten ein Denkmal setzen, unterstützt von der Witwe eines der Männer. Dort sind Helden wieder gefragt. »Sie waren edle Menschen«, sagt eine junge Historikerin.
Dies ist auch eine Geschichte darüber, wie sich die Wahrnehmung historischer Ereignisse mit der Zeit verändert oder wie sie verändert wird. In den letzten 55 Jahren ist vieles durcheinandergeraten und anderes verklärt worden. Die menschliche Erinnerung ist unzuverlässig. Die Umstände, unter denen Kapustin und Janow verunglückten, lassen Raum für Interpretationen und auch für Fantasie. Was in den letzten Minuten in der Pilotenkapsel über Berlin wirklich passierte, ob die Männer tatsächlich einen Befehl verweigerten, um Menschenleben zu retten, und ob sie den trudelnden Düsenjet nach dem Ausfall beider Triebwerke noch kontrolliert in den Stößensee lenken konnten, ist nicht mehr bis ins letzte Detail zu klären.
Dies ist auch eine Geschichte über die Probleme, die entstehen können, wenn es keinen Grundkonsens über die Vergangenheit gibt. Dabei wollen unterschiedlichste Menschen in Ost und West, in Russland und Deutschland, das Gleiche. Trotzdem stoßen sie immer wieder auf Hindernisse. Denn es gibt keinen gemeinsamen Blick auf den Absturz der Piloten und keine Einigkeit in der Bewertung des Kalten Krieges und der heutigen politischen Situation. Es gibt generell kein gemeinsames russisch-deutsches Geschichtsverständnis.
In einer Zeit, in der Schwarz-Weiß-Denken um sich greift und über einen »neuen Kalten Krieg« geredet wird, erzählen wir, wie Vergangenheit manipuliert und politisch instrumentalisiert wird und sich aufgrund subjektiver Erinnerung so verändert, dass unterschiedliche Versionen einer Geschichte entstehen, deren gemeinsamer Nenner die Sehnsucht nach Helden ist. Wir wollen deutlich machen, wie weit der Blick auf die Sowjetunion, auf den Kalten Krieg und die Neunzigerjahre in Ost- und Westdeutschland auseinandergeht, wie diese unterschiedlichen Sichtweisen zustande kommen und dass zudem viele Russen ein verzerrtes Bild von Deutschland und von der Rolle der Sowjetunion in der DDR haben.
Die Geschichte des Absturzes von Boris Kapustin und Juri Janow ist eine Geschichte von großer Liebe, von Geheimdiensten, Tod, Verschwörungen, Politbürokratie, Heldentum und Propaganda. Es ist eine Geschichte von Erwartungen und Projektionen, in der auch Angela Merkel eine Rolle spielt. Und nicht zuletzt ist es eine Geschichte von Menschen, die sich für das Erinnern an diese beiden Piloten einsetzen, von Menschen aus unterschiedlichen Gesellschaftssystemen, die mit ihren Besonderheiten, Überzeugungen und Werten Kontakt jenseits organisierter Strukturen suchen und im viel diskutierten und äußerst komplizierten deutsch-russischen Verhältnis ein Ziel haben: Völkerverständigung, im Kleinen wie im Großen.
Bei der Rekonstruktion des Alltags auf dem Luftwaffenstützpunkt bei Eberswalde am Tag des Absturzes und der anschließenden Bergung in Berlin stützen wir uns auf Interviews mit Zeitzeugen und Berichte von Reportern vor Ort. Zitierte Briefe, Zeitungsberichte und andere Dokumente haben wir behutsam sprachlich korrigiert, Inhalt und Geist der Schriftstücke jedoch bewahrt.
1 Der TagEberswalde-Finow
Der 6. April 1966 ist ein Mittwoch und beginnt auf dem Luftwaffenstützpunkt der Roten Armee in Finow wie viele andere Tage. Es ist bewölkt, ab und zu regnet es. Gegen acht Uhr morgens schrillt Alarm und Hauptmann Boris Kapustin läuft zum Hangar. Gegen elf Uhr steht er in voller Ausrüstung wieder vor seiner Frau. Fehlalarm. Das ist nichts Ungewöhnliches, oft gibt es sogar mitten in der Nacht Alarm oder er muss aus einem anderen Grund nachts arbeiten. »Ich lege mich noch ein bisschen hin«, sagt Boris zu Galina. Flieger und Seeleute können immer schlafen, das lernt man in jeder Armee der Welt. Boris Kapustin geht in das verdunkelte Schlafzimmer, seine Frau pflanzt Blumen. Vor dem Haus haben die beiden ein kleines Beet angelegt. Auf einem Bänkchen neben der Haustür döst eine Katze. Wenige Minuten später steht ihr Mann wieder vor Galina. Sein sonst sorgsam nach hinten frisiertes Haar ist zerzaust. »Ich kann nicht schlafen, Galinuschka, gibt es irgendetwas, das ich tun kann? Kann ich dir helfen?« Die Katze rekelt sich, springt vom Bänkchen, streicht Kapustin lautlos um die Beine.
»Ich bin gleich fertig mit dem Pflanzen, Borja. Aber bald kommt der Mai, wir müssen Fenster putzen. Ich glaube, es regnet heute nicht mehr, lass uns den Winterdreck abschrubben.«
»Mit Vergnügen«, sagt der Pilot. Er geht ins Bad, erfrischt sich, kämmt sein Haar. Irgendwie verspürt er an diesem Tag keine Lust zu fliegen. Das ist eher ungewöhnlich. Seit Beginn seiner Ausbildung hat er mehr als tausend Flugstunden absolviert und alles dafür getan, sich zum »Militärflieger erster Klasse« zu qualifizieren.
Seine Frau reicht ihm Putzmittel. »Mach bitte diese Seite, die andere ist schon fertig.«
Als hätte er das nicht gesehen. Und so steht Hauptmann Boris Kapustin auf der Leiter und putzt an einem Mittwochvormittag Fenster. Es ist sein letztes Jahr in der Westgruppe der Roten Armee, in wenigen Wochen soll er mit Frau und Sohn in die Sowjetunion zurückkehren.
»Es ist so schön hier. Freust du dich auf zu Hause?«, fragt er Galina.
»Ja, irgendwie schon.«
»So gut wie hier werden wir es nicht mehr haben, Galinuschka.«
»Ich weiß.«
Sie leben für sowjetische Verhältnisse privilegiert. Der Dienst in der Westgruppe in Deutschland ist um einiges luxuriöser als an anderen Orten, und die Offiziere dürfen im Unterschied zu den einfachen Soldaten ihre Familien mitnehmen. Die Kapustins haben es besonders gut getroffen.
In Finow, einem ruhigen, fast idyllischen Städtchen nahe Eberswalde, leben sie im Erdgeschoss einer Doppelhaushälfte in einer Fliegersiedlung am Ortsrand. In der Etage über ihnen ist technisches Personal des Luftwaffenstützpunkts untergebracht.
Die kleinen Häuser in den ruhigen Anliegerstraßen wurden vor dem Zweiten Weltkrieg für Arbeiter und ihre Familien gebaut. Die sowjetische Armee hat sie nach dem Krieg beschlagnahmt. In den Gärten wachsen Apfelbäume. Das Schlafzimmer ist zwar klein, das Wohnzimmer umso größer. Im Flur gibt es eine Kochecke, an der Wand steht eine Badewanne. Es ist eng und improvisiert, aber doch so viel besser als die Wohnverhältnisse in der Sowjetunion und komfortabler als das Leben in den großen Kasernen in Eberswalde und anderen Städten der DDR.
Die Fliegersiedlung in Finow ist umzäunt und grenzt direkt an den sowjetischen Flughafen. Während die meisten Männer mit dem Rad zur Arbeit fahren, geht Kapustin gewöhnlich zu Fuß, er hat einen schnellen Schritt. Der Wald ist nah und ganz in der Nähe gibt es einen See, in dem Boris Kapustin das ganze Jahr über badet. Schon als junger Mann hat er sich den »Walrössern« angeschlossen, den Eisbadern, und er ist mit seinen vierunddreißig Jahren immer noch gut in Form. Kapustin ist gesellig, beliebt und der Parteisekretär seiner Fliegerstaffel. Seine Kameraden kommen gern zu ihm, auch wenn sie Probleme haben. Die Jahre in der DDR erscheinen der Familie als eine rundum gelungene Zeit.
Boris Kapustin 1965 in der Fliegersiedlung in Finow
»Weißt du, wen ich vermissen werde?«
»Wen denn?«
»Die Verkäuferin im Laden. Sie ist immer so nett. Aber ihr Russisch ist so schlecht.«
»Lern doch noch schnell Deutsch, Galina.«
Beide lachen.
»Ich freue mich darauf, dass es zu Hause im Winter wieder richtig kalt ist«, sagt Kapustin, denn für das Eisbaden war es in Deutschland in den vergangenen Jahren oft zu warm. Lediglich der Winter 1962/63 war mit drei Monaten Frost ganz nach seinem Geschmack. »Aber ich werde die Kameraden vermissen.«
Mit seinem Co-Piloten, Juri Janow, versteht er sich gut. Seit Jahren fliegen die beiden gemeinsam. Sie sind gleich alt, Janow hat wie er Familie, lebt mit Frau und zwei kleinen Kindern in Finow. Kapustin und Janow waren die Ersten, die vom Kommandanten für besondere Leistungen ausgezeichnet wurden.
Boris Wladislawowitsch Kapustin (links) und Juri Nikolajewitsch Janow (rechts)
»Möchtest du Tee, Lieber?«, fragt Galina und wartet die Antwort gar nicht erst ab. Etwas später sitzen beide vor dem Haus. Der Flieder treibt erste Knospen.
»Mein geliebter Flieder«, sagt Kapustin und nimmt einen Löffel Marmelade zum Tee. Er hat den Busch selbst gepflanzt. Er drückt seiner Frau einen Kuss auf die Wange, sieht sie liebevoll an.
Ihr Sohn Waleri ist vor zwei Monaten acht Jahre alt geworden und weiß nicht recht, was er von dem bevorstehenden Umzug in die Sowjetunion halten soll. Er kann sich nicht vorstellen, wie das Leben dort sein wird, er kennt es nur von den seltenen Besuchen bei den Großeltern. In Finow hat er eine unbeschwerte Kindheit, die russische Grundschule ist in Fußnähe in der Fliegersiedlung, nachmittags tollt er mit den anderen Jungs in den Vorgärten oder dem angrenzenden Waldstück umher. Manchmal schleichen sich die Kinder heimlich aufs Flughafengelände, wo ihre Väter arbeiten und die einfachen Soldaten in Kasernen hausen; wenn sie erwischt werden, gibt es zwar Ärger, aber das lässt sich verschmerzen. Am Wochenende und an Feiertagen dürfen die Offiziersfamilien die Siedlung verlassen und spazieren durch Eberswalde. Dann sieht Waleri auch deutsche Kinder, aber in Kontakt kommen sie nicht. Der Schlagbaum, der Zaun um die Siedlung, die Sprachbarriere – es gibt viele Faktoren, die Begegnungen zwischen Deutschen und Sowjets verhindern, und sie sind, jenseits von offiziellen Treffen, auch nicht gewünscht.
»Ich kümmere mich zu wenig um den Jungen«, sagt Kapustin auf einmal.
Da hat er nicht unrecht. Wenn er vom Einsatz kommt, umringen ihn die Kinder seiner Kameraden, Waleri ist deshalb manchmal eifersüchtig.
»Aber, Lieber, das stimmt doch nicht. Rede nicht so einen Blödsinn, du kümmerst dich dauernd um Walera.«
Kapustin ist geschickt. Bevor er zur Fliegerei kam, hat er Industriemechaniker gelernt. Seinem Sohn hat er eine kleine Werkstatt im Keller eingerichtet. Dort bastelt er Kostüme, mal eine Wassermelone, mal eine Ritterrüstung. Er hält nicht viel von autoritärer Erziehung, lieber redet er mit seinem Jungen, überzeugt ihn, nimmt ihn in den Arm – untypisch für die Zeit und für Offiziere, nicht nur in der Sowjetunion der Sechzigerjahre.
»Nein, nein, Galinuschka. Ich muss mich mehr kümmern.«
Und so sitzt Hauptmann Boris Kapustin an diesem Mittwochmittag vor dem Haus und denkt über die letzten Jahre nach. Anstrengende Jahre. 1966 ist der Kalte Krieg auf seinem Höhepunkt, die weltpolitische Lage äußerst angespannt. Natürlich wirkt sich das auf das Leben der Soldaten aus, sehr zum Leidwesen von Waleri. Sein Vater kommt oft nur kurz nach Hause, isst schnell etwas, zieht sich um, ein Küsschen für Frau und Kind und weg ist er. Die Flieger des 668. Bomberregiments der 132. Bomberdivision der 24. Luftarmee stehen an vorderster Front. Kapustin ist überzeugt, eine wichtige Mission an der westlichen Grenze des sozialistischen Lagers zu erfüllen und den Luftraum der DDR zuverlässig zu schützen. Fünf Jahre nach dem Mauerbau und vier Jahre nach der Kubakrise ist die Kriegsgefahr immer noch groß. West-Berlin ist der DDR und der Sowjetunion ein Dorn im Auge. Die DDR hat sich nahezu komplett gegen den Westen abgeschottet. Es gibt nicht einmal ein Transitabkommen, das die Durchfahrt von Westdeutschland nach West-Berlin vereinfachen würde. Die Atmosphäre ist frostig.
Familie Kapustin 1962: Galina, Waleri, Boris
Kapustin kennt den Westteil der Stadt nur von oben. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Alliierten drei Luftkorridore zwischen dem späteren Bundesgebiet und West-Berlin für die Maschinen der USA, Großbritanniens und Frankreichs festgelegt. Über dem übrigen Gebiet der DDR haben westliche Flugzeuge nichts zu suchen. Über Berlin gilt eine sogenannte Kontrollzone, hier ist die Flughöhe auf maximal 3.000 Meter begrenzt. Diese Zone umfasst auch Teile Ost-Berlins, und so fliegen die Westalliierten mitunter über den Ostteil der Stadt. Die sowjetischen Kampfflugzeuge ihrerseits donnern fast täglich über West-Berlin, nicht selten durchbrechen sie dabei die Schallmauer – bewusst, um der Bevölkerung ihre Anwesenheit zu demonstrieren und sie mit dem Lärm, einem gewaltigen Knall, zu zermürben. Die Westsektoren besuchen, dürfen die Rotarmisten selbstverständlich nicht.
Boris Kapustin 1965 auf dem sowjetischen Militärflugplatz Finow
Kapustin fliegt gewöhnlich eine Iljuschin-28, der Bomber ist zu dieser Zeit in der Sowjetunion weit verbreitet. Doch kürzlich hat er umgeschult auf einen Abfangjäger vom Typ Jakowlew. Die Jak-28P ist brandneu, vollgestopft mit neuester Technik und soll schon bald in Serienproduktion gehen, um den Vorsprung gegenüber den USA in der Militärluftfahrt auszubauen. Natürlich unterliegt das Modell strengster Geheimhaltung.
Die Sechzigerjahre sind geprägt vom Wettlauf der Supermächte um den Vorsprung bei Waffentechnologien und Raketenantrieben, letztendlich um die Vorherrschaft im Kosmos. Die UdSSR hat 1957 mit dem Sputnik, dem ersten Satelliten im Weltall, einen Schock im Westen ausgelöst. Als vier Jahre später Juri Gagarin als erster Mensch die Erde umkreist, ist klar: die Sowjetunion hat einen immensen Vorsprung. Jetzt geht es darum, wer als Erster den Mond erreicht: die USA oder die UdSSR. Teil des Wettlaufs um Raketentechnik ist auch die Entwicklung von Jagdflugzeugen wie der Jak-28P. Jederzeit bereit, über Westdeutschland zu kämpfen, sollen die hochmodernen Flugzeuge den Gegner einschüchtern. Die ersten Maschinen dieses Typs stehen im April 1966 bereits kampfbereit in Köthen in Sachsen-Anhalt, keine hundert Kilometer von der innerdeutschen Grenze entfernt. Fünf weitere haben Boris Kapustin und seine Kameraden am 3. April aus der Sowjetunion geholt.
Doch bei der Überführung gab es Probleme mit Kapustins Maschine. Statt direkt nach Köthen zu fliegen, mussten sie auf dem Stützpunkt in Finow zwischenlanden. Galina Kapustina hat sich erschreckt, als sie den Schlüssel viel früher als erwartet in der Tür hörte.
»Borja, was ist passiert?«, fragte sie. Ihr Mann hatte ein schwarz verschmiertes Gesicht.
»Stell dir vor, ein Motor hat versagt. Mit dem zweiten haben wir es gerade so hergeschafft.«
Seitdem versuchen die Monteure in Finow, das Flugzeug wieder startklar zu machen. Mehrmals schon wurde Kapustin zum Flugplatz gerufen, weil die Maschine angeblich wieder einsatzfähig war, dann wurde der Start erneut verschoben. Kein Wunder also, dass er am Vormittag des 6. April unruhig ist. Nun, Befehl ist Befehl, und auf dunkle Vorahnungen von Soldaten wird in keiner Armee der Welt Rücksicht genommen.
»Boris Wladislawowitsch! Wir haben es eilig.« Die anderen Flieger fahren lachend an ihm vorbei zum Flugplatz.
Als Letzter kommt sein Co-Pilot Juri Janow. »Los!«, ruft er. »Wir fliegen endlich.«
»Geh schon mal vor, ich komme gleich nach.«
Kapustin zögert.
»Borja, du musst los«, drängt nun auch Galina.
»Ach lass, die hole ich schon ein.«
Er steht auf, küsst seine Frau flüchtig und geht schnellen Schrittes in Richtung der Hangars. Kapustin hat noch keine zwanzig Schritte zurückgelegt, da dreht er sich plötzlich um, geht zurück, küsst seine Frau innig und umarmt sie fest. Dann reißt er sich los, doch nach wenigen Schritten dreht er sich erneut um, kommt wieder zurück und umarmt sie noch einmal – noch fester als zuvor.
Boris Kapustin nach einem Flug, Finow 1964
»Nun ist aber gut, Borja.« Sie streicht ihm über die Wange.
»Was ist bloß los«, fragt sich Galina Kapustina, »so ist er doch sonst nie.«
Laut sagte sie: »Borja, du kommst zu spät, alle sind schon fort.«
»Keine Sorge, sie werden nicht ohne mich losfliegen.«
Und so geht Boris Kapustin an diesem 6. April schnellen Schrittes hinüber zum Flugplatz.
»Borja«, ruft Galina ihm hinterher, »du bist nicht du selbst.«
»Wahrscheinlich brauche ich Urlaub. Ich bin müde.«
Bald darauf stehen Kapustin und Janow mit der Jak-28P startbereit auf dem Rollfeld, neben ihnen eine zweite Maschine desselben Typs. Sie sollen gemeinsam nach Köthen fliegen. Die Triebwerke laufen warm, die Piloten warten auf die Starterlaubnis. Alles ist wie immer. Kapustins Unruhe weicht professioneller Konzentration. »Pojechali – auf geht’s«, ruft er, als er den Befehl zum Start bekommt. Sie rollen los, beschleunigen, und wenige Sekunden später, um 15:24 Uhr, heben die beiden Jak-28P endlich ab, durchbrechen die geschlossene Wolkendecke, die Piloten sehen den strahlend blauen Himmel. Kurze Zeit später erreichen sie die Flughöhe von 4.000 Metern. 200 Kilometer bis Köthen, 600 km/h, keine große Sache für die beiden Flugzeuge. Kapustin und Janow übernehmen die Führung und gehen auf Kurs. Doch plötzlich beginnen die Triebwerke ihrer Maschine erneut zu stottern. Kapustin gibt dem folgenden Flugzeug den Befehl, weiter rechts zu fliegen. Die Distanz zwischen den beiden beträgt jetzt 100 Meter. Kapustin und Janow fallen zurück, der Pilot der zweiten Jak versteht das als Hinweis, sich an die Spitze zu setzen. Eineinhalb Minuten später kann er die Jak von Kapustin und Janow nicht mehr sehen und spricht die Kameraden über Funk an.
»Ich höre«, antwortet Kapustin.
»Sehen Sie uns?«, fragt der andere.
»Nein.«
Das ist das Letzte, was er von Kapustin mitbekommt. Bei dessen Jak sind zu diesem Zeitpunkt beide Triebwerke komplett ausgefallen. Die Maschine kommt ins Trudeln. Immer schneller sackt das Flugzeug. Kapustin und Janow sehen die Häuser West-Berlins unter sich, immer näher kommen Straßen, Autos, Menschen.
»Jura, wahrscheinlich musst du jetzt springen.«
Janow antwortet: »Boris Wladislawowitsch, ich bleibe bei Ihnen.«
»Jura, spring!«
»Kommandeur, ich bleibe.«
Die Piloten sehen den noch kahlen Grunewald, die stark befahrene Heerstraße mit der Brücke über den Stößensee, die Havel.
Kurz darauf, fünfzehn Minuten nach dem Start in Finow, ragt nur noch das Heck des Düsenjägers aus dem Wasser, und Kapustin und Janow hängen tot in der Kanzel tief im Schlamm der Havel.
2 Die BergungWest-Berlin
Um 15:40 Uhr klingelt beim Spandauer Volksblatt das Telefon. Eine Frau berichtet mit zitternder Stimme: »Da ist ein Flugzeug abgestürzt. Irgendwo im Grunewald.« Bald darauf der nächste Anrufer. Er stellt sich als Doktor Engel vor und auch er klingt äußerst aufgeregt. Er habe am Stößensee auf seinem Boot gearbeitet, »und dann war da so ein Geräusch. Ich schaue hoch. Und da seh ich ein Flugzeug. Die Maschine kippt und rast mit einer Halbspirale steil ins Wasser. Teile spritzen auf der Oberfläche hoch. Vor Schreck lief ich rückwärts ins Wasser.«
In der Feuerwache im West-Berliner Stadtteil Tempelhof geht am Nachmittag des 6. April 1966 noch alles seinen gewohnten Gang. Die Feuerwehrtaucher sind mitten in einer Übung, als die Alarmglocke sie zusammenzucken lässt. »Beeilt euch! Großalarm! In Spandau ist ein Flugzeug abgestürzt.« Der Rest ist Routine: Die Männer rennen zu ihrem Auto mit dem Schlauchboot und den Taucherausrüstungen. »Es ist ein Passagierflugzeug«, sagt einer. Während der Fahrt zwängen sich die Männer in ihre Taucheranzüge, schnallen Sauerstoffflaschen um. Als sie etwa eine halbe Stunde später am Stößensee ankommen, sehen sie nur den oberen Rand der silbern glänzenden Heckflosse aus dem Wasser ragen. Polizisten sind bereits dabei, das Ufer und die Zufahrten abzusperren. Auch die britische Militärpolizei ist da. West-Berlin ist in drei Sektoren aufgeteilt, Spandau und den Stößensee kontrollieren die Briten.
Die Taucher warten zunächst eine Weile am Ufer, dann trifft auch das Feuerlöschboot ein und fährt sie die wenigen Meter auf den See hinaus. Dort werfen sie Anker und die ersten beiden Taucher gehen über eine Treppe ins Wasser. Nach ein paar Minuten kommt einer von ihnen, Klaus Abraham, wieder hoch: »Man sieht nichts. Eine totale Schlammschlacht. Das Flugzeug steckt tief im Morast.«
»Geht an die Kanzel ran«, sagt der Einsatzleiter. »Guckt, ob ihr Personen findet.«
Abraham taucht noch einmal. Zentimeterweise tastet er sich voran, aber er kommt nicht weit. Immer dichter wird der Schlick. »Nichts zu machen, wir kommen nicht ran an die Kanzel«, informiert er den Einsatzleiter. »Die Maschine muss steil runtergekommen sein, die steckt viel zu tief im Schlamm. Wir können da nicht mehr schwimmen.« Die Taucher meinen, ein sowjetisches Hoheitsabzeichen identifiziert zu haben. »Versucht es weiter.«
Abraham taucht wieder ab. Noch ist unklar, um was für einen Flugzeugtyp es sich handelt. Doch eines stellen die Taucher schnell fest: Es ist eine Militärmaschine, kein Passagierflugzeug. Damit sind die Alliierten zuständig. Abraham ertastet ein Stück Blech, etwas größer als seine Hand. Er und sein Kollege kommen wieder hoch. »Ich muss kurz an meine Tasche«, sagt Abraham zu seinem Kollegen. Der grinst. Abraham ist seit sechs Jahren bei der Feuerwehr und liebt seinen Beruf. Er ist seit drei Jahren verheiratet und hat ein einjähriges Kind. Unbemerkt lässt er das Fundstück in seiner Tasche verschwinden. Dann taucht er wieder.
Mittlerweile ziehen Feuerwehrmänner Ölsperren um die Unfallstelle, um zu verhindern, dass eventuell austretender Treibstoff die Havel vergiftet. Auf dem Wasser bildet das Ölbindemittel eine weißgrüne Schaumschicht. Der Stößensee ist eine kleine geschützte Ausbuchtung der Havel, ein Bootssteg reiht sich an den anderen. Anfang April beginnen die meisten Wassersportler die Saison. An den Tagen vorher erledigen sie noch letzte Reparaturen, streichen, polieren, schleifen. Sie freuen sich auf Ostern, auch wenn Regen angekündigt ist. Für die West-Berliner ist die Havel mit ihren angrenzenden Seen, dem großen Wannsee und dem Grunewald das Naherholungsgebiet. Seit dem Mauerbau sind die drei Westsektoren abgeschottet. Das Umland, die Brandenburger Seen, das Havelland, der Spreewald und die Müritz sind für West-Berliner quasi unerreichbar. Mal eben rausfahren, zum Beispiel an die westdeutsche Ostseeküste, ist eine größere Aktion. Die Fahrt auf der Transitstrecke durch DDR-Gebiet dauert Stunden und man weiß nie, wie lange man an den Grenzübergängen aufgehalten wird. Dazu kommen schikanöse Kontrollen. Ein eigenes Boot ist in West-Berlin etwas Großartiges, bietet das Gefühl von Freiheit in der ummauerten Stadt. »An warmen Sommerwochenenden kommt man trockenen Fußes über die Havel«, witzeln Freizeitkapitäne, so voll ist es dann auf dem Wasser. Aber an diesem 6. April, mitten in der Woche, sind nur wenige auf ihren Booten, um ihre Schiffe für die Saison fertig zu machen.
Berliner Feuerwehrtaucher warten auf Kommandos der Briten
»Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei! Stellen Sie bitte das Rauchen ein. Explosionsgefahr!«, schallt es über den See. Am Ufer wird es immer voller. Blaulicht, Sirenen, Rettungsfahrzeuge. Es riecht beißend nach Kerosin. Die am Nachmittag viel befahrene Heerstraße mit der Brücke über den Stößensee wird gesperrt. Viele Ausweichstrecken über die Havel von und nach Spandau gibt es nicht. Der beginnende Feierabendverkehr staut sich. Lediglich Busse fahren noch. Auch deren Fahrgäste werden aufgefordert, nicht zu rauchen.
Die Stäbe der Besatzungsmächte werden aktiv und informieren die Regierungen in London, Moskau, Paris und Washington; jeder Zwischenfall kann die angespannte Lage zwischen Ost und West eskalieren lassen. Bald nach dem Absturz treffen britische Soldaten an der Unglücksstelle ein, ebenso Vertreter der USA und Frankreichs, der anderen beiden Westalliierten. Briten in Zivil setzen mit einem Boot über zur Absturzstelle. »Wir übernehmen das hier«, erklären sie.
Den Offizieren der Royal Air Force ist schnell klar, dass es sich bei der abgestürzten Militärmaschine um ein modernes sowjetisches Flugzeug handelt, und das ist für die Nachrichtendienste äußerst interessant, gerade angesichts des sowjetischen Vorsprungs in der Raketentechnik. Die Briten haben keine eigenen Taucher in Berlin, deshalb weisen sie die Berliner Feuerwehrleute an: »In wenigen Stunden werden unsere Spezialisten hier sein. Wir werden Ihnen sagen, was Sie tun können. Aber erst mal erzählen Sie uns bitte, was Sie da unten gesehen haben.« Die Antwort fällt knapp aus.
Am Ufer wimmelt es längst von Schaulustigen. Reporter suchen Augenzeugen. Eine Frau mit einem Kind auf dem Arm schildert der SFB-Abendschau ruhig, was sie gesehen hat: »Wir haben gerade hier am Würstchenstand gesessen und Würstchen gegessen. Und plötzlich kam hier so ’ne Düsenmaschine mit ’nem roten Stern auf uns zu. Und da dachten wir, nanu, was macht der denn für Kunststückchen. Auf einmal wurde er ganz langsam, kam immer tiefer und trudelt, trudelt, und mit dem Kopf zuerst runter. Ich lief dann gleich los und wollte sehen, vielleicht ist was passiert, vielleicht kann man helfen. Aber der war schon direkt im Wasser drin. Man konnte nix mehr sehen.« Überhaupt ist an der Würstchenbude in der Nähe der Brücke einiges los. Die Leute bestellen Bier und Schnaps. »Falls ihr so weitermacht«, ruft der Wirt in die Runde, »hab ich bald nichts mehr auf Lager.«
Der Fernsehreporter drängelt sich durch die Menge. »Wenn die Alliierten das immer weiter mit ansehen, die Mauer haben sie mit angesehen, dann sollten sie aber wirklich bald mal was machen dagegen«, sagt ein Mann in die Kamera. »Als einfacher Mensch weiß man nicht, was man machen soll, aber die sollen was machen. So kann es ja gar nicht weitergehen, immer nur die Nervenbelastung.«
Verängstigt und verärgert: Schaulustige am Stößensee
»Danke«, sagt der Reporter, »Sie sprechen mir aus der Seele.« Dann wendet er sich anderen zu: »Wer von Ihnen hat den Absturz gesehen?«
»Ich«, sagt einer. »Ich auch«, ein anderer.
»Darf ich Sie gleich mal ansprechen, wenn die Kamera läuft, und Sie schildern mir bitte kurz, was Sie gesehen haben, für die Abendschau?«
»Klar.«
»Können Sie sich bitte hier zusammenstellen, dann schwenken wir ein bisschen auf Sie.« Der Reporter zieht sich einen Moment zurück, sammelt sich, nimmt das Mikrofon.
»Fertig?«, fragt der Kameramann.
»Von mir aus können wir.«
»Na dann …« Der Kameramann verschwindet hinter der Kamera, kneift ein Auge zu. Der Reporter strafft sich.
»Es läuft«, sagt der Kameramann, »und bitte.«
»Von dem abgestürzten Flugzeug ist nichts zu sehen. Die Polizei gab eben eine Meldung durch, dass das Rauchen in unmittelbarer Umgebung der Stößenseebrücke eingestellt werden soll, da Explosionsgefahr besteht. Als die ersten Feuerwehrzüge am Absturzort eintrafen, ragte nur ein Teil des Leitwerkes der Maschine aus dem Wasser heraus. Die Kanzel hatte sich in den morastigen Boden gegraben. Im Übrigen wurde sofort die höchste Alarmstufe gegeben und eine unübersehbare Zahl von Rettungsfahrzeugen stellte sich im benachbarten Waldgelände in Bereitschaft.«
Er wendet sich den Männern zu, die neben ihm stehen.
»Meine Herren, Sie haben gesehen, wie das Flugzeug abgestürzt ist. Was konnten Sie beobachten?«
»Wir konnten nur den Flug sehen. Kam im Steilflug an und dann gab es einen Knall und in dem Moment war er im See verschwunden.«
Der zweite Mann nickt. »Ich hab es gesehen. Der kam an, fing an zu trudeln, die Triebwerke liefen nur noch ganz leise und dann hörte man nur noch einen dumpfen Aufknall. Ich war etwa zweihundert bis dreihundert Meter weg.«
Auch Radioreporter suchen nach Informationen. »Wir hörten oben das Brummen«, berichtet ein Mann dem RIAS, dem Rundfunk im amerikanischen Sektor. »Es war aber kein Flugzeug zu sehen, und ein Ehepaar machte uns darauf aufmerksam, dass aus dem blauen Dunst ein Flugzeug im Sturzflug nach unten kam. Als er hundert, hundertfünfzig Meter über dem Turm war, fing er zweimal an zu trudeln und kurz hinterher, wir waren ja auf der anderen Seite der Heerstraße, ging es patsch. Das war ein Zeichen, dass er nicht explodierte, dass er hier im Wasser aufschlug.«
Für die Berliner Feuerwehrtaucher gibt es nun doch wieder etwas zu tun. In Abstimmung mit den Briten schickt der Einsatzleiter sie zurück ins Wasser: »Sucht das Umfeld nach Wrackteilen ab.«
Unablässig tauchen die Männer, finden aber nichts von Bedeutung. Schließlich ein neuer Auftrag: »Versucht, Haltepunkte am Wrack zu finden. Damit wir das Ding anheben können.« Sie schaffen es, Gurte um das Flugzeug zu legen. Nach einer Weile trifft ein Prahm ein, eine Plattform mit einem kleinen Kran darauf. Klaus Abraham und seine Kollegen betrachten aus geringer Entfernung, wie das Gerät zum Einsatz kommt. Der Ponton bewegt sich, nicht das Flugzeug. Der Kran ist zu schwach.
»Ein größerer ist bereits unterwegs«, sagt der Einsatzleiter. »Ihr bleibt so lange hier, bis die Bergungsaktion gelaufen ist. Falls hier irgendwas Feuer fängt. Da ist ja noch Treibstoff drin.«
Jetzt heißt es warten.
Um 17:35 Uhr geben die Briten eine erste relativ nichtssagende Meldung an die Presse heraus. Ein Sprecher der Alliierten bestätigt darin lediglich den Absturz eines »nicht identifizierten Flugzeugs«. Weiter heißt es, es gäbe »Hinweise« darauf, dass es sich um eine sowjetische Militärmaschine handele, doch »das Flugzeug ist so tief im Schlamm eingegraben, dass es nicht möglich ist, das zu bestätigen.«
Gerüchte machen die Runde, die Kanzel sei leer. Die Piloten hätten sich mit dem Schleudersitz gerettet, seien über West-Berlin abgesprungen, vielleicht auch noch über dem Osten der Stadt. Berliner Polizei und Alliierte suchen mit einem Großaufgebot nach den feindlichen Soldaten. Auch Hubschrauber sind im Einsatz.