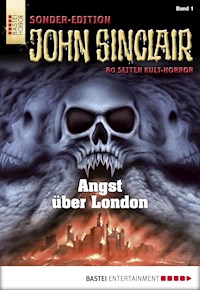
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: John Sinclair Sonder-Edition
- Sprache: Deutsch
John Sinclair ist der Sohn des Lichts. Der Kampf gegen die Mächte der Finsternis ist seine Bestimmung. Als Oberinspektor bei Scotland Yard tritt er Woche für Woche gegen Zombies, Werwölfe, Vampire und andere Höllenwesen an und begeistert weltweit eine treue Fangemeinde.
Mit der John Sinclair Sonder-Edition werden die Taschenbücher, die der Bastei Verlag in Ergänzung zu der Heftromanserie ab 1981 veröffentlichte, endlich wieder zugänglich. Die Romane, in denen es John Sinclair vor allem mit so bekannten Gegnern wie Asmodina, Dr. Tod oder der Mordliga zu tun bekommt, erscheinen in chronologischer Reihenfolge alle zwei Wochen, natürlich auch als E-Book.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 167
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Angst über London
Vorschau
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
© 2015 by Bastei Lübbe AG, Köln
Verlagsleiter Romanhefte: Dr. Florian Marzin
Verantwortlich für den Inhalt
Titelbild: Rainer Kalwitz/Rainer Kalwitz
E-Book-Produktion: César Satz & Grafik GmbH, Köln
ISBN 978-3-7325-1604-9
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
www.bastei.de
John Sinclair ist der Sohn des Lichts. Der Kampf gegen die Mächte der Finsternis ist seine Bestimmung. Als Oberinspektor bei Scotland Yard tritt er Woche für Woche gegen Zombies, Werwölfe, Vampire und andere Höllenwesen an und begeistert weltweit eine treue Fangemeinde.
Mit der John Sinclair Sonder-Edition werden die Taschenbücher, die der Bastei Verlag in Ergänzung zu der Heftromanserie ab 1981 veröffentlichte, endlich wieder zugänglich. Die Romane, in denen es John Sinclair vor allem mit so bekannten Gegnern wie Asmodina, Dr. Tod oder der Mordliga zu tun bekommt, erscheinen in chronologischer Reihenfolge alle zwei Wochen in einer 80seitigen Heftromanausgabe.
Lesen Sie in diesem Band:
Angst über London
von Jason Dark …
Die medial begabte Miriam di Carlo spürte als Erste, dass etwas nicht stimmte.
Irgendwas war anders in dieser Novembernacht.
Sie schreckte aus dem Schlaf hoch, saß aufrecht im Bett, hatte die Augen weit geöffnet und starrte in die Dunkelheit. Gleichzeitig lauschte sie. Nichts …
Es blieb ruhig in der obersten Etage des hohen Hauses, in dem Miriam mit zahlreichen anderen Mietern wohnte. Hier erreichte sie auch nicht der Widerschein der Leuchtreklamen. Man kam sich vor wie auf einer Insel.
»Warum bin ich wach geworden«, murmelte sie und fuhr sich mit gespreizten Fingern durch das dunkelbraune zerwühlte Haar, als zwischen den Fingern auf einmal Funken sprühten.
Miriams Hand zuckte zurück. Sie war elektrisch aufgeladen, das geschah immer, wenn ein großes Ereignis dicht bevorstand. Wenn sie ihre Ahnungen hatte und spürte, dass eine fremde Macht in diese Welt eingriff.
Miriam hatte aus ihrer Begabung nie ein Geschäft gemacht. So etwas widerte sie an. Sie behielt ihre Ahnungen und Träume lieber für sich, was vielleicht auch nicht immer gut war. Doch Miriam wollte nicht ins Rampenlicht der Öffentlichkeit gezerrt werden. Sie hasste Publicity. Sie wollte lieber unerkannt bleiben und als Sachbearbeiterin in einem Industrieunternehmen weiterhin ihre Brötchen verdienen.
Aber noch nie hatte sie die Gefahr mit einer solchen Deutlichkeit gespürt wie jetzt, und das erschreckte sie zutiefst.
Ich muss etwas tun, dachte sie, warf die leichte Bettdecke zurück und schwang ihre langen Beine über die Kante. Auf nackten Sohlen trat sie ans Fenster und schob den Vorhang ein wenig zur Seite.
Miriam schaute durch den Spalt. Dunkelgrau lag der Himmel. Gewaltige Wolken verdeckten die Gestirne.
Miriam di Carlo atmete tief durch. Sie stützte die Handballen auf die kalte Fensterbank. Ihr Atem traf die Scheibe, die leicht beschlug. Das lange Haar fiel nach vorn. Einige Strähnen verdeckten ihr ebenmäßiges Gesicht wie ein Vorhang.
Die dreißigjährige Miriam konnte man als eine schöne Frau bezeichnen. Sie hatte eine sportliche Figur und war genau an den Stellen gerundet, die Männern ins Auge fallen. Sie war immer modisch gekleidet und hatte grünblaue Augen, die eine samtene Wärme ausstrahlten. Sie hätte es leicht gehabt bei Männern, doch sie war gewarnt. Eine Ehe hatte sie hinter sich. Ihr Mann hatte sie betrogen. Miriam hatte es dank ihrer medialen Begabung gespürt, sie hatte es ihm auf den Kopf zugesagt – und das war dem Ehemann unheimlich gewesen. Er hatte sich verdrückt. Vor so einer Frau konnte man ja nichts verstecken.
Das war mittlerweile fünf Jahre her.
Miriam wollte sich gerade umdrehen und zum Bett zurückgehen, als sie das Gefühl hatte, ihr Kopf würde in einen Schraubstock gepresst.
Miriam stöhnte auf, hob die Hände und legte sie auf die Wangen. Mit schreckgeweiteten Augen blickte sie hinunter auf London.
Die Perspektive hatte sich plötzlich verzerrt. Als hätte jemand die Proportionen bei einem Gemälde verschoben. Big Ben befand sich ganz in der Nähe, der Tower, Victoria Station, die hohen Häuser, die Menschen …
»Nein!«, flüsterte sie, »nein, das gibt es nicht, das darf nicht wahr sein, bitte …« Was Miriam di Carlo sah, war der Untergang Londons. Das große Entsetzen, das gewaltige Chaos.
Gebäude stürzten ein, Big Ben zerbröckelte, der Bahnhof zerbrach, die Brücken fielen in die Themse, der Tower sah aus wie nach einem schweren Bombenangriff.
Und dann die Menschen. Sie waren am allerschlimmsten betroffen. Ihre Wohnhäuser waren nicht mehr zu retten. Schreiend rannten die Verzweifelten auf die Straße, wo sie von den einstürzenden Mauern der Häuser begraben wurden.
Viele wollten auch mit ihrem Wagen fliehen. Die Ampeln funktionierten nicht mehr, viele Straßen waren verschüttet.
Dies alles sah Miriam mit erschreckender Deutlichkeit, und sie wusste, dass es auch eintreffen würde. Noch nie hatten ihre seherischen Fähigkeiten versagt.
»Mein Gott!« Sie taumelte zurück und spürte, wie heiß ihre Wangen auf einmal waren. Eine Art Nervenfieber schüttelte sie. Zum Glück befand sich das Bett in ihrem Rücken. Mit den Waden stieß sie dagegen. Sie fiel auf die Decke und blieb liegen.
Ihr Atem ging schnell und keuchend. Der Schweiß lag wie eine Ölschicht auf ihrer Stirn. Sie konnte einfach nicht mehr, dieser Anblick war schwer zu verkraften.
Natürlich hatte sich auch ihr Herzschlag beschleunigt. Das Blut rauschte durch die Adern, in ihrem Kopf hämmerte und pochte es. Sie hatte bereits zahlreiche Visionen gehabt, doch so stark und vor allen Dingen so grauenhaft waren sie noch nie gewesen.
Wach lag Miriam di Carlo auf dem Bett und starrte gegen die Decke, die in der Dunkelheit nur schemenhaft zu ahnen war.
Es dauerte fast eine halbe Stunde, bis sie sich einigermaßen beruhigt hatte. Danach begann sie zu überlegen, was zu tun war.
Sollte sie zur Polizei gehen? Kaum, denn da lachte man sie aus. Nicht zum ersten Mal wäre das geschehen. Bei den nüchtern denkenden Beamten hielt man nicht viel von ihren Wahrnehmungen und Voraussagen.
Diese Möglichkeit fiel also weg.
Sollte sie die Stadt verlassen? Fliehen, solange noch Zeit war? Auch die Alternative schloss sie in ihre Überlegungen mit ein, andererseits wäre sie sich feige vorgekommen. Hatte sie nicht die Pflicht, etwas zu tun?
Sie hing an London. Diese gewaltige, herrliche Millionenstadt an der Themse durfte nicht dem Untergang geweiht werden.
Aber konnte sie das überhaupt verhindern?
Miriam war realistisch genug, um ihre Möglichkeiten abzuschätzen. Nein, sie würde es kaum schaffen. Dazu reichte die Kraft nicht. Sie war nicht so stark.
»Ich werde noch wahnsinnig«, murmelte sie und richtete sich auf. Dabei beugte sie sich zur Seite, und ihre tastende Hand fand den Schalter der Nachttischlampe. Sie machte Licht.
Miriam di Carlo stand auf und schritt um ihr Bett herum. Sie ging wie eine alte Frau. Gebeugt, sorgenschwer …
Die kleine Küche lag dem Schlafzimmer gegenüber. Miriam verspürte plötzlich Durst. Sie wollte sich etwas zu trinken holen, ihre Kehle fühlte sich an wie ein Reibeisen. Sie öffnete die Kühlschranktür und griff zur Flasche mit dem Mineralwasser. Sie nahm sich nicht die Zeit, ein Glas zu nehmen, sondern trank direkt aus der Flasche.
Das kalte Wasser tat gut. Ein paar Mal atmete sie tief durch. Das dumpfe, drückende Gefühl im Kopf war geblieben. Die Angst ließ sich nicht so einfach ausradieren.
Miriam verließ die Küche und ging zurück ins Schlafzimmer. In der Diele hing eine alte Uhr. Es war zwei Stunden nach Mitternacht.
Noch einmal schaute sie aus dem Schlafzimmerfenster. Ihre Augen wurden groß, sie begann zu zittern, denn der Himmel hatte sich verändert.
Er war nicht mehr so grau wie zuvor, sondern zeigte einen rötlichen Schein. Und dieser Schein kam von einem Gesicht, das in seiner kalten Schönheit beeindruckend war. Und irgendwie passten sogar die beiden Hörner dazu, die aus der Stirn wuchsen.
Miriam hatte das Gefühl, als würden die kalten, erbarmungslosen Augen nur sie anschauen, und der Mund verzog sich dabei zu einem wissenden, spöttischen Lächeln.
Miriam di Carlo kannte die Frau nicht, sie hatte sie noch nie gesehen und auch nichts von ihr gehört. Sie wusste nicht, dass es sich um Asmodina, die Tochter des Teufels, handelte.
***
Ich schlief sehr unruhig. Den Grund wusste ich nicht, es war halt so.
Gegen zwei Uhr wurde ich zum ersten Mal wach.
Ich stand sogar auf, streckte mir im Spiegel der Diele die Zunge heraus und ging durch die Wohnung.
Alles war ruhig, verändert hatte sich nichts. Auf dem Tisch stand noch die volle Bierflasche vom Abend. Ich nahm sie mit in die Küche, stellte sie in den Kühlschrank und trank einen Schluck Saft.
Obwohl mein Durst gelöscht war, wollte das unruhige Gefühl in mir nicht weichen. Irgendetwas lag in der Luft, das spürte ich genau, und ich hatte in den vergangenen Jahren gelernt, auf solche Zeichen zu achten.
Auch spürte ich ein leichtes Brennen auf meiner rechten Wange. Dort saß die sichelförmige Narbe, die ich einem meiner Erzfeinde, Dr. Tod, zu verdanken hatte.
Ich ging wieder zurück ins Schlafzimmer und stieß mir an der Tür den linken großen Zeh, weil ich barfuß lief. Ich setzte mich auf die Bettkante. Oft dachte ich über die Zukunft und auch die Vergangenheit nach, vor allen Dingen in Nächten, wo ich wenig Schlaf fand.
Aber warum konnte ich nicht schlafen? Eine Bedrohung, eine Vorahnung, etwas Schlimmes, das in der Luft lag.
Bei diesem Gedanken stockte ich. Sollte das tatsächlich der Fall sein, stand mir was bevor. Manchmal hat man ja einen sechsten Sinn, und ich hatte mir angewöhnt, auf mein Unterbewusstsein zu hören. Es hat mich selten im Stich gelassen.
Zwei Uhr vierundzwanzig! Fast eine halbe Stunde war ich schon auf den Beinen. Das musste sich ändern.
Ich legte mich wieder zurück, schloss die Augen und versuchte einzuschlafen. Es klappte nicht.
Auch das berühmte Schäfchenzählen brachte mir keinen Erfolg, die innere Unruhe war zu groß. Manchmal hatte ich das Gefühl, mein Blut würde schneller als sonst durch die Adern laufen, die Aufregung, die Nervosität machten sich bemerkbar. Ich öffnete die Augen und starrte gegen die Decke.
Wer oder was braute sich da wieder zusammen? Diese Frage quälte mich. Ich lag weiterhin wach, überlegte hin und her, doch zu einem Ergebnis kam ich nicht.
Schließlich fiel ich doch in einen unruhigen Schlaf, der mit seltsamen Träumen gespickt war.
Dann wurde ich wieder wach.
Fünf Uhr! Auf die Minute.
Oder nicht? Die Zeiger meiner Uhr waren stehen geblieben. Es konnte durchaus später sein.
Ich stand auf und schaute aus dem Fenster. Draußen war es noch dunkel, kein heller Streifen zeigte sich am Horizont. Der würde erst später auftauchen.
Demnach war die Uhr doch stehen geblieben und der Wecker auch. Seltsam, wirklich. Wenn eine Uhr stehen geblieben wäre, hätte ich das noch verstanden, aber beide gleichzeitig, das war mehr als ungewöhnlich. Dabei ahnte ich zu diesem Zeitpunkt nicht, was mir alles noch widerfahren sollte und dass ich in den schlimmsten Fall meines Lebens hineingeriet. Ich zog die Uhr auf. Zuerst die am Arm, dann den Wecker. Und trotzdem liefen sie nicht.
Das war doch nicht möglich. Zwei Uhren auf einmal defekt. Dahinter steckte schon Methode.
Schlafen konnte ich sowieso nicht mehr, deshalb stand ich auf und überlegte, ob ich Suko fragen sollte. Vielleicht war ihm eine ähnliche Sache passiert.
Nein, Shao und Suko wollten sicherlich noch schlafen. Ich konnte ihn nachher vom Büro aus anrufen.
Ich schlüpfte aus dem Schlafanzug und stellte mich unter die Dusche.
Zuerst heiß, dann kalt und so weiter.
Als ich mich abtrocknete, fühlte ich mich so, als hätte ich sechs Stunden geschlafen und nicht nur drei.
Während ich mit dem Elektrorasierer meine Stoppeln wegschabte, dachte ich wieder über die beiden Uhren nach. Ich wollte sie mit ins Büro nehmen und später bei einem Uhrmacher vorbeibringen.
Noch vor dem Anziehen, setzte ich Kaffeewasser auf, steckte Toast in den Röster und holte Marmelade und Käse.
Ich erzähle das alles der Reihe nach, weil auch die Kleinigkeiten eine große Bedeutung bekommen sollten.
Alles lief völlig normal. Das Einzige war eben, dass meine Uhren nicht mehr tickten und ich fast zwei Stunden früher auf den Beinen stand als gewöhnlich.
Ich trank den Kaffee. Er war nicht mal halb so gut wie der von Glenda Perkins. Auf ihren Kaffee freute ich mich besonders. Hoffentlich kam sie heute ein paar Minuten früher, damit ich nicht so lange zu warten brauchte.
Ich ließ mir Zeit mit dem Frühstück und fuhr gegen sechs Uhr nach unten in die Tiefgarage, wo auch mein Bentley stand. Unterwegs nahm ich noch eine Zeitung mit.
Mit mir zusammen verließen einige Frühaufsteher die Garage.
Zum Glück herrschte noch nicht so viel Verkehr. Ich kam gut voran und benötigte für die Strecke zum Yard zehn Minuten weniger als sonst.
Wie schon oft benutzte ich den Hintereingang. Der Portier sah mich nicht. Er stand gebeugt in seiner Kanzel und kramte in einer Schublade herum.
Ein Lift stand bereit, und ich fuhr hoch in mein Büro.
Ich machte Licht, setzte mich hinter meinen Schreibtisch und hörte auf das Summen der Heizung. Dann blätterte ich die Zeitung durch, las hier und da einen Artikel.
Mein Blick fiel auf den Aktenstapel. Da hatte sich wieder einiges angesammelt, zudem fehlte noch eine Spesenabrechnung.
Die füllte ich aus und legte sie Glenda auf den Schreibtisch. Alles okay.
Die Berichte über die Vorfälle der Nacht waren schon eingetroffen. Bei einer Zigarette sah ich sie durch. Viel war nicht passiert und schon gar nichts, was mich beruflich hätte interessieren können. Das Wetter im November hielt selbst Ganoven zurück und die Dämonen scheinbar auch.
Auf dem Flur schlugen die Türen. Die ersten Mitarbeiter trafen ein. Ich hoffte, dass Glenda auch dabei sein würde. Dann bekam ich endlich meinen Kaffee.
Sie kam noch nicht.
Die Zeit verging viel zu langsam. Ich holte meine Uhren hervor und stellte sie auf den Schreibtisch, damit ich sie nur nicht vergaß. Allerdings fühlte ich mich ohne Armbanduhr irgendwie nackt, deshalb legte ich sie doch um.
Draußen wurde es langsam hell. Der erste graue Streifen kroch über den Himmel und wurde immer breiter. Er schob die Dunkelheit der Nacht regelrecht weg.
Dann kam Glenda.
Ich sah sie nicht, sondern hörte sie. Meine Sekretärin erkannte ich schon am Gang auf dem Flur. Diese schnellen, etwas hastigen Schritte waren zu markant.
Glenda betrat das Vorzimmer. Sie drückte die Tür zu und wandte sich um.
Glenda trug einen Trenchcoat, der in der Taille von einem Gürtel gehalten wurde.
Ich hatte mich erhoben.
Jetzt musste sie mich sehen.
Sie sah mich auch, doch ihr Gesicht nahm einen ungeheuer erstaunten Ausdruck an.
Ich lachte. »Da staunen Sie, was? So früh bin ich schon im Büro, liebe Glenda. Und jetzt seien Sie so gut und kochen mir eine Tasse von Ihrem Besten.«
Glenda schüttelte den Kopf. Anscheinend konnte sie noch immer nicht fassen, mich hier zu sehen.
Mein Lächeln zerbrach. »Ist irgendetwas? Habe … habe ich etwas an mir?«
»Nein, nein, Mister.«
Mister, hatte sie gesagt! Komisch …
»Was ist?«
Glenda Perkins schluckte. »Wer … wer sind Sie, Mister? Und was machen Sie in diesem Büro?«
***
Das gab es doch gar nicht! Glenda Perkins kannte mich nicht mehr oder wollte mich nicht kennen. Ganz ruhig bleiben, sagte ich mir, ganz ruhig.
Ich lächelte noch. »Sie fragen also, wer ich bin, nicht wahr?«
»Ja.«
»Ich bin John Sinclair. Oberinspektor John Sinclair. Angestellter Ihrer Majestät der Königin. Alles klar?«
»Sie sind nicht John Sinclair!«
Die Antwort klang so bestimmt, dass mir mein Lächeln auf den Lippen gefror.
»Wiederholen Sie das noch mal, bitte!«
»Gern.« Glenda sagte mir die gleichen Worte.
Ich verstand die Welt nicht mehr. Entweder war sie verrückt oder ich. »Okay, ich bin nicht John Sinclair. Dann seien Sie wenigstens so gut und machen mir einen Kaffee.«
»Wie käme ich dazu, für einen Fremden Kaffee zu kochen«, erklärte mir Glenda.
Das war starker Tobak!
Ich setzte mich.
Glenda kam näher. Vor meinem Schreibtisch blieb sie stehen. Ihre dunklen Augen blitzten. »Und jetzt verschwinden Sie hier, Mister. Aber auf der Stelle. Hauen Sie ab. Ich will Sie nicht mehr hier sehen. Machen Sie, dass Sie wegkommen!« Ihr Gesicht wurde rot vor Anstrengung. Sie war auch wütend.
Nicht nur sie. Auch meine Geduld war zu Ende.
»Verflucht noch mal!«, zischte ich. »Was wird hier eigentlich gespielt? Bin ich in einem Irrenhaus gelandet?«
Ich schüttelte den Kopf und schlug mir gegen die Stirn.
»Ich heiße John Sinclair. Soll ich Ihnen, meiner Sekretärin, noch den Ausweis zeigen, um dieses zu beweisen?«
»Nein, das ist nicht nötig.«
»Na bitte. Dann ist ja alles okay.« Ich lächelte wieder. »Kochen Sie mir endlich einen Kaffee. Bitte …«
Glenda ging überhaupt nicht auf das Thema ein. »Sie sind also nicht willens, das Büro zu räumen?«
»Nein.«
»Das ist Ihr letztes Wort?«
»Sicher!«
»Dann lasse ich Sie entfernen.« Glenda machte auf der Stelle kehrt und ging in ihr Büro.
Zwei Sekunden hockte ich wie angewachsen auf meinem Stuhl. Dann sprang ich auf. Ich brauchte weniger Schritte als Glenda. Noch bevor sie den Hörer abnahm, war ich bei ihr und riss sie an der Schulter herum.
»Lassen Sie mich los!«, fauchte Glenda.
»Nein!«
Klatsch! Da hatte ich eine Ohrfeige sitzen. Meine linke Wange fing sofort an zu brennen. Ich wusste überhaupt nicht, was ich sagen sollte. Glenda Perkins, meine Sekretärin, hatte mir eine Ohrfeige gegeben.
Das gab’s doch nicht. Die musste verrückt geworden sein.
Glenda wandte sich wieder dem Telefon zu. Da jedoch wurde die Tür aufgestoßen.
Sir James Powell erschien.
Glenda wirbelte herum. Erleichterung machte sich auf ihrem, aber auch auf meinem Gesicht breit. Jetzt würde bald alles geklärt sein.
Bevor ich noch etwas sagen konnte, hatte Glenda schon reagiert. »Sir!«, rief sie laut, und ihre Stimme vibrierte dabei. »Diese Person«, dabei deutete sie auf mich, »saß hier in Sinclairs Büro und behauptet frech, John Sinclair zu sein.«
Sir James nickte. Dann drehte er den Kopf und schaute mir ins Gesicht. Die Augen hinter seinen dicken Brillengläsern funkelten und in mir machte sich so etwas wie eine Ahnung breit.
»Wer sind Sie?«, fragte mich mein Chef.
Nein! Das durfte doch nicht wahr sein. Da lief doch was falsch. Waren denn alle hier wahnsinnig?
»Ich bin John Sinclair!«, wiederholte ich zum x-ten Mal. »Oberinspektor bei Scotland Yard. Und Sie sind Sir James Powell, mein Vorgesetzter und stehen im Range eines Superintendenten. Habe ich mich deutlich genug ausgedrückt?«
»Das haben Sie. Aber Sie können nicht behaupten, John Sinclair zu sein. Tut mir leid.«
Ich hob die Schultern. Dann lachte ich. Lauthals schallte mein Lachen. Die Kollegen im Flur mussten es hören, bis Sir Powell eingriff.
»Halten Sie Ihren Mund!«
Mein Lachen brach ab.
Der Superintendant fixierte mich scharf. »Wenn Sie nicht freiwillig gehen, lasse ich Sie hinauswerfen!«
»Ich denke gar nicht daran!«
Sir James Powell drehte sich um und ging zur Tür.
»Moment!«, sagte ich. »Brauchen Sie Beweise, dass ich John Sinclair bin?«
»Nein, Sie sind es nicht und fertig.«
»Aber ich habe mein Kreuz, ich habe meine Beretta, meinen Ausweis. Ich kann Ihnen …«
»Sie können nur verschwinden!« Sir Powell öffnete die Tür.
Sekundenlang starrte ich in den Flur. Ich überlegte, ob ich es darauf ankommen lassen sollte, entschied mich aber dafür, den Rückzug anzutreten.
Auf dem Flur schaute ich mich nicht um. Kollegen begegneten mir. Sie grüßten, als wäre ich ein Fremder.
Mit dem Lift fuhr ich nach unten.
Jetzt hielt mich der Pförtner an. »Wo wollen Sie hin?« Er hatte gesehen, dass ich den Hinterausgang benutzte.
»Zum Parkplatz. Dort steht mein Wagen.«
Der Mann schaute mir nach, bis ich die Fahrertür geöffnet hatte. Wütend knallte ich sie ins Schloss.
Ich drehte mich zur Seite und blickte an der Fassade des Yard Building hoch. Es war zu meiner zweiten Heimat geworden. Und man hatte mich rausgeworfen wie einen räudigen Hund.
Was steckte dahinter?
***
Ich fuhr nach Hause. Diesmal allerdings langsam, denn ich wollte und ich musste nachdenken.
Man hatte mich nicht erkannt. Das war alles. Ich war plötzlich für die Kollegen im Yard ein Fremder. Was war geschehen?
An einer Ampel musste ich halten. Ich schaute aus dem Fenster. Links sah ich den St. James Park. Die Bäume hatten mittlerweile ihr letztes Laub verloren. Ein skurriles Gebilde aus kahlen Ästen reckte sich dem bleifarbenen Novemberhimmel entgegen. Einige Krähen hockten auf den Ästen. Die schwarzen Vögel passten zu dieser Zeit.
Hinter mir wurde gehupt. Die Ampel war längst umgesprungen, ich gab wieder Gas und fuhr langsam an.





























