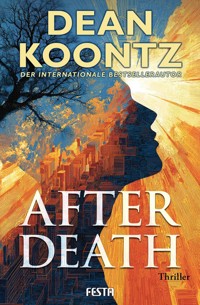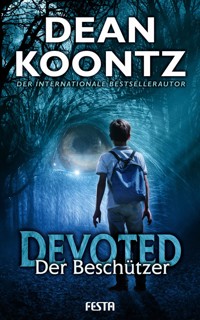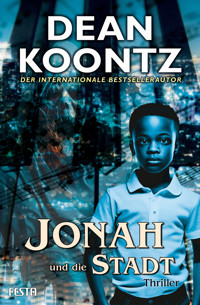
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Festa Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Jonah Kirk ist neun Jahre alt. Für ihn gibt es nichts Wichtigeres als seine Familie, seine Freunde und die elektrisierende Kraft der Musik. Aber Jonahs Leben wird sich für immer verändern. Erst wird er von einer rätselhaften Frau gewarnt, die sich selbst »Die Stadt« nennt. Dann suchen ihn prophetische Visionen und Albträume heim – bis er das erschreckende Geheimnis seiner Stadt entdeckt … Zusätzlich enthalten ist die Vorgeschichte zum Roman, die schildert, wie in einer dunklen Nacht ein geheimnisvoller neuer Nachbar in das Haus nebenan einzieht. The Times: »Dean Koontz ist nicht nur der Experte für unsere dunkelsten Träume, sondern auch ein literarischer Künstler.« Dean Koontz ist neben Stephen King der weltweit meistverkaufte Meister der dunklen Spannung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 641
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Aus dem Amerikanischen von Patrick Baumann
Impressum
Die amerikanische Originalausgabe The City
erschien 2014 im Verlag Bantam Books.
Copyright © 2014 by The Koontz Living Trust
Die amerikanische Originalausgabe The Neighbor
erschien 2014 im Verlag Bantam Books.
Copyright © 2014 by The Koontz Living Trust
Copyright © dieser Ausgabe 2023 by Festa Verlag GmbH, Leipzig
Titelbild: Kim Isaak
Alle Rechte vorbehalten
eISBN 978-3-98676-086-1
www.Festa-Verlag.de
DER NACHBAR
1
Mein Name ist Malcolm Pomerantz, und ich bin ein Axtschwinger, aber nicht so einer wie in den Reality-TV-Serien über Holzfäller. Wäre ich diese Art von Axtschwinger, hätte ich mir wohl schon längst beide Füße abgehackt oder wäre von einem umstürzenden Baum erschlagen worden. Mein ganzes Leben lang bin ich ungeschickt gewesen. Ich blieb nur deshalb von einem Unfalltod verschont, weil mein Beruf – ich bin Musiker – nicht erfordert, dass ich mit Elektrowerkzeugen hantieren oder mich durch tückisches Gelände bewegen muss. Axt ist Musiker-Slang für Instrument, und meine Axt ist ein Saxofon. Ich spiele seit meinem siebten Lebensjahr. Damals haben ich und das Saxofon noch beinahe dieselbe Größe gehabt.
Jetzt bin ich 59, zwei Jahre älter als Jonah, der seit einem halben Jahrhundert mein bester Freund ist. Ich bin groß, Jonah nicht. Ich bin weiß, er ist schwarz. Als ich ihm im Sommer 1967 zum ersten Mal begegnete, war Jonah zehn. Er war flink, elegant, ein Piano-Wunderkind. Ich war zwölf und stapfte umher wie Lurch, der Butler aus Addams Family, einer Serie, die im vorangegangenen Jahr ein großer Fernseherfolg gewesen war. Als ich ihn zum ersten Mal spielen hörte, rockte er die Tasten mit Fats Dominos I’m Gonna Be A Wheel Someday. 1967 sollte sich für uns beide als ein Jahr erweisen, das … unvergesslich war.
Auf mein Drängen hat Jonah vor Kurzem die Geschichte seines Lebens – oder zumindest eines merkwürdigen, turbulenten Abschnitts davon – auf Tonband gesprochen. Aus seiner Erzählung wurde ein Buch mit dem Titel Die Stadt. Mein Leben nachzuerzählen würde keinen Sinn ergeben, denn das Interessanteste daran ist das, was geschah, während ich Zeit mit Jonah verbrachte. All das hat er bereits berichtet. Doch ich habe noch eine kleine Erfahrung zu erzählen, eine sonderbare Abfolge von Ereignissen, die ein paar Wochen vor meiner ersten Begegnung mit ihm stattfanden. Ebenso wie seine spannendere Story legt auch die meine nahe, dass die Welt meist rätselhafter ist, als sie erscheint, während wir von morgens bis abends unserer beruhigenden Tagesroutine nachgehen.
Meine Schwester Amalia war damals 17, fünf Jahre älter als ich, aber wir standen uns so nahe, als wären wir Zwillinge. Nicht dass wir uns ähnlich gesehen hätten. Sie band ihr blondes Haar zu einem Pferdeschwanz, war geschmeidig und zierlich, steckte so voller Begeisterung für das Leben, dass ihr Strahlen sowohl bei Licht als auch bei Dunkelheit nicht nur der Einbildungskraft ihres sie bewundernden kleinen Bruders entsprungen sein konnte. Ich dagegen war ein tollpatschiger Zwölfjähriger mit einem Adamsapfel, der mich aussehen ließ, als hätte ich einen ganzen Granny-Smith-Apfel geschluckt, der in meiner Kehle stecken geblieben war. Obwohl ihre Garderobe nicht besonders umfangreich war, trug Amalia zu jeder Gelegenheit die passende Kleidung und sah immer aus, als wäre sie einem Sears-Katalog entstiegen. Da ich runde Schultern hatte und meine Arme so unverhältnismäßig lang waren wie die eines Orang-Utans, versuchte ich, meine unvorteilhafte Figur zu verbergen, indem ich mich kleidete wie ein Erwachsener. Weil ich jedoch blind für Mode war, lenkte ich dadurch nur noch mehr Aufmerksamkeit auf meine schlaksige Gestalt: schwarze Wingtips, aber mit weißen Socken; Anzughosen, die mir bis mehrere Zentimeter über den Bauchnabel reichten; kurzärmlige Hemden mit breitem Kragen, die ich bis zum Hals zuknöpfte.
Mit zwölf Jahren dachte ich noch nicht viel an Mädchen. Vielleicht war mir bereits bewusst, dass ich auch als Erwachsener mit meinem langen, blassen Gesicht und den trüben Augen hinter dicken Brillengläsern niemals ein Kerl sein würde, dem die hübschen Mädchen in Scharen nachliefen. Ich hatte die Liebe meiner Schwester und mein Saxofon, und das genügte mir.
Das musste es auch, denn Amalia und ich hatten kein Familienleben, das sich für eine Fernsehserie wie Ozzie and Harriet oder Erwachsen müsste man sein geeignet hätte. Unser alter Herr war Maschinist, der Vorarbeiter einer ganzen Werkstatt voller Dreher. Meistens blieb er stumm wie ein Felsbrocken. Er war ein kühler Mann, der allein durch seinen Blick seine Missbilligung zum Ausdruck bringen konnte sowie seinen glühenden Wunsch, jemanden an seiner Drehbank zu etwas Ansprechenderem umzuformen. Was für einen frommen Katholiken die Hostie ist, waren für ihn Chesterfield-Zigaretten. Amalia hat nachdrücklich die Ansicht vertreten, dass er nicht kaltherzig, sondern nur vom Leben verletzt und emotional isoliert sei. Unsere Mutter sah gern rund um die Uhr fern, nur unterbrochen von Klatsch und Tratsch mit Mrs. Janowski, die nebenan wohnte, sowie den Lucky-Strike-Zigaretten, von denen sie so viele rauchte, als hinge die Zukunft der Erde davon ab, und das selbst während der Mahlzeiten, die sie meist im Wohnzimmer von einem Tablett zu sich nahm. Sie war stolz darauf, eine gute Hausfrau zu sein, was in ihrem Fall bedeutete, dass sie sämtliche Arbeit effizient an Amalia und mich delegierte.
Der König und die Königin unseres kleinen Schlosses der unteren Mittelschicht sprachen so selten miteinander, dass man hätte annehmen können, dass ihre Kommunikation vor allem telepathisch stattfand. Doch selbst wenn das der Fall war, verriet ihr Verhalten, dass sie so gut wie jeden telepathischen Austausch miteinander verabscheuten. Amalia sagte, dass vor langer Zeit irgendetwas Bedeutendes zwischen unseren Eltern vorgefallen sein musste, dass sie einander verletzt hatten, dass sie sich darüber alles gesagt hatten, was es zu sagen gab, und sich nicht überwinden konnten, einander zu vergeben. Daher war für sie jede Unterhaltung miteinander qualvoll. Amalia nahm nie gern das Schlechteste über jemanden an, bevor derjenige sich eindeutig als unverbesserlich schlecht herausgestellt hatte.
Meine Schwester hatte mit acht Jahren begonnen, Klarinette zu spielen, nachdem ein Junge im nächsten Block, dessen Eltern ihm den Unterricht aufgezwungen hatten, rebelliert und überzeugend damit gedroht hatte, sich zu erhängen. Man hatte ihr das Instrument geschenkt, und sie hatte es vor allem deshalb erlernen wollen, weil sie wusste, dass es unsere Eltern stören würde. Sie hoffte, dass ihr Spiel ihnen so auf die Nerven gehen würde, dass sie sie zum Üben in die vom Haus getrennte Ein-Fahrzeug-Garage verbannen würden. Dort würde sie nicht mitansehen müssen, wie sie so entschlossen das Gespräch miteinander verweigerten. Dort roch die Luft nicht nach Chesterfields und Lucky Strikes, sondern nach Schmierfett, Reifengummi und Schimmel. Ihre Hoffnung wurde erfüllt. In den letzten Jahren, die wir noch im Haus wohnten, lauteten die Worte, die unsere Eltern am häufigsten aussprachen: »Geh doch in die Garage.« Sie sagten es nicht nur, wenn wir Klarinette oder Saxofon übten, sondern auch, wenn wir sie durch unsere bloße Anwesenheit von den Fernsehsendungen, dem Trinken und dem leidenschaftlichen Rauchen ablenkten.
Amalia wurde ziemlich gut an der Klarinette, aber ich stellte mich am Saxofon als ein Naturtalent heraus. Ich brachte mir alles selbst bei und versuchte ständig, mich zu verbessern, und sei es nur ein wenig. Das Saxofonspielen war die einzige Sache, in der ich glänzen konnte.
Mit ihrem Notendurchschnitt von 4,0 und ihrem beträchtlichen Schreibtalent war Amalia eine Amateurmusikerin, für die die Zukunft Größeres bereithielt als die Mitwirkung in einer Tanzkapelle. Obwohl unsere geistesabwesenden Eltern es für keine große Errungenschaft hielten, bekam sie aufgrund ihrer Noten, aber auch aufgrund einiger cooler Kurzgeschichten, mit denen sie verschiedene Preise gewonnen hatte, ein Vollstipendium an einer großen Universität.
Ich war stolz auf sie. Ich wollte, dass sie großen Erfolg hatte, dass sie den giftigen Wolken und der Düsternis unserer verbitterten Eltern entkam, die das Haus der Familie Pomerantz wie Poes Haus Usher kurz vor dessen Versinken im Sumpf erscheinen ließen. Gleichzeitig konnte ich mir nicht vorstellen, wie mein Leben wäre, wenn sie am Ende dieses Sommers weit wegging und die Universität besuchte. Dann wäre ich das einzige Familienmitglied, das sein Abendessen nicht von einem Tablett zu sich nehmen wollte.
Anfang Juni, fast einen Monat bevor ich hörte, wie Jonah Kirk im Haus seines Großvaters, das unserem gegenüberlag, diese Fats-Domino-Nummer rockte, geschah nebenan etwas Seltsames. Es war nicht das Haus im Osten, wo die Janowskis wohnten und wo meine Mutter regelmäßig mit Mrs. Janowski Klatschgeschichten austauschte, die meisten davon wahnhafte Fantasien über die ehelichen Beziehungen anderer Menschen in unserer Straße. Es handelte sich um das Haus direkt westlich von uns, das einmal Rupert Clockenwall gehört hatte und leer stand, seit der alte Mr. Clockenwall vor einem Monat an einem schweren Herzanfall gestorben war.
Das seltsame Ereignis begann eines Morgens um drei Uhr, als ich von einem ungewöhnlichen Geräusch geweckt wurde. Ich setzte mich im Bett auf. Das Geräusch schien nicht in meinem Zimmer gewesen zu sein. Ich war ziemlich sicher, dass es von draußen gekommen war. Vielleicht war es der letzte Klang eines Traums gewesen, der so bedrohlich gewesen war, dass er mich geweckt hatte. Er erinnerte an den Laut, der entsteht, wenn ein langes Schwert aus einer metallenen Scheide gezogen wird, wie Stahl, der über Stahl schleift.
Selbst in einem älteren Wohnviertel wie unserem, das weit von den Hochhäusern und der Hektik der Innenstadt entfernt liegt, ist es nie ganz still. Man lernt, schon lange bevor man zwölf Jahre alt ist, all das Rattern, Klirren und Hämmern der Stadt auszublenden, um nachts ausreichend schlafen zu können. Was mich jetzt weckte, klang fremdartig. Ich warf das Laken zurück und stieg aus dem Bett.
Zuvor hatte ich mit der Hoffnung auf Zugluft den unteren Fensterflügel hochgeschoben, aber die Nachtluft blieb warm und still. Als ich mich zum Fenster beugte, ertönte das Geräusch wieder und schien im Fenstergitter zu vibrieren, als hätte jemand mit der Klinge eines Stiletts über das Metall gestrichen. Erschrocken wich ich zurück.
Als dieses Schleifen ein drittes Mal erklang, diesmal leiser, stellte ich fest, dass es seinen Ursprung nicht wenige Zentimeter vor mir, sondern im Haus nebenan hatte. Ich beugte mich noch einmal näher zum Fenstergitter. Zwischen den Häusern wuchs eine uralte Platane, die in voller Blüte stand. Weil er vielleicht in seiner Jugend zu wenig Sonnenlicht bekommen oder eine Krankheit durchgemacht hatte, besaß dieser Baum eine verkrümmte Struktur und verdeckte mir die Sicht auf das Clockenwall-Haus nicht vollständig. Durch die krummen Äste sah ich Lampenlicht aus einem Fenster im Erdgeschoss dringen.
Der einzige noch lebende Angehörige des verstorbenen Rupert Clockenwall war dessen Bruder, der einen halben Kontinent entfernt wohnte. Bis alle Fragen bezüglich der Erbschaft geklärt waren, konnte das Haus nicht zum Kauf angeboten werden, und seit Mr. Clockenwalls Todestag hatte es auf dem Grundstück keinerlei Aktivitäten gegeben. Da ich wie alle Zwölfjährigen natürlich über viel Fantasie verfügte, stellte ich mir manchmal Dramen vor, wo es keine gab, und jetzt fragte ich mich, ob sich dort vielleicht ein Einbrecher gewaltsam Zutritt verschafft hatte.
Lampen erhellten nun ein weiteres Fenster im Erdgeschoss und bald darauf auch eines im ersten Stock. Durch die Gardinen vor dem oberen Fenster sah ich eine geschmeidige, dunkle Gestalt vorbeihuschen. Obwohl jeder sich bewegende Schatten vom Licht und von jeder Oberfläche, auf die er fällt, verformt wird, kam mir dieser hier besonders merkwürdig vor. Er erinnerte mich an die biegsamen Flossen von Mantarochen, die so elegant im Meer schwimmen, wie Vögel am Himmel fliegen.
Weil mich das Gefühl überkam, dass irgendeine unheimliche Person um das Clockenwall-Haus herumschlich, wartete ich eine Weile am offenen Fenster, atmete die warme Nachtluft und hoffte darauf, diesen geschmeidigen, schaurigen Schatten noch einmal zu sehen, und vielleicht auch noch mehr. Als mein Warten nicht durch irgendwelche trügerischen Umrisse oder weitere eigenartige Geräusche belohnt wurde, konnte schließlich nicht einmal mehr mein kindliches Verlangen nach Rätseln und Abenteuern meine Aufmerksamkeit fesseln.
Ich musste mir eingestehen, dass wahrscheinlich weder ein Einbrecher noch ein Randalierer sein Eindringen in ein fremdes Anwesen durch das Einschalten beinahe aller Lampen verraten würde.
Nach meiner Rückkehr ins Bett schlief ich bald wieder ein. Ich weiß noch, dass ich einen bösen Traum hatte, in dem ich mich in einer verzweifelten Lage befand, aber als ich mich um vier Uhr morgens plötzlich im Bett aufsetzte, konnte ich mich an diesen Albtraum nicht erinnern. Noch halb im Schlaf ging ich zum Fenster, nicht um das Haus nebenan zu beobachten, wo die Lichter immer noch schienen, sondern um den unteren Fensterflügel zu schließen. Ich schloss ihn auch ab, obwohl es heiß war und etwas Zugluft sehr willkommen gewesen wäre. Weshalb ich glaubte, das Fenster verriegeln zu müssen, weiß ich nicht mehr – ich weiß nur noch, dass ich das dringende Bedürfnis hatte, es zu tun.
Als ich wieder im Bett lag, verbrachte ich die letzte brütend heiße Stunde dieser Sommernacht im Halbschlaf und murmelte vor mich hin wie ein Malariakranker, der einen Fiebertraum hat.
2
Unser alter Herr aß zum Frühstück meistens ein Sandwich, für gewöhnlich Speck und Eier auf dick mit Butter bestrichenem Toast. Bei schlechtem Wetter stellte er sich zum Essen an die Küchenspüle und starrte in den kleinen Garten hinaus, stumm und geistesabwesend, als ob er über wichtige philosophische Fragen nachdachte – oder einen Mord plante. Auf dem Schneidbrett in der Nähe stand ein Becher Kaffee. Er hielt das Sandwich in der rechten Hand, eine Zigarette in der linken und bediente sich abwechselnd links und rechts. Wenn ich das sah, hoffte ich immer, dass er einmal aus Versehen in die Zigarette beißen oder versuchen würde, das Sandwich zu rauchen, aber leider passierte ihm das nie.
Am Morgen, nachdem ich die Aktivitäten im Clockenwall-Haus bemerkt hatte, aß er stattdessen auf der hinteren Veranda. Als er die Treppe hinunterging und sich auf den Weg zur Arbeit machte, ging ich und holte die Kaffeetasse und den Aschenbecher, die auf der flachen Oberfläche des Geländers balancierten. Während ich das Geschirr in der Küche spülte, servierte Amalia unserer Mutter im Wohnzimmer das Frühstück. Im Fernsehen wurde irgendein Filmstar vom Moderator einer Morgensendung interviewt, und die beiden schienen sich in der Falschheit ihres Lachens gegenseitig übertreffen zu wollen. Unsere Mutter hatte Bratkartoffeln, ein Käseomelett und eine Schale Fruchtcocktail aus der Dose bestellt. Sie und der Alte aßen selten zur selben Zeit und wollten nie dasselbe.
Amalia kehrte in die Küche zurück und sagte: »Ich glaube, jemand ist heute Nacht nebenan eingezogen. Mein Fenster war offen. Eine Stimme hat mich geweckt und da drüben war in allen Zimmern das Licht eingeschaltet.«
Ihr Zimmer lag auf derselben Seite wie meins. Ich erwiderte: »Ich hab niemanden gehört. Hab das Licht gesehen und wie jemand dort herumlief, nur ein Schatten. Aber es hat noch kein Makler ein Schild aufgestellt.«
»Vielleicht wollen die es vermieten, statt es zu verkaufen.«
»Aber um drei Uhr morgens einzuziehen ist ein bisschen komisch. War das nur eine Person, eine Familie, oder …?«
»Ich habe niemanden gesehen.«
»Was ist mit der Stimme?«
»Ach, das war bestimmt ein Traum. Es stand jedenfalls niemand unter meinem Fenster. Ich habe erst gedacht, jemand hätte da unten gestanden und nach mir gerufen, ein Mann. Aber ich muss geträumt haben, denn als ich aufgestanden und zum Fenster gegangen bin, war da keiner.«
Ich legte die Platzdeckchen und das Besteck auf den Esstisch. Während ich den Toast zubereitete und die ersten zwei Scheiben verbrannte, rührte Amalia Eier und briet Schinkenstreifen für unser Frühstück.
»Was hat er denn gesagt – der Mann unter deinem Fenster?«, fragte ich.
»Er hat meinen Namen gerufen. Zweimal. Aber ich bin sicher, dass er nur im Traum da war, nicht in Wirklichkeit.«
»Worum ging es in dem Traum?«
»Ich weiß nicht mehr.«
»Noch nicht mal irgendeine Einzelheit?«
»Nicht mal das.«
Bei ihr lagen die Eier, der Schinken und der Toast auf demselben Teller. Für mich servierte sie diese drei Dinge auf drei kleinen Tellern, wie ich es bevorzugte. Ich hatte die Ränder von meinem Toast abgeschnitten, um sie separat essen zu können. Schon damals hatte ich meine kleinen Rituale, mit denen ich versuchte, der Welt, die mir so chaotisch erschien, ein gewisses Maß an Ordnung abzuringen.
Wir hatten gerade erst angefangen zu essen, als die Waschmaschine in der angrenzenden kleinen Waschküche fertig war und zu summen begann.
Als ich aufstand, um die Wäsche zum Trockner zu bringen, sagte Amalia: »Das kann warten, Malcolm.«
Ich blieb sitzen, erwiderte aber: »Bevor du zur Uni gehst, musst du mir beibringen, wie man bügelt.«
Immer wenn irgendetwas sie bewegte oder amüsierte, funkelten ihre grünen Augen, das schwöre ich. »Süßer, ich würde dir genauso wenig eine Kettensäge wie ein Bügeleisen in die Hand drücken.«
»Tja, er wird jedenfalls niemals bügeln. Und sie höchstens, wenn sie dabei sitzen bleiben und sich Gameshows anschauen kann.«
»Sie hat gebügelt, als ich noch zu klein dazu war. Sie hat bestimmt nicht vergessen, wie das geht.«
»Aber sie wird es nicht tun. Das weißt du. Wenn ich darauf warte, bleiben meine Sachen zerknittert.« Obwohl ich erst zwölf war, war mir wichtig, wie meine Kleidung aussah, weil mein eigenes Aussehen so streberhaft war.
»Malcolm, wage es ja nicht zu bügeln, wenn ich an der Uni bin.«
»Ich weiß noch nicht. Mal sehen.«
Für eine Weile aß sie schweigend. Dann sagte sie: »Das ist nicht richtig von mir. Zu einer Uni zu gehen, die so weit weg ist.«
»Hm? Red keinen Blödsinn. Dort hast du doch das Stipendium bekommen.«
»Vielleicht kriege ich eins von einer Hochschule, die näher ist. Dann könnte ich zu Hause bleiben, statt in ein Studentenwohnheim zu ziehen.«
»An der Universität gibt es doch dieses spezielle Schreibprogramm. Das ist doch der Grund, warum du dort hingehst. Du wirst sicher mal eine große Schriftstellerin.«
»Ich werde überhaupt nichts Großes werden, wenn ich dich hier mit denen allein lasse und das für den Rest meines Lebens bereue.«
Sie war die beste Schwester, die man sich wünschen kann, lustig, klug und hübsch, und sie würde eines Tages berühmt werden. Ich hatte sie angebettelt, mir beizubringen, wie man bügelt.
Nun kam ich mir egoistisch vor, denn in Wirklichkeit wollte ich, dass sie zur Universität ging, weil es gut für sie war. Gleichzeitig wollte ich jedoch, dass sie blieb.
»Ganz so ungeschickt bin ich auch wieder nicht. Wenn ich gut Saxofon spielen kann, kriege ich es bestimmt auch hin, Sachen zu bügeln, ohne gleich das Haus abzubrennen.«
»Wie man Romane schreibt, lernt man sowieso nicht, indem man Kurse besucht«, sagte sie. »Das ist ein ganz persönlicher Kampf.«
»Wenn du dieses Stipendium nicht annimmst, puste ich mir das Hirn raus.«
»Erzähl keinen Quatsch, Süßer.«
»Doch, das tu ich. Warum denn nicht? Wie sollte ich denn damit leben, dass ich dein Leben ruiniert habe?«
»Du kannst mein Leben gar nicht ruinieren, Malcolm. Du bist das Wichtigste und Wunderbarste darin.«
Sie log nie. Sie war keine Person, die andere Menschen manipulierte. Wäre sie nicht die gewesen, die sie war, hätte ich ihr in die Augen sehen und weiterhin behaupten können, dass ich Harakiri begehen würde, obwohl ich wusste, dass ich das nie tun würde. Stattdessen starrte ich auf die abgeschnittenen Rinden meines Toasts und riss sie in kleine Stückchen. »Du musst das Stipendium annehmen. Das musst du einfach. Das ist das Beste, das uns je passiert ist.«
Ich hörte, wie sie ihre Gabel ablegte. Nach kurzem Schweigen erwiderte sie: »Ich hab dich auch lieb, Malcolm.« Nun konnte ich ihr aus einem ganz anderen Grund nicht in die Augen sehen. Oder sprechen.
Nachdem wir den Tisch abgeräumt hatten, sie das Geschirr gespült und ich es abgetrocknet hatte, schlug sie vor: »Hey, lass uns Haferplätzchen backen.«
»Mit Schokosplittern und Walnüssen?«
»Für Mom und Dad machen wir welche mit Anchovisstückchen und Limabohnen, nur um ihre Gesichter zu sehen, wenn sie reinbeißen. Die restlichen mit Schokosplittern und Walnüssen. Wir bringen den neuen Nachbarn einen Teller voll und stellen uns vor.«
Sie ratterte eine Liste der Dinge herunter, die sie benötigte: Backbleche, Rührschüsseln, einen Teigschaber, zwei Esslöffel, einen Messbecher … Weil ich den Verdacht hegte, dass dies vielleicht der erste einer Reihe von Tests war, mit denen sie feststellen wollte, ob man mir ein Bügeleisen anvertrauen konnte, merkte ich mir jeden Punkt, sammelte zügig die Gegenstände ein und ließ keinen einzigen davon fallen.
Der köstliche Duft der Plätzchen im Ofen erreichte schließlich das Wohnzimmer. Unsere Mutter verließ ihren Platz vor dem Fernseher lange genug, um in die Küche zu kommen und zu fragen: »Ihr richtet hier doch keine Sauerei an?«
»Nein, Ma’am«, versicherte Amalia.
»Sieht aber wie eine Sauerei aus.«
»Nur so lange, wie wir backen. Wir machen hinterher alles sauber.«
»Es gibt noch Hausarbeit, die vorher erledigt werden sollte«, mahnte unsere Mutter.
»Was die Hausarbeit angeht, habe ich einen Vorsprung herausgearbeitet«, versicherte Amalia ihr. »Die Schule ist ja jetzt vorbei.«
Mutter blieb an der Tür zum Flur stehen. Sie bot einen interessanten Anblick in ihrem gesteppten rosafarbenen Hausmantel und mit ihrer Morgenfrisur. Sie wirkte leicht verwirrt, als ob die Aufgabe, die wir uns vorgenommen hatten, ihr so rätselhaft erschien wie ein kompliziertes Voodoo-Ritual. Dann sagte sie: »Ich mag meine mit Mandeln, nicht mit Walnüssen.«
»Klar«, gab Amalia zurück, »dann machen wir ein paar davon.«
»Euer Vater mag Walnüsse, aber keine Schokosplitter.«
»Davon machen wir auch welche«, versprach Amalia.
An mich gewandt fragte meine Mutter: »Hast du irgendwas fallen gelassen und kaputt gemacht?«
»Nein, Ma’am. Ich hab alles im Griff.«
»Ich mag den gläsernen Messbecher. Solche werden nicht mehr hergestellt.«
»Ich passe auf.«
»Sei vorsichtig damit«, schärfte sie mir ein, als hätte ich kein Wort gesagt. Dann kehrte sie wieder vor den Fernseher im Wohnzimmer zurück.
Amalia und ich backten die Plätzchen. Dann machten wir sauber. Ich zerbrach nichts. Und danach gingen wir nach nebenan, um die neuen Nachbarn zu besuchen.
3
Als wir die Treppe hinaufstiegen und die Veranda betraten, sahen wir, dass die Haustür nur angelehnt war. Die Sonne stand noch im Osten. Ihr heißes Licht drang unter der Dachrinne hindurch und zeichnete ein helles Rhomboid auf den Boden. Wir standen auf dieser erhellten Fläche der grau gestrichenen Bodenbretter wie auf einer Falltür. Amalia hielt den Plätzchenteller. Ich drückte den Klingelknopf. Niemand reagierte auf das Klingeln, also tat ich es noch einmal.
Als ich zum dritten Mal geklingelt hatte und es offensichtlich schien, dass niemand im Haus war, sagte Amalia: »Vielleicht war das ja doch ein Einbrecher letzte Nacht. Trotz all der eingeschalteten Lampen. Ich meine, einem Einbrecher wäre es bestimmt egal, ob er die Tür hinter sich zugemacht hat.«
Durch die etwa zehn Zentimeter breite Lücke zwischen Türblatt und Türpfosten konnte ich den engen, dunklen Vorraum und das noch dunklere Wohnzimmer dahinter sehen. »Und warum macht sich ein Einbrecher die Mühe, die Lichter wieder auszuschalten? Vielleicht stimmt hier irgendwas nicht. Vielleicht braucht jemand Hilfe.«
»Wir können da nicht einfach so reinplatzen, Malcolm.«
»Was sollen wir sonst machen?«
Sie beugte sich näher zur Tür und rief: »Hallo? Ist jemand zu Hause?«
Das Schweigen, das sie zur Antwort erhielt, erinnerte an meinen Vater, der auf der hinteren Veranda stand und sein Frühstückssandwich aß.
Amalia rief noch einmal, und als niemand reagierte, stieß sie die Tür auf, sodass wir eine bessere Sicht auf den engen Eingangsbereich und das Wohnzimmer hatten. Dort schien alles noch so möbliert zu sein wie damals, als Mr. Clockenwall noch gelebt hatte. In den Monaten seit seinem Tod war niemand gekommen, um seine Besitztümer zu entsorgen.
Nachdem meine Schwester noch einmal gerufen hatte, diesmal lauter als zuvor, sagte ich: »Vielleicht sollten wir nach Hause gehen, die Polizei rufen und einen Einbruch melden.«
»Aber kannst du dir vorstellen, wie die uns die Hölle heißmachen werden, wenn es doch kein Einbruch war?«
Mit »die« meinte sie nicht die Polizei. Unserer Mutter war nichts auf der Welt lieber als ein legitimer Grund, uns zu kritisieren. Für den kleinsten Fehler hackte sie ewig auf einem herum, bis man glaubte, sie würde so lange weitermachen, bis nur noch Knochen von einem übrig waren. Und unser alter Herr, der den Klang der Stimme unserer Mutter nicht ausstehen konnte, wenn diese angriffslustig war, brüllte dann Amalia und mich an, als ob wir diejenigen wären, die den Lärm machten: »Ich versuche hier bloß, ein bisschen fernzusehen und zu vergessen, was ich für einen Scheißtag auf der Arbeit hatte, okay? Habt ihr was dagegen, ihr zwei?«
Ich wiederholte ihre Mahnung an mich: »Wir können da nicht einfach so reinplatzen.«
»Nein, das stimmt.« Sie trat mit dem Plätzchenteller in der Hand über die Türschwelle. »Aber denk dran, Mr. Clockenwall wurde erst einen ganzen Tag später gefunden, nachdem er gestorben war. Vielleicht braucht dadrin jemand Hilfe.«
Natürlich folgte ich ihr. Ich wäre meiner heiligen Schwester bis in die Hölle gefolgt, und im Vergleich dazu war dieses Haus nicht besonders Furcht einflößend.
Obwohl die Gardinen ein wenig Tageslicht durchließen, war das Wohnzimmer dennoch in Schatten gehüllt, eine düstere, stille Kammer, in der man beinahe damit rechnete, einen aufgebahrten Leichnam zu sehen.
Amalia betätigte einen Wandschalter, der eine Lampe neben einem Lehnsessel aufleuchten ließ.
Eine Staubschicht bedeckte den Tisch, auf dem die Lampe stand. Dort lag eine Lesebrille neben einem Taschenbuch, das Mr. Clockenwall vielleicht hatte lesen wollen, bevor ihm das Schlimmste zugestoßen war, das einem Menschen zustoßen konnte. Es gab keine Spuren von Vandalismus.
»Wir wohnen nebenan«, rief Amalia. »Wir sind nur hier, um Hallo zu sagen.« Sie wartete ab und lauschte. Dann: »Hallo? Alles in Ordnung?«
In der Küche summte der Kühlschrank. Es standen Frühstücksteller auf dem Tisch. Auf einem davon war ein Klecks Eigelb zu etwas Hartem, Dunklem geronnen. Toastkrümel waren über die Formica-Tischplatte verstreut. Hier hatte Mr. Clockenwall der Herzinfarkt ereilt, vielleicht als er gerade von seiner Mahlzeit aufgestanden war. Niemand hatte aufgeräumt, nachdem der Leichenwagen den Toten weggebracht hatte.
»Es ist schrecklich, allein zu leben«, sagte Amalia.
Die Traurigkeit in ihrer Stimme wirkte echt, obwohl Clockenwall kein Mann gewesen war, der sich an seine Nachbarn gewandt oder auf andere Weise versucht hatte, seine Einsamkeit zu lindern, falls er wirklich einsam gewesen war. Er war höflich gewesen, und wenn er zufällig in seinem Garten gewesen war, wenn man sich ebenfalls gerade im Garten aufhielt, hatte er sich ein paar Minuten ganz angenehm über den Zaun hinweg mit einem unterhalten. Niemand hatte ihn für überheblich oder kalt gehalten, nur für schüchtern und gelegentlich melancholisch. Manche hatten vermutet, dass er in der Vergangenheit irgendeine Tragödie durchlebt hatte und der einzige Begleiter, mit dem er sich wohlfühlte, die Traurigkeit war.
Amalia war etwas beunruhigt. »Irgendjemand hätte diese Teller wegräumen und den Kühlschrank leeren sollen, bevor darin alles verdirbt. Das alles so zurückzulassen … Das ist einfach nicht richtig.«
Ich zuckte die Achseln. »Vielleicht hat sich niemand um ihn gekümmert.«
Meine Schwester schien sich um jeden zu kümmern. Sie fand selbst für unsere Eltern in ihren schlimmsten Momenten noch eine Entschuldigung. Aber jetzt sagte sie nichts.
Ich seufzte. »Bitte sag mir, dass du nicht meinst, dass wir das aufräumen sollten.«
Als sie gerade antworten wollte, änderte sich ihre Haltung abrupt. Erschrocken drehte sie sich um und fragte: »Was, wer?«
Verwirrt erwiderte ich: »Hä?«
Sie runzelte die Stirn. »Hast du das nicht gehört?«
»Nein. Was habe ich nicht gehört?«
»Er hat gesagt: ›Melinda. Süße Melinda.‹«
»Wer hat das gesagt?«
»Es hörte sich wie Mr. Clockenwall an.«
Als ich jünger und meine Schwester noch nicht perfekt gewesen war, hatte sie es sehr genossen, mir Angst einzujagen, indem sie mir mit großer Überzeugungskraft Dinge erzählte wie: Dad wusste nicht, dass ich da war. Er hat sein Gesicht abgenommen, und darunter hatte er ein Echsengesicht! Oder: O Gott, ich habe gesehen, wie Mom lebende Spinnen gegessen hat! Sie war so überzeugend, dass ich etwa ein Jahr brauchte, um gegen ihre bizarren Enthüllungen immun zu werden. Für ein weiteres Jahr tat ich so, als würde ich sie glauben, weil es so großen Spaß machte. Dann begann sie, sich für Jungen zu interessieren, und verlor die Lust daran, mir Angst einzujagen. Aber keine ihrer Lügengeschichten verängstigte mich so wie manche der Idioten, mit denen sie ausging. Doch selbst damals war sie bereits klug genug gewesen, sich nicht mehr als zweimal mit einem wahnsinnigen Psychopathen zu verabreden.
»Mr. Clockenwall ist tot und begraben«, erinnerte ich sie.
»Das weiß ich.« Sie hielt den Plätzchenteller in der linken Hand und rieb sich mit der rechten den Nacken, wie um eine Gänsehaut zu vertreiben. »Tot ist er jedenfalls.«
»Ich bin keine neun mehr, Schwesterherz.«
»Was soll das heißen?«
»Ich weiß, dass Mom nur tote Spinnen isst.«
»Ich mache keine Witze, Malcolm.« Wieder erschrak sie und drehte sich um, in Richtung einer Stimme, die ich nicht hören konnte.
»Was ist denn jetzt los?«
»Er hat es wieder gesagt. ›Süße Melinda.‹«
Plötzlich setzte sie sich in Bewegung, als ob sie den Sprecher suchen wollte. Sie schaltete in jedem Raum, den wir betraten, das Licht ein. Ich folgte ihr durch das Erdgeschoss und schaltete die Lampen hinter uns wieder aus. Als wir wieder an der Vorderseite des Hauses waren, spähte Amalia die Treppe hinauf in die Düsternis des Obergeschosses.
Nachdem sie einen langen Moment wie gebannt dort gestanden hatte, verzog sie in einem Ausdruck des Ekels das Gesicht. Ich fragte sie, was los sei, und sie antwortete: »Er ist widerlich. Obszön. Krank.«
Argwöhnisch, aber halb überzeugt fragte ich: »Was?«
»Ich werde nicht wiederholen, was er gesagt hat.« Sie eilte durch die offene Haustür nach draußen.
Ich blieb am Fuß der Treppe stehen, blickte hinauf und fragte mich, ob sie mich auf den Arm nehmen wollte oder es ernst gemeint hatte. In diesem Moment hörte ich schwere Schritte im oberen Flur. Dann knarrten die Treppenstufen, als ob jemand hinabstieg. Auch der Treppenabsatz nach dem ersten Abschnitt knarrte und knackte, als ob eines der alten Bretter unter einem schweren Gewicht zu splittern begann. Die Schatten waren nicht so dunkel, dass sie jemanden hätten verbergen können. Wer auch immer da zu mir herabstieg, war für das Auge nicht besser erkennbar als Claude Rains in dem alten Film Der Unsichtbare.
Wenn unsichtbare Männer oder ihre Äquivalente auftauchten, bedeutete das, dass guten Menschen schlimme Dinge passieren würden. Ich verließ rasch das Haus, zog die Eingangstür hinter mir zu und schloss mich Amalia an, die die Verandatreppe hinunterstieg und hastig den Weg entlanglief.
Als wir durch das Gartentor gingen, fragte ich sie: »Was war das denn?«
»Ich will jetzt nicht darüber reden.«
»Wann willst du denn darüber reden?«
»Ich sag dir schon Bescheid.« Sie machte sich auf den Weg nach Hause.
Ich erwiderte: »Schätze, dann werden wir die Plätzchen selbst essen müssen.«
»Ja. Sie will keine mit Walnüssen.«
»Und er will keine mit Schokosplittern. Und ich glaube, der neue Nachbar hat überhaupt kein Interesse an Plätzchen.«
»Es gibt keinen neuen Nachbarn«, verkündete Amalia, während wir unter den Ästen der krummen Platane hindurch an der Seite unseres Hauses entlangeilten.
»Aber irgendwas ist da.« Ich blickte über den Zaun hinweg zum Clockenwall-Haus.
4
Ich saß in meinem Zimmer am Fenster und beobachtete das Nachbarhaus durch einen Spalt zwischen den Vorhängen. Dabei rief ich mir alles in Erinnerung, was ich über Rupert Clockenwall wusste. Er hatte 40 Jahre lang an der Jefferson Middle School Englisch gelehrt. Mit 62 wäre er pensioniert worden, aber er war einen Monat vor dem Ende des Schuljahres gestorben.
In seiner beruflichen Laufbahn war er zweimal mit dem Stadtpreis für den ›Besten Lehrer des Jahres‹ ausgezeichnet worden. Er hatte nie geheiratet. Manche vermuteten, dass er schwul war, aber man hatte ihn nie in männlicher Begleitung gesehen. Es waren die Zeiten, in denen die Leute noch so ignorant waren zu glauben, dass alle schwulen Männer tänzelten, lispelten oder beides, und dass sie keine Knochen in den Handgelenken hätten. Bei Mr. Clockenwall war keine dieser Verhaltensweisen festzustellen. Er machte nie Urlaubsreisen. Wenn er ins Haus eines Nachbarn eingeladen wurde, lehnte er immer mit Bedauern ab und schickte Blumen, um seine Dankbarkeit für die Einladung zu zeigen. Er sprach nie ein unfreundliches Wort über irgendjemanden. Seine Stimme war sanft und melodisch. Er hatte ein freundliches Lächeln. Er machte gern Gartenarbeit und züchtete beeindruckende Rosen. Im Haus trug er Hush Puppies, Kakihosen und langärmlige Plaidhemden, an kälteren Tagen Cardigans. Einmal hatte er einen verletzten Vogel gefunden, ihn wieder aufgepäppelt und freigelassen. Er kaufte immer Girl Scout Cookies, für gewöhnlich zehn oder zwölf Schachteln. Wenn die Pfadfinderinnen Zeitungsabonnements verkauften, kaufte er viele davon, und als sie einmal versucht hatten, handgestrickte Topflappen an den Mann zu bringen, hatte er auch davon ein Dutzend genommen. Er schien eine gewisse Schwäche für Pfadfinderinnen zu haben. Haustiere hatte er nicht. Er sagte, er reagiere allergisch auf Katzen. Hunde jagten ihm Angst ein. Seine Größe betrug etwa 1,75 Meter, sein Gewicht etwas mehr als 70 Kilogramm. Blassblaue Augen. Hellblonde Haare, die langsam weiß wurden. Sein Gesicht war nicht einprägsamer als ein leeres Blatt Schreibpapier.
Rupert Clockenwall schien mir eine so fade Person gewesen zu sein, dass ich mir nicht vorstellen konnte, dass er aus dem Grab zurückkehrte, um zu spuken. Je länger ich über das nachdachte, was in seinem Haus geschehen war, desto sicherer war ich mir, dass ich es falsch interpretiert hatte. Als ich nach einer Stunde immer noch nichts Interessantes durch den Spalt zwischen den Vorhängen in meinem Zimmer gesehen hatte, ging ich nach unten, um Amalia bei ihren Aufgaben zu helfen.
Für eine halbe Stunde arbeiteten wir zusammen, machten die Betten im Schlafzimmer unserer Eltern, staubsaugten, wischten. Dann fragte ich sie, ob sie bereit sei, über das zu sprechen, was passiert war. Sie sagte Nein.
40 Minuten später, als wir eine ganze Weile in der Küche geschuftet hatten und dabei waren, Karotten und Kartoffeln für das Abendessen zu schälen, fragte ich sie noch einmal, und sie sagte: »Gar nichts ist passiert.«
»Na, irgendwas war da doch.«
Amalia konzentrierte sich ganz auf die Kartoffel, die sie pellte, und erwiderte: »Es ist nur dann was passiert, wenn einer von uns darauf besteht, dass es so war. Wenn wir uns beide einig sind, dass da nichts war, dann war da nichts. Du weißt schon – wenn im Wald ein Baum umfällt und niemand da ist, der es sieht, dann ist er nicht umgefallen. Okay, schon gut, ich weiß, es heißt anders. Wenn im Wald ein Baum umfällt, und es ist keiner da, der es hört, dann hat es vielleicht kein Geräusch gegeben. Aber meine Version ist eine logische Ableitung daraus. Völlig logisch. Im Clockenwall-Haus ist kein Baum umgefallen, also gab es dort nichts zu hören oder zu sehen. Du bist zwölf, also ergibt das für dich vielleicht keinen Sinn, aber wenn du noch ein paar Jahre Mathe hattest und einen Logikkurs belegt hast, wirst du das verstehen. Ich will nicht darüber reden.«
»Wenn nichts geschehen ist, worüber willst du dann nicht reden?«
»Eben.«
»Hast du Angst oder so?«
»Es gibt nichts, wovor man Angst haben muss. Es ist nichts passiert.«
»Na, immerhin reden wir jetzt darüber«, gab ich zurück.
Sie warf einen Streifen Kartoffelschale nach mir, der mir im Gesicht kleben blieb. »Brudermisshandlung!«, rief ich, und sie konterte: »Pass auf, das war noch gar nichts!«
5
Nachdem wir an diesem Abend das Geschirr vom Abendessen gespült und abgetrocknet hatten, nahm ich mein Saxofon und ging damit in die Garage, bevor der Alte mir die Anweisung dazu geben konnte. Amalia blieb am Küchentisch sitzen, atmete den Rauch meiner Mutter ein und musste sich die Gründe anhören, warum ihr Kartoffelbrei, den sie zum Brathähnchen serviert hatte, so furchtbar ungenießbar sei. Und das, obwohl unsere Eltern sich beide einen Nachschlag genommen hatten.
Ich begann nicht sofort zu spielen, sondern hörte mir etwas coole Big-Band-Musik an. In einer Ecke der Garage hatten wir eine billige Stereoanlage und einige Alben, darunter eine Anzahl von Schallplatten aus den 1930er-Jahren, die wir spottbillig in einem Secondhand-Plattenladen bekommen hatten. Ich war gerade in Stimmung, mir eine Band namens Andy Kirk and His Clouds of Joy anzuhören. Diese wäre in den 30er- und 40er-Jahren mehrmals beinahe berühmt geworden, aber es war ihnen nie ganz gelungen. Jetzt, etwa 30 Jahre später, war ich ein Fan ihres Tenorsaxofonisten Dick Wilson, außerdem von Ted Donnelly, der einer der besten Swing-Band-Posaunisten aller Zeiten war. Doch diejenige, die mich vollkommen fesselte, war Mary Lou Williams am Klavier. Ich setzte mich auf eine Kiste und ließ mich zweimal völlig von Froggy Bottom vereinnahmen, dann von Walkin’ and Swingin’, bevor Amalia eintraf.
Wir hörten uns Roll ’Em an, das Mary Lou Williams geschrieben hatte und das feinster Big-Band-Boogie-Woogie war. Als das Stück vorbei war, sprang meine sonst immer so energiegeladene Schwester nicht auf, sie schnippte nicht mit den Fingern und schien auch sonst in keiner Weise von der Musik bewegt zu sein. Sie hatte ihre Klarinette nicht mitgebracht. Wir würden nicht zusammen spielen.
»Stimmt was nicht?«, fragte ich.
Sie trat an das kleine Fenster, durch das man in Richtung des Hauses unseres verstorbenen Nachbarn sah. Das konzentrierte Sonnenlicht dieses frühen Juniabends vergoldete ihr hübsches Gesicht. »Ich habe einmal im Garten gestanden, am Picknicktisch, und an einem Kunstprojekt für die Schule gearbeitet. Ich war ganz in die Arbeit vertieft. Nach einer Weile habe ich den Blick gehoben und sah Clockenwall auf der anderen Seite des Zauns stehen und mich anstarren. Sein Blick war ziemlich … eindringlich. Ich sagte Hi, aber er hat nicht geantwortet, und da war was in seinen Augen, das mir fast wie Hass vorkam, aber es war nicht nur das. Es war warm, ich hatte Shorts und ein Tanktop an, und plötzlich fühlte ich mich, als ob ich … als ob ich nackt wäre. Er war überhaupt nicht so, wie er sonst immer gewesen ist. Nicht wie ein ›Lehrer des Jahres‹, ganz sicher. Er leckte sich die Lippen. Ich meine, er hat eine richtige Show draus gemacht, wie er sie sich leckte, und er hat mich so dreist angestarrt, ich kann gar nicht beschreiben, wie dreist, mit so einem Verlangen. Vielleicht war das wirklich Hass in seiner Miene, Hass und Wut, aber das war nicht alles, wenn du verstehst, was ich meine.«
Ich wusste es. »Was hast du dann gemacht?«
»Ich hab meine Kunstsachen eingesammelt und bin damit ins Haus gegangen.«
»Hast du niemandem davon erzählt?«
»Es war mir zu peinlich, darüber zu sprechen. Und wem hätte ich es denn sagen sollen? Dad war auf der Arbeit. Wenn er nach Hause kommt, will er nicht, dass ihn irgendjemand davon abhält, sein erstes Bier zu trinken. Mom saß wie angeklebt vor ihren Nachmittags-Gameshows. Ich hätte lieber meine Hand in ein Alligatormaul gesteckt, als sie von Bill Cullen und The Price Is Right abzulenken.«
»Du hättest es mir sagen können«, bemerkte ich.
»Das war vor vier Jahren. Da warst du acht, Süßer. So was braucht man mit acht Jahren noch nicht zu hören.«
»Und du warst erst 13«, sagte ich. »Mann, was war der denn für ein gruseliger Typ?«
Sie wandte sich vom Garagenfenster ab und ihr Kopf war von einem Quadrat aus goldenem Sonnenschein umrahmt. »Es ist noch mal passiert, ungefähr sechs Monate später. Ich bin mit dem Müll in die Gasse gegangen, um ihn in die Tonne zu werfen. Zuerst war er nicht da, aber als ich mich umdrehte, um zurück zum Haus zu gehen, stand er direkt hinter mir, vielleicht einen Meter entfernt. Ich habe nichts gesagt und er auch nicht, aber er hat sich wieder so die Lippen geleckt. Und er … Er hat sich mit einer Hand in den Schritt gefasst. Ich bin ihm ausgewichen. Er hat nicht nach mir gegriffen oder so was, und danach ist nie wieder was passiert.«
»Ich hasse ihn«, verkündete ich. »Ich bin froh, dass er tot ist.«
Sie setzte sich in der Nähe der Kiste, auf der ich hockte, auf einen Stuhl mit Rollen. Sie starrte auf ihre Hände, die sie auf dem Schoß zu Fäusten geballt hatte. »Als wir heute dort drüben waren, habe ich ihn wirklich gehört, Malcolm.«
»Okay.«
»Wirklich. Er sagte: ›Süße Melinda.‹ Und als wir dann im Eingangsbereich waren und die Treppe hochgeschaut haben, sagte er meinen Namen … meinen Namen und etwas Schmutziges.«
Sie hob den Kopf und sah mir in die Augen. Ich sah, dass sie mich nicht auf den Arm nehmen wollte. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte.
»Halt dich von diesem Haus fern, Malcolm.«
»Warum sollte ich da noch mal hingehen wollen?«
»Halt dich fern.«
»Werde ich. Was denkst du denn? Das ist total unheimlich. Meine Güte.«
»Ich meine es ernst. Geh da nicht hin.«
»Und du solltest besser auch nicht hingehen.«
»Das habe ich auch nicht vor«, erwiderte sie. »Ich weiß, was ich gehört habe, und das möchte ich nie wieder hören.«
»Ich wusste gar nicht, dass du an Geister glaubst«, sagte ich.
»Habe ich nie getan. Aber jetzt glaube ich dran. Halt dich fern.«
Wir saßen für eine Weile schweigend da. Schließlich sagte ich, dass ich mir etwas anhören müsse, um mich zu beruhigen. Ich legte ein Album auf, das nicht zu den alten Platten gehörte, eine Sammlung von Glenn Millers besten Stücken. Wir mochten Rock ’n’ Roll, aber mit dem Herzen hingen wir an einer anderen musikalischen Ära.
Amalia hörte sich In The Mood an, aber kurz bevor die Band zu Moonlight Serenade überging, sagte sie: »Das hier beruhigt mich nicht. Ich werde ins Bett gehen und lesen. Ich habe einen Roman.« An der Seitentür der Garage blickte sie zurück und fügte hinzu: »Bleib nicht nach Einbruch der Dunkelheit hier draußen.«
»Das mache ich doch immer.«
»Aber nicht heute Nacht. Auch nicht in den nächsten paar Nächten.«
Sie hatte offensichtlich Angst. Ich nickte. »Okay.«
Nachdem sie gegangen war, hörte ich mir weiter Moonlight Serenade an, dann American Patrol. Danach hob ich die Nadel des Plattenspielers und setzte sie wieder an den Anfang des Albums.
Als In The Mood begann, verließ ich die Garage und ging in die Gasse. Es waren noch etwa 40 Minuten Tageslicht übrig. Ich ging zum hinteren Tor des Clockenwall-Grundstücks.
6
Ich war kein besonders tapferer Zwölfjähriger. Ich kannte meine Grenzen gut. Wenn ich in einen Kampf mit einem anderen Jungen geriet, war die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich mich selbst k.o. schlug, als dass ich den anderen verprügelte. In einer Konfrontation mit dem Übernatürlichen hätte ich gegen einen Feind, der bedrohlicher war als Casper, der freundliche Geist, keine guten Chancen gehabt.
Dennoch war ich entschlossen, den Garten des Clockenwall-Grundstücks zu durchqueren und die Stufen der hinteren Veranda hinaufzusteigen, weil ich meine Schwester mehr liebte als mich selbst. Ich hatte das Gefühl, dass ich die Aufgabe hatte, dieses bizarre Problem zu lösen. Ich hatte Amalia noch nie auch nur ansatzweise so erschüttert erlebt wie in dem Moment, als sie mir von dem lüsternen Lehrer erzählt hatte.
Sie war furchtlos, entschlossen und tüchtiger als jeder andere, den ich kannte. Es fiel mir schwer, mitanzusehen, wie die Angst sie so einschüchterte, und es machte mich wütend und traurig, daran zu denken, wie sie sich in ihr Zimmer zurückzog und sich hinter einem Buch versteckte. Denn diesen Eindruck hatte ich, auch wenn ich ihr das niemals offen gesagt hätte.
Ich ging über die Veranda des Clockenwall-Hauses und war nicht überrascht, als ich sah, dass die Hintertür einen Spalt offen stand, wie es zuvor bei der Haustür der Fall gewesen war. Beim Betreten der Küche, in die nun weniger Sonnenlicht fiel als bei meinem letzten Besuch, schaltete ich kurz entschlossen die Deckenleuchte ein. Wenn der Geist des Toten wirklich einen Monat nach dem Begräbnis zurückgekehrt war, wäre es ohnehin unmöglich, ohne sein Wissen sein Haus zu durchstöbern. Sicherlich ist ein Geist allwissend, zumindest was den Ort angeht, den er heimsucht.
Der mit getrocknetem Eigelb beschmierte Teller und das schmutzige Besteck befanden sich auf dem Tisch, und auch die Toastkrümel waren noch da. Clockenwall war nicht zum Saubermachen zurückgekehrt.
Ich schaltete die Lampen ein, während ich durch das Haus zur Vordertreppe ging, wo zuvor etwas Unsichtbares hinabgestiegen war. Als ich mich vor dem ersten Treppenabsatz befand, blieb ich stehen und lauschte, aber da war nur eine Stille, die so tief war, als würde sich das Haus nicht mehr in der Stadt befinden, sondern wäre von einer Art Raum-Zeit-Blase umgeben, in der es für alle Ewigkeit dahinschwebte.
Schließlich fragte ich mich, was ich mit meinem Besuch hier eigentlich zu erreichen hoffte. Ich war kein Exorzist. Meine Familie ging nicht einmal in die Kirche. Meine Eltern waren Atheisten. Themen wie Gott und das Jenseits waren ihnen so gleichgültig wie alles andere, das man nicht essen, trinken, rauchen oder sich im Fernsehen anschauen konnte, ohne dadurch auf zu viele Gedanken gebracht zu werden. Ich fand keine gute Antwort auf die Frage, die ich mir gestellt hatte. Daher kam ich mit der Logik eines Zwölfjährigen zu dem Schluss, dass meine Intuition mich hierhergeführt hatte und dass ich ihr vertrauen sollte, wie ein Hund seinem Geruchssinn vertraut.
Als ich plötzlich ein schnelles Pochen hörte, zuckte ich zusammen und zog mich von der Treppe zurück. Aber mir wurde rasch bewusst, dass ich lediglich das Klopfen meines Herzens gehört hatte. Enttäuscht von mir, wütend über mich selbst, zog ich die Schultern zurück und hob den Kopf. Ich erzählte mir selbst die unglaubliche Lüge, dass es im Stammbaum der Familie Pomerantz viele Generationen von Kriegern gegeben habe. Dann stieg ich die Treppe hinauf in den ersten Stock.
Das Gute daran, zwölf Jahre alt oder jünger zu sein, ist, dass man glaubt, man würde ewig leben. Daher geht man ohne großes Zögern gewaltige Risiken ein, und manchmal zahlt es sich aus. Manchmal auch nicht.
Oben suchte ich ein Zimmer nach dem anderen ab, ohne zu wissen, wonach ich suchte. Ich vertraute darauf, dass meine Intuition mich irgendetwas entdecken lassen, mir irgendein Wissen oder ein Mittel verschaffen würde, um Clockenwalls Geist dorthin zurückzuschicken, woher er gekommen war, falls er wirklich aus dem Jenseits zurückgekehrt war, um meine Schwester zu belästigen. Im Schlafzimmer des ›Lehrers des Jahres‹ stand ein Tisch an der Stelle, an der jemand anderes vielleicht einen Schminktisch aufgestellt hätte. Ich wurde davon angezogen wie Eisenspäne von einem Magneten.
Dann geschah etwas Verstörendes. Ohne mich daran erinnern zu können, mich hingesetzt oder eine der Schubladen geöffnet zu haben, saß ich plötzlich auf dem Stuhl vor dem Tisch. Vor mir befand sich ein Sammelalbum voller Zeitungsartikel über ein Mädchen namens Melinda Lee Harmony. Süße Melinda. Sie war eine Middle-School-Schülerin gewesen, die drei Monate vor ihrem 13. Geburtstag auf dem Heimweg von der Schule verschwunden war. Einige der ausgeschnittenen Artikel waren datiert. Sie stammten alle aus dem Jahr 1949, waren also 18 Jahre alt. Mit wachsendem Unbehagen blätterte ich sie durch, aber ich konnte nicht damit aufhören, als hätte ich keine Kontrolle mehr über meinen Körper. Die Polizei hatte mit einem großen Kontingent freiwilliger Helfer das Schulgrundstück, die Viertel in der Umgebung sowie den Balfour Park abgesucht, der an der Strecke lag, die das Mädchen für gewöhnlich gewählt hatte, wenn es nach Hause gegangen war. Aber man hatte keine Spur von ihr gefunden. Man setzte eine Belohnung aus, aber niemand konnte sie sich abholen.
Ihre geplagten Verwandten, ihr Pfarrer und einige Lehrer der Schule lobten sie in den höchsten Tönen, dieses sanfte, intelligente und charmante Kind, von dem man sich für die Zukunft so vieles versprochen hatte. Einer dieser Lehrer war Rupert Clockenwall gewesen. Man hatte der Zeitung drei Fotos von ihr überlassen, die alle kurz vor ihrem Verschwinden aufgenommen worden waren. Sie war ein hübsches Mädchen gewesen, blond und schlank, mit einem jungenhaften Lächeln. Während ich sie anstarrte, hörte ich mich selbst sagen: »So ein köstliches kleines Früchtchen.«
7
Ich habe keine Erinnerung daran, wie ich das Album beiseitelegte oder wie ich das dicke Tagebuch aus einer anderen Schublade nahm. Während ich in einem beinahe traumartigen Zustand dieses Buch durchblätterte, von einer eisigen Furcht gepackt, aber außerstande, etwas dagegen zu unternehmen, sah ich, dass Clockenwall mit seiner fast maschinenartig sauberen und konsistenten Handschrift die Ereignisse um Melinda Lee Harmonys Gefangenschaft festgehalten hatte. Die Aufzeichnungen begannen mit dem Tag, an dem er ihr eine Mitfahrgelegenheit nach Hause angeboten hatte, und sie reichten – ich konnte nicht anders, als weiterzublättern – bis zu dem Tag, an dem er sie getötet hatte, 17 Monate später. Es war ein Tagebuch, in dem die Verdorbenheit zelebriert wurde. In den Einträgen, die ich zu Gesicht bekam, bereute er nichts außer dem Mord. Er klagte über seinen plötzlichen Kontrollverlust, bei dem Lust und Gewalt für ihn eins geworden waren.
Ich hörte mich sagen: »So eine Verschwendung, so ein Jammer, sie hätte mir immer noch nützlich sein können.«
Wieder hatte ich kein Bewusstsein davon, dass ich den Band zur Seite legte und ein weiteres Album vom Tisch nahm, das neueren Datums war. In diesem fand ich ausgeschnittene Artikel aus der Schülerzeitung der Middle School, die Amalia besucht hatte, der Schule, an der Rupert Clockenwall Englisch unterrichtet hatte. Es handelte sich um Gedichte und kleine Geschichten, die sie für die Zeitschrift geschrieben hatte. Irgendwie waren ihre Klassenfotos aus der siebten, achten und neunten Klasse in seinen Besitz gelangt. Ich bemerkte das silberne Kreuz, das sie damals immer an einer Kette um den Hals getragen hatte, nun jedoch nicht mehr trug. Außerdem fand ich Fotos, die mit einem Teleobjektiv aufgenommen worden waren: eine jüngere Amalia, die auf der Veranda saß, im Garten stand, zur Garage ging, die für sie und mich ein sicherer Hafen gewesen war. Als meine Schwester 15 Jahre alt wurde, schien Clockenwall dem Album keine weiteren Bilder mehr hinzugefügt zu haben. Als ich die leeren Seiten aufschlug, die er nicht mehr benutzt hatte, hörte ich mich sagen, ohne es zu wollen oder es kontrollieren zu können: »Ein reizendes, kleines Luder, aber zu nah. Zu riskant. Hab’s nicht gewagt. Hab’s nicht gewagt. Wünschte, ich hätte.«
Ohne Erinnerung daran, vom Tisch aufgestanden zu sein, das Schlafzimmer verlassen zu haben und die Vordertreppe hinuntergestiegen zu sein, fand ich mich in der Küche wieder. Ich hielt ein Filetiermesser in der Hand.
8
Ich versuchte, das Messer wegzuwerfen, aber stattdessen packte ich es nur noch fester. Falls die Vorstellung, dieses Haus zu verlassen und mit irgendeiner unvorstellbaren Absicht nach Hause zu gehen, mich mit Entsetzen erfüllt hatte, weiß ich es nicht mehr. Ich befand mich immer noch in einem traumartigen Zustand, während ich durch die Küche zu einer Innentür ging, sie öffnete, das Kellerlicht einschaltete und die steile Treppe hinunterstieg in dieses unterirdische Reich.
An diesem fensterlosen, vollständig unter der Erde liegenden Ort mit seinen Wänden aus Zementblöcken und seinem Erdfußboden fand ich einen kleinen Holztisch und zwei Stühle. Außerdem war dort ein Regal mit Büchern, die für ein zwölfjähriges, bald 13-jähriges Mädchen geeignet waren, Geschichten über Pferde, Liebe und Abenteuer. Am Boden lag eine fleckige, schimmelnde Matratze, und darüber war eine Ringschraube in der Zementwand verankert, von der eine Kette mit einer Handfessel herabhing.
Ich stellte mich in die Ecke neben dem Ofen, schwankte und starrte auf die festgeklopfte Erde hinab. Mit der Zeit hatten helle weiße und gelbliche Kristalle auf ihr zu schimmern begonnen, welche Muster bildeten, die vage an Voodoo-Veves erinnerten. Jetzt teilte Clockenwall Bilder mit mir – Erinnerungen, wie er das ermordete Mädchen in einem tiefen Bett aus Kalk begraben hatte, um die Verwesung zu beschleunigen und den Gestank zu reduzieren. Vor meinem inneren Auge sah ich, wie er eine Erdschicht über dem Kalk festklopfte. Er weinte bei der Arbeit, nicht um das Mädchen, sondern weil er sein Spielzeug verloren hatte. Melinda lag schon so viele Jahre in ihrem Grab, dass kein Verwesungsgeruch mehr wahrzunehmen war.
Ich hob den Blick, starrte das Messer an und fragte mich, zu welchem Zweck er mich veranlasst hatte, es aus einer Küchenschublade zu nehmen.
Von oben rief Amalia meinen Namen.
9
Mit großen Augen und fragendem Blick kam Amalia die Kellertreppe herab. Ihre Schritte auf den Holzstufen hallten dumpf durch den Keller. Der Roman, den sie gelesen hatte, hatte sie nicht gefesselt, und sie hatte nicht aufhören können, an die Stimme zu denken, die in diesem Haus zu ihr gesprochen hatte. Bei Einbruch der Dämmerung hatte sie aus dem Fenster gesehen und festgestellt, dass das Clockenwall-Haus wieder voller Licht war.
»Ich bin in die Garage gegangen«, sagte sie. »Du warst nicht da, aber eine Platte lief, und ich wusste einfach, wo ich dich finden würde. Es ist meine Schuld, dass du hergekommen bist. Ich meine, was habe ich denn erwartet, als ich dir gesagt habe, du sollst dich von hier fernhalten? Du bist zwölf, du bist ein Junge, und du wirst bald in die Pubertät kommen. Du bist tapfer – okay? Aber wir sollten von hier verschwinden.«
Sie hatte einen Blick auf die Matratze geworfen, als sie heruntergekommen war, aber die schreckliche Erkenntnis kam ihr erst mit dem zweiten Blick, als sie die Ringschraube, die Kette und die Handfessel bemerkte.
Dennoch begriff sie sicher nicht vollständig, was hier geschehen war. Vielleicht hatte sie nie von Melinda Harmony gehört, die ein Jahr vor Amalias Geburt entführt worden war. Doch als sie an Mr. Clockenwalls unheimliches Interesse an ihr zurückdachte, schien meine sehr kluge Schwester daraus ableiten zu können, dass die Kette und die Fessel auf eine Gefangenschaft schließen ließen und die verdreckte Matratze nicht nur zum Schlafen benutzt worden war. Sämtliche Farbe wich aus ihrem Gesicht, aber als sie ihre Aufmerksamkeit wieder auf mich richtete, wirkte sie verwirrt, nicht verängstigt.
Verzweifelt und plötzlich schwitzend versuchte ich, ihr zuzurufen: Lauf weg! Aber meine Stimme verweigerte den Dienst.
»Malcolm? Was hast du gefunden? Was ist hier passiert?«
»Köstliche Erinnerungen«, sagte ich, und obwohl die Stimme, die ich hörte, meine war, war ich doch nicht derjenige, der gesprochen hatte.
Ich hielt das Messer an meiner Seite, an meinem Bein. Jetzt sah sie es. »Süßer, was machst du mit dem Messer?« Sie sah zum Ofen, in die dunklen Ecken des Kellers. »Ist jemand hier, bist du in Gefahr?«
Ich ging auf sie zu und hörte, wie meine Stimme verkündete: »Hätte ich dich zuerst gesehen, hätte ich mich gar nicht mit dem anderen Mädchen aufgehalten.«
Amalias Augen wurden noch ein Stück größer und sie wich vor mir zurück.
Am oberen Ende der Treppe schloss sich die Tür mit einem Knall. Ich nahm an, falls sie das obere Ende der Treppe erreichte, würde sich die Tür als abgeschlossen erweisen.
Sie war meine geliebte Schwester, die rund um die Uhr in meinem Zimmer geblieben war, als ich mit acht Jahren eine Grippe bekommen hatte, die mich beinahe umgebracht hatte. Sie war meine Schwester, deren Klarinettenspiel mich inspirierte, die Musik in mir zu finden, mich dem Saxofon zu widmen, das sich rasch zum Schlüssel zu meiner Identität entwickelt hatte. Ich liebte sie wie niemanden sonst, denn niemand sonst hatte meine Liebe zugelassen. Wenn ich sie unter dem Einfluss irgendeines bösen Geistes umbrachte, konnte ich mich ebenso gut gleich selbst umbringen.
Für gewöhnlich war ich derjenige, der durchs Leben trampelte und stolperte, dem es an körperlicher Eleganz fehlte. Aber diesmal war Amalia diejenige, die einen Fehltritt machte, nach hinten fiel und sich schwungvoll auf die dritte Treppenstufe setzte, als ich das Messer hob. Ihre grünen Augen waren tief wie das arktische Meer, und in ihnen funkelten kalte Angst und plötzlicher Schrecken.
Als das Messer den höchsten Punkt seiner Bahn erreichte, sah ich an ihrem Hals das Silberkreuz, das sie seit der Middle School nicht mehr getragen hatte. Sie musste es angelegt haben, bevor sie das Haus verlassen hatte, als hätte sie gewusst, dass sie mich nicht in der Garage finden würde, dass sie diesen verhassten Ort noch einmal betreten müsste.
Während sich das Messer herabsenkte, wurde mir bewusst, dass sie das winzige Silberkreuz an der Kette gekauft hatte, als sie 13 Jahre alt gewesen war, nach dem ersten Mal, als sie Rupert Clockenwall dabei ertappt hatte, wie er sie anstarrte. Es war der Tag, an dem sie im Garten an dem Kunstprojekt gearbeitet hatte. Sie musste den Wunsch gehabt haben, dieses Böse abzuwehren und sich geschützt zu fühlen in dieser Welt, in der niemand jemals wirklich sicher ist.
Das Messer senkte sich mit weniger Kraft, als Clockenwall wollte, und mit einem anderen Ziel als dem, das ihm vorschwebte. Als sich die Klinge tief in meinen Oberschenkel bohrte, schrie ich auf, und mit diesem Schrei vertrieb ich ihn aus mir.
Ein Kreischen hallte von den Wänden wider, das weder von mir noch von Amalia kam. In diesem fensterlosen Raum konnte kein Luftzug entstanden sein, und dennoch erhob sich mehr als das. Ein Wind rauschte durch den Keller, der sich in dieser Sommernacht kalt anfühlte. Er wirbelte Staub auf, ebenso die weißen und gelben Kristalle auf dem Grab, ein Wind, der eine Verkörperung unmenschlichen Zorns war.
Ich zog das Messer aus meinem Bein, warf es zu Boden und ließ mich auf ein Knie hinab. Ich blutete, verspürte aber noch keinen Schmerz, während ich eine Hand auf die Wunde drückte.
Amalia kam wieder auf die Beine. Der Wind schien sich zu einem Rammbock zu verdichten und traf sie mit solcher Geschwindigkeit, solcher Kraft, dass das Gummiband, das ihren Zopf zusammenhielt, riss und ihre blonden Locken zu Berge standen, als ob sie eine Kerze und ihr Haar die Flamme wäre. Ich glaubte, sie würde gleich von den Beinen gerissen. Der Anhänger streckte sich gerade von ihr weg, bis zur vollen Länge der Kette, als würde er von ihr weggezogen und davongeweht. Sie packte ihn mit einer Hand und hielt ihn an ihren Hals.
Dann hörte ich wieder das Geräusch, das mich in der vorigen Nacht, als dies alles begonnen hatte, geweckt und zum Fenster gelockt hatte, ein Klang, als würde Stahl über Stahl gezogen. Wie zuvor ertönte es dreimal, doch jetzt hörte es sich weniger wie ein Schwert an, das aus einer Scheide gezogen wurde, sondern eher wie eine große Metalltür, die über eine Türschwelle kratzte. Der brüllende, pfeifende Wind schien durch diese unsichtbare Tür zu wehen. Dann wurde es still im Keller und der Staub sank wieder zu Boden.
Weil Amalia ebenso robust wie stark und ebenso stark wie klug war, kniete sie sich neben mich, verschwendete keine Zeit damit, über das zu sprechen, was wir gerade erlebt hatten, und sagte: »Dein Bein, die Wunde, lass mich mal sehen.«
Das Blut war zwischen meinen Fingern hindurchgeströmt, hatte mein Hosenbein verdunkelt und war auf den Boden getropft. Aber als ich meine Hand von der Verletzung nahm, sah ich, dass meine Hose kein Loch hatte. Staunend hob ich die Hand und sah, dass das Blut, das noch vor einem Augenblick von ihr herabgetropft war, nicht mehr zu sehen war. Die Hose war nicht mehr besudelt, der Boden ohne einen einzigen roten Fleck. Die Messerklinge funkelte und schien so sauber zu sein, als wäre sie gerade erst geputzt worden.
Ich stand auf und war körperlich unversehrt, im selben Zustand, in dem ich das Haus betreten hatte. Auch Amalia erhob sich. Sie sah mir in die Augen, und keiner von uns brachte ein Wort hervor. Sie legte die Arme um mich, ich umarmte sie, und nach einer Weile gingen wir die Treppe hinauf zur Küche.
Wir gingen zusammen durch das stille Haus und schalteten die Lampen aus, die ich eingeschaltet gelassen hatte. Bevor wir gingen, zeigte ich ihr das Sammelalbum über Melinda Lee Harmony, das Tagebuch sowie das Album, in das er mit Klebeband ihre Klassenfotos aus der Middle School eingefügt hatte.
Immer noch sprachen wir kein Wort. Wir hatten nicht das Bedürfnis, das gerade Erlebte in Worte zu fassen, denn wir verstanden seine Bedeutung in unseren Herzen.
Wir schlossen die Haustür und gingen die Verandatreppe hinunter. Die Nacht tilgte die letzten violetten Farbtöne vom Himmel, während wir Clockenwalls Garten durchquerten.
Am Hintertor sagte Amalia: »Das Glenn-Miller-Zeug hat also doch nicht deine Nerven beruhigt.«
»Ich hätte besser ein Guy-Lombardo-Album auflegen sollen«, erwiderte ich.
10
Wir wollten dieses Haus nie wieder betreten. Wir wollten auch nicht über das sprechen, was geschehen war, oder Fragen darüber gestellt bekommen. Meine Schwester benutzte eine Schreibmaschine in einem Arbeitsraum in der öffentlichen Bibliothek, um einen Brief an die Polizei zu schreiben. Darin beschrieb sie detailliert, was die Polizisten im Clockenwall-Haus finden würden. Sie stellte sicher, dass sie sämtliche Fingerabdrücke von Briefbogen und Umschlag entfernt hatte, bevor sie den Brief in einem Postamt abschickte, das zwölf Blocks von unserem Haus entfernt war.
Vielleicht hielten sie den Brief für einen Schwindel. Aber sie mussten sich vergewissern. Eine Woche lang war die Geschichte eine Sensation, und das war bereits eine lange Zeit in einem Jahr voller großer Nachrichtenstorys über den Krieg in Vietnam und die Rassenunruhen in den amerikanischen Städten.