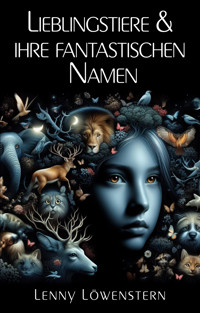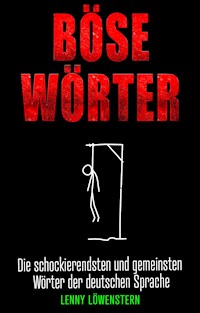2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Wer ist der Sommermörder? Erst ergattert die verträumte Hutmacherin Josefine Bach den wichtigsten Auftrag ihres Lebens, dann macht sie eine erschütternde Entdeckung. Der Bernburger Bankdirektor Jochen Sommer wird ermordet. Hartnäckig und von Neugier getrieben, stellt das »verrückte Huhn« auf eigene Faust Ermittlungen an. Sie verliebt sich in ihren Helden und schwebt bald ahnungslos in höchster Gefahr. Zum Träumen und Mitfiebern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Josefine und der Sommermörder
von Lenny Löwenstern
Eins
Irre, dachte Josefine. Ich träume. Ich hab’s wirklich geschafft. Ich hab ihn, den Auftrag. Von IHM persönlich. Ist das denn zu glauben?
Eben hatte sie die Tür hinter dem großen Kleon von Üyr zugeschoben. Ihr Schicksal lag zitternd eine halbe Stunde lang in seinen Händen. Am Ende hatte der gefeierte Modeschöpfer aus der Metropole ihre Entwürfe akzeptiert und zwei davon gleich mitgenommen.
Nun war das Glück da, doch sie bekam es noch nicht zu fassen. Kein Wunder, wenn einem das Herz überläuft. Josefines Füße begannen zu tanzen. Sie musste ihnen nichts sagen. Sie musste nicht darüber nachdenken, wie man seine Füße zu fröhlichen Bewegungen brachte, es geschah einfach.
Ein Hauch von Parfüm schwebte noch in der Luft. Sie würde das Fenster erst später öffnen und auch des Meisters Glas nicht berühren. Pfirsichlimonade hatte sie für ihn gemacht, deren Duft konnte sie noch riechen. So wollte sie seine Anwesenheit noch ein wenig länger auskosten.
Noch im letzten Sommer hatte sie um jeden Auftrag bangen müssen. Ein hutverrücktes Publikum gab es in der Stadt nicht in dem Umfang, wie der kleine Betrieb es gebraucht hätte. Aber da war noch das Internet. Die Geschäftsfrau Josefine Bach hatte angefangen, ihre Kreationen herumzuzeigen. Prompt liefen Anfragen und erste Bestellungen ein. Die Sache hatte vorläufig ihre Krönung gefunden, als der bewunderte KvÜ, seines Zeichens Couturier der Herzen aller Damen über dreißig, sich ihrer Dienste versicherte. Für eine Modenschau sollte sie ein halbes Dutzend extravaganter Kopfbedeckungen beisteuern. Frische Kreationen sollten die Präsentation in den Himmel ziehen. Das war der Plan. Und für den war kein Aufwand zu groß.
Josefine angelte sich eine Dose Glitzerpuder aus dem obersten Regal. Das fiel ihr leicht, denn sie war hochgewachsen. Storchenklapperdürr sagten die Leute. Manche Menschen brachten ihr Äußeres in Verbindung mit Bäumen, Bohnen und sogar Riesen. Die Gemeinsten darunter hatten sich nicht gescheut, sie mit einem Mobilfunkmast zu vergleichen. Ihre beste Freundin Henni nannte sie liebevoll einen Luftzug mit Hutgeruch. Denn dünn war sie ja auch. Henni musste es wissen, denn Henni kannte sich mit Körper und Gewicht aus. Henni hatte sehr, sehr viel davon.
Josefine dachte nach, grübelte ein bisschen, verträumte sich in der Minute. Das Glitzerpuder war vergessen. Sie spielte mit einem Krümel, den sie über die Werkbank jagte. Fünf Minuten brachte sie mit der Krümeljagd herum. Dann kam ihr die nächste Idee. So nutzte sie gern ihre Zeit. Meist pflegte sie eine schlichte und praktische Art, mit den Dingen umzugehen. So nannte Josefine das Haus zwar ihr Eigen, eine Erbschaft der Eltern, eine Wohnung darin hatte sie jedoch nicht bezogen. Ihr genügte die Werkstatt im Erdgeschoss, die zugleich als Verkaufsraum diente. So hatte sie stets alles beisammen. Eine gemütliche Sitzecke mit einem flauschigen Teppich gab es auch. Dort stand ein Sofa mit reichlich Kissen, ein niedriger alter Holztisch, ein Bistrotisch mit zwei Stühlen und ein deckenhohes, kenntnisreich gefülltes Bücherregal. Nichts passte zueinander, alles war betagt, aber nicht schäbig. Kein Stück war etwas Besonderes. Dennoch vermisste sie nichts. Das Wichtigste an einem Heim ist, wie man sich darin fühlt.
Die einen stecken ihren Kopf in die Wolken, die anderen in den Sand. Josefines Kopf befand sich in einer Hutschachtel. Eine verlegte Hutnadel ließ ihr keine Ruhe. Sie war doch eben noch da gewesen … Hutnadeln mögen zwar aus der Mode gekommen sein, wie Hüte im Allgemeinen, doch gehörten die kräftigen, dekorierten Nadeln für manche Trägerin immer noch dazu. Damit kriegte man den Hut auch noch auf das widerspenstigste Haar. Selbst wenn es zu allen Seiten abstand, so wie ihres. Oder wenn man es mal mit dem Haarspray übertrieben hatte oder der Hut nicht zum Kopf passte. Und selbst der Wind konnte daran nichts ändern. Ganz gleich wie er pfiff und sauste. Außerdem kam so ein gewisser Reiz hinzu. Das war umso wirkungsvoller, je schlichter ein Hut sich präsentierte. Natürlich musste man aufpassen. Waren die Nadeln zu lang, konnte man sich oder andere Menschen damit verletzen, aber es gab passende Endstücke dazu.
In einem gläsernen Raritätenkasten lagen historische Objekte, die angeblich Prominenten gehört haben sollen. Eine war von Agatha Christie in den Dreißigerjahren in Ägypten spazieren getragen worden. Die Sonne hatte das Metall dunkel gefärbt. Eine andere hatte Colleen Moore gehört, einer Schauspielerin aus der Stummfilmzeit. Es gab sogar ein Foto davon … Ob es sich aber wirklich um das Original handelte, das durfte guten Gewissens angezweifelt werden. Experten hätten wohl das zu geringe Alter angemerkt. Josefine war das egal. Für sie waren Colleen und Agatha herausragende Exemplare ihrer Sammlung. Die altertümliche Vitrine nahm einen Ehrenplatz in der Werkstatt ein. Die Nadeln standen nicht zum Verkauf, sie waren eher Ausdruck einer verhinderten Sammelleidenschaft. Manchmal holte sie eine davon hervor, um sie selbst zu tragen, um sie an einem neuen Hut auszuprobieren oder um sie zu bewundern. Josefine stellte sich dann vor, Stummfilmschauspielerin zu sein oder durch Ägypten zu stolzieren oder … Aber treten wir ihr jetzt nicht zu nahe.
Die Hutmacherin hatte ein Problem. Sie suchte immer noch. Eine ihrer Nadeln war abhandengekommen. Swetlana war eine besonders kräftige, solide Nadel, ideal für die riesenhaften Hüte vornehmer Matronen, mit einer Süßwasserperle als Knauf. Angeblich hatte sie einst einer russischen Prinzessin gehört, vor über hundert Jahren. Unglücklicherweise gab es keinen Beleg für diese Theorie, kein Foto, nichts. Echt oder nachgebaut, Swetlana gehörte zu ihren schönsten Stücken der Sammlung. Umso ärgerlicher, dass sie sie verlegt oder verloren haben musste. Wenn sie sich nur erinnern würde …
Vielleicht sollte sie das bunte Werkstattchaos einmal aufräumen. Alles nach System sortieren. Aber sie liebte es, in dem Durcheinander zu arbeiten. Und ER mochte es auch. Sie war sicher, sie fühlte es.
»Eine Woche, liebe Josefine«, hatte er zu ihr gesagt. »So viel Zeit kann ich Ihnen geben. Ach, ist das wunderschön hier. Ich liebe Ihr altes Handwerk und das schöpferische Durcheinander.« Waren das nicht seine Worte gewesen? »Wie ich Sie beneide, Sie ahnen es nicht. Ich habe selbst jahrelang genäht und gebastelt. Habe mir die luftigsten Kleider selbst geschneidert. Ach, das war schön. Heute ist da zu viel Druck. Aber ich langweile Sie. Und wenn es etwas gibt, dass ich Menschen niemals antun will, dann ist es, sie zu langweilen.«
Kleon von Üyr war ein groß gewachsener, kräftiger, hantelgestärkter Mann. Geld musste er darüber hinaus haben und der Erfolg war ihm so was von hold. Nicht wenige Damen würden Josefine um den gerade erfolgten Besuch auf das Äußerste beneiden. Unglücklicherweise war Kleon nicht an Frauen interessiert. Er lebte mit einem alten Knacker zusammen. Das wusste sie aus dem Fernsehen. So was gibt’s in Berlin.
Trotzdem hatte er genau hier gestanden, in dieser Werkstatt. Er hatte eine Lederjacke getragen, ein schlichtes weißes T-Shirt darunter. Seine Augenlider hatte er pfirsichfarben geschminkt. Was für ein Kontrast. Gemeinsam hatten sie gefachsimpelt. Josefine hatte ihm ihre verrücktesten Ideen vorgeführt. Gejauchzt hatte er. Die Mode war sein Lebenselixier und Hüte das ihre. Seine Ideen und hingeworfenen Skizzen inspirierten sie prompt zur nächsten Tat. Sie hatte ihm freche Materialien, ungewöhnliche Zierstoffe und selbst ausgedachte Formen gezeigt.
Kleon war aus sich herausgekommen, hatte emotional reagiert und sie immer wieder gelobt. Dann wieder hatte er nervös, fast fahrig gewirkt. Manchmal schien er so gar nicht bei der Sache, träumte sich regelrecht fort aus dem Raum, so schien es. Nicht, dass sie das nicht verstehen konnte … Bestimmt denkt er an seine eigenen Entwürfe, wusste Josefine sich das Benehmen zu erklären. Vielleicht, hoffte sie, machte sie ihn auch ein ganz kleines bisschen nervös. Das hoff ich wohl … Denn überraschenderweise war KvÜ ohne seine Assistentin erschienen. Im Fernsehen sah man die beiden ausschließlich gemeinsam. Romi Ginsterberg war Teil seiner Entourage. Bewegte er sich durch Berlin oder in den Modemetropolen der Welt, folgte ihm eine Traube aus Unterstützern, Freunden, Günstlingen, Presseleuten und Security. Romi immer vorneweg an Kleons Seite.
Während seiner Ausflüge in die Provinz zog er es vor, inkognito unterwegs zu sein. Den Anhang konnte er dabei nicht brauchen. Nicht unbedingt verkleidet zog er durch Straßen und Gassen, aber doch gewöhnlich genug, um niemanden aufzufallen. Heute allerdings hatte er Romi ins Studio zurückgeschickt. Sie sollte etwas erledigen, das offensichtlich keinen Aufschub duldete.
»Ist es meinetwegen?«
»Nicht doch, meine Liebe. Wo denken Sie hin mit Ihrem bezaubernden Köpfchen? Schauen Sie, der hier sieht aus, als hätte ihn ein Engel gemacht und zu uns heruntergeschickt.«
Dabei waren es Josefines geschickte Finger gewesen, die den Hut zu verantworten hatten. KvÜ wusste das natürlich. Wollte er ablenken?
»Also, was macht Romi gerade?«
»Romi wird die Bahn nehmen und wahrscheinlich nicht früher ankommen, als ich in meinem Maybach. Wollen Sie es wirklich wissen?«
Josefine nickte. Sie wollte unbedingt.
»Dann will ich es Ihnen erläutern, meine Teuerste. Es ist nichts anderes als ein kleiner Denkzettel. Romi soll über etwas nachdenken, genug Zeit dazu hat sie jetzt. Das Mädchen war so fahrig heute Morgen, oh je, oh je. Unkonzentriertheiten kann ich nicht leiden. So etwas geht einfach nicht in unserer Branche. Jeder von uns hat stets die optimale Performance hinzulegen, im Großen wie in den Details. Alles ist wichtig, wenn man oben mitspielen will. Und was für mich gilt, das gilt auch für meine Angestellten.«
KvÜ warf die Arme empor und stellte sich künstlich in Pose. Er wirkte wie ein Schauspieler, gab sich gewollt exaltiert. Den Applaus spendierte er sich selbst. Er klatschte in die Hände und forderte Josefine auf weiterzumachen.
»Jetzt ist aber genug geredet. Wenden wir uns unserer Arbeit zu. Die Romi brauche ich heute nicht. Mit Ihnen, liebe Josefine, werde ich auch allein fertig. Oder trauen Sie mir das nicht zu?«
»Was ich Ihnen zutraue, das behalte ich doch lieber für mich«, hatte sie ihm verschmitzt gestanden und beide hatten gelacht. Sein glattes Kindergesicht hatte gestrahlt, nur der gefärbte Bart, der im Licht wie aufgemalt wirkte, leuchtete unheimlich auf.
»Lassen Sie uns noch ein paar Ihrer famosen Hüte aufprobieren, ehrenwerte Meisterin.«
Und los ging es. KvÜ hatte sichtlich Spaß daran, Damenhüte aufzusetzen. Und er schaute sich selbst gern im Spiegel beim Tragen zu. Ein wenig seltsam mochte das aussehen, der Bart unter dem bunten Stoff und all der Glitzer. Doch angesichts dieser Menge geballter Sympathie kicherte sie das einfach weg.
Grundsätzlich probierte Josefine jede ihrer neuen Schöpfungen selbst aus. Sie trug sie in der Stadt spazieren, denn sie musste wissen, wie ihre Ideen auf die Leute wirken. Dabei erfuhr sie, dass nicht alles immer praktisch ist, was die Muse ihr in den Sinn gezaubert hat. Die Welt kunstvoller Kopfbedeckungen ist eine verspielte Welt, da kann man nichts machen. Und warum sollte man auch? Hüte sollen beschirmen und vor Unbill schützen, dabei dürfen sie fantastisch aussehen und Spaß machen. Erst dann ist ein Hut ein Hut. Jedenfalls solange es um Damenhüte geht.
Dieser eine neue Hut ragte so weit auf, dass es Probleme damit gab. Vögel flogen dagegen. Unterführungen waren ein Risiko und bei Wind ging man besser erst gar nicht vor die Tür. Na schön, dachte sie, diese Kreation ist unpraktisch, also wird sie für den Laufsteg genau das Richtige sein. Ob sie jemandem gefällt, das wüsste ich gern.
Abgemacht waren sechs neuartige Hüte, die in Berlin gezeigt werden sollten. Die ersten Entwürfe hatte Kleon von Üyr am Computer begutachtet. Nun wollte er zwei fertiggestellte Exemplare in natura bewundern und ihre Schöpferin kennenlernen.
»Es ist alles wie besprochen«, sagte sie.
»Nein«, widersprach er. »Sie sind schöner als auf den Fotos.«
Für einen Moment dachte Josefine, er würde sie meinen. Aber das war doch zu lächerlich. Sie schob den Gedanken beiseite.
»Eine exzellente Arbeit. Wenn Sie einverstanden sind, nehme ich die beiden Hüte jetzt schon mit nach Berlin. Ich möchte sie meinem Team zeigen.«
»Ich habe passende Hutkoffer da«, sagte sie und wagte kein weiteres Wort.
Kleon liebte Glitzer, ihm konnte es nie glamourös und funkelnd genug sein. Pailletten? Gern. Flimmersternchen? Wo es nur geht, meine Teuerste. Stäubchen und Flitter? Musst du haben. Strass? Ich bestehe darauf. Goldener Zierrat? Bitte mehr davon. Aus seiner Sicht war nichts überladen, nie etwas zu viel. Strahlen sollten seine Mannequins unter ihrem Kopfputz. Und das würden sie auch. Wunderglitzerhüte würde Josefine ihnen erschaffen. Sie würden in einem Glitzermeer schwimmen. Die Hüte wurden gehörig schwer, das war ein Nachteil. Aber der Meister zahlte es ja und die Backfische aus der Ukraine und Weißrussland hatten gewiss starke Hälse.
»Es ist aufwühlend hier. Ihr Bernburg hatte ich mir ganz anders vorgestellt, langweiliger, um ehrlich zu sein«, hatte er bei der Arbeit gemeint und an den Hüten herumgezupft. »Doch jetzt und hier erleben Sie mich regelrecht aufgewühlt.«
»Sie haben bestimmt schon viel gesehen.«
»Fast alles, meine Liebe. Ach was, ich übertreibe, Sie merken das, oder? Ach, Ihnen kann ich nichts vormachen. Das Fernsehen, die Presse machen das mit einem. Bei Ihnen werde ich wieder zum Kind und möchte mit all den schönen Sachen spielen.«
Was ihr überhaupt nicht recht war. Kleon möge doch bitte ein Mann bleiben. Er grinste auch sofort sein unverschämt jugendlich altkluges Kleonlächeln. »Aber manchmal findet man eine Perle«, sagte er. »Das verändert ein Leben. Ganz überraschend. Ihr Bernburg ist so unglaublich charmant. Der Verfall, all diese alten Häuser. Finden Sie nicht? Ach wissen Sie, überall stößt man auf die zwanziger Jahre. Ich meine die des letzten Jahrhunderts. Es ist … herrlich. So eine glorreiche Zeit. Schade, dass wir das nicht mehr haben.«
Redet der jetzt von der Mode, von Bernburg oder von mir? Sie war sich nicht sicher. Beim Herrn von Üyr purzelten die Gedanken schon einmal übereinander. Nicht dass ihn das unzivilisiert gemacht hätte. Im Gegenteil …
»Erinnerungen sind auch was Schönes.«
»Erinnerungen genügen mir nicht. Ein Kleon von Üyr will erleben.«
Wie er sie ansah. Überlegen, ja. Und so bestimmt, aber doch warmherzig auf seine Art. Sie spürte die Unruhe, die von ihm ausging. Das war das kraftvolle Herz, der Mann wollte zur Tat schreiten. Oder spielte er nur mit ihr, so wie sie mit den bunten Stoffen und den Hüten?
Kleon von Üyr hatte, wie er es immer zu tun pflegte, auch in Bernburg einen Rundgang durch das Stadtzentrum unternommen. Eine Marotte von ihm, gewiss, die ihn aber doch menschlich und nahbar machte. Josefine freute sich über das Interesse an ihrer Stadt. Dass Kleon sich für jedes seiner zahlreichen Ziele in der Provinz interessierte, musste sie ja nicht wissen.
»Ich komme bestimmt öfter her. Ihre Werkstatt ist fantastisch. Ich kann die neuen Kreationen kaum erwarten. Wie ist das alles nur schön. Und all diese Farben, nein.«
Die Hutmacherin wusste kaum, wie ihr geschah, Lob war sie nicht gewohnt. Kleons Euphorie wirkte mindestens so belebend wie ein Glas Erdbeerlimes. Wahrscheinlich war das Teil seines Erfolgsgeheimnisses, überlegte sie. So musste man sein, wenn man in der Welt etwas zuwege bringen wollte.
»Wenn Sie mögen, zeige ich Ihnen meine Dachterrasse. Oben haben wir das beste Tageslicht und niemand stört oder sieht uns. Es ist auch nicht so stickig wie hier in der Werkstatt.«
»Vielleicht beim nächsten Mal. Dann schaue ich sie mir gern mit Ihnen zusammen an. Für heute möchte ich nur diesen Raum in Erinnerung behalten. Und natürlich Sie, meine Teuerste.«
Verträge hatte er nicht machen wollen. Sein Wort und Pfirsichduft sollten genügen. Heute sei er nicht der Geschäftsmann, sondern nur der Kreative. Er fühle sich angespannt und ein wenig überreizt, ihm sei nicht wohl. Nur keine Geschäfte jetzt. Er wolle noch eine Runde laufen gehen, gleich vor Ort unten an der Saale. Ob Josefine ihm eine Route empfehlen könne? Freundlich hörte er sich ihren Rat dazu an. Mit den Details zu dem Auftrag käme Assistentin Romi auf Josefine zu. Gleich morgen oder übermorgen würde das geschehen. Sie könne sich darauf verlassen. Das hatte er gesagt. Und daran konnte kein Zweifel bestehen, der Mann war schließlich prominent. Und seriös auf eine eigenartige Weise, obwohl er sich wie ein Luftikus benahm. Alles musste er anfassen, überall hineinschauen. Und wo immer möglich betrachtete er sein Spiegelbild, in einem Löffel, in Scherben, in der Goldfolie, in den Scheiben der Vitrine …
Dieser Mann hatte es nicht einfach gehabt im Leben, Josefine konnte das spüren. Umso schöner, dass er so weit hatte aufsteigen können. Frauen liebten seine Mode, seine Einfälle und das, wofür er stand. Die Show, seine echte tief empfundene Begeisterung. Sie wollte ihn mit ganzem Herzen und ihrer gesamten Handwerkskunst unterstützen. Ob ich ihm eine Route empfehlen kann, das will er wissen? Es kommt darauf an, wohin es Sie zieht, Herr von Üyr, dachte sie. Den Weg zu meinem Herzen muss ich Ihnen nicht beschreiben. Sie kennen ihn schon. Oder wollen Sie wirklich nur joggen gehen?
Ein schnelles Küsschen links und eines rechts. KvÜ hatte sich die beiden rosa Koffer geschnappt und war mit den Schätzen abgeschwirrt.
Wo ließ er die jetzt? Er wollte doch joggen. Dann fiel ihr der Maybach ein, der auf ihn wartete. Ein KvÜ denkt an alles.
»Wir telefonieren, Teuerste«, hatte er gemeint und ihr routiniert noch einen letzten Kuss zugeworfen, wie man das eben macht in Berlin. Gefreut hatte sie sich trotzdem. Was für ein herrlicher Tag das doch war.
Jetzt noch eine SMS an Henni.
Ihre beste Freundin wollte die Nacht in Schönebeck verbringen. Dort war sie nicht etwa zur Kur, sondern lag im Krankenhaus. Routineuntersuchungen, die einmal im Jahr an ihr vorgenommen wurden. Henni hatte über die Jahre einige schreckliche Krankheiten aufgesammelt und trug sie nun beharrlich durch ihr Leben. Sie sprach selten davon. Henni lachte das alles weg.
»Alles gut?«
»Alles im Eimer. Sonst gut.«
»KvÜ war da. Hab den Auftrag!«
»Oh Fienchen!«
Zurück kamen ein Glückwunsch und eine Armada aus Herzchen und weiteren Emojis. Ein Vorrat, der bis morgen reichen würde. Dann würden sie sich sehen.
»Lass du dich mal richtig schön inwendig ausleuchten. Wer weiß, was man da alles finden kann.«
»Das will ich gar nicht wissen.«
Nachdem ihr Gewissen beruhigt war, verstaute Josefine das Handy. Es war ihr erstes. Ihre Weltvergessenheit hatte sie sich lange bewahren können. Aber als Geschäftsfrau ging es auf Dauer nicht ohne. Inzwischen hatte ein zwiespältiges Verhältnis zu dem Gerät entwickelt. Einerseits hatte sie dessen Möglichkeiten schätzen gelernt, andererseits störte sie die fast zwangsläufige Dauerkommunikation, die damit einherging. Wenn man nicht aufpasste, hatte man keine ruhige Minute mehr. Dafür, fand sie, hatte sie es nicht angeschafft. Immerhin, mit Handy und Kühlschrank war ein Stück Vernunft in ihre Welt eingezogen. Aber nur ein wenig. Den größten Teil davon füllten immer noch die Träume aus.
Träumen …
Die schönsten Träume hat man unter dem Himmelszelt. Es ist gut, dafür eine Dachterrasse zur Verfügung zu haben. Die Dunkelheit begann sie einzuholen, als sie zu später Stunde allein unter dem weiten Dunkelrund saß. In der abendroten Welt spielten Schatten Streiche. Husch, husch und dann die Stille. Der Tag stürzte sich müde in die Nacht. Finsternis spannte sich auf und begründete ihr sternvolles Regiment.
Ja, träumen …
Das Mondschimmermädchen war in den Teich gefallen und als es wieder herauskam, schimmerte es einfach weiter. Es hatte den Mondschimmer von der Wasserobernfläche genommen wie die Haut von der warmen Milch und sich darin eingewickelt. Der Schimmer kleidete sie nun sehr. Man müsste noch nachschneidern, doch das neue Mondschimmerkleid sah einfach fabelhaft aus. Schimmersilbrig und lichtbewegt. Und doch knisterte es nicht. Das Mädchen bewegte sich anmutig kühl und lautlos hingegossen wie diese Mondnacht.
Zwei
Im oberen Stock des rot gestrichenen Altbaus wohnte die neunzigjährige Mieterin Anita Roswitha Käsebein. Dort lag auch die Dachterrasse für den gemeinschaftlichen Gebrauch. Sie war der Treffpunkt der Hausbewohner. Das waren, abgesehen von Josefine mitsamt Werkstatt und Verkaufsraum, Frau Käsebein und die Peißens, Geschwister, die im ersten Stock eine WG aufgemacht hatten. Die gegenüberliegende Wohnung war nicht vermietet. Josefine ließ sich Zeit, wollte sich jemanden Passendes aussuchen und dabei keinen Fehler machen. In Bernburg gab es Leerstände, was die Vermietung nicht einfacher machte. Eines Tages würde sich der perfekte Mieter melden, das stand für sie fest.
Sie nahm den gläsernen, außen angebrachten Fahrstuhl. Frau Käsebein fand sie beim Blumengießen auf der Dachterrasse.
»Guten Morgen, Käsebeinchen.«
»Guten Morgen, Liebes.«
Josefine produzierte einen besorgten Ausdruck, um ihre Mieterin zu foppen, was aber nicht recht gelang.
»Nun sag schon, hat es geklappt?«
»Und wie!« Josefine grinste. Länger hätte sie die ernste Version ihres Gesichts sowieso nicht aufrechterhalten können. Und hinter ihr lachte schon die Sonne. Anita Roswitha Käsebein stellte die Gießkanne ab und rollte herüber.
»Oh, das ist schön. Das hast du dir verdient. Rackerst dich hier in der Provinz ab. Die meisten wissen das gar nicht zu schätzen. Das sind doch alles Hutmuffel.«
»Ein bisschen Glück habe ich schon gehabt.«
»Papperlapapp, das war pures Können, nichts anderes. Und eine Portion weiblicher Charme.«
»Ich gehe einkaufen. Irgendwelche Wünsche? Ich habe noch Tragekapazitäten an meinen Armen.«
»Heimlich trainiert?«
»Von wegen, gearbeitet habe ich. Die Kollektion für den berühmten KvÜ entsteht eben nicht von selbst.«
»Dein Modeheini hält dich ja ganz schön auf Trab. Und was für ein Name das ist …«
»Hast du ihn gesehen? Eine stattliche Erscheinung ist das. Davon schwärmen alle.«
»Sogar Männer, habe ich gehört.«
»IHM widersteht eben niemand.«
»Na, solange du dich nicht von IHM ausnutzen lässt. Diesen Berlinern ist nicht zu trauen. Und wenn die dann auch noch in Mode machen … Ist das denn wirklich seriös? Also, ich weiß nicht, Kindchen.«
»Nur keine Sorge, ich mache nur die Hüte für ihn. Das, was ich sowieso gemacht hätte. Aber jetzt kriege ich einen Batzen Geld dafür.«
»So?«
Leicht war Anita Roswitha Käsebein nicht von den guten Nachrichten zu überzeugen. Josefine nahm ihren Strohhut ab und brachte sich in die Pose, die sie vorhin bei Kleon von Üyr gesehen hatte. Den Hut stieß sie jubelnd in die Wolken. Oder sagen wir … fast. Groß genug dafür wäre sie ja beinahe gewesen.
»Also jetzt noch mal für mein Käsebeinchen. Ich hab den Auftrag! Es ist alles gut.«
Jetzt fiel der Groschen. Frau Käsebein beglückwünschte ihre Vermieterin, drückte ihre Hände und war stolz auf Josefine, mit der sie mehr als nur gelegentliche Plaudereien verband.
»Eierlikörchen?«
»Jetzt nicht.«
»Wenn du meinst.«
»Nun kann ich mich kreativ austoben, und den Laden finanziert es auch.«
»Zeigst du mir deine Entwürfe?«
»Später vielleicht. Erst sind die Einkäufe dran.«
»Alles klar. Hast du Lust auf ein Abenteuer in der Stadt?«
»Wartet denn eins auf mich?«
»Weiß ich’s?« Anita Roswitha Käsebein kicherte listig. »Dazu braucht man kein Abenteuerland. Mit meinen jetzt neunzig Jahren weiß ich das. Irgendwo wartet immer ein Abenteuer auf einen, man muss es nur finden.«
»Und woran erkennt man das Abenteuer?«
»Der Drang ist es, es zieht dich hin zu ihm.«
»Das kenne ich.«
»Natürlich kennst du das …«
Die Frauen schauten einander an.
»Für manche ist das ganze Leben ein Abenteuer.«
»Für dich, Käsebeinchen?«
»Na, was denkst du. Die wilden Zeiten sind vorbei, das ist nicht zu übersehen. Aber Abenteuer? Pah, Affären hatte ich und Eskapaden. Und was für welche! Das kann sich einer heute gar nicht mehr vorstellen. Damals in Budapest, das waren noch Zeiten.«
Den Teil kannte Josefine schon. Die alte Frau Käsebein, die von einer Mieterin zur Freundin und Ersatzoma geworden war, war einmal Tänzerin gewesen. Das war länger her als ein ganzes Josefinisches Leben. Den gesamten Ostblock hatte sie unsicher gemacht in der Nachkriegszeit. Den wilden Osten gab es nicht mehr, und die flinke und drehfreudige Pirouettenkönigin Anita Roswitha saß abenteuermüde in einem Rollstuhl. An den hatte sie sich gewöhnt, für den Rest ihrer Zeit würde er genügen, meinte sie, wenn mal eine Bemerkung dahingehend kam. »Ich habe genug getanzt für ein Leben. Jetzt sind eben andere dran.«
»Aber Frau Käsebein«, sagten dann die Leute.
»Ich tanze weiter, keine Sorge, aber eben inwendig, in meinen Gedanken. Jeder Tanz geht weiter. Ein Tanz, der einmal begonnen wurde, hört nie auf. Die Bewegung bleibt für immer erhalten. Das Momentum bleibt. Das nennt sich Leben. Oder Abenteuer. Ganz wie ihr Junggemüse wollt. Ein Tanz ist ewig. Die Ewigkeit tanzt.«
So war sie, die alte Frau Käsebein. Immer für eine Einsicht und einen Ratschlag gut. Josefine brauchte hin und wieder eine Portion davon, die sie sich nur zu gern auf der Dachterrasse abholte.
»Ach, was ich noch fragen wollte«, kam Josefine etwas in den Sinn. Dabei setzte sie ihr typisches Gesicht auf. Das war einerseits fragend, andererseits signalisierte es ein entschiedenes Ich-war-das-nicht. Ich habe nichts gemacht. Ich bin unschuldig, sag erst gar nichts.
»Habe ich eine Hutnadel bei dir liegen lassen?«
»Nicht, dass ich eine bemerkt hätte. Aber im Vergessen warst du immer schon Meisterin.«
Na danke schön auch …
»Bis später dann«, rief sie im Davongehen.
Der Tag hatte als Montag begonnen, und würde zu einer festgelegten Zeit als Dienstag enden, so viel stand fest. Ebenso stand fest, dass am Montag Einkäufe zu erledigen waren. Davon konnte sie auch ein KvÜ nicht abhalten. Obwohl sie es sich gern gefallen ließe.
Josefine war, wie wir bereits wissen, äußerst beschwingt zu dieser Stunde. Die gute Laune musste genutzt und sollte nicht durch anstrengende Arbeiten verdorben werden. Ein wenig frische Luft und ein Bündel Sonnenstrahlen waren da genau das Richtige.
»Luise«, rief sie energisch. »Wir gehen aus!«
Luise mochte zuhören, antworten aber konnte sie nicht. Eine Kammerdienerin war die Luise auch nicht. Luise war ein Bauchladen, gezimmert aus lichtgrauem Treibholz. Josefine kam sich immer vor, als trüge sie ein Stück vom Meer spazieren. Das Holz hatte seine sämtliche Schwere einst ins Wasser verloren, sich aber auch nach Jahren noch einen Hauch von Salz und Tang bewahrt. Der Kasten diente seiner Eigentümerin als Rucksackersatz und Vorratsbehälter für Gegenstände aller Art. Der sperrige, ehemals weiß lackierte Behälter war zwar in mancher Situation hinderlich, doch er war so gut gefüllt, dass er einer Kammerdienerin gelegentlich durchaus nahekam. Es war so ziemlich alles vorhanden, was ein Mensch wie Josefine unterwegs brauchen konnte oder auflas, in dem Kasten verstaute und später vergaß, es wieder daraus hervorzuholen. Auf Luise war Verlass. Ein Rucksack und sei er auch noch so klug erdacht, würde ihr das niemals bieten können.
Nur die allerwichtigsten Utensilien kamen mit. Außer der Luise waren das der Haustürschlüssel, die käsebeinerne Einkaufsliste (auf der es nur zwei Positionen gab), das Handy und ein unbenutztes Notizbuch. Falls sie eine Idee überkam, die es festzuhalten lohnte. Sie war fest entschlossen, es eines Tages zu nutzen. Das Büchlein war da, es fehlte allerdings noch an festhaltenswerten Einfällen. Schließlich wollte sie nicht irgendwas notieren … Und der Hut. Ohne Hut wagte sich Josefine nicht vor die Tür. Das ginge nicht. Wie häufig im Sommer trug sie einen selbst geflochtenen Strohhut aus Seegras. Der war so leicht, dass er einen in den Himmel ziehen konnte, wenn man nicht aufpasste. An solchen Tagen hingen die Hutträgerinnen überall herum oben im Blau, grüßten einander mit den freundlichsten Worten, die man je gehört hatte. Und durchschwebten zufrieden das frischwarme Himmelszelt. Ohne Hut war es nicht gut um Josefine bestellt. Ach, es war gänzlich unmöglich, sich das auch nur vorzustellen. Und was hätten die Leute erst zu ihrem Haar gesagt.
»Also das ist ja wohl …«
»Wie kann man nur so rumlaufen?«
»Hat die keine Bürste?«
»Als wären Frisur und Friseur nie erfunden worden.«
»Guck dir die mal an, Struwwelpetra persönlich.«
Die kannte sie alle. Gar nicht dran denken und gleich zum Hut gegriffen, da konnte einem nichts mehr passieren. Der Hut war ein Beschützer, unter dessen Obhut man sich sicher fühlen konnte.
Endlich im Freien …
Die Nachmittagsluft roch noch immer ein wenig frühlingsfrisch, duftete rosa und lindgrün. Die Sonne lag schon auf der Lauer, lediglich ein davorgeschobenes Wolkenband hielt sie von ihrem strahlenden Tun ab. Dann würde es warm werden und der Sommer die Stadt erobern.
Wie üblich in Jeans, himbeerfarbenen Turnschuhen und Marinière genoss Josefine die kurze Strecke ins Zentrum.
Schweben …
Über eine Flasche Rotkäppchen dachte Josefine nach. Der Deal mit Berlin wollte gefeiert werden. Wie das schon klang, Deal. Irgendwie professionell, jetzt gehörte sie wohl dazu. Ihre Geschäfte mit dem großen KvÜ, Josefine Enterprises. Wer wusste schon, was da auf sie zukam. Josefine musste kichern, bevor sie den erst noch zu kaufenden Alkohol überhaupt genossen hatte. Vielleicht würde sie eines Tages selbst ihre Hüte in der großen Stadt präsentieren. Josefine auf dem Laufsteg, ein überlanges Bein vor das andere. Ein Watvogel bei der Nahrungssuche. Nein, kein Watvogel, ein Paradiesvogel. So sollten die Leute über sie denken. Gestolpert wird nicht, der Vogel tut es auch nicht, egal wie lang die Natur ihm die Beine gezogen hat. Das musste auch für Josefine Bach gelten dürfen. Sie würde kunstvolle Entwürfe ihrer kühnsten Ideen zeigen, und die Modewelt läge ihr zu Füßen, schmölze dahin. Und das Glück böge sich zu ihr herunter und küsste sie pfirsichsanft auf die Stirn.
»Stehen Sie noch länger hier?«
Ohne Absicht hatte Josefine die Auslagen eines Blumengeschäfts blockiert.
»Entschuldigung«, sagte sie. »Ich war in Träumen.«
»Ja, das hat man gesehen.«
»Guck mal, die Bohnenstange schläft im Stehen«, hörte sie einen anderen im Hintergrund sagen. »Hat wohl eine LPG hier vergessen. Hat Glück gehabt, dass die nicht umgefallen ist.«
Was für Zeiten waren das, wo man für Träume und das Eingeständnis, ebensolche zu haben, öffentlich angefeindet wurde? Aber wahrscheinlich stand sie tatsächlich im Weg. Als ob das nicht mal vorkommen dürfe.
Josefine fühlte sich benommen, ob nun infolge des vorausgenommenen Rausches, ihres Erfolges oder eigener versonnener Gedanken wegen, spielte in der Situation keine Rolle.
»Muss das denn ausgerechnet hier sein?«
»Das müssen Sie schon meine Träume fragen«, meinte sie schnippisch. Als wäre der schrumpeltrockene alte Herr dazu in der Lage.
»Aber bitte schön, der Herr. Frönen Sie nur Ihrer Kauflust.«
Gegenüber stolzierte die Frau Gerlebogk mit einer Bratwurst in der Hand. Von der wusste man, dass sie ihren winzigen faustgroßen Rucksack, der als abgenutzt zu betrachten war, Margot genannt hatte. Margot sollte angeblich aus volkseigener Produktion stammen. Schlechtes Material war aber nicht der Grund für den unerklärlichen Schrumpfprozess des einst ausladenden Gegenstands gewesen. Das hatte Henni zu berichten gewusst. Die Gerlebogk soll, aber das war nur ein Märchen, damals als es die DDR noch gegeben hatte, darin Träume vom Westen und von einem besseren Leben aufbewahrt haben. Dann kam die Wende, und mit ihr die Wirklichkeit – jedenfalls erst mal. Der Rucksack, der einst für die längsten Touren um den Plattensee herum gereicht haben sollte, so groß war der gewesen, schrumpfte immer mehr. Und reichte heut grad noch für ein Portemonnaie. Trotzdem konnte sich die Frau Gerlebogk nicht von ihrer geliebten Margot trennen. Man hängt an Dingen manchmal so sehr, als seien sie Körperteile. Und Körperteile hängen manchmal so sehr … Moment, das war der falsche Gedanke. Noch mal: Körperteile legt man ja auch nicht ab, wenn sie aus der Mode kommen oder anfangen, ihren Zweck nicht mehr zu erfüllen. Wäre das so, wie würden die Leute dann aussehen und herumlaufen? Wie in der Geisterbahn wäre das. Du liebe Zeit. Obwohl, für Henni hätte man das gar nicht schlecht finden müssen. Bei der müsste dringend mal was gewechselt werden. Ach, wäre es nur so einfach …
Als Josefine auf dem Nachhauseweg am Glaspalast der Bernburger Bank vorüberkam, musste sie natürlich hineinstarren. Die Gelegenheit war zu günstig, um sie verstreichen zu lassen. Die Scheiben blitzten nämlich frisch gewischt und gewienert. Josefine legte ihre Hände auf das Glas und steckte, soweit es ihr möglich war, ohne von der Scheibe aufgehalten zu werden, den Kopf dazwischen. Auffälliger ging es nicht mehr, zumal die Luise zweimal gegen das Glas rumste. Das war nicht peinlich, denn man konnte es erklären. Es lag eben daran, dass sich der Rotkäppchen im Innern befand. Jeder andere mit einem Bauchladen und ähnlicher Zuladung hätte dieselbe Schwierigkeit gehabt. Außerdem sahen die Bankleute von drinnen auch heraus, während sie so taten, als täten sie genau das nicht.
Josefine war seit Jahren Kundin der Bank. Hier zahlte sie alle paar Tage ihr Bargeld ein, sofern es etwas einzuzahlen gab. Die beste Kundin war sie nicht, dazu war ihr Geschäft zu klein, zu weit außerhalb gelegen, zu spärlich besucht und die Kauflust der Kundschaft zu allem Unglück auch viel zu gering.
Gänzlich ungeniert beobachtete Josefine den dicken Schaltermann beim heimlichen Futtern aus einer Pappschachtel. Sie verfolgte das nervöse Tun einer wartenden Kundin neben der Hydrokultur. Im Hintergrund sah sie Mika Peißen vorübergehen, ihre Mieterin aus der Geschwister-WG, die einen Stapel Ausdrucke von einem Schreibtisch zu einem anderen schleppte. Unweit davon stand der Geschäftsführer Herr Sommer. Mika unverkennbar mit rosa gefärbtem Haar, der Sommer mit blutroter Fliege. Ein Omen, aber das wusste Josefine zu diesem Zeitpunkt nicht.
Josefine winkte energisch zurück, als Mika sie bemerkte. Der Geschäftsführer hingegen blickte absichtlich an ihr vorbei. Der hat ja eine Laune, dachte sie.
Drei
Am frühen Morgen.
Josefine: »Ich kann euch sehen.«
Sonnenstrahlen: »Echt jetzt? Ihre Augen sind aber noch geschlossen.«
Josefine: »Ich sehe euch trotzdem. Und fühlen kann ich euch auch, ihr kitzelt nämlich gerade meinen Bauch.«
Sonnenstrahlen: »Deswegen haben Sie sich doch so hingelegt. Halb aus dem Bett hängend und schräg zum Fenster gedreht. Das kann kein Zufall sein.«
Josefine: »Erwischt. Ist wirklich kein Zufall.«
Sonnenstrahlen: »Und, gefällt es Ihnen?«
Josefine: »Famos. Bitte weitermachen, liebe Sonnenstrahlen, kitzeln Sie mich ordentlich durch.«
Dann rekelte sie sich noch ein bisschen im Morgenlächeln des Tages. Die Sonnenstrahlen legten sich ins Zeug. Für Josefine sollte es erst nach Traumschluss weitergehen.
Noch bettschwer schlurfte sie schließlich in den Tag. Der Rotkäppchen von gestern Abend hatte 3,99 Euro gekostet, von seinem wahren Preis hatte jedoch nichts auf dem Etikett gestanden. Den bezahlte sie jetzt. Die Währung hieß Kopfschmerzen.
Josefine frühstückte an der Werkbank in einem bunten Durcheinander aus Materialien und Gerätschaften. Hier lagen Zangen und Hämmer, daneben die Klebepistole, drüben stand die robuste Dürkopp-Nähmaschine, was man täglich so braucht. Dazwischen historisches Werkzeug, das niemand mehr verwendete, aber ein gediegenes Ambiente erzeugte. Da waren Hohl- und Krummstampfer, verschlissene Schneidebleche, ein uraltes Walkholz, ein rostiges Raufeisen, verschiedene Filztafeln und -Bleche. Filz kam heutzutage aus der Fabrik. Man hatte ihn früher noch selbst gewalkt. Das war eine harte Arbeit und nichts für Couturiers und zarte Finger.
Apropos …
Eine massive Werkbank ist stabiler, als jeder Küchentisch es je sein kann. Und mit Verschmutzungen aller Art nimmt sie es auch nicht so genau. Sie ist das gewöhnt. Selbst wenn man das Wischen unterlässt, bleibt der Protest aus. Eine Werkbank zeigt die Spuren und Wunden eines Lebens, der Küchentisch dagegen tut vornehm, will glänzen und makellos erscheinen. So ein Tisch ist etwas fürs Schaufenster, aber nicht fürs Leben, konstatierte sie.
Josefine vergluckerte einen Becher Milchkaffee und verdrückte zwei Schokoladenbrötchen. Die Schokolade kurbelte sogleich die josefinische Fantasie an. Märchenhafte Hutdesigns erschienen vor ihrem inneren Auge. Dazu Josefine elegant auf dem Catwalk, umjubelt von Millionen, umgeben von Scharen bildhübscher blutjunger Hutträgerinnen. Sie dachte an den großen KvÜ, der über ihr strahlte wie ein Mond aus Pfirsich, und an das Glück, das er ihr verschaffte.
Er würde zufrieden mit ihr sein, zwei tollkühne Hüte hatte er bereits mitgenommen. Für den Rest würde sie sich ins Zeug legen. Aber noch nicht heute Morgen. Sie musste dringend an die Luft. Ein Spaziergang wäre das Richtige. Erst musste man in Form kommen, dann klappte es auch mit der Arbeit. Frische Luft war deshalb das Gebot der Stunde. So wäre der alkoholisierte Abend vom Vortag bald restlos vergessen. Anschließend würde Henni noch kurz bei ihr aufschlagen. Das war verabredet. So viel Freizeit musste sein.
Das Glück dieses Morgens hatte seine eigene Farbe. Es wurde Sommerhimmelblau genannt. Nur echt mit fünf Silben. Es war ein ganz besonderes Blau, das man erstens nur am Himmel und zweitens nur im Sommer finden konnte. Aber nirgendwo anders, versteht sich. Wer das nicht glaubt, der kann lange suchen und wird doch nichts Besseres finden.
Immer noch sommer- und morgenverträumt machte sich Josefine auf den Weg. Ihr Ziel war keine fünfzehn Minuten entfernt. Es war der Stadtpark, genannt »Alte Bibel«. Mehr Wald konnte man in der Stadt nicht bekommen.
Wer genau hinsah, entdeckte eine unheimliche Komponente. Was heute einen Park darstellt, war einst ein Friedhof. Daher stammte auch der Name. Gräber und Grabsteine waren zwar verschwunden, doch die ehemaligen Friedhofsmauern kündeten noch davon.