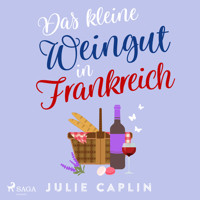18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Medien / Kommunikation - Medien und Politik, Pol. Kommunikation, Note: 1,1, Universität Siegen (Medienwissenschaft), Sprache: Deutsch, Abstract: „Was wir über unsere Gesellschaft, ja über die Welt, in der wir leben wissen, wissen wir durch die Massenmedien.“ In diesem viel zitierten Diktum des Systemtheoretikers Niklas Luhmann kommt zum Ausdruck, welche tragende Rolle Medien in modernen Gesellschaften einnehmen. Medien vermitteln, informieren, bilden Meinungen. Gerade die Demokratie erfordert es, politisches Handeln und Entscheidungsprozesse öffentlich darzustellen, denn die Regierenden sind auf die Unterstützung der Regierten angewiesen. Politische Vorhaben beruhen wesentlich auf der Zustimmungsbereitschaft der Bevölkerung. Auch in Zeiten, in denen Politiker ,twittern‘, Profile in sozialen Netzwerken haben und die Bundeskanzlerin sich über einen Podcast an die Bürger wendet, gelangen Themen vor allem dann in die breite Öffentlichkeit, wenn sie von publizistischen Massenmedien aufgegriffen werden. Andersherum, und auch darauf deutet Luhmanns Zitat hin, haben Themen, die von den Medien ignoriert werden, kaum eine Chance, öffentlich wahrgenommen zu werden. Beispielsweise wurde die Thematisierungsfunktion der Medien auch im Zusammenhang der vergangenen Europawahl diskutiert und die Schuld am Minusrekord der Wahlbeteiligung, von Politikern aber auch von Politikwissenschaftlern, u.a. bei den Medien gesucht. Als Vermittler zwischen Politik und Medien agiert die politische Public Relations (PR). Durch sie wird die Kommunikationsbeziehung zwischen Journalisten und politischen Akteuren wesentlich gestaltet und versucht, auf die Themensetzung der Medien Einfluss zu nehmen. Die Untersuchung dieser Einflussnahme ist Kern dieser Arbeit. Im Gegensatz zu einigen anderen Studien zur PR-Journalismus-Beziehung stehen dabei normative Fragen eher im Hintergrund. Es soll weder darum gehen die Unabhängigkeit des Journalismus in Frage zu stellen, noch eine mögliche Herrschaft der Medien zu bestätigen. Das Forschungsinteresse dieser Untersuchung ist in erster Linie davon gelenkt zu überprüfen, wie politische PR versucht ihre Themen auf der Medienagenda zu platzieren und ob PR-Treibende dabei durch eine strategische Anpassung an den Journalismus ihren Erfolg beeinflussen können. Dafür sollen Pressemitteilungen der Bundesregierung zunächst inhaltsanalystisch auf, aus den theoretischen Vorüberlegungen abgeleitete, Anpassungshandlungen an den Journalismus untersucht werden. In einem zweiten Schritt wird dann ihre Resonanz in der Berichterstattung zweier Tageszeitungen sowie eines Onlinemediums geprüft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Page 2
3.5 Darstellung der Ergebnisse: Resonanz in den untersuchten Medien 36
3.5.1 Übernahme der Pressemitteilungen 36
3.5.2 Bearbeitungspraxis der Pressemitteilungen 37
3.5.3 Einfluss auf das Selektionsverhalten 38
4. Schlussbetrachtung39
Literaturverzeichnis43
Anhang
I. Anmerkungen zum Kategoriensystem II. Skalierung der Nachrichtenfaktoren III. Auflistung der analysierten Pressemitteilungen IV. Auflistung der analysierten Artikel V. Tabellenverzeichnis
Page 3
Einleitung
„Was wir über unsere Gesellschaft, ja über die Welt, in der wir leben wissen, wissen wir durch die Massenmedien.“1In diesem viel zitierten Diktum des Systemtheoretikers Niklas Luhmann kommt zum Ausdruck, welche tragende Rolle Medien in modernen Gesellschaften einnehmen. Medien vermitteln, informieren, bilden Meinungen. Damit kommt den Medien auch in der Politikvermittlung eine zentrale Bedeutung zu. Gerade die Demokratie erfordert es, politisches Handeln und Entscheidungsprozesse öffentlich darzustellen, denn die Regierenden sind auf die Unterstützung der Regierten angewiesen. Politische Vorhaben und Entscheidungen beruhen wesentlich auf der Zustimmungsbereitschaft der Bevölkerung.2Auch in Zeiten, in denen Politiker,twittern‘,Profile in sozialen Netzwerken haben und die Bundeskanzlerin sich über einenPodcastan die Bürger3wendet, gelangen Themen vor allem dann in die breite Öffentlichkeit, wenn sie von publizistischen Massenmedien aufgegriffen werden. Andersherum, und auch darauf deutet Luhmanns Zitat hin, haben Themen, die von den Medien ignoriert werden, kaum eine Chance, öffentlich wahrgenommen zu werden. Beispielsweise wurde die Thematisierungsfunktion der Medien auch im Zusammenhang der vergangenen Europawahl diskutiert und die Schuld am Minusrekord der Wahlbeteiligung, von Politikern aber auch von Politikwissenschaftlern4, u.a. bei den Medien gesucht.
Als Vermittler zwischen Politik und Medien agiert die politische Public Relations (PR). Durch sie wird die Kommunikationsbeziehung zwischen Journalisten und politischen Akteuren wesentlich gestaltet und versucht, auf die Themensetzung der Medien Einfluss zu nehmen. Die Untersuchung dieser Einflussnahme ist Kern dieser Arbeit. Im5Gegensatz zu einigen anderen Studien zur PR-Journalismus-Beziehung stehen dabei
normative Fragen eher im Hintergrund. Es soll weder darum gehen die Unabhängigkeit des Journalismus in Frage zu stellen, noch eine mögliche Herrschaft der Medien zu bestätigen. Das Forschungsinteresse dieser Untersuchung ist in erster Linie davon gelenkt zu überprüfen, wie politische PR versucht ihre Themen auf der Medienagenda zu platzieren und ob PR-Treibende dabei durch eine strategische Anpassung an den Journalismus ihren Erfolg beeinflussen können. Dafür sollen Pressemitteilungen der Bundesre-
1Luhmann2004: 9
2vgl. Jarren/Röttger 1999: 199
3Aus Gründen der besseren Lesbarkeit, wird in dieser Arbeit durchgehend die maskuline Form verwendet. Selbstverständlich sind stets beide Geschlechter gemeint.
4vgl. dpa (08.06.2009):Experte: Politik Schuld an geringer Wahlbeteiligung.www.focus.de[15.06.2009]5vgl. u.a. Baerns 1985; Grossenbacher 1991
Page 4
gierung zunächst auf, aus den theoretischen Vorüberlegungen abgeleitete, Anpassungs-handlungen an den Journalismus untersucht werden. In einem zweiten Schritt wird dann ihr Eingang in die Berichterstattung zweier Tageszeitungen sowie eines Onlinemediums geprüft.
Der praktischen Analyse soll ein theoretischer Teil vorangestellt werden. Um darzustellen welchen Aufmerksamkeitsregeln der Journalismus folgt wird zunächst auf die Nach-richtenwertforschung eingegangen. So soll sich der Frage genähert werden, welchen Selektionsmechanismen sich die PR ggf. anpassen müsste bzw. welche Anpassungen zu erwarten sind.
Die Verbindung zwischen Journalismus und politischer PR soll anschließend dadurch hergestellt werden, dass unterschiedliche Perspektiven zum Verhältnis zwischen Politik und Medien allgemein dargestellt werden, bevor auf die politische Öffentlichkeitsarbeit im Speziellen eingegangen wird.
Es folgt eine Begriffsdefinition politischer PR, eine Abgrenzung zu anderen Formen persuasiver Kommunikation sowie eine Eingrenzung, was politische Public Relations innerhalb dieser Arbeit meint. Da die Öffentlichkeitsarbeit der Bundesregierung die Analysegrundlage in dieser Arbeit bildet, sollen anschließend ihre PR-treibenden Akteure dargestellt werden. Hier soll das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung im Vordergrund stehen. Darüber hinaus soll geklärt werden, was Regierungs-PR legitimiert, welche Funktion sie hat und welche Ziele sie verfolgt. Danach wird auf das Themenmanagement, als die PR-Strategie, mit der versucht wird, Inhalte auf der Medienagenda zu platzieren bzw. sie unter der medialen Wahrnehmungsschwelle zu halten, eingegangen. Die Pressemitteilung stellt das PR-Instrument dar, welches in dieser Arbeit analysiert werden soll, daher wird sie im darauffolgenden Kapitel genauer betrachtet. Hier soll, als Vorüberlegung für die praktische Untersuchung, auch herausgestellt werden, was eine gute Pressemitteilung auszeichnet. Anschließend wird der For-schungstand zum Verhältnis von politischer PR und Journalismus reflektiert. Dabei werden bisherige Studien und theoretische Ansätze dargestellt, von denen einige zur Orientierung für die vorliegende Arbeit dienten.
Um die Fragestellung noch einmal zu konkretisieren und damit die Analyse einzuleiten, werden in einem Zwischenfazit die Ergebnisse aus den Vorüberlegungen zusammengefasst, bevor der inhaltsanalytische Teil dieser Arbeit beginnt.
Page 5
1. Vorüberlegungen und theoretische Rahmung
1.1 Selektionsmechanismen im Journalismus
„Von 99 Prozent allen Geschehens auf diesem Erdball erfährt der Zeitungsleser nichts, weil es einfach nicht zur Kenntnis der Presse gelangt“, schreibt der ehemalige dpa-Redakteur Manfred Steffens und fährt fort: „Aber damit nicht genug: über 99 Prozent aller Nachrichten, die schließlich doch der Presse bekannt werden, gelangen nie vor die Augen des Lesers, weil sie […] aussortiert und dem Papierkorb anvertraut werden.“6Die Prozentangaben des Journalisten sind plakativ, doch er veranschaulicht damit gut, dass eine Zeitung bzw. Medien im Allgemeinen eben nicht der Spiegel dessen sind, was in der Welt passiert, sondern allenfalls einen minimalen Ausschnitt davon abbilden. „Das Bild der Welt, das die Medien präsentieren, ist notwendigerweise anders als die ,wahre Welt‘“7, schreibt Schulz in Anlehnung an Walter Lippmanns These: „News and truth are not the same thing, and must be clearly distinguished.“8Schulz betont, dass man sich der Tatsache stellen müsse, „daß keine Nachrichtenberichterstattung auch nur im entferntesten ‚umfassend‘ oder ,vollständig‘ sein kann. Sie ist ihrem Wesen nach eher das Gegenteil: Ereignisse werden erst dadurch Nachrichten, daß sie aus der Totalität und Komplexität des Geschehens ausgewählt werden.“9Auf Grund begrenzter Ver-
mittlungskapazitäten auf Medienseite und begrenzter Aufnahmekapazitäten auf Publikumsseite kann ein Journalist auch kaum anders. Es besteht ein Selektions- und Reduktionszwang.
Der Frage, nach welchen Kriterien Nachrichten auszuwählen sind bzw. ausgewählt werden und ob diese Auswahl bestimmten Gesetzmäßigkeiten unterliegt, geht die Nach-richtenwertforschung nach. In den mehr als vier Jahrzehnten sind eine Reihe von Studien und Konzepten entstanden, die die Ereignis- bzw. Nachrichtenselektionsprozesse beschreiben. Zur späteren Konkretisierung meiner Fragestellung ist es hilfreich, ausgewählte Stationen der Nachrichtenforschung darzustellen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der europäischen Forschungstradition.
1.1.1 Nachrichtenfaktoren und Nachrichtenwert: Der Forschungsstand
Walter Lippmann beschreibt in seiner Arbeit „Public Opinion“ bereits 1922 das Zustandekommen der Medienberichterstattung als eine Kette von Selektionen. Er kommt zu
6zit. nach Schulz 1990: 7
7Schulz 2008: 88
8Lippmann1922: 358, zit. nach Schulz 2008: 88
9Schulz 1990: 8
Page 6
der Erkenntnis, dass die Gesetze der individuellen, menschlichen Informationsverarbeitung auch für die Nachrichtenauswahl der Medien gelten, womit folglich Entscheidungen der Nachrichtenselektion nach kognitiv und kulturell geprägten stereotypen Mustern abliefen.10Zur Bezeichnung der Merkmale, die ein Ereignis zur Nachricht machen, führt Lippmann den Begriff „news value“ (Nachrichtenwert) ein.11Heute ist es üblich, zwischen Nachrichtenwert und Nachrichtenfaktoren zu unterscheiden. Nachrichtenfak-toren sind dabei die „Kriterien der Selektion und der Verbreitung von Nachrichten“12, ihre Anzahl und Ausprägung sowie das Zusammenspiel bilden die Grundlage für den daraus resultierenden Wert einer Nachricht.13
Einar Östgaard begründete 1965 die europäische Nachrichtenwertforschung. Seine Erkenntnis ist, dass bei der Nachrichtenauswahl, neben politischen, wirtschaftlichen und organisatorischen Bedingungen, bestimmte Faktoren der Nachrichtenereignisse über deren Publikationswahrscheinlichkeit entscheiden. Östgaard unterscheidet drei Fakto-renkategorien: Vereinfachung, Identifikation, und Sensationalismus.14Er geht davon aus, dass Ereignisse, damit sie in den Medien zu Nachrichten werden, erst eine Art „Nachrichtenbarriere“ überwinden müssen. Je stärker Ereignisse die genannten Faktoren erfüllen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, die Nachrichtenbarriere zu überspringen.15
Aufbauend auf den Erkenntnissen Östgaards erarbeiteten Johan Galtung und Marie Holmboe Ruge ebenfalls im Jahr 1965 „ein erstes umfangreiches Konzept, das sich explizit mit der Bedeutung von Nachrichtenfaktoren im Nachrichtenauswahlprozess aus-einandersetzt.“16Sie fassen die Nachrichtenauswahl als zweistufigen Selektionsprozess auf, bei dem die Nachrichtenfaktoren sowohl bei der journalistischen Auswahl von Ereignissen als auch anschließend beim Rezeptionsprozess des Publikums wirksam werden.17Eine höhere Selektionswahrscheinlichkeit besteht dabei bei Ereignissen mit hohem Nachrichtenwert. Zudem liegt ihrem Konzept die Annahme zugrunde, dass Ereignisse verzerrt dargestellt werden, indem Journalisten die Merkmale, die den Nach-10vgl.Schulz 2008: 88
11vgl. Maier 2003a: 30
12Schulz 1990: 13
13vgl. Maier 2003a: 30; Schulz 2008: 89; Strohmeier 2004: 123f.
14vgl. Maier 2003a: 30f; Schulz 1990: 13f.; Ruhrmann/Göbbel 2007: 9
15vgl. ebd.
16Ruhrmann/Göbbel 2007: 9
17vgl. Maier 2003a: 31f; Schulz 1990: 15; Ruhrmann/Göbbel 2007: 9