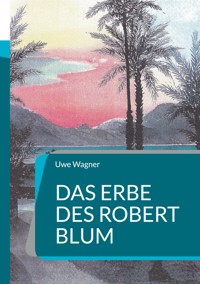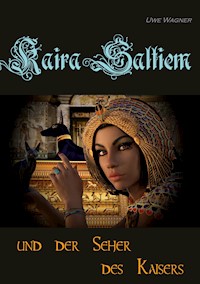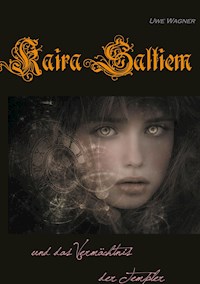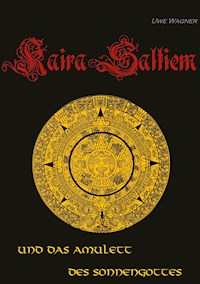
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Kaira Saltiem
- Sprache: Deutsch
Endlich Ferien. Kaira kann es kaum erwarten Ulf wiederzusehen. Dennoch vermag sie dessen Begeisterung für die Ausstellung zur Kultur und Geschichte der Azteken zunächst gar nicht zu teilen. Aber schon bald entdecken sie bei ihren Vorbereitungen auf den Besuch ein abgründig finsteres Geheimnis. Daher ist es für Kaira auch nicht verwunderlich, wenn plötzlich einige obskure Gestalten auftauchen. Warum sind denen sowohl die alte Sprache als auch die okkulte Riten der Azteken geläufig? Geradezu beängstigend sind jedoch deren wahren Beweggründe. Denn jene selbsternannten Freischärler scheinen vor nichts und niemandem zurückzuschrecken. So bleibt Kaira keine andere Wahl, will sie Ulf nicht im Strudel der Geschichte verlieren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 649
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
„Es ist schwieriger,
eine vorgefasste Meinung
zu zertrümmern
als ein Atom.“
Inhalt
Prolog
Besuch
Versteckspiel
Reise
Neuland
Epilog
Prolog
In der Mitte von Schwierigkeiten liegen die Möglichkeiten.
Paris – Sonntag, 8. Oktober 1307
„B ruder Pierre, kommt nach dem Nachtgebet zum Brunnen im Garten, aber kommt allein“, hatte ihm der Großkomtur und Hüter des Ordensschatzes nach der sonntäglichen Frühmette zugeraunt. Das war nicht so ungewöhnlich, denn schon des Öfteren hatte er, Pierre de Caligny, und seine zwölf getreuen Ritterbrüder für den Großkomtur des Ordens Arme Ritterschaft Christi und des salomonischen Tempels zu Jerusalem, allgemein unter den Namen Templerorden bekannt, Aufträge der besonderen Art ausgeführt. Zwölf mussten es an der Zahl sein, wie schon zu Zeiten als Christus mit seinen getreuen Jüngern durchs Heilige Land gezogen war.
Auch wenn es nun schon fast unzählige Male geschehen war, konnte er sich an jeden einzelnen Auftrag gut erinnern. Stets war ihm die Verantwortung des Anführers zugefallen. Das verdankte er eindeutig seinem selbstlosen Einsatz vor 16 Jahren. Damals, am Vorabend zum Gedenktag des Bischofs Saint-Germain1 im Jahre des Herrn 1291, hatte ihn Ritter Thibaud Gaudin2, dem bereits zehn Jahre vor dem Kampf um Akkon, des Hauptstützpunktes der Templer im Königreich Jerusalem, das Amt des Großkomturs, des obersten Schatzmeisters des Ordens, zugefallen war, zu sich gerufen.
„Mein lieber Bruder Pierre“, hatte Gaudin begonnen, „wie Ihr wisst, steht es schlecht um unser Akkon. Unser Großmeister ist bereits im Kampf gefallen und die Mameluken wüten seit zehn Tagen in der Stadt. Niemand, weder Weib noch Kind, wird verschont und nun rennen sie gegen unsere letzte Feste an.“ Mit einer Armbewegung wies er auf die massiven Mauern der Eisenburg, die als letzte Zuflucht der Templer im Heiligen Land auch alle Schätze des Ordens barg.
„Gott und König Heinrich sind auf unserer Seite“, hatte Caligny gewagt einzuwerfen, was Gaudin jedoch mit einer herrischen Handbewegung abgetan hatte, als wolle er eine der lästigen Stechfliegen abwehren.
„Die Macht des Teufels Al-Ashraf Khalil ist groß und seine Mameluken sind so zahlreich wie die Sandkörner der Wüste, die alles im Sturm zermalmen.“ Ein Seufzer entrang sich seiner Brust. „Nein, auch unsere Eisenburg werden wir nicht halten können. Wir hätten das Angebot Khalils auf Abzug annehmen sollen.“
„Um Frauen und Kinder den Mameluken überlassen“, hatte Caligny aufgebracht erwidert.
„Natürlich nicht!“, hatte Gaudin wütend gezischt. „Das ist eines Ritters unwürdig. Nur sie alle gleich niedermachen, das war eingedenk ihrer Übermacht sehr unklug.“
„Sie hatten den Tod verdient.“
„Schweigt, Bruder Pierre!“, war Gaudin ihn angefahren. „Wollt Ihr mich belehren?“
„Nichts liegt mir ferner“, hatte Pierre daraufhin klein beigegeben. „Wir handelten nach den Regeln unserer Orden.“
„Aber nicht des Unsrigen“, hatte Gaudin mit aller Macht dagegengehalten. „Für die Ritter des Deutschordens und der Johanniter mag das gelten, aber deren Ordensburg ist auch nicht bedroht. Außerdem haben sie sich seit jeher gegen eine Verständigung mit den Mohammedanern ausgesprochen, die der Christenheit allerdings sehr einträglich war.“
„Kampf bedeutet Ehre.“
„Ganz recht, Bruder Pierre. Doch eine größere Ehre ist es, wenn wir es ohne Kampf erreichen. Außerdem sollte ein jeder Ritter erkennen, wenn ein Kampf verloren ist und dann weise handeln, damit ihm die ehrerbietige Behandlung seitens des Siegers widerfährt, so wie sie Al-Ashraf Khalil gewährte. Doch wir haben die dargebotene Hand abgeschlagen, mit einem Hieb.“
„Und nun regiert das Gesetz der Blutrache?“
„So ist es, Bruder Pierre. Damit ist es ein aussichtsloser Kampf. Und das hat auch König Heinrich erkannt. Sein Schiff ist bald zum Auslaufen bereit, bereit die Blockade der Feinde zu durchbrechen. Er hat nicht vor, bis zum bitteren Ende auszuharren wie unser Großmarschall, dein Namensvetter.3“
Betroffen hatte Caligny geschwiegen. Flucht? Dem Kampf ausweichen? Was hätte er darauf erwidern sollen? Irgendwas hielt ihn davon ab zu bemerken, wie ehrenvoll es sei für die Kirche, für das Kreuz, für den Orden zu sterben. Was genau es war, konnte er bis heute nicht sagen, selbst nachdem Thibaud Gaudin zum Großmeister des Ordens aufgestiegen und noch vor Ablauf eines Jahres dahingeschieden war.
„Wir müssen handeln“, hatten ihn die Worte Gaudins aus seinen Grübeleien gerissen, „und zwar noch in dieser Nacht. Wir müssen retten was es zu retten gibt, um den Orden für den Gegenschlag zu rüsten. Damit hat unser Großmarschall mich als den Hüter des Ordensschatzes beauftragt. - Versammle zwölf Getreue um dich und komm nach dem Nachtgebet unten in die Katakomben, an den Eingang des Tunnels zum Hafen.“
„Wir werden zur Stelle sein“, hatte Caligny erwidert, schwankend zwischen Verwirrung und großer Entschlossenheit.
„Und silentium!“, hatte Gaudin ihm eingeschärft. „Die Mameluken haben ihre Ohren schon überall.“
„Nur Gott ist mein Zeuge“, hatte Caligny voller Inbrunst eines jungen Ritters geantwortet.
„Und nun Gott mit Euch, Bruder Pierre.“
„Gott mit euch, Bruder Thibaud.“ Daraufhin hatte er sich traditionell bekreuzigt und verbeugt, um sich sodann schnellen Schrittes zu entfernen.
Fast bis zum Morgengrauen hatten sie dann schwere Kisten aufs Schiff gebracht, das dank den Johannitern und der Leibgarde des Königs bereit zu sein schien, den Durchbruch durch die feindliche Schar der Schiffe zu bestehen.
„Was bringt ihr da, Ritter Gaudin?“, hatte der Kapitän mit begehrlichem Blick auf die Truhen und Kisten gefragt. „Etwa den Schatz des Templerordens?“
„Aber gewiss doch“, hatte Gaudin ruhig geantwortet. „Den größten Schatz der Christenheit. Alte Schriftrollen aus der Zeit unseres Herrn Jesu Christi, Reliquien und Zeugnisse aus dem Heiligen Land. Hundert Jahre lang haben wir sie zusammengetragen und gehütet. Sollen wir sie jetzt etwa den Mameluken überlassen? – Meint ihr, Euer Schiff kann diese Schätze zum Heiligen Vater bringen oder werden diese Teufel obsiegen?“
„Macht Euch keine Gedanken um diese Schätze, Ritter Gaudin“, hatte der Kapitän voller Sarkasmus und mit kaum verhohlener Enttäuschung geantwortet. „Meinen König werde ich sicher in seine Heimat geleiten und wenn Ihr und Gottes Vermächtnis an Bord verbleibt, so soll es Euch auch gelingen.“
Auch wenn sie die Mameluken im Morgengrauen überrumpelt hatten, so waren die Kämpfe auf See doch sehr hart gewesen. Fast alle an Bord waren verwundet worden und drei von Pierres Getreuen waren ihren Verletzungen erlegen. Bei den Johannitern hatten sogar nur sieben überlebt. Die Leibgarde des Königs und die Schiffsbesatzung waren soweit geschwächt worden, dass es an ein Wunder grenzte, dass sie ihren Feinden entkommen waren. Mit Gottes Hilfe hatten sie dann auf verschlungenen Pfaden nach einigen Wochen den neuen Sitz des Templerordens in der Nähe der Stadt Paris erreicht.
Die Zeiten waren danach nicht besser geworden. Der Verlust des Königreiches Jerusalem hatte den Orden stark geschwächt und seitdem die Aufnahme von König Philipp, der zu Unrecht „der Schöne“ gerufen wurde, vom Großmeister Jacques de Molay verweigert worden war, standen die Zeichen auf Sturm.
Und nun dieser besondere Auftrag, bei dem ihn alles an jene Nacht vor sechzehn Jahren erinnerte. Ging es wieder einmal dem Ende entgegen, ging es wieder einmal fluchtartig davon?
Diese Fragen hielten sein Denken noch gefangen als er sich zur angegebenen Zeit beim verwaisten Brunnen einfand, der im spärlichen Licht kaum auszumachen war. Er lauschte, doch es war nur das seichte, beruhigende Geräusch des Wassers zu vernehmen. Es sprudelte wie von Geisterhand aus dem Stein hervor, was viele für ein Wunder Gottes hielten. Niemand widersprach, denn wenn bekannt würde, wie es sich wirklich zutrug, würde der Orden vollends in Ungnade fallen. Pierre de Caligny wusste zwar nicht wie der Baumeister es angestellt hatte, aber er wusste, dass er es sich bei den Mohammedanern abgeschaut hatte, die für ihren Emir dieses Wunder in jedem Palast vollbrachten, um sie in duftende Gärten zu verwandeln.
In seinen Erinnerungen schwelgend sog er genüsslich den Duft des Herbstes in sich ein, in dem noch keine Spur von Moder auszumachen war. Jede Jahreszeit hatte ihre eigenen Gerüche, selbst der Winter. Obwohl alle vom Frühling schwärmten, war ihm der Herbst, mit der reifen Schwere der Ernte am liebsten.
„Bruder Pierre“, hörte er jemanden leise sagen und er drehte sich um. Doch er sah nichts als das Dunkel der umgebenden Pflanzen. „Hier, beim Brunnen“, sagte die Stimme und diesmal meinte Caligny eine schemenhafte Bewegung zu erkennen. Langsam ging er auf jene Stelle zu, legte jedoch seine Hand auf Knauf seines Schwertes, bereit es zu ziehen.
Die Wolkendecke riss auf und er erkannte eine Gestalt, die in den typischen braunen Umhang der Kaplane gehüllt war. An der ihm entgegengestreckten Hand war jedoch eindeutig der Siegelring des Großkomturs erkennbar. „Auf Euch ist stets Verlass, Bruder Pierre. – Kommt, setzen wir uns.“ Der Großkomtur nahm auf der steinernen Bank Platz, die noch immer ein wenig Wärme von der herbstlichen Sonne in sich gespeichert hatte und bedeutete Pierre sich neben ihn zu setzen. Widerstrebend folgte er der Einladung. Zu viele Gerüchte hatten sich verbreitet und daher bereitete ihm diese Nähe einiges an Unbehagen.
Ohne Umschweife kam der hohe Würdenträger zur Sache. „Bruder Pierre, ich weiß um Eure Verdienste für den Orden, damals bei Akkon.“ Er hielt einen Moment inne, doch Caligny blieb stumm. „Noch einmal braucht der Orden Euch und Eure besondere Ergebenheit, um unseren Schatz zu bewahren.“
„Zu Euren Diensten, mit Gottes Hilfe.“
„Versammelt erneut zwölf Getreue um Euch und kommt morgen zur selben Zeit in den Tour de Temple. Seid bereit noch in der Nacht aufzubrechen.“
„Weder als Feind noch als tobendes Wasser wird der Teufel uns aufhalten.“
„Gott mit Euch, Bruder Pierre. Wusste ich doch, dass Euch auch die Hölle nicht schreckt.“
„Die Ritter des Kreuzes obsiegen auch dort.“
„Gewiss, Bruder Pierre. Doch lasst Euch gesagt sein, es wird eine lange Reise. Aber ich habe den Kaplan, Bruder Eugene de la Gardie, gewinnen können Euch zu begleiten. So ist Euch der seelische Beistand gewiss.“
„Seelischer Beistand? Wohin wird die Reise gehen?“
„Fort aus dieser Welt, dorthin, wohin Euch niemand – auch nicht die königlichen Seeleute – folgen werden. – Doch sorgt Euch nicht, denn ich habe einen Kundigen für Euch. Es ist ein Normanne, der Euch führen wird.“
„Ein Normanne? Ein Heide?“, wunderte sich Pierre. „Spricht er wenigstens unsere Sprache oder die der Heiligen?“
„Ja. Eines Weibes wegen blieb er bei uns. Er fand den Weg zum Herrn und es lehrte ihn unsere Sprache.“
„So wird er uns führen und dann mit uns zurückkehren, zu seinem Weibe?“
„Nein, es starb im Frost des vergangenen Winters. – Nein, Ihr alle dürft nicht zurückkehren, denn niemand darf erfahren, wohin Euch Eure Reise geführt haben wird. Noch nicht einmal ich weiß es genau, denn keine Christenseele ist jeher dort gewesen.“
„Sprecht ihr von Cipangu4, Bruder? Die Polos sind damals von Akkon aus nach Asien gereist und haben von diesem fernen Land berichtet. Aber selbst die waren nie auf der Insel.“
„Nein. Die Normannen haben viele Länder erkundet, die unseren Gelehrten unbekannt sind und das ist auch der Grund, weshalb ich ihn auserkoren habe. Denn diesmal darf unser Vermächtnis niemandem mehr bekannt sein. Kein König, so edel er auch sei von Gemüt, wird auf Dauer der Versuchung widerstehen können.“
„So ist es also wahr, was ich vernahm?“
„Was ist wahr, Bruder Pierre? Was habt Ihr gehört?“
„Der König von Frankreich zürnt unserem Orden und begehrt den Schatz.“
Ein Seufzer war die Antwort. „Leider ja, Bruder Pierre. Unser Großmeister, weigert sich die Gefahr zu sehen. Doch mein Cousin, der Graf von Montfort-l’Amaury, hat mir berichtet, dass sein Vater, er ist der Herzog der Bretagne, einen geheimen Brief des Königs erhalten hat. In fünf Tagen sollen alle Templer verhaftet und unser Orden zerschlagen werden.“ – Er hielt einen Moment inne und lauschte. Doch nur der Wind verfing sich in den Zweigen der umgebenden Büsche.
„So ist es wie in Akkon.“
„Ganz recht, Bruder Pierre. Wieder sind wir belagert und vom Untergang bedroht. Wieder gilt es zu handeln. Und wer, wenn nicht Ihr, weiß Gottes Werk so volltrefflich zu erfüllen?“
„Ich bin nur Gottes Werkzeug.“
„Wahr gesprochen, Bruder, doch seid Ihr es, den Gott auserkoren hat das Vermächtnis unseres Ordens zu wahren, wieder einmal.“
„Wie könnt Ihr so sicher sein, dass der Normanne nicht mit dem Teufel im Bunde steht?“
„Gar nicht, Bruder. Deshalb halte ich es für weise, wenn Ihr mit zwölf Getreuen den Kaplan begleitet und eine neue Welt segelt und alle Seelen dort für uns gewinnt.“
„Eine neue Welt?“
„Der Normanne erzählte einst beim Weine davon, den es auch dort geben soll.“
„Aber dann ist es doch bekannt“, wandte Pierre ein.
„Nein, Bruder. Alle, die ihn damals hörten und verlachten, sind bereits bei Gott. Nein, niemand sonst weiß davon, nur wir und selbst ich habe nur vage Kunde. So sorgt Euch nicht, gedenke ich doch der Folter zu entgehen.“
„Folter? So werdet Ihr uns nicht begleiten?“
„Nein, Bruder Pierre. Noch viele Dinge wollen geregelt sein. Außerdem ist Eure Mission von zu großer Bedeutung. Bei meiner Abwesenheit würde der König gewahr, dass sein Vorhaben verraten worden ist. Dann schwinden Euer Vorsprung und auch die Aussicht auf Erfolg.“
„Was Gott verhüten möge. Doch sprecht, wie ist Euer Plan?“
„Der Herzog der Bretagne hat dem König eine Gunst versprochen. Schätze aus seinen ehemaligen Besitzungen in Britannien sollen nach Paris geschafft werden und er hat unseren Orden beauftragt dies zu bewerkstelligen. Damit die Wagen nicht leer die weite Reise antreten, sollen sie edle Stoffen und anderen Tand laden. Darunter werden wir unsere Kisten zu verbergen wissen.“
„Doch wie werden wir sie aufs Schiff schaffen? Wenn ich Euch recht verstanden habe, geht es doch um eine Schiffsreise.“
„Ganz recht, Bruder Pierre. – Der Herzog hält sich noch in Brest, in der Grafschaft Bro-Leon auf. Dort werdet Ihr die Wagen entladen und – soweit kenne ich unsere Familie – fürstlich bewirtet werden. In der Nacht bringt Ihr die Wagen zum Hafen, wo das Schiff des Normannen Euch erwartet und auch die Ladung für die Rückfahrt in der Festung verwahrt ist. Schickt die Wagen zur Festung. Sie werden dort von unseren Brüdern in Empfang genommen, um sie auf der Rückreise zu begleiten.“
„Wird es nicht auffallen, wenn wir plötzlich verschwinden?“
„Nein, Bruder. Dem Herzog ist es gleich, wer von unserem Orden seine Schätze bewacht und unsere Brüder gehen davon aus, dass Ihr in der Burg des Herzogs unterkommt. – Nein, wenn sie es denn gewahr werden, seid Ihr längst ihren Blicken entschwunden und keiner wird es wagen Euch zu folgen.“
„Wagen?“
„Fürchten sie doch alle die Hölle am Ende des Himmels.“
„Die Hölle am Rande der Welt?“
„Ganz recht, Bruder Pierre. Doch wissen wir vom Normannen, dass sie dort ebenso wenig zu finden ist wie auf dem Weg von Akkon nach Rom, auch wenn es scheint, die Welt wäre auch dort zu Ende.“
„Wahrlich. Sah ich es doch mit eigenen Augen.“
„So wird es wieder sein.“
„Ist dies das Zeugnis des Normannen?“
„So ist es, Bruder Pierre. Fürchtet Euch nicht. Gott wird mit Euch sein.“
„Nur die Habgier fürchte ich. Doch wie können wir dem Normannen vertrauen?“
„Wie ich bereits sagte, gar nicht. Er sagt, er ist ein gläubiger Christenmensch, dennoch ist er keiner von uns. Deshalb hat er auch keine Kenntnis von der Fracht, die Ihr behütet. Für ihn geht es um eine Missionarsreise nach Vinland.“
„Vinland?“
„Ja, Bruder Pierre, so heißt das Land bei den Normannen, das Land, das für unsere Kirche nicht existiert. Und wenn einer es erwähnt und wer auch nur andeutet es sei nicht die Hölle, wie doch jeder gute Christenmensch weiß, so ist er gleich ein Ketzer und der Häresie5 schuldig.“
Ungläubig, ja entsetzt starrte Pierre den Großkomtur an. Denn der oberste Schatzmeister des Ordens hatte soeben eine Aussage des Heiligen Stuhls in Abrede gestellt. Wahrlich schwere Zeiten waren das. „Aber wenn doch der Heilige Vater…“
„Nein, Bruder Pierre. Der Heilige Vater und auch keiner der Kardinäle oder Bischöfe sind je zur See gefahren. Der Normanne aber schon und er hat dies aus dem fernen Land mitgebracht.“ Er zog etwas unter seinem Mantel hervor.
Im schwachen Mondschein war nur etwas Unförmiges zu erkennen, eine Mischung aus Schwert und Keule. Pierre griff danach und betrachtete es genauer. Auf beiden Seiten eines Holzschaftes waren sehr scharfkantige Bruchstücke eines schwarzen Gesteins eingearbeitet. Es wog schwer in seiner Hand, jedoch nicht so wie das Metall aus dem die Schmiede die Schwerter herstellten. „Was ist das?“, fragte er nach einiger Zeit des Grübelns.
„Ein besonderes Schwert“, erwiderte der Großkomtur. „Aber es ist anders geartet als alle, die wir seit dem Altertum her kennen. Es ist weder aus Bronze noch aus Eisen. Außerdem ist es mit schwarzen, äußerst harten Steinen des Obsius6 besetzt.“
„Ein Schwert?“, wunderte sich Pierre. „Wäre es rundlich, ähnelte es mehr einem Morgenstern. Was soll es gegen unsere Waffen, die gegen Mameluken erprobt sind, schon ausrichten?“
„Es mag unseren Waffen unterlegen sein, aber dennoch ist es eine tödliche Waffe. Selbst Eure Rüstung wird Euch dagegen kein Schild sein. Denkt an die primitiven Waffen der Normannen. Seid also auf der Hut, Bruder Pierre.“
Noch einmal beäugte Caligny die ihm dargebotene Waffe, soweit es ihm das spärliche Licht erlaubte. Dann gab er sie zurück. „Ist es ein Schwert, so weiß ich es abzuwehren.“
„Gott möge Euch beschützen, Bruder Pierre. Nur mit Eurer Hilfe werden wir den Orden retten können.“ Der Großkomtur verbarg das Schwert wieder in seinem Mantel. „Doch nun genug der Worte gewechselt. Bereitet Euch und die Euren auf die Reise vor. Und Silentium.“
„Mit Gottes Hilfe wird es mir gelingen.“ Pierre verbeugte sich leicht. „Werdet Ihr zu uns stoßen, Bruder, sobald des Königs Plan offenbart ist?“
„Nein, Bruder Pierre, mein Weg ist nicht der Eure. Meine Bestimmung ist es auch dann an der Seite des Großmeisters zu bleiben, selbst wenn die Würfel längst gefallen sind.“
„So werdet Ihr bald im Paradiese sein.“
„Wahrlich, eine Freude. Vollkommen wird sie aber erst sein in der Gewissheit, dass Ihr das Vermächtnis des Ordens auf ewig der Todsünden dieser Welt entzieht.“ Er hielt kurz inne und holte ein Bündel aus den Falten seines Mantels. „Dies hier vertraue ich Euch persönlich an.“ Er übergab das Bündel Pierre, der es öffnete und auf zwei große Steine starrte, deren Besonderheit auch ohne vollendeten Schliff in diesem fahlen Licht erkennbar war.
„Steine?“, wunderte sich Pierre und sog zischend die Luft zwischen seinen Zähnen ein, denn selbst das schwache Mondlicht brachte einen der beiden zum Leuchten.
„Ja. Sie stammen aus dem Tempel von Jerusalem. Lux aeterna, das ewige Licht Gottes. Und simulacrum infernus, der Schatten der Unterwelt oder der Hölle. Der eine spendet ewig Licht, der andere ewige Dunkelheit.“ Da Caligny beide nur schweigend anstarrte, fuhr er fort: „Beiden wird göttliche Macht nachgesagt. Einer unserer Ritter soll mit dem simulacrum infernus direkt in die Hölle gefahren sein. Der Teufel holte ihn mitten am Tag. Er verschwand vor den Augen seiner Brüder und ward nie wieder gesehen.“
„Und was ist mit dem anderen?“, wollte Pierre wissen.
„Wem sein Licht leuchtet, der erfährt das Paradies und kehrt doch zurück.“ Wieder blickte Pierre ihn fragend an. „Einer unserer Brüder wurde, so heißt es, durch Engel ins Paradies geholt, sobald er Gott mit den heiligen Worten gepriesen hatte. Sie hüllten ihn in einen seidenen Umhang und er war fort, wie jemand, der im Nebel entschwindet.“
„Heilige Worte?“
„Ja, wie sie in unseren Werken mannigfach vermerkt sind.“
„Dann sind die Werke Teil der Fracht?“
„Nein, Bruder Pierre, sie würden Schaden nehmen. Nein, wir haben sie bereits vielen Ordensgemeinschaften zum Geschenk gemacht.“
„So ist das Geheimnis doch offenbart.“
„Nein, denn niemand weiß ob der Steine oder kann der Worte Deutung entziffern. Das Geheimnis ist bestens gewahrt, denn alle können es sehen, aber keiner kann es erkennen.“
„Die Calliditas7 ist mächtiger als das Schwert. Aber Ihr spracht von Rückkehr aus dem Paradies.“
„Ja, so ist es überliefert, auch wenn der Glaube schwach war unter unseren Brüdern.“
Caligny sah ihn fragend an, schwieg jedoch.
„Ja, Bruder Pierre. Unser Bruder kehrte zurück aus dem Paradiese. Er war so jung und voller Leben, wie damals als die Engel ihn dorthin begleiteten. Daher wollte niemand recht daran glauben, auch wenn er es unter Anrufung aller Heiligen beteuerte, dass er es sei. Alle sagten, er sei gewiss der Sohn seines Sohnes, aber wir wissen, dass es nicht so war.“
„Und woher wisst Ihr, dass er die Wahrheit sprach?“
„Sein alter Ordensbruder, der vor Gott treten sollten und schon die letzte Ölung erhalten hatte, erkannte ihn eindeutig an den Narben, die er sich damals in einem Kampfe zugezogen hatte, den sie beide überstanden und sonst nie jemandem gegenüber erwähnt hatten. Dennoch wusste der junge Mann davon.“
„Aber wenn ich Euch recht verstanden habe, so war der Glaube dennoch schwach?“
„So ist es. Niemand wollte ihm glauben und er wurde sogar der Häresie beschuldigt. Eines Morgens war er fort und niemand hat ihn je wieder gesehen. Außerdem wisst Ihr ja, wie hartnäckig sich Gerüchte halten, vor allem, wenn einfache Geister die göttliche Macht fürchten.“
„Ja, gewiss, Bruder. Da ist es besser zu schweigen.“
„Ganz recht, Bruder Pierre und das ist fortan auch Euer Gebot. Doch nun haltet die Steine verborgen. Nur für Euch allein ist dieses Wissen darum bestimmt.“
„So werde ich beides behüten, so wahr mir Gott helfe.“ Er hüllte die Steine ein und verbarg sie in seinem Wams.
„Gehet in Frieden. Gott sei mit Euch.“ Der Großkomtur erhob sich.
„Und mit Euch“, verabschiedete sich Caligny und erhob sich ebenfalls. Er verbeugte sich ehrerbietig und im nächsten Moment war er schon wieder allein am Brunnen. Einen Moment verharrte er noch und lauschte. Doch wieder war nur das Geräusch des Wassers zu vernehmen. Mit einem Ruck wandte er sich um und eilte mit schnellen Schritten davon.
***
1 28. Mai
2 Thibaud Gaudin, Großkomtur des Templerordens und dessen Großmeister von August 1291 bis April 1292
3 Pierre de Sevry, Großmarschall des Templerordens
4 Japan
5 Irrlehre, Ketzerei - eine vom Anerkannten abweichende Lehre, Meinung, Ideologie, Weltanschauung
6 Obsidian
7 List, Verschlagenheit
Besuch
Bremen – Donnerstag, 4. Juli 2019
F erien. Endlich! Wie sehr hatte Kaira diese Zeit herbeigesehnt. Doch jetzt, da es endlich soweit war, empfand sie nichts als die bleierne Schwere der Langeweile. Ihre Vorfreude war vor nicht einmal zwei Wochen zerstoben, als ihr Vater, Michael Dengler, Professor für Geschichte, angekündigt hatte, dass aus dem geplanten Urlaub auf der Burg nichts würde. Sein Institut müsse kurzfristig einspringen und den Historikerkongress in diesem Jahr ausrichten.
„Wir können ja die Herbstferien dort verbringen“, hatte er versucht die Situation zu retten und ihr Trost zu spenden.
Doch Kaira hatte nur einen unendlichen Groll und Enttäuschung in sich aufsteigen gespürt. „Nein!“, hatte sie ihm wütend entgegengeschleudert und war in ihr Zimmer gerannt, gerade rechtzeitig bevor ihr die Tränen über die Wangen strömten.
Auch der Ausblick, endlich viel Zeit mit ihrer Mutter, Kaija Saltiem, zu verbringen, die sie so viele Jahre schmerzlich vermisst und aus dem Verlies der Vergangenheit8 befreit hatte, stimmte sie noch immer nicht um. Außerdem hatten sie in den vergangenen Monaten bereits unzählige Stunden miteinander verbracht, auch wenn damit die verlorenen Jahre niemals wieder wettgemacht werden konnten.
Es war im Gegenteil nun vielmehr so, dass sich ein Zustand in ihre Beziehung eingeschlichen hatte, der landläufig– meist einhergehend mit einem tiefen Seufzer der Ergebenheit – als normal bezeichnet wurde. Kaira, inzwischen fünfzehn, fast sechzehn Jahre alt, wollte auf eigenen Beinen stehen und das schienen ihre Eltern nur schwer zu verstehen, auch unter den besonderen Umständen.
„Kaira, Schatz“, vernahm sie die Stimme ihrer Mutter, die sich gleich nebenan im Hauswirtschaftsraum befand und sie so unsaft aus ihrem Selbstmitleid riss, „du könntest mal eben die Wäsche nach oben bringen.“
Kaira verdrehte genervt die Augen und erhob sich vom Küchentisch.
„Sollen wir danach ein Eis essen gehen?“, hörte sie ihre Mutter fragen.
„Nein, Ma“, erwiderte sie leicht stöhnend.
„Nein?“, Kaija schien tatsächlich verwundert zu sein und steckte den Kopf durch die Tür, um ihre Tochter anzublicken. „Was ist los mit dir? – Kein Eis und ein Besuch im Freibad ist auch nichts für dich“, stellte sie aufzählend fest. „Was möchtest du denn machen?“
„Das weißt du doch“, gab Kaira patzig zur Antwort und strich sich eine Strähne ihres inzwischen schulterlangen Haars übers Ohr.
„Ach Kaira. Schatz. Das haben wir doch schon alles so oft…“
„Ma, ich bin bald sechzehn. Ist das so schwer zu verstehen, dass ich auch alleine klarkommen kann?“ Ihre Wut war augenblicklich wieder da. „Es ist meine Burg und ich war letztes Jahr schon alleine da.“
„Das weiß ich doch, mein Schatz, aber dein Vater…“
„Pa ist immer gegen alles! Genau deshalb war ich ja alleine da“, unterbrach sie ihre Mutter und stampfte wütend mit dem Fuß auf. „Ich hätte doch einfach fahren sollen“, fügte sie knurrend hinzu.
„Du weißt, dass ich das nicht für gut heißen kann. Und ich habe keine Lust ständig zurückzuspringen, um dich daran zu hindern.“
Oh ja, das hatte sie wirklich getan. Und das nicht nur einmal. Es war ja nicht so, dass Kaira es nicht versucht hätte, sich heimlich davonzuschleichen. Schließlich hatte sie das vor einem Jahr bereits erfolgreich getan. Doch diesmal lagen die Dinge anders. Ihre Mutter beherrschte die Kunst des Zeitspringens genauso gut wie sie und so hatte die einfach den Moment abgepasst als Kaira das Haus verlassen wollte und sie an der Tür zur Rede gestellt. Dummerweise war ihr Vater zu Hause und der hatte ihr doch gleich Hausarrest aufgebrummt. – Hausarrest! – Ging’s noch? Für wie alt hielten die sie überhaupt, für fünf?
Die Wut wollte sie wieder übermannen, die Wut auf ihren Vater. Seinetwegen hatte sie daraufhin sogar Ulf absagen müssen. Ausgerechnet. Wie sehr hatte sie sich gefreut ihn endlich wiederzusehen. In ihrem Bauch flatterten jetzt schon wieder unzählige Schmetterlinge, wenn sie nur an ihn dachte.
Doch bevor sie nun ihrer Mutter etwas hätte entgegnen können, etwas, das sie vielleicht später bereute, holte sie das Klingeln der Türglocke aus ihrem Teufelskreis.
„Ich geh‘ schon“, sagte sie nur kurz angebunden, um die leidige Diskussion zu beenden, aber auch um sich durch Bewegung abzureagieren. Am besten wäre natürlich eine richtig harte Trainingseinheit Karate gewesen, aber es waren Ferien und damit fand kein Training statt. Wer immer auch auf diese glorreiche Idee verfallen war, ein wirklicher Liebhaber des Sports konnte es nicht gewesen sein.
Mit schnellen Schritten hastete sie durchs Vestibül und stand mit geballten Fäusten vor der Eingangstür, bereit dem Störenfried gehörig die Meinung zu geigen. Doch während die Türglocke erneut erklang war da auf einmal wieder das Gefühl, alles schon einmal erlebt zu haben. Wie vor einem Jahr war dieses seltsame Déjà-vu-Ding schlagartig mit aller Wucht wieder da, sobald sie die Tür geöffnet hatte. Denn vor ihr stand der altbekannte Postbote und, als wolle sie jemand mit einer Wiederholung der Szene foppen.
‚Das gibt’s doch nicht!‘, schoss es ihr durch den Kopf. ‚Bin ich jetzt in so einem billigen Film gelandet?‘
„Ah, die junge Dame des Hauses.“ Der Mann schien erfreut zu sein. Er balancierte, wie konnte es auch anders sein, um die Unwirklichkeit des Augenblicks in Unermessliche zu steigern, ein ansehnliches Paket, das er mit Hilfe seines Knies in eine Position schob. Diese Aktion erlaubte ihm die rechte Hand freizubekommen. Schon zückte er mit breitem Grinsen das elektronische Gerät, um sich den Empfang quittieren zu lassen. Das Paket kippte dabei leicht und er hatte sichtlich Mühe es aufzufangen. Schon, Kaira wunderte sich auch darüber nicht mehr, fielen zwei Briefe herab, die er wieder einmal obenauf gelegt hatte. Wie auf vorgezeichneten Bahnen schlitterten sie ins Haus.
‚Ich fasse es nicht‘, dachte Kaira. ‚Ich muss in der Truman Show sein.‘ Instinktiv suchten ihre Augen den Hintergrund ab, um eine Kamera zu entdecken. Sie hatte sich sogar ein wenig vorgebeugt, um etwas hinter dem Postboten zu erspähen. Doch konnte sie nichts Verdächtiges entdecken, mit Ausnahme der Kameras des Sicherheitssystems, das ihr Vater vor einigen Jahren hatte installieren lassen.
„Holla! Nicht so eilig, junge Dame“, lachte der Postbote, der ihre Bewegung offenbar falsch deutete. Kaira hatte schlagartig das Gefühl, dass es ihr jetzt wieder einmal so erging wie in dem Film mit dem Murmeltier. „Außerdem brauche ich noch eine Unterschrift“, fügte der Mann hinzu, als rezitiere er einen vorgegebenen Text der Szene. Mit einer inzwischen äußerst vertrauten Bewegung übergab er ihr das Paket und griff erneut zum Gerät an seinem Gürtel. Mit der anderen Hand hatte er, wie ein Bühnenkomödiant, der sein Programm täglich wieder abspult, den Kunststoffgriffel aus seiner Brusttasche hervorgezogen und hielt Kaira breit lächelnd beides hin. „Bitte, einmal quittieren. Gleich hier im leeren Feld.“
‚Das ist gar kein Mensch. Das ist ein Roboter‘, schlussfolgerte Kaira. ‚Klar, ein programmierter Roboter‘, bekräftigte sie in Gedanken ihre Erkenntnis.
Das Räuspern des Mannes riss sie aus ihren Gedanken. Ein Räuspern? Das war neu. Das war bislang nicht vorgekommen. Also doch kein Programm, eher die Improvisation während eines verpatzten Bühnenauftritts?
Sie schenkte ihm ein gequältes Lächeln, nahm den Stift und kritzelte mit einer hastigen Bewegung ihren Namen in das angegebene Feld, während sie sich mit der anderen Hand das Paket ans Kinn drückte, um es irgendwie unter Kontrolle zu halten.
„Bitte sehr“, kommentierte sie, wobei es ihr nicht annähernd gelang so jovial zu klingen, wie sie beabsichtigte.
„Danke“, erhielt sie zur Antwort und schon verabschiedete sich der Postbote mit der vertrauten Geste.
Verwirrt schloss Kaira die Tür und stand einen Moment lang wie benommen da. Doch schon wurde sie jäh in das Hier und Jetzt katapultiert.
„Ach du lieber Himmel!“, rief ihre Mutter von der Küche her und eilte zu ihr. „Was hat dein Vater da nun wieder bestellt?“
„Bücher. Wie immer“, antwortete Kaira und beeilte sich das Paket ins Arbeitszimmer zu bringen.
„Warte ich helfe dir.“ Schon war ihre Mutter bei ihr und Kaira bemerkte wie das Paket etwas leichter wurde. Gemeinsam trugen sie es ins Arbeitszimmer. „Oje. Wie sieht’s denn hier aus?“, stöhnte Kaija. „Wo sollen wir denn nun damit hin?“
„Er möchte es immer auf seinem Schreibtisch haben“, klärte Kaira sie auf. „Sagt er jedenfalls“, ergänzte sie als sie den Zweifel im Gesichtsausdruck ihrer Mutter bemerkte.
„Na denn.“ Mit einer letzten Anstrengung wuchteten sie das Paket auf den mit unzähligen Papieren bedeckten Schreibtisch.
„Danke“, sagte Kaira nicht nur aus guter Gewohnheit.
„Dafür nicht, mein Schatz“, erhielt sie zur Antwort, zusammen mit einem wohlwollenden Lächeln, das sie nun doch ein wenig milder stimmte. Im doppelten Sinne erleichtert kehrte Kaira, gefolgt von ihrer Mutter, ins Vestibül zurück.
„Waren die Briefe auch dabei?“, fragte Kaija verblüfft.
„Ja, wie immer“, wollte Kaira erwidern, besann dich dann aber gerade noch rechtzeitig und sagte möglichst teilnahmslos: „Ja. Die sind mir runtergefallen.“
„Kein Wunder. Der Kerl ist einfach ein grober Klotz. So ein schweres Paket einfach einem Mäd…“
„Maaa!“, unterbrach Kaira sie warnend.
„Was denn? Einfach einem Mädchen so ein Paket in die Hand zu drücken ist doch wirklich nicht die feine Art“, verteidigte sich Kaija. „ Echte Kavaliere gibt’s wirklich nicht mehr.“
„Ich bin nicht aus Zucker“, gab Kaira angesäuert zurück. Es reichte ihr schon, wenn in der Schule die Jungs schon immer den Macho markierten. Auf diese Sprüche konnte sie gerne verzichten, auch wenn sie von ihrer Mutter wohlwollend gemeint waren.
„Trotzdem hätte er anbieten können, es hereinzubringen.“
„Der kennt das schon“, entschlüpfte es ihr, bevor sie sich besinnen konnte. Prompt sah ihre Mutter sie fragend an und Kaira wurde auf einmal mächtig heiß. Fast war sie geneigt ihrer Mutter von den seltsamen Erlebnissen zu erzählen. Doch dann sagte sie nur: „Na, der kommt doch alle Nase lang mit solchen Paketen für Paps.“
„Dann werde ich mal mit deinem Vater reden. Der kann sich seine schweren Pakete selbst abholen.“ Damit bückte sie sich nach den beiden Briefen und beäugte sie kritisch.
„Mam, das ist schon okay. Ehrlich“, wehrte Kaira ab. Ein Gefühl sagte ihr, dass es nicht gut war, daraus eine Staatsaffäre zu machen.
„Wenn du meinst“, gab ihre Mutter geistesabwesend zurück, während sie ihren Blick auf die Briefe gerichtet hielt. „Die sind beide für dich“, stellte sie erstaunt fest und hielt ihrer Tochter die beiden Umschläge hin.
„Für mich?“ Kaira bemühte sich überrascht zu klingen, obwohl sie es mitnichten war. Warum war sie es nicht? Hatte sie sich inzwischen damit abgefunden wie der Held der Truman Show in einem vorgefertigten Set zu leben? Oder war es ihr inzwischen schlicht egal? Sie wusste es nicht. Teilnahmslos nahm sie die Briefe entgegen.
Ihr Herz schlug ihr jedoch sofort bis an den Hals als sie sich die Umschläge genauer ansah. Einer der Briefe war von der Kanzlei. ‚Wenn das jetzt nochmal der Brief über die Erbschaft ist, drehe ich wirklich durch‘, sagte sie im Geiste zu sich selbst und riss den Umschlag auf.
„Dafür haben wir Brieföffner“, kommentierte ihre Mutter streng.
„Was? – Äh… Ja, sicher“, gab Kaira zurück als erwache sie aus einem Traum und überflog die Zeilen. Entwarnung. – Es ging zwar um die Erbschaft, aber nur, um ihr mitzuteilen, dass das Verfahren nun abgeschlossen war. Kommentarlos, einen Seufzer der Erleichterung unterdrückend, reichte sie den Brief ihrer Mutter. Es war ihr nicht entgangen, dass die sich vor Neugier kaum zurückhalten konnte.
Als Kairas Blick auf den zweiten Brief fiel, war da sofort etwas anders. Unmittelbar spürte sie eine unerklärliche Vorfreude. Lag es an dem nicht sehr professionell gedruckten Adressaufkleber? – Nein. Aber woran dann? Was war es, eine Vorahnung? – Was hielt sie davon ab, den Brief ebenfalls gleich aufzureißen und nachzusehen?
Warum sie den Brief tatsächlich zunächst umwendete, um den Absender zu lesen, konnte sie auch nicht sagen. Es war als suchte sie dort nach einer Bestätigung für ihre Vorahnung. Und sie erhielt sie prompt. Denn der Brief war tatsächlich von Ulf!
Eine Woge unbeschreiblicher Wärme überschwemmte sie und ihre Wangen brannten auf einmal wie Feuer. Hastig wandte sie sich um und eilte zur Treppe. Auf einmal konnte sie gar nicht schnell genug in ihr Zimmer gelangen. Außerdem wollte sie nicht, dass ihre Mutter etwas davon mitbekam.
Schon hatte sie die ersten Stufen erklommen, da hörte sie ihre Mutter fragen: „Was schreibt Ulf denn?“ Augenblicklich erstarrte sie in ihrer Bewegung. „Oder darf ich das nicht wissen?“
Hatte ihre Mutter den Absender gesehen? Schließlich hatte sie die Briefe aufgehoben. Nein, das konnte nicht sein. Kaira war sich sicher, dass ihre Mutter nur die Anschriften gelesen und ihr umgehend die Briefe gereicht hatte. Oder hatte ihre Mutter den Absender entziffert als Kaira den Brief umgedreht hatte? Das konnte auch nicht sein, denn schließlich war ihre Mutter während der Zeit in die Lektüre des anderen Briefes vertieft gewesen. Wie also konnte sie wissen, dass der Brief von Ulf war?
„Weiß ich noch nicht“, gab Kaira zur Antwort und damit zugleich auch zu, dass der Brief tatsächlich von Ulf stammte. Verärgert darüber, so überrumpelt worden zu sein, rannte sie weiter die Treppe hinauf und stürmte in ihr Zimmer.
So hörte sie nicht mehr wie ihre Mutter ergeben seufzte. „Ach Kaira, was glaubst du denn, wie es mir damals mit Michael ging.“
***
Mexiko-Stadt – Donnerstag, 13. Juni 2019
„Und du bist dir sicher, dass es der Stein ist?“ Frederico Diaz Lopez schaute den Mann mit der Hakennase, die an den Schnabel eines Adlers erinnerte, prüfend, ja fast herausfordernd an. Dabei schob er seine Brille, deren Goldrand übertrieben wirkte, ein wenig höher auf seine ungewöhnlich spitze Nase, die ihm ein Aussehen verlieh, das den Betrachter unweigerlich an ein Wiesel erinnerte.
Frederico, von seinen Freunden in Mexiko-Stadt seit seiner frühesten Jugend mit dem Spitznamen Kiko bedacht, wirkte deutlich älter als vierzig. Hauptsächlich lag es an seiner Haarpracht, die sich inzwischen nur auf ein dunkles Band beschränkte, das sich nur mit Mühe an den Seiten und am Hinterkopf zu halten vermochte. Seine äußerst hohe Stirn und der Großteil seines Kopfes waren somit unbedeckt und mussten anderweitig gegen die kräftige Sonne Mittelamerikas geschützt werden. Er bevorzugte dafür ein rotes Käppi, das mit dem Halo-A-Logo der Los Angeles Angels of Anaheim verziert war. Immerhin hatte er für dieses Team während seiner Studienzeit sogar einen Division-Titel geholt. Außerdem war es ein wichtiges Symbol für seinen stummen Protest gegen die spanischen Besatzer, die sein Land vor fünfhundert Jahren Überfallen und die Vorherrschaft seiner aztekischen Vorfahren jäh beendet hatten.
Geblieben waren der jahrhundertelange Widerstand sowie das Festhalten an alten Traditionen und Gebräuchen der Mexica, wie sich die Azteken selbst bezeichneten. Dazu gehörte auch, dass die alte Sprache, Nahuatl, weiterhin gesprochen, dem Spanischen sogar vorgezogen wurde. So hielten sie es auch in ihrer kleinen, aber schlagkräftigen Widerstandsgruppe von Freiheitskämpfern, der sie den Namen Cahuitl, also Freiheit oder Zeit, gegeben hatten. Die Sprache an sich bot allerdings – und das war ihnen durchaus bewusst – keinen hinreichenden Schutz in puncto Geheimhaltung, denn beim mexikanischen Militär und sogar bei den US-Behörden gab es zahlreiche Mitarbeiter, denen Nahuatl geläufig war. Daher hatten sie sich Decknamen zugelegt, um während ihrer Kommunikation ihre bürgerlichen Identitäten zu verschleiern.
Frederico war der Name Coatl, Viper, zugedacht worden. Anfangs hatte er dafür kaum Begeisterung aufbringen können. Aber nachdem er sich intensiver seinem „Wappentier“, Coatl, beschäftigt hatte, schmeichelte es ihm. Denn wie die Viper ihrer Beute auflauerte und ihren tödlichen Biss ansetzte, so verstand er es seine Raffinesse und seinen juristischen Sachverstand einzusetzen. Hinzu kam, aber das hatte er kaum jemanden auf die Nase gebunden, beschrieb es doch recht treffend seine frühere Aktivität als Entfesselungskünstler, auch wenn er dabei über das Niveau einer Zirkuswelt nie hinausgekommen war.
Auch für die Begutachtung von Edelsteinen konnte er nicht annähernd den Sachverstand aufbringen, den es erforderte. Dagegen hatte er, wie die Viper, ein feines Näschen für kleinste Unstimmigkeiten. Und das sagte ihm, dass hier etwas faul sein könnte. Folglich war sein Misstrauen, das in seiner Frage zum Ausdruck kam, nichts Persönliches, sondern eher ein reiner Instinkt.
„Absolut, Coatl. Es ist der Stein“, erwiderte sein Gegenüber, Antonio Martinez Alvarez. Dabei richtete er sich kaum merklich auf, so als wolle er die unausgesprochene Herausforderung mit größtem Verlangen annehmen. Seine dunklen Augen schienen vor Entschlossenheit zu glühen.
Antonio hatte, trotz seiner gerade einmal fünfunddreißig Lenze, schon stellenweise ergraute Strähnen in seinem ansonsten fast schwarzen Haar. Dieses Zeichen des fortschreitenden Alters konnte auch sein militärischer Kurzhaarschnitt, der ihm ein jugendlich verwegenes Aussehen verlieh, nicht verbergen. Anfang des vergangenen Jahres hatte er sogar mit dem Gedanken gespielt mit einem Färbepräparat nachzuhelfen. Graue Haare passten einfach nicht zu Tuco, wie er von seiner Familie noch immer gerufen wurde. Doch dann hatte er sich den Mexica-Freiheitskämpfern Cahuitl angeschlossen und in ihren Reihen wurde dem Alter traditionell hohen Tribut gezollt. In der Truppe war er als Cuauhtli, der Adler, bekannt, da er in der Lage war über den Dingen zu schweben und dem doch keine Einzelheit entging. Folglich war er der Stratege und Seher der Einheit. Gab es etwas auszukundschaften, so war er es, der ihnen den entscheidenden Informationsvorsprung verschaffte.
„Cuauhtli, du weißt, wie erfreut Cuamiztli darüber sein wird. Aber wehe dir, wenn du dich geirrt hast.“ Damit spielte Frederico auf die sehr heißblütigen Reaktionen ihres Anführers, Ignacio Perez Gonzales an, der von ihnen Cuamiztli, der Löwe, genannt wurde. Auch wenn dieses Temperament eher einem der Konquistadoren zugeschrieben werden konnte als einem Nachfahren eines Hohepriesters der Azteken, so gereichte er damit seinem Kampfnamen doch zu aller Ehre.
„Ich irre mich nicht“, beharrte Antonio. „Es ist der Stein aus dem Messer zu Ehren unseres Gottes Tezcatlipoca9, der Stein, der alles Licht aufsaugt und perfektes Schwarz hinterlässt und ihm dennoch erlaubte in die Zukunft zu sehen, wann immer ihm ein Knabe geopfert wurde.“
„Dann werden wir ihm die Botschaft überbringen, dass der Spiegel des Jaguars gefunden ist.“
„Warum überbringen wir ihm nicht gleich das göttliche Geschenk selbst? Es ist so leicht, die weißen Tölpel werden gar nicht merken, dass der wahre Stein nicht mehr an seinem Platz ist.“
„Nein!“, fuhr Frederico ihn an. „Cuauhtli, du kennst die Regeln der Mexica.“
„Ja“, knurrte Antonio missmutig. Die Regeln kannte er allerdings. Nichts wurde unternommen, bevor der Hohepriester, nun in Gestalt von Ignacio, dem Löwen, seinen Segen gegeben hatte.
„Es während der Ausstellung zu unternehmen ist viel zu gefährlich und, wenn es herauskommt, lenkt es nur unnötig Aufmerksamkeit auf unsere Sache“, bekräftigte Frederico.
„Cuamiztli wird meinem Plan zustimmen“, gab sein Gegenüber selbstbewusst zurück. „Die Bewachung während der Ausstellung ist wirklich lachhaft.“
„Hochmut kommt vor dem Fall, Cuauhtli. Ist dir je der Gedanke gekommen, es könnte eine Falle sein?" Sein Blick über den Rand der Brille wirkte ein wenig oberlehrerhaft.
„Aber selbstverständlich“, entgegnete Antonio mit süffisantem Lächeln. „Deshalb habe ich mir auch alle Informationen quasi aus erster Hand beschafft.“
„Aus erster Hand? Wie das? Hast du die Wachleute befragt?“
‚Typisch Anwalt‘, dachte Antonio. „Nein“, gab er leicht verärgert zur Antwort und grinste. „Ich habe der Firma, die für die Bewachung engagiert ist, einen nicht angemeldeten Besuch abgestattet und mir die Pläne des Sicherheitssystems besorgt.“
„Dennoch scheint es mir zu einfach. – Hmm…“ Grübelnd rieb er sich das Kinn. „Da ist was faul. Das spüre ich.“ Da sein Kumpan nur mit den Achseln zuckte, ergänzte er mit Bestimmtheit: „Es ist besser, wenn sich Tocatl die Sache noch einmal ansieht.“
Tocatl, die Spinne, mit bürgerlichem Namen Jose Fernandez Martin, war der Jüngste ihrer Truppe. Er war ein begnadeter Fachmann in allem was jegliche Art von elektronischer Datenverarbeitung anbelangte. Mit größtem Vergnügen hackte er sich in elektronische Sicherheitssysteme, die als unangreifbar galten. Daher arbeitete er als Freiberufler gleich für mehrere sogenannte Cyber-Security-Firmen, die ihren Kunden absolute Unangreifbarkeit ihrer IT-Systeme verkauften. Nun, das waren sie in der Regel auch, nur eben nicht für Pepe, der den Namen Tocatl als große Ehre ansah, betrachtete er sich doch als die Spinne im Netz.
„Soweit ich weiß hat er das schon gemacht“, erwiderte Antonio gleichmütig. „Aber du hast recht. Schaden kann’s jedenfalls nicht“, ergänzte er und es klang wie ein Friedensangebot, um ihren kleinen Disput zu beenden.
„Gut, ich werde ihn beauftragen und sobald er etwas herausbekommen hat, werde ich Cuamiztli über alles informieren.“
„Aber bedenke, dass nicht viel Zeit bleibt“, wandte Antonio ein, dem es nun doch recht seltsam vorkam, dass es Frederico offenbar darauf ankam Ignacio, ihren Anführer, nicht umgehend zu informieren. „Noch ist die Ausstellung in Europa, irgendwo in Alemania. Für Cuetlachtli wäre es ein Leichtes den Stein dort zu besorgen“, gab sich Antonio noch nicht geschlagen.
Mit Cuetlachtli, dem Wolf, brachte er Quino, Joaquin Garcia Lopez, ins Spiel, der in besonderen Kreisen Latinoamerikas als El Lobo, der Wolf, bekannt war. Als typischer Einzelgänger hatte Quino seine Karriere als Einzelkämpfer bei den Green Berets der US-Army begonnen und dann freiberuflich eine andere, wenn auch sehr lukrative Richtung eingeschlagen. Mit Besinnung auf seine Vorfahren, auch wenn das aztekische Blut in seinen Adern über viele Generationen verdünnt worden war, hatte er sich im vergangenen Jahr den Cahuitl-Freiheitskämpfern angeschlossen. Seit dem übernahm er gerne die etwas spezielleren Aufträge zur Beschaffung von Informationen oder Finanzierungsmitteln, bei denen er seine besonderen Fähigkeiten und Erfahrungen zum Einsatz bringen konnte.
„Es ist einfach zu riskant“, hielt Frederico dagegen. „Du weißt sehr wohl, dass wir beide Steine brauchen, den Spiegel des Jaguars und das Leuchten des Sonnengottes. Nur wenn wir dem großen Tonatiuh sein Leuchten zurückbringen, können wir ihn gnädig stimmen. Nur so kann er die Dunkelheit besiegen und die Geschehnisse von Grund auf ändern. Nur dann kann Tonatiuh wieder als Adler aufsteigen, um das große Reich von Tenochtitlán vor dem Untergang zu bewahren.“
„Und ein Opfer“, ergänzte Antonio, dem die Rituale um den Sonnengott Tonatiuh, auch in der Gestalt eines Adlers, sehr wohl bekannt waren. „Tonatiuh hat immer ein Opfer verlangt, um wieder zu Kräften zu kommen.“
„Sehr richtig, Cuauhtli10. Das lass mal meine Sorge sein“, wehrte Frederico den Einwand ab. „Wenn wir erst beide Steine haben, wird das kein Problem sein.“
„Und was ist mit dem Knaben, den Tezcatlipoca fordert?“, warf Antonio ein.
Frederico wusste selbst, dass die Tradition zu Ehren des Gottes der Nacht und der Materie, Tezcatlipoca, auch unter dem Namen Rauchender Spiegel bekannt, ein Menschenopfer erforderte. Dabei handelte es sich der Überlieferung nach um einen Knaben, der zuvor ein Jahr lang selbst als Symbol dieses Gottes verehrt wurde. Dennoch tat Frederico es mit einer Handbewegung ab. „Das weiß ich sehr wohl. Aber wie gesagt, wenn wir beide Steine haben, wird das kein Problem sein. Wir müssen nur beide in unseren Besitz bringen. Beide, verstehst du?“
„Schon klar.“
„Die Frage ist nur, wo sich der andere Stein befindet.“ Er deutete mit dem Zeigefinger auf sein Gegenüber. „Und das herauszufinden ist deine Aufgabe. Also erhebe dich in die Lüfte, Cuauhtli und richte deinen scharfen Blick darauf.“
Der Hauch eines spöttischen Grinsens huschte über Antonios Gesicht. „Und das, Coatl11, werde ich. Der Stein wird schon bald in den Klauen des Adlers sein“, erwiderte er unter Anspielung auf die doppelte Bedeutung des Adlers, sowohl hinsichtlich der Gestalt des Sonnengottes als auch in Anspielung auf seinen eigenen Decknamen.
***
Santo Domingo – Samstag, 17. März 1509
„So kommt herein, werter Don Velázquez“, begrüßte Nicolás de Ovando y Cáceres, Statthalter seiner Majestät, König Ferdinand II – allgemein bekannt als Ferdinand der Katholische –, seinen langjährigen Stellvertreter und breitete die Arme aus, um ihn mit traditioneller Umarmung zu begrüßen.
„Habt Dank für Eure Gastfreundschaft, werter Caballero de Ovando“, erwiderte Don Diego Velázquez de Cuéllar den Gruß und verbeugte sich dann, wie es das Protokoll vorsah.
„Welche Freude Euch zu sehen.“ In der Tat empfand Ovando ein wenig Stolz, denn er wertete. es als sein Verdienst, dass sein Vize inzwischen auch am Hofe der Majestäten als äußerst tüchtig bekannt war.
„Ganz meinerseits“, erwiderte Velázquez lächelnd. „Es ist auch immer erquicklich Euer kleines Paradies aufzusuchen.“
„Oh, zu viel der Ehre. Es ist doch nur eine bescheidende Behausung, vor allem im Vergleich zu Eurer. Aber es gestatte mir dennoch all dem Treiben im Palast zu entflieh‘n.“
„Bescheiden wie immer, wenn es um Euer eigenes Wohl geht, Caballero Ovando und doch seid Ihr bewundernswert majestätisch, wenn es um das Wohl und Recht der Krone geht.“
„Die zu vertreten in Hispaniola und den Gebieten Westindiens mir beschieden war“, entgegnete Ovando mit einer leichten Niedergeschlagenheit.
Velázquez stutzte und beäugte sein Gegenüber kritisch. „Beschieden war? – Wie darf ich das verstehen Caballero?“
„Das ist einfach und schnell erklärt, lieber Don Velázquez, denn aus diesem Grunde bat ich Euch mich aufzusuchen.“ Velázquez schwieg, um den Statthalter des Königs in seinen Ausführungen nicht zu unterbrechen. „Seine Majestät hat mich zurück nach Spanien beordert.“
„Also doch“, konnte sich Velázquez nicht zurückhalten.
„Ihr habt schon Kenntnis davon?“, knirschte Ovando.
„Es gibt Gerüchte in der Stadt, dass Diego Kolumbus als Vizekönig von Westindien eingesetzt ist. Da mir eure Rivalität mit seinem Vater Christoph und Eure Konsequenz wohlbekannt sind, gab es für mich nur die eine Schlussfolgerung.“
„Ja, diese Schmach bleibt mir nicht erspart. Seine Majestät hat tatsächlich den Sohn dieses genuesischen Emporkömmlings dazu bestimmt, fortan als Vizekönig zu amtieren. Unglaublich!“ Er blickte seinen Stellvertreter direkt an. „Ich weiß, Ihr standet gut mit dem Entdecker der neuen Welt und habt ihn auf seiner zweiten Reise begleitet…“
„Das ist lange her, Caballero. Die Abenteuerlust obsiegte damals in mir. Auch wenn ich dies nicht bereue, so hatten wir uns doch längst entzweit als Francisco de Bobadilla12 ihn in Ketten legen ließ.“
„Das war mit ein Grund, weshalb ich Euch bat das Amt meines Stellvertreters zu übernehmen. Bobadilla selbst setzte mich über alles in Kenntnis und war erzürnt, dass der Emporkömmling von den katholischen Majestäten begnadigt wurde und zu seinem Verdruss bei seiner eigenen Abberufung, die mir damals oblag, zugegen war.“
„Immerhin entsandte seine Majestät Euch, Caballero Ovando, und nicht einen aus der Familie Kolumbus.“
„Ja, diese Demütigung ist allein mir aufgebürdet, mir, dem es endlich gelungen ist Hispaniola zu befrieden, etwas, bei dem Bobadilla kläglich versagte.“
„Wohl wahr, Eure Verdienste sind unermesslich“, pflichtete Velázquez ihm bei. Dazu hatte er auch allen Grund, denn sein Aufstieg zum reichsten Mann in ganz Westindien verdankte er dem von ihrer Katholischen Majestät, Königin Isabella I. von Kastilien, geschaffenen Encomienda-System. Ovando hatte es mit harter Hand eingeführt und so auch ihm ermöglicht, unzählige Indios als Sklaven zu halten und immense Reichtümer anzuhäufen. „Dann habt ihr diese schöne Stadt nicht nur wieder aufgebaut, sondern als wahre Perle der neuen Welt gestaltet.“
„Um jedem ein Sinnbild der Macht der vereinigten Königreiche von Kastilien und Aragón zu verdeutlichen.“ Er seufzte. „Und nun dies. Möge mich doch auch der Sturm erlösen wie es für Francisco de Bobadilla eine Gnade war.“
„Gnade? Verzeiht, Caballero, aber dieser Sturm damals war der Odem der Hölle, der alles verschlang.“
„Ja, das hat er in der Tat, mit einer Ausnahme“, knurrte Ovando.
„Denn selbst der Satan hat diesen Emporkömmling aus dem verruchten Genua verschmäht.“
„Viele hielten es damals sogar für ein Wunder, dass Kolumbus diesen Sturm und ein Jahr danach sogar sein erneutes Martyrium bei seinem Schiffbruch auf Jamaika überlebte.“
„Unsinn!“, fuhr Ovando dazwischen. „Er hatte stets einen Pakt mit dem Teufel.“
„Bei dem er, wie ich jüngst hörte, bereits seit drei Jahren weilt.“
„Ganz recht. Dabei hatten wir alle Hoffnung, dass es mit ihm endlich aus und vorbei wäre als Königin Isabella, die er mit des Teufels Hilfe verhext hat, zu Gott berufen wurde. – Nein, er stand mit dem Teufel im Bunde, da habe ich keinerlei Zweifel. Und als bedürfe es eines Beweises, entsteigt nun sein Erstgeborener der Hölle, um die Tochter von Fadrique Álvarez de Toledo zu ehelichen, der nicht nur Oberbefehlshaber der Truppen in León, sondern auch noch zweiter Herzog von Alba ist.“
„Der Herzog gab ihm seine Tochter zur Frau?“, wunderte sich Velázquez. „War sie so hässlich oder schon zu alt für einen wahrhaft Noblen?“
„Wahrscheinlich beides“, knurrte Ovando. „Und eine Hexe ist sie obendrein, denn wie anders kann es angehen, als nun auch unseren König zu verhexen, damit er diesen Hurensohn zum Admiral und Vizekönig ernennt. Eine Schande für die gesamte christliche Welt.“
„Männer aller Stände denken wie Ihr, Caballero. Wir werden alles unternehmen, um auch ihn in Ketten wieder über den Atlantik zurückzuschicken.“
Ovando wandte sich seinem Stellvertreter zu und legte ihm die Hände auf die Schultern. „Seid klug, Don Velázquez. Er hat nun alle Macht in den Händen und wird sie gewiss missbrauchen, so wie es sein Vater tat. Ich weiß nicht, wie viel Zeit mir noch bleibt, bevor Gott mich zu sich ruft, aber seid versichert, dass ich bei Hofe alles unternehmen werde, damit dieser Unhold schnellstmöglich abberufen wird.“
„Dennoch wissen wir beide, dass darüber Jahre ins Land ziehen können. Aber ich werde die Zeit zu nutzen wissen, Caballero. Wie Ihr wisst, hat Sebastián de Ocampo im vergangenen Jahr Fernandina13 umfahren und damit bewiesen, dass es eine Insel ist.“
„Ja, eine große Tat. – Was ist Euer Plan? Wollt Ihr sie erobern?“
„Das Abenteuer übt einen unwiderstehlichen Reiz auf mich aus.“
„Ihr wäret nicht Don Velázquez, wenn Ihr nicht längst Vorbereitungen getroffen hättet.“ Sein Gegenüber schwieg, aber ein süffisantes Lächeln umspielte seine Lippen. „Lasst Vorsicht walten, damit Euch die Früchte Eurer Anstrengungen nicht genommen werden.“
„Das werde ich“, erwiderte Velázquez erhobenen Hauptes.
„Verschafft mir nur Zeit und ich werde die Insel für unseren König Ferdinand erobern.“
„Verstehe.“ Ein Lächeln huschte über Ovandos Gesicht. „Ihr werdet das Land in aller Form im Namen der Krone in Besitz nehmen. Aber denkt daran sofort eine Stadt zu gründen, damit unser König Euch als Gouverneur in die neuen Lande einsetzen kann.“
„Das Spiel ist mir wohl bekannt“, erwiderte sein Stellvertreter selbstbewusst.
„Nichts anderes entspricht meiner Erwartung. Doch eine Bitte hätte ich noch an Euch zu richten, Don Velázquez.“
„Sie sei Euch bereits gewährt, Caballero, so sprecht.“
„Behaltet meinen Neffen Hernando in Euren Diensten und lasst ihn an Euren Abenteuern teilhaben. Es wird gewiss zu Eurem Vorteil sein.“
„Daran gibt es keine Zweifel. Es wäre meine Bitte gewesen, dass Ihr ihn in meiner Obhut belasst. Er ist aus dem rechten Holze, klug, ehrgeizig und verwegen.“
„Waren wir in unserer Jugend nicht alle von Abenteuerlust durchdrungen?“, hielt Ovando dagegen.
„Jugend? Immerhin zählt er schon zwei Dutzend Jahre…“
„Ja, es ist die Zeit, in der ein jeder junger Ritter nach Ruhm und Ehre dürstet. So war es für mich nicht verwunderlich, dass ihn sein Studium der Rechte, dass er bereits vor zehn Jahren begann, nicht erfüllen konnte. Nicht das Wort, sondern die Degen kreuzen und Schlachten zu schlagen, danach steht ihm der Sinn.“
„Trefflich. Es wird mir eine Ehre sein, Euren Neffen anzuleiten, Caballero.“
„Habt Dank dafür, Don Velázquez.“
„Wie gesagt, Caballero, der Dank gebührt Euch, ihn mir zur Seite zu stellen. Ich werde ihn umgehend zu meinem persönlichen Sekretär ernennen. Seid gewiss, Caballero de Ovando, die Welt wird von Hernando Cortez hören, Euch zu Ehren.“
***
Bremen – Donnerstag, 4. Juli 2019
„Du könntest dich wenigstens bei deiner Tochter bedanken“, merkte Kaija leicht gekränkt gegenüber ihrem Mann beim Abendessen an. „Schließlich hat sie das schwere Paket angenommen.“
„Um es dann einfach auf meinen Schreibtisch zu lassen“, erwiderte Michael brüsk. „Ihr wisst doch genau, dass ihr meine Unterlagen nicht anrühren sollt.“
„Na was denn? Du hast doch gesagt, dass ich es immer auf deinen Schreibtisch stellen soll“, verteidigte sich Kaira empört. Außerdem unternahm sie damit einen kläglichen Versuch, im sich anbahnenden Streit zwischen ihrem cholerischen Vater und ihrer nicht minder temperamentvollen Mutter zu vermitteln.
„Aber doch nicht, wenn ich meine Unterlagen dort liegen habe!“, richtete Michael nun seinen Groll gegen seine Tochter.
„Mike! – Jetzt mach‘ aber mal ’nen Punkt!“, ging Kaija gleich dazwischen. „Wenn es dir nicht passt, kannst du dir die Pakete demnächst selbst bei der Postlagerstelle abholen.“ Ihre Augen schienen Funken zu sprühen. Wäre einer von Kairas Klassenkameraden Zeuge dieser Szene geworden, dann hätte er die Bedeutung des Spruchs wie die Mutter, so die Tochter sofort verstanden. Auch Kaira wurde schlagartig bewusst, dass sie in dieser Hinsicht ihrer Mutter ähnlicher war als sie zugeben mochte.
Irgendwas Unverständliches vor sich hin murrend stocherte Michael in seinem Essen herum. „Jaja. Schon gut“, kam es ihm kaum hörbar über die Lippen. „Danke dafür.“
Dann herrschte eine Weile lang Stille. Nur Kaira und ihre Mutter wechselten ein paar verstohlene Blicke.
„War noch was in der Post?“, brach Michael das drückende Schweigen.
„Nur zwei Briefe für Kaira“, gab ihm seine Angetraute in einem Tonfall zurück, der Teilnahmslosigkeit ausdrücken sollte, jedoch das Gegenteil bewirkte.
„Zwei? Für Kaira?“, wunderte sich Michael und zog die Augenbrauen hoch.
„Ja, von der Kanzlei“, beeilte sich Kaira einzuwerfen.
„Von der Kanzlei?“, hakte Michael nach, wobei sein Tonfall eine Mischung aus Gereiztheit und Misstrauen zum Ausdruck brachte. Dachte er doch auch sogleich wieder an die Ereignisse des vergangenen Jahres. Damals war er über die angekündigte Erbschaft in den bislang vehementesten Streit mit seiner Tochter geraten.
„Ja“, erwiderte Kaira scheinbar gelangweilt. „Es ist alles erledigt.“
„Die Erbschaftssache ist nun abgeschlossen“, fügte ihre Mutter erklärend hinzu.
„Das will ich auch hoffen“, knurrte Michael. „Das hat mir wirklich gereicht.“ Auf den strengen, vorwurfsvollen Blick seiner Frau ergänzte er hastig zu ihr gewandt: „Äh, ich meine natürlich, in einer Sache war es doch gut.“ Er griff nach ihrer Hand. „Immerhin bist du nun endlich wieder bei uns, mein Schatz.“
„Aha. Dann war es also doch gut, dass unsere Tochter so…“
„…dickköpfig war?“, ergänzte er ihren Satz.
„Von mir aus auch das“, gab Kaija achselzuckend zu. „Aber ohne ihre Dickköpfigkeit – wobei mir Hartnäckigkeit besser gefällt – und ohne die Hilfe von Ulf, wäre ich wohl noch immer dort im Verlies.“
„Jaja, stimmt schon“, knurrte Michael kleinlaut. „Trotzdem bleibt es dabei. Wir fahren diesen Sommer nicht hin“, ergänzte er fast ein wenig patzig. Dabei sah er seine Tochter an, als erwarte er einen Wutausbruch.
Doch die lächelte nur geheimnisvoll. „Von mir aus“, gab sie gleichgültig zurück, wohl wissend, dass ihr Vater sofort misstrauisch würde.
„Von dir aus?“, sprang der auch gleich darauf an und blickte ratlos zu seiner Frau, die jedoch ebenso erstaunt war wie er.
„Was hat Ulf dir denn geschrieben?“, konnte die sich nun nicht länger zurückhalten. „Der zweite Brief war nämlich von Ulf“, fügte sie für ihren Mann erklärend hinzu.
„Er kommt hierher“, antwortete Kaira wie beiläufig und ohne aufzusehen.
„Hierher?“ Michael verschlug es die Sprache. Sollte er nun darüber zornig sein, weil einfach über seinen Kopf hinweg entschieden worden war oder sollte er froh sein, weil sich das leidige, seit Wochen für Unmut sorgende Thema, Besuch der Burg, damit erledigt hatte?
„Oh! Das ist ja eine Überraschung“, freute sich Kaija, bevor ihr Angetrauter etwas erwidern konnte. „Wann denn? Wie lange bleibt er? Bleibt er die ganzen Ferien?“
„Ja. Ab nächste Woche hat er nämlich auch Ferien. Ach, und er kommt übrigens mit dem Zug. – Allein“, konnte sich Kaira nicht verkneifen anzumerken.
„Aha.“ Michael wusste noch immer nicht so recht, wie er mit der Situation umgehen sollte, entschloss sich aber, auf die provokante Anmerkung seiner Tochter nicht einzugehen. Denn im Gegensatz zu Kairas Eskapade vom vergangenen Jahr hatte Ulf seine Reise bestimmt mit Erlaubnis seiner Eltern angetreten. Aber sicher konnte er sich nicht sein und eine Argumentation darauf aufzubauen, könnte sich schnell als Eigentor erweisen. Nein, auf das Glatteis wollte er sich nicht führen lassen. „Seine Eltern werden das Hotel in der Hauptsaison bestimmt nicht schließen“, stellte er nur lapidar fest. „Muss er denn nicht arbeiten?“
„Keine Ahnung“, gab Kaira zur Antwort. „Ich kann mich ja nächstes Jahr revanchieren und wieder aushelfen.“ Damit spielte sie auf ihre Mithilfe im Hotelbetrieb von Ulfs Eltern vom vergangenen Jahr an.
„Das ist doch eine gute Idee“, stimmte ihr Kaija sofort zu, bevor Michael etwas dagegen einwenden konnte. „Und er kann natürlich auch bei uns wohnen. Schließlich haben sie dich letztes Jahr auch aufgenommen.“
„Kein Wunder. Die haben schließlich ein Hotel“, merkte Michael sarkastisch an.
„Trotzdem haben sie fürs Zimmer nichts berechnet“, bekräftigte Kaija.
„Weil unsere Tochter Küchendienst geschoben hat.“ So wie Michael es sagte, klang es fast als wäre es unter der Würde der Familie.
„Dann kann er das bei uns eben auch tun“, ließ sich seine Frau davon gar nicht beirren. „Außerdem, was soll das überhaupt heißen? Ist ehrliche Arbeit etwas, das plötzlich nicht mehr gut genug ist? Bist du jetzt so ein Snob geworden?“
„Nein, natürlich nicht“, verteidigte er sich, sichtlich peinlich berührt als hätte er soeben alle seine Ideale der Jugend über den Haufen geworfen. „Es ging mir nur darum, dass sie eben nicht…“
„Mike!“, unterbrach ihn Kaija warnend.
„Jaja. Schon gut.“ Er seufzte ergeben. „Natürlich kann er bei uns bleiben.“ Mit einem Blick auf das von Vorfreude gezeichnete Gesicht seiner Tochter ergänzte er mit Entschiedenheit: „Im Gästezimmer unterm Dach.“
Augenblicklich erstarb Kairas Lächeln. „Häh? Wieso das denn? Bei mir ist doch genug Platz.“
„Soweit kommt das noch!“, echauffierte sich Michael. „Nix da. Ihr zwei in einem Raum geht schon mal gar nicht.“
„Und was ist mit dem anderen Gästezimmer?“ Kaira hatte dabei das Zimmer neben ihrem im Sinn. Das Zimmer war mal für ein Geschwisterkind eingeplant gewesen. Nur ließ dieses Kind noch immer auf sich warten.
„Das ist nur für Angehörige der Familie“, gab ihr Vater ungerührt zurück.
„Wir werden schon eine Lösung finden“, mischte sich Kaija nun mit aller Entschiedenheit ein. „Auf jeden Fall kann er die ganzen Ferien bei uns bleiben. – Apropos… Was wollt ihr denn unternehmen?“, versuchte sie dem Gespräch eine andere Wendung zu geben.
Kaira zuckte mit den Schultern. „Weiß noch nicht genau“, gab sie zu. „Ulf hat was von einer Ausstellung geschrieben.“
„Ausstellung?“, wunderte sich Kaija. „Kunst? Ich wusste gar nicht, dass er sich dafür interessiert.“
„Nee… Naja, vielleicht doch“, überlegte Kaira laut. „Es geht um die Azteken.“
„Also doch eher Geschichte“, stellte ihr Vater mit einer Mischung aus Befriedigung und Überraschung fest. „Ich weiß ja noch, dass Ulf ein Faible für die Templer hatte, aber für die Azteken?“
„Es gibt eben Leute, die sich noch in anderen Epochen auskennen und nicht nur im Altertum“, feixte Kaira.
„Von wegen Epochen, das ist eher ein ganz anderer Zweig der Geschichte. Mein Fachgebiet dagegen ist das Altertum, und zwar im Mittelmeerraum. Die Azteken sind da quasi aus einer ganz anderen Welt.“
„Von mir aus“, gab Kaira nur achselzuckend zurück. „Ich finde schon, dass es viele Parallelen gibt.“
„Azteken?“, unterband Kaija nun mit einer Frage eine weitere Kabbelei. „Das sind doch Indianer.“
„Ganz recht, mein Schatz. Angeblich ein sehr weit entwickeltes Volk. Aber eben nur relativ gesehen zu den anderen Ureinwohnern Amerikas.“ Zu seiner Tochter gewandt fuhr er fort, „Trotzdem ist es ein ganz anderer, wie soll ich sagen, ein anderer Zeitstrom. Die Völker haben sich nun wirklich völlig unabhängig voneinander entwickelt.“ Er hielt kurz inne. „Aber, das muss ich in der Tat zugeben, es gibt da schon einige Parallelen zu meinen Völkern des Altertums, auch wenn das wissenschaftlich nicht haltbar ist.“
„Aha! Also doch“, triumphierte Kaira.
„Trotzdem erreichte die Hochkultur der Azteken ihre Blüte erst im fünfzehnten Jahrhundert und das ist für uns, nun genau genommen, ist es sogar schon die Neuzeit“, beharrte Mike.