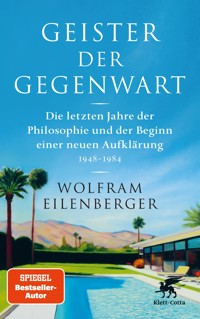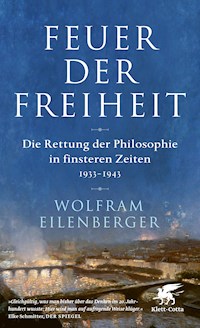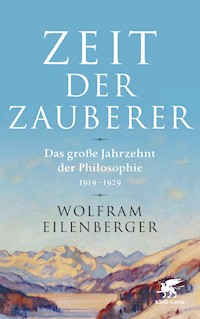7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Und täglich grüßt der Familienwahnsinn
Was unterscheidet den Finnen vom Kanadier, und wie kommt ein deutscher Mann damit klar, dass sein nordamerikanischer Nachbar auf die wohlmeinende Frage nach dem werten Befinden so gar keine ehrliche Antwort parat hat? Dass seine Frau Karriere macht, während er die Kinder zur Schule bringt und täglich mit den Marotten der Interims-Landsleute zu kämpfen hat? Warum hätte der Geburtstag der Töchter besser in einer Shoppingmall stattfinden sollen als in den eigenen vier Wänden? Und was sagt eigentlich die finnische Frau dazu?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 180
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Wolfram Eilenberger
Kanada kann mich mal
Von einem, der mit seinen Kindern in die Ferne zog
Impressum
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
© 2012 by Wolfram Eilenberger / Blanvalet Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Satz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, München
ISBN 978-3-641-07276-6V003
www.blanvalet.de
Für Matt Galloway und alle, die es ganz besonders gut meinen
Ich weiß, dass die Welt, die ich in den Städten und auf dem Lande antreffe, nicht die Welt ist, die ich denke.
Ralph Waldo Emerson, Erfahrung
I know that the world I converse with in the cities and in the farms, is not the world I think.
Ralph Waldo Emerson, Experience
1How are you?
Stimmt. Es gibt keinen Grund, sich ernsthaft für mein Leben zu interessieren. Aber bei Gelegenheit fragt man dann doch nach, oder? Neu in der Gegend, ach. Und woher kommen Sie? Finnland, interessant. Wie war noch einmal der Name? Berufsbedingt, Ihre Frau, verstehe. Und die Kinder, Zwillinge. Na, so was! Zweieiig, ja, das sieht man.
Interessiert Sie nicht? Nicht im Geringsten? Macht nichts. Ich werde es Ihnen trotzdem erzählen. Im Prinzip habe ich die letzten sieben Jahre nichts anderes getan, als mich wildfremden Menschen vorzustellen. Da kommt es jetzt auf den einen oder anderen auch nicht mehr an.
Es wird ja gern behauptet, in Nordamerika kämen die Menschen leichter miteinander ins Gespräch. Ich kann das so nicht bestätigen. Meine Probleme beginnen in der Regel bereits beim Gruß: How are you? Klar, das ist keine Frage. Ich weiß das. Dennoch bleibt etwas in mir, das jedes Mal wieder ehrlich antworten will. Das erzählen will von der Steuererklärung des vorletzten Jahres, den Bandscheibenproblemen meiner Frau, der Sehnsucht nach einem Sieben-Minuten-Pils sowie dem geschwollenen Knöchel Bastian Schweinsteigers. Doch ich habe gelernt, an mich zu halten und zu tun, was zu tun ist: I am fine, and how are you?
Frage, Lüge. Gegenfrage, Gegenlüge. Ein trauriges Schauspiel, so gesehen. Ich meine, nicht dass man seinem Gegenüber gleich den ewigen Weltfrieden an den Hals wünschen müsste, aber eine kleine, ehrlich gemeinte Hoffnung zu Beginn hat noch keiner Konversation geschadet. Wie etwa beim deutschen Guten Tag. Das ist vernünftig und realistisch. In Finnland wünschen sich die Menschen gesprächseinleitend übrigens einfach nur einen Tag: Päivää! Gern auch als Dopplung erwidert: päivää, päaivää! Vor allem im Winter.
Schwierig, die Sache mit dem Grüßen. Großer Bär weiß das. Großer Bär ist unser Indianer. Genau genommen bewohnt er das Haus direkt gegenüber. Und noch genauer genommen handelt es sich bei Großer Bär nicht um einen Indianer, sondern um ein Mitglied der First Nations (so heißen die Indianer hier). Welcher First Nation Großer Bär konkret angehört, weiß ich nicht. Genauso wenig wie ich seinen richtigen Namen kenne. Großer Bär spricht nicht mit der Nachbarschaft. Stattdessen gibt er freundliche Handzeichen von seinem Campingstuhl im Vorgarten aus, wenn das Wetter es zulässt. Morgens, wenn ich die Kinder zur Schule begleite, und nachmittags, wenn wir heimkehren. Immer dieselbe Handbewegung. Nicht eigentlich ein Winken, mehr eine gelassene Klärungsgeste des angewinkelten Unterarms. Die Kinder können es schon ganz gut.
Im Moment geht es mir nicht besonders gut. Das hat vor allem mit dem nahenden Geburtstag meiner Töchter zu tun. Ich weiß nicht, ob Sie schon einmal vor der Aufgabe standen, auf einem kanadischen Großstadtschulhof in besserer Wohnlage vierzehn Einladungen an die jeweils bevollmächtigten Aufsichtspersonen zu verteilen. Konkret bedeutet dies, in weniger als fünf Minuten die Aufmerksamkeit eines knappen Dutzends weit über die Anlage verstreuter internationaler Kindermädchen zu erringen. Sogar geträumt habe ich vergangene Nacht davon: Ohne auf- oder mich gar anzusehen, streckt Joanna die Hand aus, lässt das rosafarbene Kuvert ungeprüft in die rechte Gesäßtasche ihrer eng anliegenden Jeans gleiten, um daraufhin – ihr in grausigen Schnatterlauten geführtes Mobiltelefonat nicht einen Moment unterbrechend – den ihr anvertrauten Sprössling herbeizuwinken. Mit dem Finger zeigt sie auf mich und ruft: Ah … Abigail, do you want to go that party? Abigail, do you want to go with this man?
So schlimm muss es nicht kommen. Aber selbst bei günstigstem Verlauf verbleibt die ebenso kleine wie feine Gruppe jener Hedgefonds-Gattinnen, die ihren ganzen Mutterstolz zeigen, indem sie ihr Kind tatsächlich eigenhändig die fünfhundert Meter von der Villa zur Schule fahren. Die wenigstens steigen aus. Doch wenn sie es tun, schützen sie sich durch ganzjährig getragene, sehr dunkel getönte Sonnenbrillen. Ein Schleier ist nichts dagegen. Mit einem How are you brauchen Sie es da gar nicht erst zu versuchen. Ich habe es wiederholt ausprobiert.
2No-Go
Wenn das alles jetzt zu Anfang sehr negativ geklungen hat, bedaure ich es, denn im Prinzip fühlen wir uns ausgesprochen wohl hier. Die Umstände, wie gesagt, sind heute besondere. Außerdem ist es ja so: Familien fühlen nicht. Das tun nur die Individuen, aus denen sie bestehen.
Unsere Familie besteht im Kern aus vier Individuen: meiner finnischen Frau Pia, den bald siebenjährigen Zwillingen Tyyne und Tuuli sowie mir. Und bevor Sie eigens nachfragen müssen, es handelt sich bei Tyyne und Tuuli tatsächlich um weibliche Vornamen. Durchaus gängige sogar. Zumindest in Finnland. Tyyne bedeutet übersetzt »Stille« oder »Friede«, insbesondere in Form der Ruhe eines Waldsees am frühen Morgen, Tuuli »Wind« oder »frohes Lüftchen«, insbesondere in Form einer erfrischenden Brise auf dem morgendlichen Waldsee. Also eine Art nordisch gewendete Yin-Yang-Dynamik. So hat es mir meine Frau erklärt.
Affig, gesucht oder gar kulturell gezwungen sollte ein Vorname ja in keinem Fall wirken. Andererseits aber auch nicht schal oder allzu gängig, wobei sich die Situation vor allem in Bezug auf die zweite der beiden Gefahren grundlegend verschärft hat. Mag man es Eltern, die beispielsweise den Nachnamen Herrmann tragen, noch nachsehen können, ihre Kinder in den Siebzigerjahren Jochen oder Julia genannt zu haben, lässt sich eine vergleichbare Entscheidung zu Beginn des dritten Jahrtausends nur als Verbrechen an der Zukunft des Sprösslings bezeichnen: Versuchen Sie mal, einen Jochen Herrmann, geboren nach 2000, im Internet zu finden! Hoffnungslos. Ein Wesen ohne Kennung und also Anerkennung.
Ebenfalls unbedingt zu vermeiden sind nach Möglichkeit Umlaute wie ä, ö oder gar ü. Wie hässlich das auf Mailadressen immer aussieht! Zumal die erforderte Abweichung der Schreibweise – zum Beispiel »bjoern.loeser« oder »bjorn.loser« – global keiner festen Regel folgt und damit lebenslange Nachfragen und Verwechslungen nach sich ziehen muss. Was wir da schon mitgemacht haben! Vor drei Jahren wäre uns um ein Haar die Einreise in die USA verweigert worden, weil die Schreibweise des Namens auf dem Arbeitsvisum meiner Frau (Paivio) nicht mit der Schreibweise in ihrem finnischen Reisepass (Päiviö) identisch war und sie bereits fünfzehn Jahre zuvor als »Pia Paeivioe« eine amerikanische Social Security Number zugewiesen bekommen hatte. Aber machen Sie derlei rein alphabetisch bedingte Auffälligkeiten mal einer eisenharten Einwanderungsbeamtin klar, während Ihre von einem zehnstündigen Air-India-Flug vollends entkräfteten vierjährigen Töchter simultan das Handgepäck vollkotzen.
Da sich die geteilte nationale Identität der Zwillinge nach unser beider Wunsch bereits im Namen widerspiegeln sollte, verblieb also ein überraschend klein gewordener Pool finnischer Vornamen zur Auswahl, die keine Umlaute aufweisen, wie es Äänis, Märta, Päivi, Heljä tun, und denen überdies kein allzu offensichtliches interkulturelles Hänselpotenzial zu eigen ist wie Titta, Lalli, Foka, Anu. Nur zu lebendig stand uns der Fall der guten Minna Järvenpää – einer Doktorandenkollegin meiner Frau – vor Augen, die als Ethnologin eine Juniorprofessur im bayerischen Bamberg angenommen hatte, jedoch binnen Jahresfrist nach Jyväskylä zurückkehren musste, da es ihrer damals zehnjährigen Tochter Heini trotz wiederholter Schulwechsel nicht gelingen wollte, sich erfolgreich in den jeweiligen oberfränkischen Klassenverband zu integrieren. Der Vorname spricht sich korrekt übrigens Häini aus. Aber was hilft das schon, in so einem Fall?
Vergleichbare Diskriminierungen drohen hierzulande nicht, denn an den Grundschulen Torontos werden Namenshänseleien als wahre Kapitalverbrechen betrachtet und streng geahndet. Absolutes No-Go, schlimmer noch als Nussartikel in der Lunchbox!
Wenn ich an die großen Pausen meiner westdeutschen Grundschulzeit denke, erinnere ich mich an wahre Nutella-Orgien (mit Gesicht einschmieren, Kacka-Animationen und allem Drum und Dran), bei denen sogar schwächliche Außenseiter munter mitmachten beziehungsweise mitmachen mussten, ohne dass es dabei auch nur einziges Mal zu Asthmaproblemen gekommen wäre. Bei genauerem Studium des warnenden Informationsblattes, das zu Beginn eines jeden nordamerikanischen Schuljahres von den Kindern zur Kenntnisnahme mit nach Hause gebracht wird, entsteht allerdings der Eindruck, es handle sich bei den Inhaltsstoffen der großen Familie der Nüsse um eine Mischung aus Schweinegrippeviren, Milzbrandbakterien und HI-Viren: »Selbst geringste Spurenelemente« könnten zu »lebensbedrohlichen Situationen« führen. Sofern in den eigenen vier Wänden direkter Kontakt mit Nüssen bestehe, sei »gründliches Händewäschen dringend erforderlich«, auf dem Gelände der Schule sei aber jegliches Nahrungsmittel, das Nüsse enthalte, und das zitiere ich jetzt im kanadischen Original, absolutelyverboten.
Nutella-Brote als Pausensnack fallen für unsere Mädchen also aus, wie auch Nutella am Frühstückstisch. Wir alle – oder zumindest diejenigen, die einmal das Vergnügen hatten – wissen ja über das geschilderte Problem hinaus aus eigener Erfahrung, dass der Genuss von dick bestrichenen Nutella-Broten mit dem Verbleib dunkelbrauner Spuren an Körper und Kleidung einhergeht. Es ist schon sehr schade. Da stirbt ein Stück Tradition.
Doch bleiben wir beim Positiven! Man nimmt es in diesem Teil der Neuen Welt ganz besonders ernst mit dem Schutz von Minderheiten sowie der Sorge um die mannigfachen Gefahren sozialer Ausgrenzung. Deshalb ist es heute auch an mir, die Geburtstagseinladungen möglichst diskret unter den jeweiligen Aufsichtspersonen zu verteilen. Das Übergehen eines Teils der Kinder, erklärte mir Schulleiter Joe Conrad, erzeuge unnötige soziale Spannungen im Klassenverband, nähre ein Klima des Misstrauens und der Grüppchenbildung.
Ich glaube es gern, müsste allerdings eigentlich zu bedenken geben, dass Erstklässler des Sprechens mächtig und somit in der Lage sind, sich innerhalb ihrer jeweiligen Bezugsgruppe, in der Regel auch über deren Grenzen hinweg, über nahende Geburtstagsfeiern samt detaillierter Gästelisten öffentlich auszutauschen. Dergleichen geschieht, selbst wenn es nicht schön ist und am Ende manch einer traurig aus der Wäsche schaut. Um wenigstens die Fassade zu wahren, wird absolute Gleichbehandlung vorgetäuscht, indem das Problem in den Verband der Klasseneltern verlagert wird und damit in eine Gemeinschaft, deren Mitgliedern vergleichbare Spannungen, Kränkungen und komplex überlagerte Anerkennungsnöte vielleicht auch nicht ganz fremd sind.
»Mist!«
»Was ist denn Mist, Paps? Hast du die Einladungen wieder vergessen?«
»Nein, keine Sorge, Tuuli, heute habe ich sie dabei. Alles okay. Du weißt doch, dass der Papa manchmal mit sich selbst redet.«
»Ja, weiß ich. Aber was ist denn so Mist?«
»Nichts, wirklich, gar nichts. Alles in bester Ordnung.«
3U2
Die Stille ist tief.
»Aber sonst ist alles in Ordnung?«, frage ich. Eine andere Erwiderung auf den Aufschrei »Huch, da sind ja zwei!« will mir partout nicht einfallen.
»Ja, so weit alles in Ordnung«, antwortet Dr. Concha Fernandez-Schubbach und lässt den Kopf des Ultraschallgeräts nun wieder routiniert über den eingegelten Unterbauch meiner finnischen Frau gleiten. »Wollen Sie das Geschlecht wissen?«
Wir blicken einander an.
»Das hintere hält sich versteckt, aber das vordere ist ein Mädchen. Sehen Sie hier, ganz klar, das Brötchen!«
Ich rücke ein wenig näher an den Monitor. »Ja, das Brötchen«, nicke ich mit zugekniffenen Augen, obwohl ich beim besten Willen kein Brötchen ausmachen kann und auch sonst nichts, was entfernt an werdende weibliche Geschlechtsorgane erinnert.
Klar zu erkennen sind die Brötchen erst Wochen später auf drei riesigen, frei von der Decke hängenden Plasmabildschirmen.
»Da, die Brötchen!«, flüstere ich meiner Frau mit brüchiger Stimme zu, während die Ärztin wohlgeschwungene Laserringe um die Nackenfalten der zappelnden Kreaturen zieht, wie ein Gott bei der Schöpfung es getan haben könnte. »Ist doch alles in Ordnung, oder?«
»Wir rufen Sie dann später noch einmal herein.«
Geduld haben.
Keine so leichte Sache. Aus Sicht des sorgenden Vaters gestaltet sich die Schwangerschaft ja als eine neun Monate währende Frage nach der Befindlichkeit seiner Mutter und deren Leibesfrucht. Sorry, ich meinte natürlich, seiner Frau oder Lebensgefährtin, oder wie immer sich die Beziehung im Einzelfall darstellen mag, und deren Leibesfrucht.
Die Ärztin gibt zum Glück Entwarnung. Es ist tatsächlich alles in Ordnung.
»Haben Sie Zwillinge in Ihrer Familie?«, fragt der diensthabende Assistenzarzt und sieht sich den erst leicht geöffneten Muttermund genauer an.
Ein sympathischer Mann mit Nickelbrille und modisch kahl geschorenem Kopf, leider Gottes in meinem Alter und deshalb naturgemäß nicht vertrauenswürdig.
»Ja, eine meine Tanten hatte welche. Und Großmutter von Mutter war auch einer«, antwortet meine Frau. Ich höre das nach sieben Jahren Beziehung, drei Monaten Ehe und fünfunddreißig Schwangerschaftswochen zum ersten Mal, will aber nicht wieder streiten, lächle also und umkralle mit beiden Händen den Henkel der Reisetasche, die seit Wochen fertig gepackt in unserer Wohnung stand.
»Sieht im Prinzip gut aus«, meldet der Höhlenforscher nach einer Weile. »Wann genau, sagten Sie, ist die Fruchtblase geplatzt?«
»Vor zwei Stunden«, blende ich mich von meinem Plastikstuhl am Kopfende der Liege ein. »Und was bedeutet, wenn ich kurz nachfragen darf, ›sieht im Prinzip gut aus‹?«
»Nun, es bedeutet, dass es im Prinzip gut aussieht. Sie haben es selbst gehört, die Herztöne sind in Ordnung. Das hintere Kind ist ein wenig kleiner, aber nicht so, dass es uns Sorgen bereiten müsste. Vor allem aber: keine Anzeichen einer Infektion. Hat Ihre Hebamme denn nicht erklärt, was in einem solchen Fall zu tun ist?«
O doch, das hatte sie. Sogar wiederholt. Aber soll ich dem guten Mann jetzt wirklich auseinanderlegen, dass die Mutter meiner Frau noch in einer finnischen Waldsauna das Licht der Welt erblickte, ohne Ultraschalluntersuchungen, Pränatalscreening und Schwangerschaftspilates, sondern mit nichts als einem Eimer warmem Wasser sowie den erfahrenen Händen der zahnlosen Familienhebamme Kaisa? Und dass meine Frau es mir, wie ich annehme, vor allem aufgrund dieser kulturellen Prägung kategorisch untersagte, nach dem Platzen der Fruchtblase mitten in der Nacht einen Krankenwagen zu rufen, um sich auf einer Trage angeschnallt vier Stockwerke hinuntertragen und dann mit Blaulicht in die Klinik abtransportieren zu lassen? Was hätte sie zu Hause auf der Hütte erzählen sollen?
Und soll ich ihm wirklich erklären, dass ich mich ihrer strikten Weigerung nicht zuletzt deshalb ergab, weil ich gewisse Zweifel hegte, ob es den Sanitätern gelingen würde, eine hundertdreißig Kilo schwere und knapp zwei Meter große hochschwangere Zwillingsmutter die vier Stockwerke unseres engen Friedrichshainer Treppenhauses herunterzutragen?
Die Möglichkeit einer längeren Verzögerung oder gar eines Unfalls stand mir konkret vor Augen. Außerdem erinnerte ich mich aus meiner Zivildienstzeit beim Roten Kreuz vage an gewerkschaftliche Bestimmungen hinsichtlich des für zwei Träger maximal zumutbaren Gesamtgewichts, weshalb wir unter, ich will es nicht verschweigen, manch ungerechten Beschimpfungen von Seiten meiner Frau (»Muss ich ja nicht jede deutsche Geschiss mitmachen, Mensch!«) Arm in Arm das Treppenhaus hinunterwankten und ein Taxi herbeiwinkten, das uns direkt vor dem Haupteingang der Charité in Berlin-Mitte absetzte.
»Es ging alles so schnell«, nuschle ich schuldbewusst.
»Na, die beiden kriegen wir schon heil raus, Frau Päiviö!«
»Und zwar heute noch«, wie Stationshebamme Anita nach kurzem Blickkontakt mit dem dritten Assistenzarzt des Wochenendes gute siebzehn Stunden später trotzig beharrt.
Es ist eine der seltsamsten Eigenschaften des menschlichen Bewusstseins, sich in entscheidenden Momenten auf absolute Nebensächlichkeiten zu konzentrieren. CD-Hüllen, zum Beispiel.
Jedenfalls ging mir exakt in dem Moment, als die über lange Stunden wie munterer Pferdegalopp klingenden Herztöne des kleineren Nupfes aussetzten – wie von Geisterhand war der Kreißsaal mit sieben oder acht Personen gefüllt –, zum ersten Mal in meinem Leben auf, dass der Bandname U2, laut ausgesprochen, als klare Anspielung auf die Ermordung von Julius Caesar aufgefasst werden kann. Und zwar im Sinne des tuquoque, mi fili Brutus, auch du (U2), mein Sohn Brutus, womit die Band ihr Publikum als Verräter, gar explizit als Mörder anspricht und mit dieser Ansprache also eine Gemeinschaft der Schuldigen stiftet, die im Hinblick auf das irisch-katholische Wertgerüst der Musiker wohl eher als Gemeinschaft von Sündern zu beschreiben wäre. Wobei der Name natürlich auch eine hellere, da dialogische Lesart offenlässt, nämlich als freudig einladendes »Du auch!« (You, too) oder gar als liebevolles »Ihr beide!« (You two), was dann ja letztlich zu einem »Wir beide« führt, gleichsam die Einsicht einfangend, dass ein Du, um überhaupt ein Du sein zu können, eines zweiten Dus bedarf, womit sich die Dopplung des Zwillingsdaseins geradezu als ein menschlicher Urzustand begreifen lässt – und nicht etwa eine seltene Laune der Natur. Jedes Ich kommt zu zweit zur Welt.
Gut möglich, dass ich meiner tapfer pressenden Frau diesen Gedankengang bestärkend zuflüsterte, während ich ihre Hand hielt und die Schädeldecke der größeren unserer beiden Töchter gegen 23: 04 Uhr der Wirklichkeit entgegentrat und das zweite Kind nur acht Minuten später nach einer geschickt gesetzten Stoßbewegung der Hebamme ohne nennenswerte Pressbemühungen Pias wie auf einer Wasserrutsche hinterhergespült wurde. Ich weiß es nicht mehr und weiß, dass auch meine Frau es nicht mehr weiß.
Doch da waren sie. Da schrien sie. Die Jüngere, ob ihres strohblonden Schopfes von der Oberschwester sofort als »kleine Schwedin« identifiziert, ungleich kräftiger.
Na, du! Und du! Ich würde es noch unendlich oft sagen.
4Von Baum zu Baum
Mit drei Rucksäcken über der Schulter krame ich in der Hosentasche nach dem Schlüssel. Seit fünf Monaten der erste Tag ohne Handschuhe. Ein Südwind aus Florida trägt den Duft des Frühlings bis vor unsere kanadische Haustür.
Geschafft.
»Look, Tyyne, look, a squirrel!«
»Wow, it’s a black one!«
»Ja, ein schwarzes Eichhörnchen«, wiederhole ich. »Der Teufel ist ein Eichhörnchen, wusstet ihr das?«
»Wieso ein Eichelhörnchen?«, will Tuuli wissen.
»Eichhörnchen. Na ja, weil es der Teufel auch eilig hat, weil er immer von Ast zu Ast springt, weil er sehr geschickt ist und deshalb sehr schwer zu greifen, glaube ich.«
»Macht der Teufel das auch, I mean … hibernate?«
»Du meinst Winterschlaf halten?«
»Ja, Winterschlaf.«
»Nein, der Teufel schläft nicht. Er schläft nie. Der ist immer wach. Das ist mehr so eine Redensart, verstehst du. Eine Redensart.«
Im Grunde begreife ich es selbst nicht. Womöglich hatte es ursprünglich mit dem teufelsroten Fell der Eichkatz zu tun. Aber hier gibt es so gut wie keine Eichhörnchen mit rotem Fell. Ehrlich gesagt bin ich mir nicht einmal sicher, ob es sich bei squirrels überhaupt um Eichhörnchen handelt. Echte Eichhörnchen meine ich, also, deutsche Eich… Die hiesigen sind merklich größer und keineswegs scheu oder ängstlich, sondern ausgesprochen selbstbewusst. Geradezu vorwitzig springen sie durch die Ahornbäume der Vorgärten. Manche haben auch graue Streifen im Fell. Oder sind das Streifenhörnchen?
»Tyyne, wie heißen Streifenhörnchen noch einmal auf Englisch?«
»Was?«
»Isi haluaa tietää mikä on Tikku ja Takku englanniksi«, übesetzt Tuuli.1
»Ah, du meinst chipmunks!«
»Chipmunks, genau. Danke.«
»But that was a squirrel, not a chipmunk!«
»Schon gut, ich wollte ja nur wissen, was Streifenhörnchen auf Englisch heißt.«
Wie jeden Morgen folgt Großer Bär dem Schauspiel in aller Seelenruhe. Er ist lange nicht mehr von Baum zu Baum gesprungen. Seit mehreren tausend Jahren, stelle ich mir vor, sitzt er schon an seinem Ort, schweigend, und sieht zu, wie Fremde an ihm vorbeiziehen. Wie sie kommen. Und wieder gehen.
Toronto – in der Sprache der eingeborenen Indianer bedeutete das ursprünglich »Platz der großen Versammlung«. Dreieinhalb Millionen Menschen leben hier mittlerweile. Alles Fremde, soweit es Großer Bär betrifft. Er hat alle Zeit der Welt. Er muss nur sitzen und warten.
Er winkt uns durch.
11 Mein Finnisch ist nicht besonders, aber soweit ich es verstehe, sagt sie: Papa will wissen, wie Tikku und Takku (womöglich die finnischen Namen für die deutschen Disneyfiguren Ahörnchen und Behörnchen) auf Englisch heißen.
5Igor
Igor sagt, die kanadischen Eltern der Schule feiern die Kindergeburtstage nur deshalb nicht zu Hause, weil die Familien kaum Möbel und anderes Inventar besäßen. Alles nur Fassade, sagt Igor. Von außen, ja, da sähen die Häuser groß und prächtig aus, aber innen: alles shit! »They live like poor people«, sagt er. »It’s all fake.«
Nun, das sind Igor-Theorien. Er ist der einzige Elternteil, der auf dem Schulhof mit mir redet. Gleich am ersten Schultag kamen wir, als »alte Europäer«, wie der Serbe scherzte, gut ins Gespräch. Seine Tochter Olga ist mit meinen Kindern derzeit »bff« – also best friends forever.
Es ist als Neuling auf Schulhöfen der Fremde nicht leicht, einem Typ Igor zu entgehen. Dass schon seit Jahren niemand aus der Elterngemeinschaft mehr mit ihm reden will, weiß man ja am Anfang nicht. Nach dem dritten Tag, wie aus dem Nichts, steht Igor plötzlich wieder neben einem, womit man in den Augen der Gemeinschaft klar als Freund von Igor markiert ist (»bff«), damit ebenfalls sozial geächtet, und wenn man nicht aufpasst, beginnt man nur wenige Monate später eigenartige Geschichten über die Einrichtung von Häusern zu verbreiten, die man nie von innen gesehen hat.
Nicht zuletzt deshalb schien es meiner Frau und mir eine gute Idee, die Gäste zu uns nach Hause einzuladen. Wer weiß, was für Theorien über uns im Umlauf sind? Außerdem konnten wir uns nicht vorstellen, den Geburtstag, wie auf diesem Kontinent sonst guter Brauch, in die Katakomben eines Einkaufszentrums am Rande der Stadt auszulagern. Wie ein Dieb zwängt man die Kinder durch den Hintereingang des Komplexes, tastet sich durch ein weit verzweigtes System unverputzter Betongänge bis zu einer Stahltür, hinter der sich wahlweise ein Schwimmbad, eine Stadt aus Springburgen, eine Trampolinhalle oder auch das weitläufige Ersatzteillager einer Teddybärfabrik befindet. Die gemieteten Animateurinnen haben das arbeitsfähige Alter knapp erreicht, zwischendurch wird Pizza angeliefert, schließlich das Neonlicht ausgemacht und der von Wunderkerzen sprühende Kuchen hereingetragen. Ich habe nichts gegen Integration, aber irgendwo muss Schluss sein.