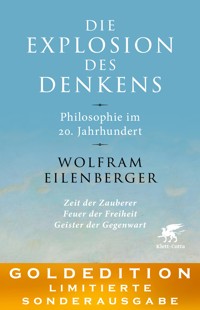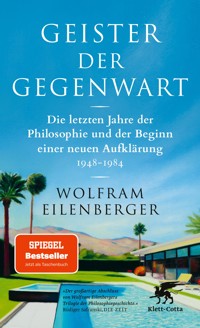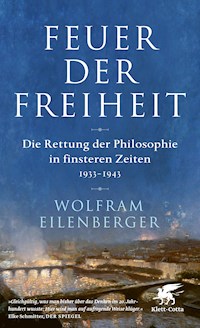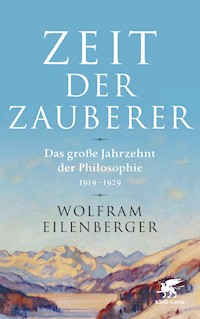
11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Jahre 1919 bis 1929 markieren eine Epoche unvergleichlicher geistiger Kreativität, in der Gedanken zum ersten Mal gedacht wurden, ohne die das Leben und Denken in unserer Gegenwart nicht dasselbe wäre. Die großen Philosophen Ludwig Wittgenstein, Walter Benjamin, Ernst Cassirer und Martin Heidegger prägten diese Epoche und ließen die deutsche Sprache ein letztes Mal vor der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs zur Sprache des Geistes werden. Wolfram Eilenberger, Bestsellerautor, langjähriger Chefredakteur des »Philosophie Magazins« und der wohl begabteste und zurzeit auffälligste Vermittler von Geistesgeschichte im deutschsprachigen Raum, erweckt die Philosophie der Zwanziger Jahre und mit ihr ein ganzes Jahrzehnt zwischen Lebenslust und Wirtschaftskrise, Nachkrieg und aufkommendem Nationalsozialismus zum Leben. Der kometenhafte Aufstieg Martin Heideggers und dessen Liebe zu Hannah Arendt. Der taumelnde Walter Benjamin, dessen amour fou auf Capri mit einer lettischen Anarchistin ihn selber zum Revolutionär macht. Der Genius und Milliardärssohn Wittgenstein der, während er in Cambridge als Gott der Philosophie verehrt wird, in der oberösterreichischen Provinz vollkommen verarmt Grundschüler unterrichtet. Und schließlich Ernst Cassirer, der Jahre vor seiner Emigration in den bürgerlichen Vierteln Hamburgs am eigenen Leib den aufsteigenden Antisemitismus erfährt. In den Lebenswegen und dem revolutionären Denken dieser vier Ausnahmephilosophen sieht Wolfram Eilenberger den Ursprung unserer heutigen Welt begründet. Dank der großen Erzählkunst des Autors ist uns der Rückblick auf die Zwanziger Jahre zugleich Inspiration und Mahnung, aber in allererster Linie ein mitreißendes Lesevergnügen. »Dieses schön erzählte Buch schildert die Jahre zwischen 1919 und 1929, in denen Heidegger, Wittgenstein, Benjamin und Cassirer Weltbedeutung gewannen. Zusammen bilden sie eine erstaunliche geistige Konstellation, vier Lebensentwürfe und vier Antworten auf die Frage: Was ist der Mensch? Herausgekommen ist dabei das Sternbild der Philosophie in einem großen Augenblick im Schatten der Katastrophen davor und danach.« Rüdiger Safranski
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 567
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Wolfram Eilenberger
Zeit der Zauberer
Das große Jahrzehnt der Philosophie1919–1929
Klett-Cotta
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe zum Zeitpunkt des Erwerbs.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Michael Gaeb
© 2018, 2019 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte inklusive der Nutzung des Werkes für Text und Data Mining i.S.v. § 44b UrhG vorbehalten
Printed in Germany
Cover: Rothfos & Gabler, Hamburg
unter Verwendung eines Gemäldes von Ernst Emil Schlatter (1883–1954), Blick auf Piz Margna von Zuoz aus, 1919
© John Mitchell Fine Paintings/Bridgeman Images
Gesetzt von Dörlemann Satz, Lemförde
Gedruckt und gebunden von CPI – Claussen & Bosse, Leck
ISBN 978-3-608-96451-6
E-Book: ISBN 978-3-608-11017-3
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in derDeutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografischeDaten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
I. Prolog
Die Zauberer
Gottes Ankunft
Gipfelstürmer
Contenance wahren
Mythos Davos
Menschen fragen
Ohne Fundament
Zwei Visionen
Vor der Wahl
Wo ist Benjamin?
Besser scheitern
Braucht mein Leben ein Ziel?
Die Ein-Mann-Republik
II. Sprünge
1919
Was tun?
Seine Zuflucht
Kritische Tage
Romantische Thesen
Neues Selbstbewusstsein
Fluchten
Die Verwandlung
Ethische Akte
Wunschloses Unglück
Andere Umstände
Offene Flanken
Welt ohne Anschauung
Der Urwissenschaftler
Ohne Alibi
Das Neue Reich
Treue zum Ereignis
Deutsche Tugenden
Der Ungeliebte
Elektrisiert
III. Sprachen
1919–1920
Bildlich gesprochen
Wiener Brücken
Poetische Präzision
Gegen die Welt
Drei Punkte in Den Haag
Bilder von Tatsachen
Der Friseur
Russell auf der Leiter
Warum es die Welt nicht gibt
Unter Strom
Der getrübte Blick
Gemeinsam einsam
Zwei Käuze
Umwelten voraus
Echtheit bricht durch
Irgendwas mit Medien
Flapper
Die Aufgabe
Radikale Übersetzung
Kult und Sound
Goethe in Hamburg
Das Grundphänomen
Der Wille zur Vielheit
Vorwärts
Gibt es
die
Sprache?
IV. Bildung
1922–1923
Friede den Hütten
Unheimliche Berufungen
Daseinsvorsorgeuntersuchung
Mut zum Sturm
Stellungskämpfe
Schlechte Nachbarschaft
Gute Nachbarschaft
Utopie im Regal
Ausgang vom Mythos
Die neue Aufklärung
Über den Fluss
Im Strudel
Dritter im Bunde?
Goethe in Weimar
Mehr Licht
Freiheit oder Schicksal
Wahl oder Entscheidung
Die geschiedene Republik
Sprung der Erlösung
Rettende Transzendenz
Gnadenlos
Drei Viertel verstanden
In Therapie
Von oben herab
V. Du
1923–1925
Der Idiot
It’s complicated
Gastfreundschaft
Von Hamburg nach Bellevue
Schlüsselexperiment mit Schlange
Tunnel und Licht
Weimar wankt
Feste Burgen
Ereignis sein
Du, Dämon
Inmitten des Seins
Das Schwerste denken
Amor mundi
Hungerkuren
Goodbye Deutschland
Trauben und Mandeln
Aufbrüche
VI. Freiheit
1925–1927
Rote Sterne
Kritische Vorrede
Ein Fall für Adam
Trauer-Arbeit
Erinnerndes Vernehmen
Trauernde Tropen
Kritisches Album
Palästina oder der Kommunismus
Nahe sein
Ans Werk
Freilegen der Frage
Die Zeit des Daseins
Das ist der Hammer: Die Zeug-Analyse
Sturm und Angst
Das gewisse Etwas: Vorlaufen zum Tod
Die Schule von Hamburg
Der verdeckte Ursprung
Pluralität im Ausgang
Selbstgestaltung durch Welterschließung
Was in den Sternen steht
Kindermund
Ingenieure des Sprechens
Liste der Vernunft
Das Prinzip Verantwortung
Ohnmachtsanfall
VII. Passagen
1926–1928
Technische Begabung
Nur für Götter
Kreis ohne Meister
Viel zu lernen ihr noch habt
Auf der Kippe
Endstation Moskau?
Die Hölle des Anderen
Mann ohne Gerüst
Party for one
Hohe See
Im Auge des Sturms
Ernstfall Frankfurt
Individuum und Republik
Am Bau
Zeit des Dämons
Nach dem Sein
Grund und Abgrund
Zurück zum Ursprung
Heimkehr
Hochtourig
VIII. Zeit
1929
Freie Schwünge
Unter Leuten
Vorabend in München
Entspannt euch!
In Wortgewittern – die Davoser Disputation
Wunden lecken
Frühlingsgefühle
Die Dreihundertgroschenoper
The Doors
Atemlos, durch die Nacht
Gaslicht
Der autodestruktive Charakter
Um die Wurst
Der Wanderer
Schulfrei
Interne Probleme
Zurück in den Alltag
Neapel in Cambridge
Erinnern zu einem Zweck
Die Stadt der Worte
Gegen die Wand
Endliche
Anmerkungen
Personenregister
Werkregister
Walter Benjamin
Ernst Cassirer
Martin Heidegger
Ludwig Wittgenstein
Auswahlbibliographie
Bildnachweis
Dank
Tafelteil
Für Eva
Das Beste, was wir von der Geschichte haben, ist der Enthusiasmus, den sie erregt.
Johann Wolfgang von Goethe(1), »Maximen und Reflexionen«
I. Prolog
Die Zauberer
Gottes Ankunft
»Macht euch nichts draus, ich weiß, ihr werdet das nie verstehen.« Mit diesem Satz endete am 18. Juni 1929 in Cambridge, England, das wohl eigenartigste Rigorosum der Philosophiegeschichte. Zur Doktorprüfung angetreten vor den Ausschuss, der aus Bertrand Russell(1) und George Edward Moore(1) bestand, war ein 40-jähriger Ex-Milliardär aus Österreich, der die vorangegangenen zehn Jahre hauptsächlich als Grundschullehrer gearbeitet hatte.[1] Sein Name lautete Ludwig Wittgenstein(1). Wittgenstein(2) war in Cambridge kein Unbekannter. Im Gegenteil, in den Jahren 1911 bis kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs hatte er dort bei Russell studiert und war unter den damaligen Studenten ob seiner offenbaren Genialität wie auch seiner Eigenwilligkeit schnell zu einer Kultgestalt aufgestiegen. »Gott ist angekommen, ich traf ihn im Fünf-Uhr-Fünfzehn-Zug«, notiert John Maynard Keynes(1) in einem Brief vom 18. Januar 1929. Keynes, zu diesem Zeitpunkt wohl der bedeutendste Ökonom der Welt, hat Wittgenstein(3) am ersten Tag von dessen Rückkehr nach England zufällig getroffen. Und es sagt viel über die ausgesprochen enge und damit gerüchteträchtige Atmosphäre der damaligen Zirkel aus, dass sich Wittgensteins alter Freund G. E. Moore(2) ebenfalls in diesem Zug von London nach Cambridge befand.
Man sollte sich die Atmosphäre im Abteil indes nicht als allzu ausgelassen vorstellen. Denn Small Talk und herzliche Umarmungen waren zumindest Wittgensteins Sache nicht. Vielmehr neigte das Genie aus Wien zu plötzlichen Wutausbrüchen und war überdies äußerst nachtragend. Bereits ein einziges loses Wort oder eine scherzhafte politische Äußerung konnten zu jahrelangem Groll, ja zum Abbruch der Beziehungen führen – wie es auch mit Keynes(2) und Moore(3) mehrfach der Fall gewesen war. Dennoch: Gott war zurück! Und die Freude entsprechend groß.
Bereits am zweiten Tag nach Wittgensteins Ankunft beruft man in Keynes(3)’ Haus deshalb den sogenannten Kreis der »Apostel« ein – ein ausgesprochen elitärer, inoffizieller Studentenclub, der vor allem für die homosexuellen Techtelmechtel seiner Mitglieder berüchtigt war –, um den verlorenen Sohn willkommen zu heißen.[2] Im Rahmen eines feierlichen Abendessens wird Wittgenstein(4) in den Rang eines Ehrenmitglieds (»Angels«) erhoben. Mehr als 15 Jahre sind für die meisten seit der letzten Zusammenkunft vergangen. Viel ist seither geschehen. Wittgenstein(5) indes wirkt auf seine Apostel äußerlich so gut wie unverändert. Nicht nur, dass er auch an diesem Abend seine immer gleiche Kombination aus kragenlosem Knöpfhemd, grauer Flanellhose und schweren, bäuerlich wirkenden Lederschuhen trägt. Auch körperlich scheinen die Jahre spurlos an ihm vorübergegangen zu sein. Auf den ersten Blick gleicht er deshalb eher einem der ebenfalls zahlreich geladenen Elitestudenten, die den seltsamen Mann aus Österreich bisher nur aus den Erzählungen ihrer Professoren kennen. Sowie natürlich als Autor des »Tractatus logico-philosophicus«, jenes legendären Werks, das die philosophischen Diskussionen in Cambridge die vorangegangenen Jahre entscheidend geprägt, wenn nicht dominiert hat. Zwar hätte keiner der Anwesenden behaupten wollen, das Buch auch nur annähernd verstanden zu haben. Die Faszination für den »Tractatus« befeuerte diese Tatsache indes nur noch mehr.
Wittgenstein(6) hatte das Buch 1918 in italienischer Kriegsgefangenschaft mit dem festen Bewusstsein beendet, sämtliche Probleme des Denkens »im Wesentlichen endgültig gelöst zu haben«, und folgerichtig beschlossen, der Philosophie nunmehr den Rücken zu kehren. Nur wenige Monate später überschrieb er, als Erbe einer der reichsten Industriellenfamilien des Kontinents, sein gesamtes Vermögen seinen Geschwistern. Wie er Russell(2) damals brieflich mitteilte, wolle er – geplagt von schweren Depressionen und wiederkehrenden Selbstmordgedanken – fortan »mit ehrlicher Arbeit« sein Leben verdienen. Konkret hieß dies, als Grundschullehrer in der Provinz zu unterrichten.
Dieser Wittgenstein(7) also war zurück in Cambridge. Zurück, wie es hieß, um zu philosophieren. Indes besaß das Genie, mittlerweile 40 Jahre alt, keinen akademischen Titel und zeigte sich zudem vollkommen mittellos. Das wenige, was er sich über die Jahre hatte ansparen können, ist bereits nach einigen Wochen in England aufgebraucht. Vorsichtige Erkundigungen, ob nicht die reichen Geschwister bereit wären, ihm finanziell auszuhelfen, werden mit aller Heftigkeit abgewehrt: »Akzeptieren Sie bitte meine schriftliche Erklärung, daß ich nicht nur eine Anzahl wohlhabender Verwandter habe, sondern daß sie mir auch Geld geben würden, wenn ich sie darum bäte. DASS ICH SIE ABER NICHT UMEINEN PENNY BITTEN WERDE«,[3] lässt er Moore(4) noch am Vortag seiner mündlichen Doktorprüfung wissen.
Was tun? Niemand in Cambridge zweifelt an Wittgensteins Ausnahmebegabung. Jeder, darunter die einflussreichsten Gestalten der Universität, wollen ihn halten und ihm helfen. Doch ohne akademischen Titel erwies es sich selbst in der familiären Atmosphäre von Cambridge als institutionelle Unmöglichkeit, dem Studienabbrecher von einst ein Forschungsstipendium oder gar eine feste Stelle zu besorgen.
So verfällt man schließlich auf den Plan, Wittgensteins »Tractatus logico-philosophicus« als Doktorarbeit einreichen zu lassen. Russell(3) hatte sich für die Veröffentlichung im Jahre 1921/1922 persönlich eingesetzt und eigens ein Vorwort verfasst, um die Publikation zu ermöglichen, hielt er das Werk des einstigen Zöglings seinen eigenen, nicht weniger epochalen Arbeiten zur Philosophie der Logik, Mathematik und Sprache doch für weit überlegen.
Kein Wunder also, dass Russell(4) beim Betreten des Prüfungssaals fluchte, »in seinem ganzen Leben nichts derart Absurdes erlebt zu haben«.[4] Dennoch: Eine Prüfung ist eine Prüfung, weshalb sich Moore(5) und Russell nach einigen Minuten freundschaftlicher Erkundigungen dann schließlich doch noch zu einigen kritischen Fragen entschlossen. Sie betrafen eines der zentralen Rätsel des an dunklen Aphorismen und mystischen Einzeilern nicht eben armen Traktats von Wittgenstein. Bereits der erste Satz des nach einem ausgeklügelten Dezimalsystem streng angeordneten Werks liefert dafür ein eindrückliches Beispiel. Er lautet:
1 Die Welt ist alles, was der Fall ist.
Aber auch Einträge wie die folgenden gaben den Wittgenstein(8)-Adepten Rätsel auf (und tun dies bis heute):
6.432 Wie die Welt ist, ist für das Höhere vollkommen gleichgültig. Gott offenbart sich nicht in der Welt.
6.44 Nicht wie die Welt ist, ist das Mystische, sondern daß sie ist.
Trotz dieser Rätselhaftigkeit ist der Grundimpuls des Buches klar. Wittgensteins »Tractatus« steht in einer langen Tradition moderner Werke wie die »Ethik, nach geometrischer Methode dargestellt« (posthum 1677) von Baruch de Spinoza(1), David Humes(1) »Untersuchung über den menschlichen Verstand« (1748) und Immanuel Kants(1) »Kritik der reinen Vernunft« (1781). All diese Werke streben an, eine Grenze zu ziehen zwischen den Sätzen unserer Sprache, die im eigentlichen Sinne sinnvoll und damit wahrheitsfähig sind, und solchen, die nur sinnvoll erscheinen und unser Denken und unsere Kultur aufgrund dieser Scheinhaftigkeit in die Irre führen. Es handelt sich beim »Tractatus« mit anderen Worten um einen therapeutischen Beitrag zu der Problemstellung, wovon man als Mensch sinnvoll sprechen kann – und wovon nicht. Nicht zufällig endet das Buch mit dem Lehrsatz:
7 Wovon man nicht sprechen kann, darüber muß man schweigen.
Und nur eine Dezimalstelle zuvor, unter Eintrag 6.54, legt Wittgenstein(9) seine eigene therapeutische Verfahrensweise offen:
6.54 Meine Sätze erläutern dadurch, daß sie der, welcher mich versteht, am Ende als unsinnig erkennt, wenn er durch sie – auf ihnen – über sie hinausgestiegen ist. (Er muß sozusagen die Leiter wegwerfen, nachdem er auf ihr hinaufgestiegen ist.)
Er muß diese Sätze überwinden, dann sieht er die Welt richtig.
Genau an diesem Punkt nun hakt Russell(5) im Prüfungsgespräch nach. Wie genau soll das vor sich gehen: jemandem durch eine Aneinanderreihung unsinniger Sätze zu einer, ja der einzig richtigen Weltsicht zu verhelfen? Hatte Wittgenstein(10) im Vorwort zu seinem Werk nicht ausdrücklich verkündet, »die Wahrheit der hier mitgeteilten Gedanken« erscheine ihm »unantastbar und definitiv«? Wie könne das sein, bei einem Werk, das nach eigenem Bekunden ausschließlich sinnfreie Sätze enthielt?
Die Frage war Wittgenstein(11) nicht neu. Vor allem nicht aus Russells(6) Mund. Sie war über die Jahre und regen Briefwechsel vielmehr zu so etwas wie einem Klassiker ihrer spannungsgeladenen Freundschaft geworden. Ein weiteres Mal also, »for old times sake«, stellte Russell seine gute Frage.
Wir wissen leider nicht, was genau Wittgenstein(12) zu seiner Verteidigung antwortete. Wir dürfen aber annehmen, dass er es wie üblich leicht stotternd tat, mit glühenden Augen und in einer höchst eigenwilligen Intonation, die weniger einem Fremdsprachenakzent als vielmehr dem Sprechen eines Menschen glich, der in den Worten der menschlichen Sprache eine besondere Bedeutung und Musikalität wahrnimmt. Und irgendwann dann, nach Minuten monologischen Stammelns, immer auf der Suche nach der eigentlich klärenden Formulierung, auch darin bestand Wittgensteins Eigenart, wird er einmal mehr zu dem Schluss gekommen sein, genug gesprochen, genug erklärt zu haben. Es ist einfach nicht möglich, jedem Menschen alles verständlich zu machen. Genauso hatte er es ja auch im Vorwort zum »Tractatus« festgehalten: »Dieses Buch wird vielleicht nur der verstehen, der die Gedanken, die darin ausgedrückt sind – oder doch ähnliche Gedanken – schon selbst einmal gedacht hat.«
Das Problem daran war nur (und Wittgenstein(13) wusste es): Es gab sehr wenige Menschen, womöglich sogar keinen einzigen, der ähnliche Gedanken schon einmal so gedacht und formuliert hatte. Ganz sicher nicht sein einstmals hoch verehrter Lehrer Bertrand Russell(7), Autor der »Principia Mathematica«, den Wittgenstein(14) für philosophisch letztlich beschränkt hielt. Und schon gar nicht G. E. Moore(6), seines Zeichens einer der brillantesten Denker und Logiker seiner Zeit, über den Wittgenstein(15) im Vertrauen sagte, Moore »sei ein hervorragendes Beispiel dafür, wie weit es ein Mensch bringen kann, der über keinerlei Intelligenz verfügt«.
Wie sollte er diesen Menschen die Sache mit der Leiter unsinniger Gedanken erklären, die man zunächst heraufsteigen und dann von sich stoßen muss, um die Welt richtig zu sehen? War nicht auch der Weise aus Platons(1) Höhlengleichnis, einmal ans Licht gelangt, daran gescheitert, seine Einsichten den anderen Höhlengefangenen verständlich zu machen?
Genug für heute. Genug erklärt. So steht Wittgenstein(16) also auf, schreitet auf die andere Seite des Tisches, klopft Moore(7) und Russell(8) wohlwollend auf die Schulter und äußert jenen Satz, von dem bis heute jeder Doktorand der Philosophie in der Nacht vor der Prüfung träumen muss: »Macht euch nichts draus, ich weiß, ihr werdet das nie verstehen.«
Damit war das Schauspiel beendet. Es blieb an Moore(8), den Prüfungsbericht zu verfassen: »Meiner persönlichen Einschätzung nach handelt es sich bei der Doktorarbeit von Herrn Wittgenstein(17) um das Werk eines Genies; doch sei dem wie es will, sie erfüllt ganz gewiss die Anforderungen, die zur Erlangung des Grades eines Doktors der Philosophie in Cambridge verlangt werden.«[5]
Das Forschungsstipendium wurde kurz darauf bewilligt. Wittgenstein(18) war wieder in der Philosophie angekommen.
Gipfelstürmer
Im eigentlichen Sinne angekommen durfte sich auch Martin Heidegger(1) fühlen, als er am 17. März desselben Jahres den Festsaal des Davoser »Grand Hôtel & Belvédère« betrat. Denn das ist sie ganz unzweifelhaft, die große philosophische Bühne, die zu erobern der mittlerweile 39-jährige Denker aus dem Schwarzwald sich bereits von früher Jugend an auserkoren sah. Nichts an seinem Auftritt sollte deshalb als zufällig angenommen werden. Nicht sein sportlich eng geschnittener Anzug, der sich von den klassischen Fracks der geladenen Würdenträger absetzte, nicht die streng nach hinten gekämmten Haare, nicht sein von der Höhensonne bäuerlich gebräuntes Antlitz, nicht die stark verspätete Ankunft im Saal und schon gar nicht die Tatsache, dass er, anstatt in den vorderen Reihen seinen eigens für ihn reservierten Platz einzunehmen, sich ohne ersichtliches Zögern unter die Schar der ebenfalls zahlreich angereisten Studenten und Jungforscher im Bauch des Saales mischte. Sich den herrschenden Konventionen ohne Tabubruch zu beugen, kam auf keinen Fall infrage. Denn für einen wie Heidegger(2) gab es nun einmal kein richtiges Philosophieren im falschen. Und falsch musste ihm an dieser Art von gelehrter Zusammenkunft in einem Schweizer Nobelhotel so gut wie alles erscheinen.
Noch im Vorjahr hatte Albert Einstein(1) den Eröffnungsvortrag für die »Davoser Hochschulkurse« gehalten. 1929 nun war er, Martin Heidegger(3), als einer der Hauptredner geladen. Drei Vorträge würde er in den kommenden Tagen halten sowie abschließend mit Ernst Cassirer(1) – dem zweiten philosophischen Schwergewicht der Tagung – in ein öffentliches Streitgespräch treten. Mochte der gesetzte äußere Rahmen also auch noch so sehr missfallen, die mit ihm verbundene Geltung und Anerkennung brachten Heideggers(4) tiefste Sehnsüchte zum Schwingen.[6]
Erst zwei Jahre zuvor, im Frühjahr 1927, hatte er mit »Sein und Zeit« ein Werk veröffentlicht, das binnen weniger Monate als neuer Meilenstein des Denkens anerkannt war. Durch seinen großen Wurf bestätigte der Küstersohn aus dem badischen Meßkirch indes nur einen Ruf, der ihn bereits in den Jahren zuvor, um es in den Worten seiner damaligen Schülerin (und Geliebten) Hannah Arendt(1) zu sagen, als »heimlichen König« der deutschsprachigen Philosophie auswies. Heidegger(5) hatte das Werk im Jahre 1926 unter enormem zeitlichen Druck geschrieben – und in Wahrheit nur zur Hälfte beendet. Mit »Sein und Zeit«, einem Jahrhundertwerk, hatte er die formalen Voraussetzungen geschaffen, aus dem ungeliebten Marburg an seine Freiburger Alma Mater zurückzukehren. Im Jahr 1928 übernimmt Martin Heidegger(6) dort den prestigeträchtigen Lehrstuhl seines einstigen Lehrers und Förderers, des Phänomenologen Edmund Husserl(1).
Hatte John Maynard Keynes(4) anlässlich der Rückkehr Wittgensteins nach Cambridge noch das transzendente Register eines »Gottes« gewählt, so verweist Arendts(2) Begriffswahl des »Königs« auf einen Willen zur Macht und damit sozialen Dominanz, die sich im Falle Heideggers(7) jedem Beobachter schon nach wenigen Sekunden deutlich mitteilte. Egal wo er auftritt oder erscheint: Heidegger(8) ist niemals nur einer unter vielen. Im Festsaal von Davos untermauert er diesen Anspruch mit der symbolträchtigen Weigerung, sich als einer unter anderen Philosophieprofessoren auf vorgesehenem Platze einzufinden. Man tuschelt, raunt, dreht sich gar eigens um: Heidegger(9) ist da. Es kann also losgehen.
Contenance wahren
Mehr als unwahrscheinlich, dass auch Ernst Cassirer(2) in das allgemeine Geraune und Gemurmel im Saal mit einstimmte. Nur nichts anmerken lassen: die Form wahren – und vor allem Haltung. So lautet das Credo seines Lebens. Und auch der Kern seiner Philosophie. Wovor hätte er sich, bei Lichte betrachtet, auch fürchten sollen? Schließlich ist dem 54-jährigen Professor der Universität Hamburg keine Umgebung vertrauter als der zeremonielle Rahmen einer akademischen Großveranstaltung. Exakt zehn Jahre nun hat er seinen Lehrstuhl inne. Zum Wintersemester 1929/1930 würde er – als der erst vierte Jude in der Geschichte der deutschen Universitätsgeschichte – gar das Rektorat seiner Hochschule übernehmen. Auch mit der Etikette Schweizer Nobelhotels durfte sich Cassirer(3) als Spross einer wohlhabenden Breslauer Kaufmannsfamilie von frühester Kindheit an vertraut wissen. Wie man es in seinen Kreisen zu tun pflegte, fuhr er mit seiner Frau Toni(1) jedes Jahr über die Sommermonate in die Schweizer Berge zur Kur. Vor allem aber befindet sich im Jahre 1929 auch Cassirer(4) auf dem Zenit seines Ruhms, dem Gipfel seines Schaffens. In den vorangegangenen zehn Jahren hatte er seine dreiteilige »Philosophie der symbolischen Formen« zu Papier gebracht. Die enzyklopädische Breite und systematische Originalität des Werkes – dessen dritter und letzter Band nur wenige Wochen vor der Davoser Tagung erschienen war – etablierte Cassirer(5) als das unbestrittene Haupt des Neukantianismus und damit der führenden akademischen Strömung der deutschen Philosophie.
Anders als bei Heidegger(10) ist Cassirers(6) Aufstieg zum Meisterdenker kein kometenhafter gewesen. Vielmehr war sein Ruf über Jahrzehnte philosophiehistorischer und editorischer Arbeiten kontinuierlich gewachsen. Sowohl eine Gesamtausgabe der Werke von Leibniz(1) als auch der Werke Kants(2) hat er als Herausgeber betreut und in den Jahren seiner Tätigkeit als Privatdozent in Berlin überdies ein umfangreiches Werk zur Philosophiegeschichte der Neuzeit veröffentlicht. Anstatt durch charismatische und sprachliche Verwegenheit zeichnet sich sein Auftreten vor allem durch beeindruckende Belesenheit und ein bisweilen übermenschlich erscheinendes Erinnerungsvermögen aus, das es ihm bei Bedarf ermöglicht, zentrale Stellen der großen philosophischen und literarischen Klassiker seitenlang aus dem Kopf zu zitieren. Geradezu berüchtigt ist Cassirers ausgeglichenes Wesen, das stets auf Vermittlung und Mäßigung abzielt. Er verkörpert – und weiß es genau – in Davos genau jene Form des Philosophierens und auch des akademischen Establishments, das Heidegger(11) mit seinem dank großzügiger Reisestipendien fast vollständig angereisten Stoßtrupp von Schülern und Habilitanden unbedingt aufzumischen strebt. Das Foto der Eröffnungsfeier zeigt Cassirer(7) – zweite Reihe links – an der Seite seiner Gattin Toni(2) sitzend. Das volle Haupthaar würdig ergraut, ist sein Blick konzentriert zum Rednerpult gewandt. Der Stuhl linker Hand vor ihm ist frei. Ein an die Lehne geheftetes Papier weist ihn als »reservé« aus. Heideggers(12) Platz.
Mythos Davos
Wie spätere Aufzeichnungen bezeugen, blieben Heideggers(13) gezielte Verstöße gegen die Davoser Etikette durchaus nicht ohne Wirkung. Toni Cassirer(3) hat das Zusammentreffen gar derart verstört, dass sie es in ihren Memoiren, die sie 1948 im New Yorker Exil unter dem Titel »Mein Leben mit Ernst Cassirer(8)«[7] schreibt, um volle zwei Jahre fehldatiert. Sie beschreibt darin einen »kleinen, ganz unscheinbaren Mann, schwarzes Haar stechend dunkle Augen«, der sie – die Kaufmannstochter aus bester Wiener Gesellschaft – »sofort an einen Handwerker, etwa aus dem südlichen Österreich oder Bayern« erinnerte, ein Eindruck, der beim späteren Gala-Diner »bald darauf durch seinen Dialekt unterstützt wurde«. Schon damals ahnte sie deutlich, mit wem ihr Gatte es zu tun bekommen würde: »Heideggers(14) Neigung zum Antisemitismus«, schließt sie ihre Erinnerungen an Davos, »war uns nicht fremd.«
Die Davoser Disputation zwischen Ernst Cassirer(9) und Martin Heidegger(15) gilt heute als einschneidendes Ereignis in der Geschichte des Denkens. In den Worten des amerikanischen Philosophen Michael Friedman(1) stellt sie gar die maßgebliche »Wegscheide für die Philosophie des 20. Jahrhunderts« dar.[8] Das Bewusstsein, Zeuge eines Epochenwandels zu sein, beseelte bereits alle damals anwesenden Teilnehmer. So zelebriert der Heidegger(16)-Student Otto F. Bollnow(1) (der in den Jahren nach 1933 zu einem bekennenden Nazi-Philosophen aufstieg) in seinem Tagebuch das »erhebende Gefühl, … einer geschichtlichen Stunde beigewohnt zu haben, ganz wie es Goethe(2) in der ›Kampagne in Frankreich‹ ausgesprochen hatte: ›Von hier und heute geht eine neue Epoche der Weltgeschichte aus‹ – in diesem Fall der Philosophiegeschichte – und ihr könnt sagen, ihr seid dabei gewesen«.[9]
In der Tat. Hätte Davos nicht tatsächlich stattgefunden, zukünftige Ideenhistoriker hätten es im Nachhinein erfinden müssen. Bis in kleinste Details spiegeln sich in diesem epochalen Ereignis die prägenden Kontraste der gesamten Dekade. Der jüdische Industriellenspross aus Berlin trifft auf den katholischen Küstersohn aus der badischen Provinz, hanseatische Contenance auf unverblümt-direkte Bäuerlichkeit. Cassirer(10) ist das Hotel. Heidegger(17) die Hütte. Unter gleißender Höhensonne treffen sie an einem Ort aufeinander, in dem die Welten, für die sie stehen, einander in unwirklicher Weise überblenden.
Die traumgleiche, insulare Atmosphäre eines Davoser Kurhotels war es ja auch, die Thomas Mann(1) zu seinem 1924 erschienenen Roman »Der Zauberberg« inspiriert hatte. Die Davoser Disputation von 1929 mochte den Teilnehmern deshalb gar als konkrete Umsetzung einer fiktionalen Vorlage erscheinen. Mit einer geradezu unheimlichen Passgenauigkeit fügten sich Cassirer(11) und Heidegger(18) in die ideologischen Schablonen eines Lodovico Settembrini und eines Leo Naphta, die Thomas Manns(2) Roman für die gesamte Epoche erstellt hatte.
Menschen fragen
Epochal lautete auch das von den Veranstaltern gewählte Thema der Davoser Zusammenkunft: »Was ist der Mensch?« Eine Frage, die bereits das Leitmotiv der Philosophie Immanuel Kants(3) bildete. Kants gesamtes kritisches Denken geht dabei von einer ebenso einfachen wie unabweisbaren Beobachtung aus: Der Mensch ist ein Wesen, das sich Fragen stellt, die er letztlich nicht beantworten kann. Diese Fragen betreffen insbesondere die Existenz Gottes, das Rätsel der menschlichen Freiheit und die Unsterblichkeit der Seele. In einer ersten kantischen Bestimmung ist der Mensch also ein metaphysisches Wesen.
Doch was folgt daraus? Für Kant(4) eröffnen diese metaphysischen Rätsel, gerade weil sie sich nicht abschließend beantworten lassen, dem Menschen einen Horizont möglicher Vervollkommnung. Sie leiten uns in dem Bestreben an, möglichst viel in Erfahrung zu bringen (Erkenntnis), möglichst frei und selbstbestimmt zu handeln (Ethik), sich einer immerhin möglichen Unsterblichkeit der Seele möglichst würdig zu erweisen (Religion). Kant spricht in diesem Zusammenhang von einer regulativen oder auch leitenden Funktion des metaphysischen Fragens.
Die Vorgaben des kantischen Projekts blieben bis in die zwanziger Jahre des 20. Jahrhunderts bestimmend für die deutschsprachige Philosophie – ja für die moderne Philosophie als Ganzes. Zu philosophieren, das bedeutete, nicht zuletzt für Cassirer(12) und Heidegger(19), in der Spur dieser Fragen zu denken. Und Gleiches galt auch für die bereits erwähnten, eher logisch orientierten Versuche Ludwig Wittgensteins, eine feste Grenze zu ziehen zwischen dem, wovon man als vernünftiger Mensch sprechen kann, und dem, worüber man schweigen muss. Wittgensteins Therapieversuch des »Tractatus« ging allerdings insofern entscheidend über Kant(5) hinaus, als er selbst noch den als grundmenschlich angenommenen Impuls, überhaupt metaphysische Fragen zu stellen – und also zu philosophieren –, mit den Mitteln der Philosophie für therapierbar zu halten schien. So heißt es im »Tractatus«:
6.5 Zu einer Antwort, die man nicht aussprechen kann, kann man auch die Frage nicht aussprechen.
Das Rätsel gibt es nicht.
Wenn sich eine Frage überhaupt stellen lässt, so kann sie auch beantwortet werden.
6.51 … Denn Zweifel kann nur bestehen, wo eine Frage besteht; eine Frage nur, wo eine Antwort besteht, und diese nur, wo etwas gesagt werden kann.
6.53 Die richtige Methode der Philosophie wäre eigentlich: Nichts zu sagen, als was sich sagen lässt, also Sätze der Naturwissenschaft – also etwas, was mit Philosophie nichts zu tun hat –, und dann immer, wenn ein anderer etwas Metaphysisches sagen wollte, ihm nachzuweisen, daß er gewissen Zeichen in seinen Sätzen keine Bedeutung gegeben hat. …
Die mit Wittgensteins Werk verbundene zeittypische Hoffnung, vom Geiste der Logik und der Naturwissenschaft geleitet metaphysische Fragen endlich hinter sich lassen zu können, beseelte auch zahlreiche Teilnehmer der Davoser Konferenz, so zum Beispiel den damals 38-jährigen Privatdozenten Rudolf Carnap(1), Autor von Werken mit solch programmatischen Titeln wie »Der logische Aufbau der Welt« oder auch »Scheinprobleme in der Philosophie« (beide 1928). Nach seiner Emigration in die USA im Jahre 1936 stieg Carnap zu einem der führenden Köpfe der sich auf Wittgensteins Wirken berufenden sogenannten »analytischen Philosophie« auf.
Ohne Fundament
Doch ganz gleichgültig, welcher Prägung oder Schule sich die Teilnehmer der Davoser Tagung zugehörig fühlten – Idealismus, Humanismus, Lebensphilosophie, Phänomenologie oder Logizismus –, in einem wesentlichen Punkt herrschte unter den anwesenden Philosophen Übereinstimmung: Das weltanschauliche und vor allem wissenschaftliche Fundament, auf dem Kant(6) einst sein beeindruckendes philosophisches System errichtet hatte, war ausgehöhlt oder zumindest stark reformbedürftig. Kants »Kritik der reinen Vernunft« basierte, nicht zuletzt in ihrem Verständnis der Anschauungsformen von Raum und Zeit, deutlich auf der Physik des 18. Jahrhunderts. Doch war das newton(1)sche Weltbild durch Einsteins(2) Relativitätstheorie (1905) revolutioniert worden. Weder können Raum und Zeit als voneinander unabhängig betrachtet werden, noch waren sie in benennbarem Sinne a priori, also vor aller Erfahrung gegeben. Bereits zuvor hatte Darwins(1) Evolutionstheorie der Idee einer dem zeitlichen Werden enthobenen, auf ewig vorgegebenen menschlichen Natur Entscheidendes an Plausibilität genommen. Mit der durch Darwin vollzogenen Aufwertung des Zufalls für die Entwicklung aller Arten auf dem Planeten – von Nietzsche(1) einflussreich auf den Bereich der Kultur übertragen – sah sich zudem die Aussicht auf einen zielgerichteten, gar vernunftgeleiteten Verlauf der Geschichte entscheidend geschwächt. Auch die vollkommene Transparenz des menschlichen Bewusstseins für sich selbst – als Ausgangspunkt von Kants transzendentaler Untersuchungsmethode – schien spätestens mit Sigmund Freud(1) nicht mehr selbstverständlich. Mehr als alles andere aber hatten die Greuel des anonymisierten, millionenfachen Tötens im Ersten Weltkrieg der aufklärerischen Rhetorik eines zivilisierenden Fortschritts der Menschheit durch die Mittel der Kultur, Wissenschaft und Technik jede Glaubwürdigkeit geraubt. Die Frage nach dem Menschen zeigte sich im Lichte der politischen und wirtschaftlichen Krisen dieser Dekade als drängender denn je. Allein die einstige Grundlage ihrer Beantwortung war endgültig fraglich geworden.
Der 1928 überraschend verstorbene Philosoph Max Scheler(1) – Autor des Werkes »Die Stellung des Menschen im Kosmos« (1928) – fasste dieses Krisengefühl in einem seiner letzten Vorträge folgendermaßen in Worte: »Wir sind in der ungefähr zehntausendjährigen Geschichte das erste Zeitalter, in dem sich der Mensch völlig und restlos problematisch geworden ist; in dem er nicht mehr weiß, was er ist, zugleich aber auch weiß, daß er es nicht weiß.«[10]
Das ist der Fragehorizont, vor dem Cassirer(13) und Heidegger(20) auf dem Gipfel von Davos zusammentreffen. Dieser Horizont hat beide Denker die vorangegangenen zehn Jahre zu ihren Hauptwerken inspiriert. Anstatt allerdings eine direkte und substantielle Antwort auf Kants(7) Frage »Was ist der Mensch?« zu versuchen – und darin besteht die jeweilige Originalität ihres Denkens –, konzentrieren sich Cassirer(14) und Heidegger(21) auf die stillschweigende Frage hinter der Frage.
Der Mensch ist ein Wesen, das sich Fragen stellen muss, die er nicht beantworten kann. Schön und gut. Aber welche Bedingungen müssen eigentlich gegeben sein, damit ein Wesen überhaupt in der Lage ist, sich diese Fragen zu stellen? Welches sind die Bedingungen der Möglichkeit dieses Fragens selbst? Worauf beruht die Fähigkeit des Hinterfragens von Fragen? Dieser Impuls? Die Antworten sprechen sich bereits im Titel ihrer Hauptwerke aus: Im Falle Cassirers(15) lautet er: »Philosophie der symbolischen Formen«. Im Falle Heideggers(22): »Sein und Zeit«.
Zwei Visionen
Nach Cassirer(16) ist der Mensch vor allem ein zeichenverwendendes und zeichenhervorbringendes Wesen – ein animal symbolicum. Er ist mit anderen Worten ein Wesen, das sich selbst und seiner Welt durch die Verwendung von Zeichen Sinn, Halt und Orientierung gibt. Das wichtigste Zeichensystem des Menschen ist dabei seine natürliche Muttersprache. Doch gibt es zahlreiche andere Zeichensysteme – in Cassirers Begrifflichkeit: symbolische Formen –, etwa die des Mythos, der Kunst, der Mathematik oder der Musik. Diese Symbolisierungen, seien es sprachliche, bildliche, akustische oder gestische Zeichen, verstehen sich in der Regel nicht von selbst. Vielmehr bedürfen sie ihrerseits der Interpretation durch andere Menschen. Der fortlaufende Prozess, in dem Zeichen in die Welt gesetzt und durch andere Menschen interpretiert und verändert werden, ist der Prozess der menschlichen Kultur. Erst diese Fähigkeit zur Zeichenverwendung ermöglicht es dem Menschen, metaphysische Fragen, ja überhaupt Fragen über sich und die Welt zu stellen. Kants(8) Kritik der reinen Vernunft wird für Cassirer(17) zum Projekt einer Untersuchung der symbolischen Formsysteme, mit denen wir uns und unserer Welt Sinn verleihen. Es wird damit zu einer Kritik der Kultur in ihrer ganzen, notwendig widersprüchlichen Breite und Vielfalt.
Auch Heidegger(23) betont die Wichtigkeit des Mediums der Sprache für das Dasein des Menschen. Aber die eigentliche Grundlage für dessen metaphysisches Wesen sieht er nicht in einem allgemein geteilten Zeichensystem, sondern in einem höchst individuellen Gefühl – und zwar der Angst. Genauer der Angst, die den Einzelnen erfasst, wenn er oder sie sich der Endlichkeit seiner Existenz voll bewusst wird. Das Wissen um die eigene Endlichkeit, das den Menschen als in die Welt »geworfenes Dasein« auszeichnet, wird diesem – vermittelt über die Angst – zum Auftrag, seine jeweils ganz eigenen Seinsmöglichkeiten zu ergreifen und zu erkennen. Heidegger(24) nennt dieses Ziel Eigentlichkeit. Die Seinsweise des Menschen zeichnet sich ferner durch ihre unhintergehbare Verwiesenheit auf die Zeit aus. Zum einen über die jeweilig einmalige historische Situation, in die sich eine Existenz ungefragt geworfen findet. Zum anderen über das Wissen dieser Existenz um ihre Endlichkeit.
Der von Cassirer(18) ausgewiesenen Sphäre der Kultur und des allgemeinen Zeichengebrauchs kommt nach Heideggers(25) Interpretation deshalb vor allem die Aufgabe zu, den Menschen von seiner Angst, von seiner Endlichkeit und damit dem Auftrag der Eigentlichkeit abzulenken, wohingegen die Rolle des Philosophierens gerade darin bestehe, den Menschen für die wahren Abgründe seiner Angst offen zu halten und ihn so im eigentlichen Sinne zu befreien.
Vor der Wahl
Es lässt sich erahnen, inwieweit Kants(9) alte Frage nach dem Menschen, je nachdem, ob dem cassirerschen oder dem heideggerschen Antwortversuch gefolgt wird, zu zwei vollkommen gegensätzlichen Idealen der kulturellen und auch politischen Entwicklung führt: Das Bekenntnis zur gleichberechtigten Humanität aller zeichenverwendenden Wesen steht gegen den elitären Mut zur Eigentlichkeit; die Hoffnung auf eine zivilisierende Zähmung tiefster Ängste gegen die Forderung, sich diesen Ängsten möglichst radikal auszusetzen; ein Bekenntnis zum Pluralismus der kulturellen Formen und Vielfalt gegen die Ahnung eines notwendigen Selbstverlustes in der Sphäre der viel zu vielen; moderierende Kontinuität gegen den Willen zum totalen Bruch und Neuanfang.
Als Cassirer(19) und Heidegger(26) am 26. März 1929 um zehn Uhr morgens aufeinandertreffen, können sie deshalb mit Recht beanspruchen, mit ihren jeweiligen Philosophien ganze Weltbilder zu verkörpern. Was in Davos auf dem Spiel stand, war also eine Entscheidung zwischen zwei fundamental voneinander abweichenden Visionen vom Entwicklungsgang des modernen Menschen. Visionen, deren widersprüchliche Anziehungskräfte unsere Kultur bis heute von innen heraus prägen und bestimmen.
Das Urteil der in Davos anwesenden Studenten und Jungforscher war zum Zeitpunkt der Davoser Disputation – zehn Tage in die Konferenz hinein – übrigens lange gefallen. Wie bei einem klassischen Generationenkonflikt zu erwarten, fällt es ganz zu Gunsten des jungen Heidegger(27) aus. Dies mag nicht zuletzt daran gelegen haben, dass Cassirer(20) – wie um die hoffnungslose Überkommenheit seines bürgerlichen Bildungsideals am eigenen Leib zu beweisen – für den Großteil der Tagung fiebernd im Hotelzimmer lag, während Heidegger(28) sich in jeder freien Minute seine Skier schnappte, um gemeinsam mit den jungen Wilden der Studentenschaft die schwarzen Pisten der Graubündner Alpen hinabzupreschen.
Wo ist Benjamin(1)?
In den Frühlingstagen des magischen Jahres 1929, als die Professoren Ernst Cassirer(21) und Martin Heidegger(29) zusammentreffen, um auf dem Gipfel von Davos die Zukunft des Menschseins zu entwerfen, quälen den freien Journalisten und Schriftsteller Walter Benjamin(2) in der großen Stadt Berlin ganz andere Sorgen. Benjamin(3) ist von seiner Geliebten, der lettischen Theaterregisseurin Asja Lacis(1), gerade aus dem frisch angemieteten Liebesnest in der Düsseldorfer Straße geworfen worden und sieht sich damit – wieder einmal – zur Rückkehr in sein nur wenige Kilometer entfernt liegendes Elternhaus in der Delbrückstraße gezwungen, wo neben seiner im Sterben liegenden Mutter auch Benjamins(4) Gattin Dora(1) sowie sein mittlerweile elfjähriger Sohn Stefan(1) auf ihn warten. Die Groteske ist an sich nichts Neues. Vielmehr ist das Muster aus liebestaumelndem Neuanfang, damit verbundenen finanziellen Überstürzungen sowie einem zügigen Ende der Liaison sämtlichen Beteiligten aus vorangegangenen Jahren bestens bekannt. In besonderer Weise verschärft zeigt sich die Situation in diesem Zeitraum allerdings dadurch, dass Benjamin(5) seine Frau Dora(2) nun von dem unwiderruflichen Entschluss in Kenntnis setzt, sich scheiden lassen zu wollen – und zwar mit dem Ziel, jene lettische Geliebte ehelichen zu können, die sich kurz zuvor von ihm getrennt hat.
Es hat seinen eigenen Reiz, sich Benjamin(6) als weiteren Teilnehmer der Davoser Hochschulgespräche vorzustellen. Etwa als Gesandten der »Frankfurter Zeitung« oder auch der »Literarischen Welt«, für die er regelmäßig als Rezensent tätig ist. Wir stellen ihn uns vor, wie er, als chronischer Eckensteher, im entferntesten Winkel des Ballsaals seinen schwarzen Block zückt (»Führe dein Notizheft so streng wie die Behörde das Fremdenregister«), sich die Nickelbrille mit den einmachglasdicken Linsen zurechtrückt und sodann mit winziger Spinnenschrift erste Beobachtungen festhält, sagen wir, zum Muster der Tapeten oder Polsterbezüge, um sodann, über eine kurze Kritik des heideggerschen Anzugschnitts, die grundsätzliche Geistesarmut eines Zeitalters zu beklagen, in dem Philosophen das »simple life« feiern und, wie insbesondere Heidegger(30), einen »Rustikalstil der Sprache« pflegen, der von der »Freude an den gewaltsamsten Archaismen« geprägt ist und sich so »der Quellen des Sprachlebens zu versichern glaubt«. Womöglich hätte er sich dann den Sesseln zugewandt, in denen es sich der »Etui-Mensch« Cassirer(22) später im Salon bequem machen würde, und dieses bourgeoise Möbel die ganze verstaubte Muffigkeit einer Philosophie repräsentieren lassen, deren bürgerlicher Biedersinn noch immer glaubt, die Vielheit der modernen Welt in das Korsett eines einheitlichen Systems zwingen zu können. Schon rein äußerlich wäre Benjamin(7) dabei als ein perfekter Hybrid aus Heidegger(31) und Cassirer(23) erschienen. Auch er zu plötzlichen Fieberschüben neigend, unsportlich bis zur Lächerlichkeit, doch trotz seines geringen Wuchses von einer Präsenz, Anziehungskraft und Weltgewandtheit, die unmittelbar Eindruck erzeugen.
Tatsächlich bilden die in Davos verhandelten Themen das Zentrum auch seines Schaffens: die Transformation der kantischen Philosophie vor dem Hintergrund eines neuen Zeitalters der Technik, das metaphysische Wesen der gewöhnlichen Sprache, die Krise der akademischen Philosophie, die innerliche Zerrissenheit des modernen Bewusstseins und Zeitempfindens, die zunehmende Warenförmigkeit des städtischen Daseins, die Suche nach Erlösung in Zeiten des totalen gesellschaftlichen Verfalls … Wer, wenn nicht Benjamin(8), hatte in den vorangegangenen Jahren zu diesen Themen publiziert? Warum hatte ihn niemand nach Davos entsandt? Oder noch schmerzhafter gefragt: Warum hatte ihn niemand als Redner eingeladen?
Die Antwort lautet: Aus akademisch-philosophischer Sicht ist Walter Benjamin(9) im Jahre 1929 eine ausgesprochene Non-Entität. Zwar hatte er sich zuvor immer wieder an zahlreichen Universitäten (in Bern, Heidelberg, Frankfurt, Köln, Göttingen, Hamburg, Jerusalem) um Einstiegsmöglichkeiten in eine professorale Laufbahn bemüht, war damit aber ein ums andere Mal kläglich gescheitert: teils an widrigen Umständen, teils an antisemitischen Vorurteilen, vor allem aber an seiner eigenen Unentschlossenheit.
1919, als er an der Universität Bern mit einer Arbeit über den »Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik« mit summa cum laude promoviert, scheinen ihm noch alle Türen offen zu stehen. Sein Doktorvater, der Germanist Richard Herbertz(1), stellt ihm einen bezahlten Lehrauftrag in Aussicht. Benjamin(10) zögert, überwirft sich zeitgleich mit seinem eigenen Vater, zerstört so sämtliche Perspektiven in der teuren Schweiz und entscheidet sich bald für eine Existenz als freier Kritiker. Dass es in den kommenden zehn Jahren von seiner Seite dennoch immer wieder zu universitären Etablierungsversuchen kommen sollte, war vor allem der sich verfestigenden Einsicht geschuldet, wie schwierig sich dieser Weg gestalten musste, wenn man so schrieb, lebte und nicht zuletzt konsumierte wie Benjamin(11). Es ist in diesen wilden Jahren einfach recht kostspielig, er zu sein. Das liegt nicht nur an seinen schwer bezähmbaren Vorlieben für Restaurants, Nachtclubs, Spielcasinos und Freudenhäuser, sondern auch an seiner ausgeprägten Sammelleidenschaft etwa für antiquarische Kinderbücher, die er in ganz Europa ausfindig macht und in nahezu zwanghafter Manier erwirbt.
Nach dem endgültigen Bruch mit dem Elternhaus war das Leben des nicht einmal schlecht beschäftigten Publizisten – der deutschsprachige Zeitungsmarkt und mit ihm die Feuilletonnachfrage explodierten in den zwanziger Jahren geradezu – deshalb von permanenten Geldsorgen geprägt. Und immer, wenn es wieder einmal besonders eng wird, schielt Benjamin(12) nach der Universität. Schließlich würde ein akademisches Amt der jungen, vielreisenden Familie neben einer finanziellen Grundsicherung auch existentiellen Halt gewähren, und damit genau jene zwei Dinge, die der innerlich tief zerrissene Denker ebenso sehr ersehnte wie fürchtete.
Besser scheitern
Ihren katastrophalen und mittlerweile legendär gewordenen Wendepunkt fanden Benjamins(13) akademische Ambitionen mit der gescheiterten Habilitation an der Universität Frankfurt im Jahre 1925. Eingefädelt von Benjamins(14) einzigem dortigen Fürsprecher, dem Soziologen Gottfried Salomon-Delatour(1) (einem der späteren Hauptorganisatoren der Davoser Hochschulgespräche), hatte Benjamin(15) eine Arbeit mit dem Titel »Der Ursprung des deutschen Trauerspiels« eingereicht. Sie strebte, auf den ersten Blick, eine Einordnung der Tradition des barocken Trauerspiels in den Kanon der deutschen Literatur an. Insbesondere aufgrund seiner »Erkenntniskritischen Vorrede« ist dieses Werk heute allgemein als ein Meilenstein der Philosophie und Literaturtheorie des 20. Jahrhunderts anerkannt. Damals allerdings kam es nicht einmal bis zur offiziellen Eröffnung des Verfahrens, hatten die von der Fakultät bestellten und mit der eigentlichen Wucht des Werks vollends überforderten Gutachter den Autor doch bereits nach einer ersten Durchsicht dringend gebeten, sein Gesuch freiwillig wieder zurückzuziehen. Ein Scheitern vor dem Prüfungsausschuss würde sonst unvermeidlich sein.
Doch selbst nach dieser ultimativen Demütigung kann Benjamin(16) nicht ganz von der Universität lassen. So sucht er noch im Winter des Jahres 1927/1928, vermittelt über seinen Freund und Förderer, den Schriftsteller Hugo von Hofmannsthal(1), Anschluss an den Hamburger Kreis der sogenannten Warburg(1)-Schule um Erwin Panofsky(1) und Ernst Cassirer(24). Auch dies im Ergebnis ein Fiasko. Panofskys Rückmeldung ist so negativ, dass sich Benjamin(17) gar ausdrücklich bei seinem Fürsprecher Hofmannsthal entschuldigen muss, ihn überhaupt in die Angelegenheit verstrickt zu haben. Unbedingt anzunehmen ist, dass auch Ernst Cassirer(25) über diesen Annäherungsversuch im Bilde war. Für Benjamin(18) besonders bitter, war er doch in den frühen Berliner Studientagen der Jahre 1912/1913 ein eifriger Zuhörer der Vorlesungen des damaligen Privatdozenten. Die Kreise sind eng, Fürsprecher alles, und Benjamin(19) gilt allgemein als hoffnungsloser Fall: zu eigenständig sein Ansatz, zu unkonventionell sein Stil, in den Brotwerken zu feuilletonistisch, in der Theorie bis zur Unentschlüsselbarkeit originell.
Tatsächlich verkörperte der Ballsaal von Davos, es wäre Benjamin(20) als Korrespondenten gewiss nicht entgangen, eine Art Ahnengalerie seiner sämtlichen akademischen Beschämungen – allen voran der von Benjamin(21) innig gehasste Martin Heidegger(32). In den Jahren 1913 und 1914 hatten beide in Freiburg noch gemeinsam bei dem Neukantianer Heinrich Rickert(1) (später Heideggers(33) Doktorvater) die Seminarbank gedrückt. Benjamin(22) verfolgte Heideggers(34) Aufstieg seither aufmerksam und durchaus neidvoll. Im Jahre 1929 plant er, mal wieder, die Gründung eines Magazins (Arbeitstitel: »Krise und Kritik«), dessen Mission, wie er seinem neuen besten Freund Bertolt Brecht(1) als geplantem Mitgründer der Zeitschrift anvertraut, in nichts anderem als der »Zertrümmerung Heideggers(35)« liegen sollte. Auch daraus aber wurde letztlich nichts. Ein weiterer Versuch, ein weiterer bereits im Ansatz gescheiterter Plan.
Mit gerade einmal 37 Lebensjahren kann Benjamin(23) bereits auf Dutzende davon zurückschauen. Denn in der vorangegangenen Dekade ist er als freischaffender Philosoph, Publizist und Kritiker vor allem eines gewesen: ein unerschöpflicher Quell gescheiterter Großprojekte. Ob Magazin- oder Verlagsgründungen, akademische Zweckschriften oder monumentale Übersetzungsaufgaben (die Gesamtwerke Prousts(1) und Baudelaires(1)), Kriminalromanserien oder ambitionierte Bühnenstücke … In der Regel bleibt es bei großspurigen Ankündigungen und Exposés. Die wenigsten Projekte erreichen auch nur das Stadium der Skizze oder des Fragments. Schließlich muss nebenher auch Geld verdient werden, was in erster Linie über das Tagesgeschäft von Glossen, Kolumnen und Rezensionen geschieht. Bis zum Frühjahr 1929 hat er mehrere Hundert davon in überregionalen Zeitungen veröffentlicht. Sein Themenspektrum reicht von jüdischer Zahlenmystik über »Lenin(1) als Briefeschreiber« bis hin zu Kinderspielzeug; Berichte von Nahrungsmittelmessen oder Kurzwaren fügen sich an großräumige Essays über den Surrealismus oder die Schlösser im Tal der Loire.
Warum auch nicht? Wer schreiben kann, kann nun einmal über alles schreiben. Vor allem dann, wenn die Herangehensweise des Autors darin besteht, den jeweils gewählten Gegenstand als eine Art Monade zu deuten, das heißt als etwas, an dessen Dasein sich nicht weniger als der gesamte Weltzustand der Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft aufweisen lässt. Genau darin bestehen Benjamins(24) eigentliche Methode und Magie. Seine Weltsicht ist eine tief symbolische: Jeder Mensch, jedes Kunstwerk, jeder noch so alltägliche Gegenstand ist ihm ein zu entschlüsselndes Zeichen. Und jedes dieser Zeichen steht in einer höchst dynamischen Verbindung mit allen anderen Zeichen. Womit die wahrheitsorientierte Deutung solch eines Zeichens für ihn auf nichts anderes hinausläuft, als dessen Eingebundenheit in das große, sich beständig verändernde Zeichenganze aufzuweisen und gedanklich durchzuspielen: Philosophie.
Braucht mein Leben ein Ziel?
Benjamins(25) idiotisch anmutende Themenstreuung folgt in Wahrheit also einer eigenen Erkenntnismethode. Eine weitere Verschärfung erfährt diese Herangehensweise durch seine wachsende Überzeugung, dass gerade die abwegigsten und damit in der Regel übergangenen Äußerungen, Gegenstände und Personen das eigentliche Mark des gesellschaftlichen Ganzen in sich tragen. Benjamins(26) bis heute gefeierte Denkbilder, etwa in seinen Werken »Einbahnstraße« (1928) oder »Berliner Kindheit um Neunzehnhundert«, sind deshalb ebenso deutlich von den Gedichten des Flaneurs Baudelaire(2) geprägt wie von der Vorliebe für Außenseiter der Romane Dostojewskis(1) oder Prousts(2) Kampf um die Erinnerung. Sie bezeugen einen romantischen Hang zum Vorläufigen und Labyrinthischen ebenso wie für die esoterischen Deutungstechniken der jüdischen Kabbala. Das alles wahlweise untermalt mit marxistischem Materialismus oder aber Idealismus der Naturphilosophien Fichtes(1) und Schellings(1). Benjamins(27) Texte erproben die Geburt eines neuen Erkenntnismodus aus dem Geiste einer zeittypischen ideologischen Desorientierung. So lesen sich die ersten Zeilen seines autobiographischen Werkes »Berliner Kindheit um Neunzehnhundert« (posthum veröffentlicht) wie eine spielerische Einführung in seine Methode:
Sich in einer Stadt nicht zurechtfinden heißt nicht viel. In einer Stadt sich aber zu verirren, wie man in einem Walde sich verirrt, braucht Schulung. Da müssen Straßennamen zu dem Irrenden so sprechen wie das Knacken trockner Reiser und kleine Straßen im Stadtinnern ihm die Tageszeiten so deutlich wie eine Bergmulde widerspiegeln. Diese Kunst habe ich spät erlernt; sie hat den Traum erfüllt, von dem die ersten Spuren Labyrinthe auf den Löschblättern meiner Hefte waren. …[11]
Gerade in der chronischen Unabgeschlossenheit, extremen Diversität und realitätssatten Widersprüchlichkeit seines Schreibens erkennt er den einzig noch verfügbaren Weg zu wahrer Welt- und damit auch Selbsterkenntnis. Um es in den verschlungenen Worten seiner »Erkenntniskritischen Vorrede« zum »Ursprung des deutschen Trauerspiels« zu sagen: Es muss dem Philosophierenden stets darum gehen, »aus den entlegenen Extremen, den scheinbaren Exzessen der Entwicklung die Konfiguration der Idee als der durch die Möglichkeit eines sinnvollen Nebeneinanders solcher Gegensätze gekennzeichneten Totalität« hervortreten zu lassen. Diese Darstellung einer Idee aber kann, so Benjamin(28), »unter keinen Umständen als geglückt betrachtet werden, solange virtuell der Kreis der in ihr möglichen Extreme nicht abgeschritten ist«.[12]
Das ist nun, ganz offenbar, weit mehr als nur eine eigenwillige Erkenntnistheorie. Es ist auch ein Existenzentwurf, der die kantische Urfrage »Was ist der Mensch?« direkt in die Frage »Wie soll ich leben?« umsetzt. Denn was für die philosophische Kunst der Darstellung einer Idee gilt, gilt für Benjamin(29) in gleicher Weise für die Kunst zu leben. Der freie, nach Erkenntnis dürstende Mensch hat sich mit jeder Faser »auf entlegene Extreme einzulassen« und kann sich in seiner Existenz »nicht als geglückt betrachten«, sollte er nicht alle möglichen Extreme abgeschritten oder wenigstens angetestet haben.
Benjamins(30) Erkenntnisweg, wie auch sein Existenzentwurf, bilden damit ein weiteres Extrem in eben jenem zeittypischen Spannungsverhältnis, das auch Wittgenstein(19), Cassirer(26) und Heidegger(36) in den zwanziger Jahren antreibt und befruchtet. Anstelle des Ideals eines logisch geklärten Aufbaus der Welt setzt seine Denkart aber auf die Erkundung widersprüchlicher Gleichzeitigkeit. Wo Cassirer(27) auf der Basis eines wissenschaftlich gefassten Symbolbegriffs die Einheit eines vielstimmigen Systems anstrebt, tritt bei Benjamin(31) der Wille zu kontrastreichen, ewig dynamischen Erkenntniskonstellationen. Und an die Position der heideggerschen Todesangst setzt er das Ideal eines den Augenblick feiernden Rausches und Exzesses als Moment der wahren Empfindung. Das Ganze untermalt er mit einer religiös aufgeladenen Geschichtsphilosophie, die sich für die Möglichkeit der Erlösung offen hält, ohne diesen Heilsmoment im vulgär-marxistischen Sinne eigens hervorbringen oder auch nur vorhersagen zu können.
Die Ein-Mann-Republik
In diesem angestrebten Einklang zwischen Handeln und Denken verlebt Benjamin(32) die zwanziger Jahre, geistig wie physisch beständig entlang der Achse Paris-Berlin-Moskau pendelnd, in der depressionsnahen Erwartung eines vollkommenen Zusammenbruches. Sein konsequenter Hang zur Selbstdestruktion – Dirnen, Casinos, Drogen – geht dabei im Verlauf weniger Monate, gar einzelner Tage mit Phasen immenser Produktivität und genialischen Ausbrüchen einher. Wie die Weimarer Republik selbst sucht Benjamin(33) keinen Ausgleich der Mitte. Für ihn liegt das aufzuspürende Wahre – auch seiner selbst – stets in den spannungsreichen Randbezirken des Daseins und Denkens.
Der Frühling des Jahres 1929 steht in diesem Sinne beispielhaft für eine Konstellation, die Benjamins(34) Leben die vorangegangenen zehn Jahre bestimmte.[13] Es ist wie immer, nur ein bisschen mehr: Er erfährt sich zerrissen zwischen mindestens zwei Frauen (Dora(3) und Asja), zwei Städten (Berlin und Moskau), zwei Berufungen (Journalist und Philosoph), zwei besten Freunden (dem Judaisten Gershom Scholem(1) und dem Kommunisten Bertolt Brecht(2)), zwei Großprojekten (Magazingründung und Beginn eines neuen Hauptwerks, dem späteren »Passagen-Werk«) sowie jeder Menge noch abzuarbeitender Vorschüsse. Wenn es einen Intellektuellen gibt, in dessen biographischer Situation sich die Spannungen des Zeitalters exemplarisch spiegeln, dann ist es Walter Benjamin(35) im Frühjahr 1929. Er ist ein Ein-Mann-Weimar. Das konnte also nicht gut gehen. Und tat es auch nicht. Schließlich reden wir hier von einem Menschen, der nach Eigenbekunden nicht einmal in der Lage war, sich »eine Tasse Tee zu kochen« (wofür er natürlich seiner Mutter die Schuld gab).
Benjamins(36) Entscheidung, den einzigen Menschen, auf den er bis dato unbedingt hatte zählen können, zu verleumden und zu verlassen, markiert den entscheidenden Wendepunkt in seiner Biographie. Wie die Betroffene übrigens weitaus klarer sieht als der Philosoph selbst. In großer Sorge wendet sich Dora(4) Benjamin(37) im Mai 1929 deshalb brieflich an den gemeinsamen Hausfreund Gershom (Gerhard) Scholem(2):
Mit Walter steht es sehr schlimm, lieber Gerhard, ich kann Dir nicht mehr sagen, denn es drückt mir das Herz ab. Er ist völlig unter Asjas Einfluss und begeht Dinge, die die Feder sich sträubt zu schreiben und die verhindern, daß ich in diesem Leben je wieder ein Wort mit ihm rede. Er besteht nur noch aus Kopf und Geschlecht, und Du weißt, oder kannst Dir denken, daß es in solchen Fällen nicht lange dauert, bis der Kopf unterliegt. Das war immer eine große Gefahr, und wer weiß, wie es wird … Walter hat – da die ersten Scheidungsverhandlungen daran scheiterten, daß er weder von seinem Erbe (120 000 Mark, Mama ist schwer krank) mir das geborgte Geld zurückgeben will, noch etwas für Stefan(2) bezahlen – mich wegen meiner Schuld verklagt … Ich gab ihm alle Bücher, tags darauf verlangte er auch die Kinderbuchsammlung; im Winter hat er monatelang bei mir ohne zu bezahlen gewohnt … Nachdem wir uns acht Jahre lang sämtliche Freiheit gegeben haben … verklagt er mich; jetzt sind ihm plötzlich die verachteten deutschen Gesetze gut genug.[14]
Dora(5) kannte ihren Pappenheimer. Nur fünf Monate später, fast zeitgleich mit dem Kurssturz des »Schwarzen Freitags« an der New Yorker Wall Street, kommt es bei Benjamin(38) im Spätherbst 1929 zum Zusammenbruch. Unfähig zu lesen, zu sprechen, geschweige denn zu schreiben, weist er sich in ein Sanatorium ein. Mit dem großen Crash hat die Menschheit die Schwelle zu einem neuen Zeitalter überschritten, so dunkel und todbringend, wie es sich bis dahin nicht einmal Walter Benjamin(39) hatte ausmalen können.
II. Sprünge
1919
Doktor Benjamin(40) flüchtet vor seinem Vater, Leutnant Wittgenstein(20) begeht finanziellen Selbstmord, Privatdozent Heidegger(37) fällt vom Glauben ab, und Monsieur Cassirer(28) arbeitet in der Elektrischen an seiner Erleuchtung
Was tun?
»Wäre einerseits der Charakter eines Menschen, d.h. also auch seine Art und Weise zu reagieren, in allen Einzelheiten bekannt und wäre andererseits das Weltgeschehen bekannt in den Bezirken, in denen es an jenen Charakter heranträte, so ließe sich genau sagen, was jenem Charakter sowohl widerfahren als von ihm vollzogen werden würde. Das heißt, sein Schicksal wäre bekannt.«[15] Stimmt das? Ist die Gestalt eines Lebenswegs wirklich in dieser Weise bedingt, determiniert, vorhersagbar? Also auch die eigene Biographie? Wie viel Spielraum bleibt einem Menschen, das eigene Leben zu gestalten? Mit diesen Fragen setzt sich der 27-jährige Walter Benjamin(41) im September des Jahres 1919 an einen Essay mit dem Titel »Schicksal und Charakter«. Wie bereits der erste Satz seines Texts vermuten lässt, erfolgt sein Bestreben, sich in dieser Zeit die Karten zu legen, stellvertretend für eine ganze Generation junger europäischer Intellektueller, die vor der Anforderung steht, nach dem Ende des großen Krieges die Grundlagen der eigenen Kultur und Existenz neu zu prüfen. Schreiben als Mittel der Selbsterhellung.
Im ersten Sommer nach dem Krieg befindet sich Benjamin(42) aber auch aus ganz persönlichen Gründen in einer Schwellensituation. Die wesentlichen Übergänge ins sogenannte Erwachsenenleben liegen hinter ihm. Er hat geheiratet (1917), ist Vater geworden (1918), und wurde Ende Juni 1919 zum Doktor der Philosophie promoviert. Soweit es den Ersten Weltkrieg betraf, war es ihm gelungen, die Schrecken des Weltenbrands nicht allzu nah an die eigene Existenz herantreten zu lassen. Seiner ersten Einberufung hatte er sich 1915 noch entzogen, indem er die Nacht vor der Musterung gemeinsam mit seinem besten Freund Gerhard Scholem(3) durchwachte und dabei unzählige Tassen Kaffee trank, so dass sein Puls am Morgen der Untersuchung ausreichende Unregelmäßigkeiten aufwies, um für untauglich erklärt zu werden. Ein damals gängiger Trick. Weitaus einfallsreicher und elaborierter gestaltete sich Benjamins(43) zweites Entziehungsmanöver im Jahre 1916. Denn hierzu ließ er sich – im Ergebnis extrem erfolgreich! – von seiner zukünftigen Frau Dora(6) mittels eines über mehrere Wochen dauernden Hypnoseverfahrens davon überzeugen, an schwerem Ischias zu leiden. Die Symptome waren gemäß militärmedizinischem Befund eindeutig. Auch wenn sie Benjamin(44) letztlich nicht vor dem Frontdienst bewahrt hätten, führten sie wenigstens zu der offiziellen Erlaubnis, das komplex gelagerte Leiden in einer Spezialklinik in der Schweiz genauer untersuchen zu lassen. Und einmal in der Schweiz, war man fürderhin vor dem Zwangseinzug sicher, sofern man dort blieb, wozu sich Dora(7) und Walter im Herbst 1917 entschieden.
Seine Zuflucht
Zuerst nimmt man in Zürich Quartier, das in den Kriegsjahren zu einer Art Sammelbecken der jungen deutschen, ja gesamteuropäischen Intelligenzija wird. So rufen etwa Hugo Ball(1) und Tristan Tzara(1) 1916 dort den Dadaismus aus. Nur wenige Meter entfernt vom »Cabaret Voltaire« logiert derweil ein gewisser Wladimir Iljitsch Uljanow(2) und plant unter dem Pseudonym Lenin(3) die russische Revolution. Ohne näheren Anschluss an diese Kreise zu finden oder auch nur zu suchen, zieht das junge, frisch verheiratete Paar – begleitet von dem gemeinsamen Hausfreund Scholem(4) – bald weiter nach Bern in die Zentralschweiz, wo Walter sich an der dortigen Universität mit dem Ziele der Promotion im Fach Philosophie einschreibt.
Die beiden – besser gesagt die drei – Berliner Exilanten leben weitgehend isoliert vom kulturellen Leben dieser bis heute für ihre Langsamkeit berühmten Stadt. Benjamins(45) und Scholems(5) Verhältnis zum Niveau der dortigen Lehrveranstaltungen ist von Geringschätzung geprägt. In ihrer gefühlten Unterforderung erfinden sie nicht nur eine Phantasie-Universität namens »Muri« und konzipieren absurde Kursangebote wie etwa »Das Osterei – Seine Vorzüge und seine Gefahren« (Theologie), »Theorie und Praxis der Beleidigung« (Jurisprudenz) oder eine »Theorie des freien Falls mit Übungen im Anschluss« (Philosophie).[16] Sie nutzen die Berner Zeit auch für gemeinsame Privatlektüren und -studien, etwa der Werke des Neukantianers Hermann Cohen(1), die sie in langen Nachtsitzungen Satz für Satz durchgehen.[17]
Es war eine Lebenssituation, deren grundlegende Unbestimmtheit und nicht zuletzt erotische Ambivalenz Benjamins(46) Charakter durchaus entgegenkam. Spätestens mit der Geburt des Sohnes Stefan(3) im April 1918 steigert er seine Produktivität enorm und stellt in weniger als einem Jahr die Doktorarbeit fertig. Das absehbare Kriegsende führt auf die Notwendigkeit, sich für die Zeit danach auch beruflich konkreter zu orientieren. Nicht zuletzt bedrängt Benjamins(47) Vater – dessen Vermögensverhältnisse durch den Krieg stark gelitten haben – den Sohn, sich endlich auf eigene Füße zu stellen.
Kritische Tage
Als die junge Familie sich für den Sommer des Jahres 1919 zur Erholung an eine Pension am Brienzersee zurückzieht, liegen arbeitsintensive Monate hinter ihr. »Dora(8) und ich sind ganz am Ende unserer Kräfte«, schreibt Benjamin(48) an Scholem(6) am 8. Juli 1919, was nicht zuletzt mit dem Gesundheitszustand des kleinen Stefan(4) zu tun hat, der schon über Monate »dauernd fiebert«, so dass man »garnicht zur Ruhe kommt«.[18] Insbesondere Dora(9) leidet unter den »schwersten monatelang gehäuften Anstrengungen«, mit »Blutarmut und schlimme[r] Gewichtsabnahme« als Folge. Benjamin(49) selbst hat derweil noch immer – und durchaus schmerzhaft – mit den Folgen seines hypnotisch beigefügten Ischias-Leidens zu kämpfen, zudem ist er, berichtet er dem Hausfreund, »im Verlauf der letzten sechs Monate lärmkrank geworden«. Nah am Burnout, würde man heute wohl sagen.
Die Familie hat ihren Sommerurlaub in der Pension mit dem schönen Namen »Mon repos« also bitter nötig. Mit Seeblick, Vollpension und eigens mitgereistem Kindermädchen – ja, die Lage mochte zwar ernst sein, finanziell hoffnungslos war sie im eigentlichen Sinne jedoch nicht –, wollte man dort gut essen, viel schlafen, ein bisschen Lesen, Walter womöglich dann und wann ein Gedicht des geliebten Baudelaire(3) ins Deutsche übertragen. Es hätte alles so schön sein können.
Doch wie bei Benjamins(50) Plänen üblich, wurde daraus nichts. Was nicht zuletzt an Walter selbst lag. Um nämlich die finanziellen Zuwendungen des Vaters nicht zu gefährden, hatte er es für klüger befunden, die Familie im heimischen Berlin erst einmal nicht von seinem erfolgreich abgelegten Doktorexamen zu unterrichten.
Vater Benjamin(51) traut seinem Sprössling indes nicht recht über den Weg und entschließt sich deshalb gemeinsam mit seiner Gattin zu einem Überraschungsbesuch in der Schweiz. Das Eintreffen der Eltern am Urlaubsort lässt sich präzis auf den 31. Juli 1919 datieren.
Wer nun die Gestalt der beteiligten Charaktere kannte, sowie die konkreten Umstände, in denen sie dort aufeinandertrafen, braucht nicht eigens eine Weltformel, um den Verlauf des Treffens zwischen Vater und Sohn zu prognostizieren. Benjamin(52) schreibt Scholem(7) am 14. August 1919 von »schlimmen Tagen, die jetzt hinter uns liegen«, und fügt kurz darauf kleinlaut hinzu: »Die Bekanntgabe meines Doktors ist gestattet.«
Der Vater ist nun also im Bilde und besteht ultimativ darauf, der Sohn möge sich in dieser mehr als unsicheren Zeit schnellstmöglich eine anständige, gerne feste, vor allem aber bezahlte Arbeit suchen. Für Benjamin(53) keine so leichte Sache, denn auf die drängende Frage, was er fortan mit seinem Leben anzufangen gedenke, kann er wahrheitsgemäß eigentlich nur eines antworten: Kritiker, Vater. Ich will Kritiker sein.
Was diese Selbstbeschreibung konkret bedeuten und beinhalten muss, genau darüber hat er seine Doktorarbeit geschrieben. Ein 300 Seiten starkes Werk mit dem Titel »Der Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik«[19]. Es wird Walter Benjamin(54) in den frühen Augusttagen des Jahres 1919 nicht leicht gefallen sein, seinem philosophisch weithin unbeleckten und zudem chronisch depressiven Kaufmannsvater zu erklären, was es mit diesem Begriff der Kritik auf sich hatte – was er für die eigene Kultur und das eigene Selbst bedeuten und nicht zuletzt, inwiefern es sich dabei um eine durchaus lohnende Tätigkeit handeln mochte.
Doch mindestens einen Versuch würde es wert sein. Zumal sich hinter dem spröden Titel dieser akademischen Zweckschrift ein höchst eigenständiges Anliegen verbarg, die Idee einer fundamentalen Offenheit der eigenen Selbstwerdung sowie des Werdens der gesamten Kultur auf ein neues theoretisches Fundament zu stellen. Die zentrale Aktivität, die diese Offenheit ermöglicht und aufs ewig Neue hervorbringt, nennt Benjamin(55) in seiner Doktorarbeit schlicht: Kritik. Er ist überzeugt, in den Kant(10) nachfolgenden Werken von Fichte(2), Novalis(1) und Schelling(2) werde eine spezifische Form geistiger Aktivität angedacht, deren eigentliche Relevanz für das eigene Leben und die eigene Kultur bisher unentdeckt geblieben war.
Romantische Thesen
Der entscheidende Impuls dieser frühromantischen Denker liegt für Benjamin(56) darin, dass die Aktivität der Kritik – versteht man sie richtig – weder das kritisierende Subjekt (also den Kunstkritiker) noch das kritisierte Objekt (also das Kunstwerk) in seinem Wesen unverändert lässt. Beide erfahren im Prozess der Kritik eine Transformation – und zwar im Idealfall auf Wahrheit hin. Diese These von der beständigen Wesensbereicherung des Kunstwerks durch die Aktivität des Kritikers beruht nach Benjamin(57) auf zwei grundlegenden Gedankenfiguren der deutschen Romantik. Sie lauten:
1. Alles, was ist, steht nicht nur in einer dynamischen Beziehung zu anderen Dingen, sondern auch zu sich selbst (These vom Selbstbezug aller Dinge).
2. Wenn ein Subjekt ein Objekt kritisiert, aktiviert und mobilisiert es damit in beiden beteiligten Einheiten sowohl deren Fremd- als auch Selbstbezüge (These von der Aktivierung sämtlicher Bezüge durch Kritik).
Aus diesen Setzungen leitet Benjamin(58) in seiner Dissertation Folgerungen ab, die zunächst sein eigenes Selbstbild als Kritiker, in der Folge aber auch das Selbstverständnis der Kunstkritik im 20. und 21. Jahrhundert revolutionieren. Allen voran gilt das für die These, dass die Funktion der Kunstkritik »nicht (in der) Beurteilung, sondern einerseits Vollendung, Ergänzung, Systematisierung« besteht.[20] Womit dem Kunstkritiker, zweitens, fortan selbst der Status eines Teilschöpfers des Kunstwerks zukommt. Drittens bedingt es dieses Kritikverständnis, dass ein Kunstwerk in seinem Wesen nie stabil ist, sondern sich sein Sein und seine mögliche Bedeutung im Verlauf der Geschichte ändert und dynamisiert. Viertens schließlich ist jede Kritik an einem Kunstwerk – das folgt aus der These vom Selbstbezug aller Dinge – auch als Kritik des Kunstwerks an sich selbst zu betrachten.
Kritiker und Künstler stehen also, recht verstanden, auf einer schöpferischen Stufe. Das Wesen eines Werks liegt nicht fest, sondern verändert sich ständig. Ja, in Wahrheit sind es die Kunstwerke selbst, die sich beständig kritisieren.
Man glaubt sich vorstellen zu können, welchen Grad der Verstörung und auch des Unverständnisses Benjamins(59) Thesen bei einem Menschen wie seinem Vater auslösen mussten.
Neues Selbstbewusstsein
Tatsächlich hängt die Plausibilität von Benjamins(60)