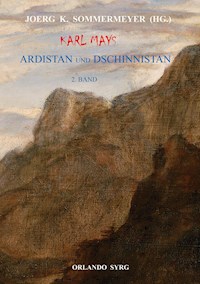
9,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Orlando Syrg Taschenbuch: ORSYTA
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Nach den fünf Kapiteln (Eine Mission, Der Panther, In Ussula, Der Dschirbani, Auf, zum Kampf) des 1. Bandes »Ardistan« (Ardistan und Dschinnistan I, OrSyTa 22020, KAR 8, Orlando Syrg, Berlin und Lahnstein 2020) bringt dieser 2. Band die Fortsetzung »Der Mir von Dschinnistan«, acht weitere Kapitel: Mit der Natur im Bunde, In der Höhle des Löwen, Weihnacht, Nach der Stadt der Toten, Wieder frei, Gegenzüge, Die Schlacht am Dschebel Allah, Nach der Grenze empor. Kara Ben Nemsi und Hadschi Halef Omar halten den diktatorischen, grausamen Mir von Ardistan von der Verwirklichung seiner Kriegspläne gegen den Mir von Dschinnistan ab. Sie helfen ihm, als er von Rebellen ermordet werden soll. Läuterung des Mir in der Stadt der Toten. Entscheidungskampf vor Dschinnistan. Weg ins Reich der Edelmenschen. Karl Mays Letzte Worte: »Das Märchen von Sitara« und »Meine Werke« beleuchten sein Spätwerk. Die ebenfalls zum Spätwerk gehörende, inhaltlich mit »Ardistan und Dschinnistan« verbundene Reiseerzählung »Merhameh« sowie ein Nachwort des Herausgebers (S. 297 ff.) runden den 2. Band und die Gesamtedition ab.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 942
Ähnliche
Über dieses Buch
Nach den fünf Kapiteln (Eine Mission, Der ,Panther’, In Ussula, Der Dschirbani, Auf, zum Kampf) des 1. Bandes »Ardistan« (Ardistan und Dschinnistan I, OrSyTa 22020 / KAR 8, Orlando Syrg, Berlin und Lahnstein 2020) bringt dieser 2. Band die Fortsetzung »Der Mir von Dschinnistan«, acht weitere Kapitel: Mit der Natur im Bunde, In der Höhle des Löwen, Weihnacht, Nach der ,Stadt der Toten’, Wieder frei, Gegenzüge, Die Schlacht am Dschebel Allah, Nach der Grenze empor. Kara Ben Nemsi und Hadschi Halef Omar halten den diktatorischen, grausamen Mir von Ardistan von der Verwirklichung seiner Kriegspläne gegen den Mir von Dschinnistan ab. Sie helfen ihm, als er von Rebellen ermordet werden soll. Läuterung des Mir in der Stadt der Toten. Entscheidungskampf vor Dschinnistan. Weg ins Reich der Edelmenschen.
Karl Mays ,Letzte Worte’: »Das Märchen von Sitara« und »Meine Werke« beleuchten sein Spätwerk. Die ebenfalls zum Spätwerk gehörende, inhaltlich mit »Ardistan und Dschinnistan« verbundene Reiseerzählung »Merhameh« sowie ein Nachwort des Herausgebers (S. 297 ff.) runden den 2. Band und die Gesamtedition ab.
Der Autor
Karl May, geb. am 25. Februar 1842 als fünftes Kind des Webers Heinrich May und dessen Ehefrau Wilhelmine im sächsischen Hohenstein-Ernstthal. Bitterarme Kindheit und Jugend. Ausbildung zum Volksschullehrer. Konflikte mit dem Gesetz, Gefängnisaufenthalte. Triviale Kolportageromane. Bestsellerautor. In Nordamerika, dem Orient und Mexiko spielende abenteuerliche Reiseerzählungen. Volksschriftsteller. Bekannt und beliebt seine Helden Old Shatterhand, Winnetou, Kara Ben Nemsi und Hadschi Halef Omar. Prozesse wegen Anschuldigungen, er sei ein »Geborener Verbrecher«, »Verderber der Jugend«, seine Werke »Schund« und enthielten »Plagiate«. Im anerkannten Alterswerk zugleich allegorisch chiffrierte Menschheitsfragen. Leidenschaftlicher Pazifist: »Wie man den Krieg führt, das weiß jedermann; wie man den Frieden führt, das weiß kein Mensch. Ihr habt stehende Heere für den Krieg, die jährlich viele Milliarden kosten. Wo habt ihr eure stehenden Heere für den Frieden, die keinen einzigen Para kosten, sondern Milliarden einbringen würden?« (Ardistan und Dschinnistan I, OrSyTa 22020 / KAR 8, Orlando Syrg, Berlin und Lahnstein 2020, S. 16) Am 30. März 1912 stirbt May in Radebeul bei Dresden. [Detaillierter Lebenslauf siehe Joerg K. Sommermeyer, Nachwort, S. 297 ff]
Der Herausgeber
Joerg K. Sommermeyer (JS), geb. 14.10.1947 in Brackenheim, Sohn des Physikers Prof. Dr. Kurt Hans Sommermeyer (1906-1969). Kindheit in Freiburg. Studierte Jura, Philosophie, Germanistik, Geschichte und Musikwissenschaft. Klassische Gitarre bei Viktor v. Hasselmann und Anton Stingl. Unterrichtete in den späten Sechzigern Gitarre am Kindergärtnerinnen-/Jugendleiterinnenseminar und in den Achtzigern Rechtsanwaltsgehilfinnen in spe an der Max-Weber-Schule in Freiburg. 1976 bis 2004 Rechtsanwalt in Freiburg. Setzte sich für eine Verstärkung des Rechtsschutzes bei Grundrechtseingriffen ein (Unterbringungsrecht, Untersuchungshaft, Durchsuchungsrecht). Zahlreiche Veröffentlichungen in juristischen Fachzeitschriften sowie Artikel in Musikblättern. Gründer und Vorsitzender der Internationalen Gitarristischen Vereinigung, Organisator und Künstlerischer Leiter der Freiburger Gitarren- und Lautentage, Herausgeber und Redakteur der Zeitschrift Nova Giulianiad: Saitenblätter für die Gitarre und Laute. Juror beim Schlesischen Gitarrenherbst in Tychy und Internationalen Gitarrenkongress Freiburg/Basel/ Straßburg. Songs, Liedtexte, Arrangements, Instrumentalmusik. 7 CDs, u. a.: Total Overdrive, Those Rocks & Lieders, Nel Cuore Romanzo Rock, Ergo, 7 Celebrities. Prosa: Anton Unbekannt, Pathoaphysischer Antiroman, Tragigroteskenfragment, 2008/2009; Vernimm mein Schreien, 2017/2018. Lieblingsmärchen, 2017/2018. Edition von Werken u. a. Franz Trellers, Oskar Panizzas, Fritz von Ostinis, Hugo Balls, Carl Einsteins, Ludwig Rubiners, Franz Kafkas, Heinrich von Kleists, Christian Morgensterns, Robert Müllers, Joseph von Eichendorffs, Adelbert von Chamissos, Georg Büchners, Denis Diderots, Wilhelm Heinrich Wackenroders, E. T. A. Hoffmanns, Heinrich Heines, Rainer Maria Rilkes, Annette von Droste-Hülshoffs, Jeremias Gotthelfs, Marie von Ebner-Eschenbachs, Eduard von Keyserlings und August Stramms.
Orlando Syrg, Berlin, 14. November 2020
Inhalt
Über dieses Buch
Der Autor
Der Herausgeber
Ardistan und Dschinnistan II
Der Mir von Dschinnistan
Erstes Kapitel:
Mit der Natur im Bunde
Zweites Kapitel:
In der Höhle des Löwen
Drittes Kapitel:
Weihnacht
Viertes Kapitel:
Nach der »Stadt der Toten«
Fünftes Kapitel:
Wieder frei
Sechstes Kapitel:
Gegenzüge
Siebentes Kapitel:
Die Schlacht am Dschebel Allah
Achtes Kapitel:
Nach der Grenze empor
Letzte Worte von Karl May
Das Märchen von Sitara
Meine Werke
Anhang
Merhameh
(Reiseerzählung)
Nachwort des Herausgebers Joerg K. Sommermeyer
Karl May,
1907 (Photographie von Erwin Raupp, 1863-1931)
Karl May
Ardistan und Dschinnistan II
Der Mir von Dschinnistan
[Friedrich Ernst Fehsenfeid, Freiburg im Breisgau 1909]
Erstes Kapitel: Mit der Natur im Bunde
Als wir die Offiziere der Dschunub überholt hatten, befanden wir uns bereits im geologischen Gebiet der Landenge. Der Sand wechselte mit festem Gestein. Felsenstücke lagen zerstreut umher. Es bildeten sich Bodenerhebungen, die erst nur leise begannen, dann aber um so kräftiger wurden, je weiter wir kamen. Und da sahen wir Halef weit draußen am Horizont, zunächst nur als kleinen Punkt, doch kamen wir ihm so rasch näher, dass wir sehr bald Reiter und Pferd voneinander unterscheiden konnten. Er ritt nicht mehr Galopp, sondern Trab. Darum zügelten wir unseren rasenden Lauf, zumal Halef anhielt, um auf uns zu warten, als er uns kommen sah. Er lachte mit dem ganzen Gesicht.
»Ist er auf den Dicken gestiegen?« fragte er uns schon von weitem entgegen.
»Ja«, antwortete ich.
»So sei Allah ihm barmherzig und gnädig! Was es heißt, auf diesem Ungetüm zu sitzen, das können nur meine Knochen und Knöchelchen schildern; leider aber bin ich es allein, der ihre Sprache empfindet. Wie kommst du zu diesen Menschen? Was wollen sie? Warum nahmen sie dich gefangen? Oder vielmehr, warum gingst du darauf ein, als Gefangener zu gelten?«
»Davon später, lieber Halef. Vor allen Dingen muss ich wissen, wie du auf den Gedanken gekommen bist, uns entgegenzureiten, und zwar auf Smihk, der doch in der Hauptstadt zu sein hat, aber nicht hier!« »Er hat da zu sein, wo sich sein Herr befindet!«
»Ganz recht! Ich habe mir auch, sobald ich ihn sah, sofort gesagt, dass Scheik Amihn uns nachgekommen ist.« »Nicht nur er, sondern auch Taldscha, seine Frau!«
»Auch sie? Was ist geschehen?«
»Etwas außerordentlich Wichtiges. Du sollst es sofort hören!«
Dieses »Sofort« war bei ihm niemals wörtlich zu nehmen. Er pflegte Dinge, die er für wichtig hielt, stets so ausführlich wie möglich zu behandeln. Darum machte er, während wir weiterritten, eine kleine Kunstpause, um unsere Spannung zu erhöhen, und begann dann an einem Punkte, der scheinbar gar nicht zur Sache gehörte: »Sihdi, weißt du, dass Ardistan zwar bis an das Meer reicht, aber ohne Häfen und darum auch ohne Schifffahrt ist?«
»Ja. Nur zuweilen kommt ein kühner Indochinese oder Sundamalaie auf leicht gebautem Segler zu der unwirtlichen Küste von Ardistan, um bei den wenigen Menschen, die da wohnen, Waren einzutauschen.«
»Ganz recht, Effendi! Und mit so einem Malaien ist der Diener gekommen.«
»Welcher Diener?«
»Welcher? Ah, richtig! Das weißt du ja noch nicht! Also, der Mir von Ardistan hat jetzt endlich dem Mir von Dschinnistan den Krieg erklärt, offen, gerade heraus oder wie nennt man das in eurem Abendlande?« »Amtlich, offiziell.« »Ja, so ist es richtig: amtlich, offiziell. Dass die beiden Söhne des Scheiks der Ussul zur Leibwache des Mir von Ardistan gehören, ist dir bekannt?« »Ja. Doch glaube ich, dass sie trotz dieser Stellung nur Bewachte, nicht aber Wächter sind. Ich halte sie nicht für Kommandierende, sondern für Geiseln, durch welche sich der Mir Gehorsam erzwingen will.«
»Diese Vermutung scheint sich zu bewahrheiten. Denn die beiden Söhne des Scheiks sind ganz plötzlich verschwunden. Der Mir hat verlangt, dass ihm der Scheik tausend Ussulkrieger sende, um ihm gegen Dschinnistan beizustehen. Da haben die Söhne sich geweigert, dies ihrem Vater zuzumuten. Sie haben erklärt, dass die Ussul nicht den geringsten Grund haben, den Mir von Dschinnistan zu bekämpfen. Hierauf sind sie mitten in der Nacht, als alles schlief, ergriffen und mit einem ihrer Diener, der sich bei ihnen befand, heimlich fortgeschafft worden. Wohin, das hat man ihnen nicht gesagt. Der Diener aber behauptet, wahrscheinlich nach der Todesstadt, denn sie sei der schon von alters her gebräuchliche Ort, missliebig gewordene hohe Personen verschwinden zu lassen. Sie wurden auf Pferde gebunden. Der Ritt dauerte lang. Am zweiten Abend gelang es dem Diener, zu entwischen. Er entkam nach der Küste und wurde dort von einem malaiischen Schiffer aufgenommen, der ihn gegen das Versprechen einer guten Belohnung quer über die Bai und dann den Fluss hinauf fast bis nach Ussula brachte. Er kam zur Stadt, gerade als der Dschirbani mit seinen Hukara von dort abgezogen war. Die Ältesten wurden schnell zur Beratung zusammengerufen, und man beschloss, dem Dschirbani rasch zu folgen, um mit dir und ihm das Nötige zu besprechen. Die Angst hat den Eltern Flügel verliehen. Sie kamen heut früh hier an.«
»Und der Dschirbani?« »Schon gestern Abend.«
»Aber nicht mit allen seinen Hukara! Das ist nicht möglich!«
»Nein, nur mit einigen. Die übrigen kamen dann während der Nacht, in der Reihenfolge der Leistung ihrer Pferde. Er hat sich keinen Schlaf gegönnt, sondern sofort alle Vorbereitungen getroffen, denen du gewiss gern zustimmen wirst. Es wurden von dem Engpass bis nach der Hauptstadt Zwischenstationen eingerichtet und bis zum Flusse Wasserposten gestellt, die erst die geleerten und dann die wiedergefüllten Schläuche einander zu reichen haben. Ich habe ihn auch schon zum Brunnen des Engels geführt, über dessen Wert er von sehr hoher Meinung ist. Er hat die Strecke vom Felsenloch bis zum Felsentor genau untersucht
»Auch den verborgenen Weg?« unterbrach ich ihn.
»Ja, auch den. Und er sagte, dass es keine bessere Falle geben könne als diese. Seine Hukara sind auch schon ganz genau so aufgestellt und unterwiesen, als ob die Feinde augenblicklich zu erwarten seien. Ich glaube nicht, dass du noch irgendetwas hinzuzufügen hast. Du wirst zufrieden sein.« »Wie steht es mit dem Palang und seinen beiden Gefährten?«
»Die stecken in einer Felsenenge gefangen, aus der sie nicht entkommen können, und werden von meinem Hu bewacht.«
»Und der oberste Minister und der oberste Geistliche von Dschunubistan?«
»Die stecken in einer anderen Felsenspalte, aus der sie nicht herauskönnen, und werden von Hi bewacht.« »Also auch gefangen?«
»Natürlich! Sie waren unterwegs dem Dschirbani begegnet und von ihm veranlasst worden, mit ihm umzukehren, da er derjenige sei, der über ihre Wünsche zu bestimmen habe. Er hatte an ihre Ehrlichkeit geglaubt und sie darum ihrem hohen Range gemäß behandelt. Sobald er aber dann von mir erfuhr, was eigentlich ihre Absicht sei, wurden sie ebenso eingesperrt wie die drei Tschoban.«
»Haben die Tschoban und die Dschunub einander gesehen?« »Ja. Es ist nicht zu vermeiden gewesen.« »Nun, und warum kamst du uns jetzt entgegengeritten? War das der Wille des Dschirbani?« »Nein; der wünschte es nicht. Aber der Scheik und die Scheikin trieben mich; sie haben Angst um ihre Söhne, und sie glauben, sich mehr auf dich als auf den Dschirbani verlassen zu können. Sie sind ungeduldig zunächst auf deinen Rat. Darum forderten sie « mich auf, dir mit der Bitte entgegenzureiten, dich zu beeilen. Und als der Dschirbani meinte, dass dies überflüssig, unter Umständen sogar gefährlich sei, veranlassten sie mich, es ohne sein Wissen zu tun. Ich konnte nicht widerstehen und hätte gern ein Pferd der Tschoban oder der Dschunub genommen; das hätte mich aber dem Dschirbani verraten, und so war ich denn gezwungen, auf Smihk, den Dicken, zu klettern und heimlich fortzureiten. Und der war gescheiter als ich. Ich wollte nach Nordost; er aber ging mit mir durch und rannte nach Nordwest; da, Sihdi, traf ich dich!«
Wir waren während dieses Berichtes so weit gekommen, dass wir jetzt die See erblickten und den Felsenzug des Engpasses vor uns liegen sahen. Ich erzählte Halef, was wir unterwegs erlebt und erfahren hatten. Dann war die Landenge erreicht; das Meer erschien auch auf der andern Seite, und in einiger Entfernung stieg gerade vor uns das Felsentor empor. Noch eine Strecke weiterhin trat der erste Posten der Ussul, um sich uns zu zeigen, hinter Steinen hervor, die ihn verborgen hatten. Dieser Posten bestand aus Irahd, dem bekannten Anführer, und acht seiner Leute. Er hatte diesen wichtigen Posten selbst übernommen, um gewiss zu sein, dass nichts Fehlerhaftes geschehe. Und eben, als wir mit ihm sprachen, kam der Dschirbani mit vielleicht einem Dutzend seiner Hukara geritten, um diesen Teil des Kampfplatzes zu besichtigen. Es war ein lieber, warmer, aufrichtiger Händedruck, mit dem er mich begrüßte; vor Abd el Fadl aber verbeugte er sich tief und feierlich, wie vor einer Person vom höchsten Stande. Das fiel mir auf. Einige kurze Fragen und Antworten genügten für ihn und mich, uns gegenseitig das Nötigste mitzuteilen; dann bat er mich, mir die Aufstellung seiner Truppen zeigen zu dürfen. Ich willigte ein, obgleich es mir Spaß gemacht hätte, bei der Gefangennahme der Dschunuboffiziere, die nun bald erscheinen mussten, zugegen sein zu können. Ich belehrte Irahd, wie das zu machen sei, und Halef versicherte mir mit sehr unternehmendem Lächeln, dass ich da ganz unbesorgt sein könne, weil er selbst hierbleiben werde, um für einen festlichen Empfang dieser Herren einzutreten.
Der Dschirbani ließ seine Begleiter hier, um bei der Gefangennahme der Dschunub behilflich zu sein. Er ritt den edlen Schimmel des Maha-Lama, der ein so schnelles Pferd war, dass wir unsere Besichtigung beträchtlich verkürzen konnten. Ich war nämlich überzeugt, dass der ältere Prinz der Tschoban sich beeilen werde, noch vor Nacht auf der Landenge einzutreffen, und wollte unbedingt dabei sein, wenn er festgenommen wurde. Da galt es also, keine Zeit zu verlieren.
Wir ritten zunächst zu dem Felsentor, wo ich Merhameh begrüßte. Hier stand ein Posten von dreißig Mann, die sich aber bei der Annäherung der Feinde zurückzuziehen hatten. Von da ging es zum Felsenloch, wo wir auf einen gleichgroßen Posten trafen. Hier war die Stelle, an welcher der erste Stoß der Tschoban ausgehalten und zurückgewiesen werden musste; für jetzt aber genügte diese schwache Zahl. Das Gros der Hukara lag noch weiter zurück, nämlich da, wo die Landenge auf ihrer südlichen Seite begann. Wir stießen da auf ein Kriegslager im wahrsten und romantischsten Sinne des Wortes.
Man denke sich die Gestalten dieser riesigen Ussul und ihrer ebenso riesigen Pferde, ihre Bewaffnung, die eigenartige Gewichtigkeit und Massigkeit in ihren Bewegungen und in allem, was sie taten! Nur ein Homer würde sich an die Beschreibung dieses Lagers wagen dürfen. Durch die Kunde, dass die beiden Söhne des Scheik verschwunden seien, war der Zuzug zu dem Heer des Dschirbani bedeutend vergrößert worden. Es zählte heute bereits zwölfhundert Mann. Und er wies keinen einzigen zurück, der zu ihm kam, denn sein eigentlicher Plan ging weit über die Landenge Chatar hinaus, und wer sich nicht zum Krieger eignete, der konnte noch im Tross von Nutzen sein. Zwei Relaisketten führten von hier weiter. Die eine zum Fluss und von da zur Hauptstadt; sie hatte täglich den Proviant und das Wasser für die Pferde zu erneuern. Die andere bis zum Brunnen des Engels, von wo das Trinkwasser für die Menschen zu holen war. Hier, im Lager, trafen wir den Scheik und seine Frau. Die Begrü-ßung war beiderseits eine herzliche, doch hatte ich keine Zeit, länger als nur einige Minuten zu verweilen, denn wir mussten nach dem nördlichen Auslauf des Engpasses zurück, weil von dieser Seite alles kam, was zu erwarten war. Vorher aber warf ich noch einen Blick in die beiden Felsenengen, in denen der »Panther« mit seinen beiden Gefährten und die zwei hohen Dschunub steckten. Ich überzeugte mich, dass es aus diesen Gefängnissen kein Entkommen gab, zumal vor jedem einer der Hunde Halefs Wache hielt. Es gab im hiesigen Felsengewühl noch ähnliche Orte in Menge. Wir suchten einen passenden auch für den älteren Prinzen der Tschoban aus, den wir mit seinem jüngeren Bruder nicht zusammenbringen wollten. Es waren teils rein menschliche und teils diplomatische Gründe, die es uns verboten, den letzteren wissen zu lassen, dass der erstere anwesend sei, und zwar auch als unser Gefangener.
Nun ritten wir wieder über den Pass zurück und hatten das Vergnügen, schon unterwegs die Beweise zu erhalten, dass Halef und Irahd ihre Pflicht sehr wohl, sogar mit Humor, erfüllten. Wir hatten nämlich, indem wir uns wieder nordwärts wendeten, das »Felsenloch« noch nicht erreicht, so kam uns ein sehr kräftiger Vorposten entgegengeritten. Er saß auf dem Pferd des Generals der Dschunub. Dieser aber lief, sehr gut gefesselt und mit der einen Hand an den Steigbügel gebunden, als Gefangener nebenher. Er wurde zu dem Maha-Lama und dem »obersten Minister« gebracht. Wir ritten sehr ernst vorüber und taten, als ob wir ihn gar nicht sähen; innerlich aber musste ich doch lächeln, wenn ich an die ironischen Ermahnungen dachte, die Halef ihm auf alle Fälle mitgegeben hatte. Nur kurze Zeit später brachte ein anderer Ussul in ganz gleicher Weise den Oberst geführt, dem schnell darauf der Major folgte. So ritten wir auch noch an dem Hauptmann, dem Leutnant und dem Unteroffizier vorbei und erreichten den Posten gerade in dem Augenblick, in dem auch der Soldat gefesselt worden war und soeben fortgeschickt wurde.
»Bist du mit uns zufrieden, Effendi?« fragte Halef. »Mit diesen sind wir fertig. Und nun schau einmal dort hinaus! Da kommen auch noch die letzten zwei, aber nicht auf-, sondern hintereinander!«
Er deutete nach der Gegend, aus der wir vorhin gekommen waren. Da sahen wir zunächst Smihk, den dicken, der mit gesenktem Kopf im Zotteltrab auf die Landenge zusteuerte und uns schon ziemlich nahe war. Weit draußen kam der Stratege hinterhergelaufen, und zwar so schnell, wie seine langen Beine den kurzen Körper tragen konnten. Die Kopfbedeckung mit dem Reiherbusch hielt er in der einen Hand, den Säbel in der andern. Am rechten Ort gelassen, hätten beide es ihm unmöglich gemacht, einen solchen Dauerlauf auszufuhren.
»Seht, wie er kommt!« forderte Halef die Hukara auf. »Es ist der Tertib We Tabrik Kuwweti Harbie Feminde Mahir Kimesne des tapferen Scheiks von Dschunubistan! Und «
Er hielt mitten in seiner Rede, die jedenfalls satirisch werden sollte, inne. Sein Auge war auf einen weiter nach rechts liegenden Punkt des nördlichen Horizonts gefallen, an dem eine Gruppe von drei Reitern erschien, deren Richtung auch gerade nach der Landenge lag.
»Wer mag das sein?« fragte er. »Der ältere Prinz der Tschoban«, antwortete ich, »mit seinem Freund und seinem Führer.« »Hamdulillah! So ist dann unser Tagwerk vollendet! Wie gut, dass er noch vor Abend kommt! Wie soll er behandelt werden?«
Er richtete diese Frage nicht an mich, sondern an den Dschirbani, weil ich ihn angewiesen hatte, nur allein diesen als den gebietenden Feldherrn zu betrachten. Dessen Antwort lautete:
»So, wie ein guter Mensch behandelt werden muss, selbst wenn er als Gegner erscheint. Ich will die Tschoban nicht vernichten, sondern sie aus Feinden in Freunde verwandeln. Und dieser Prinz ist es besonders, auf den ich mich dabei zu stützen habe. Allerdings nur derjenige Sieg ist ein wirklicher Sieg, der alle Feinde vernichtet und keinen einzigen von ihnen übrig lässt. In vergangenen, grausamen Zeiten suchte man dies dadurch zu erreichen, dass man sie ausrottete, sie tötete. Heute und noch viel mehr in der Zukunft aber kommt man viel leichter, viel sicherer und viel menschlicher zu ganz demselben Ziel, indem man den Hass in Liebe kehrt und sich dadurch den Widersacher zum Verbündeten und Helfer macht. Diese letztere Weise soll auch die unsere sein. Ich will durch Liebe siegen, nicht durch Blut und Tod!«
Nun war Smihk so weit herangekommen, dass er uns nicht nur sah, sondern auch erkannte. Er war des fremden Reiters überdrüssig geworden und hatte ihn abgeworfen. Nun er aber bekannte Gestalten erblickte, stieß er einen Jubelschrei aus, der alles überbot, was bis jetzt von ihm zu hören gewesen war. Ich ging ihm einige Schritte entgegen, um ihn zu liebkosen, wobei er den Schwanz in einen erstaunlichen Freudenwirbel versetzte. Kurze Zeit darauf stellte sich der Stratege ein, natürlich zu Fuß. Er war ganz außer Atem. Als er Halef und mich sah, blieb er pustend vor uns stehen und begann dann, ein Donnenvetter über uns loszulassen, wurde aber schnell unterbrochen: Zwei stämmige Hukara ergriffen ihn bei den Armen und zogen ihn fort, um ihn dahin zu bringen, wohin ihm seine Untergebenen vorausgeschickt worden waren.
Die Sonne war dem Untergang nahe, als der Prinz der Tschoban sich der Stelle näherte, an der wir uns befanden. Wir waren von den Pferden gestiegen, hatten diese versteckt und dann auch für uns selbst hinter Steinen so gute Deckung gesucht, dass wir nicht gesehen werden konnten. Die drei Reiter hielten sich für vollständig sicher. Sie waren darum nicht wenig überrascht, als wir plötzlich aus unserer Verborgenheit hervortraten und einen so dichten Kreis um sie bildeten, dass sich ihre Pferde nicht bewegen konnten.
»Ussul!« rief der Prinz, der sofort aus dem Äußeren der Leute, die ihn überfielen, ersah, zu welchem Volke sie gehörten. »Wer bist du?«
Diese Frage war an den Dschirbani gerichtet, der zu ihm herantrat und nach der Maulkette seines Pferdes griff, um vor allen Dingen dieses in seine Gewalt zu bringen.
»Man nennt mich den Dschirbani«, lautete die Antwort.
»Der Dschirbani bist du?« sagte er, indem er ihn mit einem langen, aufrichtig forschenden Blick musterte. »Ich habe dich noch nie gesehen, und doch ganz anders von dir gedacht, als törichte Leute denken. Und nun ich dich zum ersten Mal sehe, gefällst du mir, und ich möchte darauf schwören, dass ich mich nicht in dir geirrt habe. Was willst du von mir? Warum drängt ihr euch an uns heran?« »Um euch gefangen zu nehmen.«
»Aus welchem Grunde? Euch an uns zu vergreifen, habt ihr weder Ursache noch Recht. Der Engpass von Chatar liegt zwischen eurem und unserm Gebiet. Nur seine südliche Hälfte gehört euch, die nördliche aber uns. Wir befinden uns jetzt auf der nördlichen, also auf unserm eigenen Gebiet. Wie könnt ihr es wagen, uns da gefangen nehmen zu wollen?«
»Weil ihr nach der Landenge kommt, um sie zu überschreiten und uns zu überfallen?«
»Kennst du mich?«
»Ja. Und ich will ebenso aufrichtig sein wie du, indem ich dir sage, dass ich dich achte. Aber wir haben deinen Bruder ergriffen, als er bei uns spionierte, und wir wissen alles. Du wirst sehr bald erkennen, dass ich weder dein Feind noch derjenige deines Stammes bin, doch jetzt muss ich mich für einstweilen deiner Person versichern.«
»Mit welchem Rechte gerade du?« »Ich bin der Anführer der Ussul?«
»Du? Du? Der Anführer der Ussul?« fragte der Prinz erstaunt. »Seit wann haben die Ussul begonnen, klug und einsichtsvoll zu werden?«
Da trat Irahd an ihn heran und antwortete an Stelle des Dschirbani: »Seit sie sich entschlossen haben, die Verteidigung in den Angriff zu verwandeln. Du bist Sadik, der erstgeborene Prinz der Tschoban, und ich bin Irahd, der Unteranführer der Ussul. Es wird dir nichts geschehen. Du sollst nur für heute gefangen sein. Komm, wehre dich nicht!« Der Prinz wurde mit seinen Begleitern von den riesigen Ussul derart zusammengedrängt, dass er sich abführen lassen musste, ohne den geringsten Widerstand leisten zu können. Nachdem hierauf die nötigen Weisungen für die Nacht erteilt worden waren, ritten wir wieder den ganzen Engpass entlang dem Lager zu. Dort war für den Scheik ein Zelt errichtet, vor dem das Abendessen auf uns wartete. Bewirtet wurden wir von ihm und seiner Frau. Geladen waren Abd el Fadl, Merhameh, der Dschirbani, mein Hadschi Halef und ich. Der Dschirbani hatte geglaubt, dass ich Abd el Fadl kenne. Erst während dieses Rittes zum Abendessen erriet er aus einer Äußerung von mir, dass dies nicht der Fall sei. Da fragte er mich: »Wann hast du Abd el Fadl zum ersten Male gesehen?« »Erst vor einigen Tagen, hier«, antwortete ich.
»Weißt du, wer er eigentlich ist?« »Nein.«
»So erfahre und erstaune: er ist der Fürst von Halihm. An Reichtum kommt ihm keiner gleich im ganzen Ardistan. Und doch siehst du ihn einfacher und bescheidener, als mancher Bettler ist. Er hat ein Gelübde getan; welcher Art es ist, das weiß man nicht genau, weil er niemals davon spricht. Es ist das ein Geheimnis, das er nur mit Merhameh, seiner Lieblingstochter, teilt.« »So ist sie nicht sein einziges Kind?«
»Nein. Er hat noch Söhne und Töchter, die hoch am Throne wohnen. Nimmt er sich unser an, so ist uns viel geholfen!«
Das heutige Nachtmahl war dadurch ausgezeichnet, dass der Simmsemm vollständig fehlte. Es gab nur Wasser zu trinken. Die Einladung kam aus dem Herzen, hatte aber auch noch den besondern Zweck, uns die Befreiung der beiden Söhne des Scheiks an das Herz zu legen. Der letztere war mit dem festen Entschluss gekommen, an unserm Zug nun persönlich teilzunehmen, um den Mir von Ardistan zur Herausgabe der Gefangenen zu zwingen. Es kostete uns viele Mühe, ihn davon abzubringen, indem wir ihn zu der Überzeugung brachten, dass er uns viel eher hinderlich als förderlich sein werde. Seine brave, einsichtsvolle Frau ging uns hierbei recht wacker an die Hand. Sie war nur mitgekommen, um ihn von der Ausführung dieser seiner Absicht abzuhalten. Sie liebte ihre Söhne nicht weniger als er; aber sie wusste, dass er seinem ganzen Wesen nach weiter gar nichts als nur Ussul war und jenseits der Grenzen seines Landes und seiner persönlichen Verhältnisse auf Gehorsam und Erfolg verzichten müsse. Ich fühlte mich außerordentlich befriedigt, als es uns mit dieser ihrer Hilfe gelungen war, seinen Plan zurückzuweisen und ihn zur Heimkehr zu bewegen. Freilich sollte diese Heimkehr nicht eher angetreten werden, als bis der Sieg hier an dem Engpass endgültig entschieden sei; das machte er zur Bedingung.
Eine wirkliche Freude war es mir, zu sehen, dass der Scheik sich schon heute, nach so wenig Tagen, zum Dschirbani ganz anders verhielt als bisher. Nun, wo nicht mehr die Materie, sondern der Geist zu gebieten hatte, ließ er sich allmählich herbei, seine Rechte anzuerkennen.
Von Abd el Fadl und seiner Tochter sei heute nicht besonders gesprochen. Wir standen vor großen, hochbedeutenden Ereignissen, die sich auf dem Engpass, und zwar genau auf der Mitte desselben, vollziehen sollten. Es ist also gar wohl am Platze, heut, am letzten Abend vor Eintritt dieser Ereignisse, ein kurzes, deutliches Bild ihres Schauplatzes zu geben.
Die Landenge verband die im Norden von ihr liegende Wüste der Tschoban mit dem südwärts angrenzenden Land der Ussul. Im Süden gab es Wasser, im Norden aber nicht. Es war zu erwarten, dass die Tschoban mit ihren Pferden halbverdurstet anlangen würden. Sie rechneten jedenfalls darauf, über den Pass sehr schnell hinwegkommen und drüben den Fluss erreichen zu können. Dies ihnen unmöglich zu machen, darin bestand unser Plan. Sie mussten auf der Landenge festgehalten werden. Der Durst sollte unser Verbündeter sein. Wir hofften, dass er sie zwingen werde, sich uns auf Gnade oder Ungnade zu ergeben. Dazu war freilich nötig, dass die Einschließung sich so eng und so qualvoll für sie gestaltete, dass ihnen keine Hoffnung auf irgendeine andere Rettung blieb. Glücklicherweise kam uns die Natur durch die eigenartige Gestaltung des Engpasses in ganz besonders freundlicher Weise entgegen. Er zerfiel nämlich in drei fast ganz gleich lange Teile. Zwei Querhöhen reichten über ihn hinweg von einem Meer bis zum andern. Es gab also einen nördlichen, einen mittleren und einen südlichen Teil, die vollständig voneinander getrennt gewesen wären, wenn sich nicht in jeder der beiden Querhöhen ein schmaler Durchgang befunden hätte, durch den die Verbindung sich ermöglichte. Diese beiden natürlichen Quermauern waren das »Felsentor« und die hohe, steinige Wand des »Felsenloches«. Das erste, nördliche Drittel des Passes ging von der Wüste der Tschoban bis zu dem »Felsentor«. Das letzte, südliche Drittel reichte vom Land der Ussul bis an das »Felsenloch«. Zwischen beiden, also zwischen dem »Felsentor« und dem »Felsenloch«, lag das mittelste Drittel, welches die eigentliche Falle bilden sollte. Wenn meine Berechnung richtig war, so gingen die Tschoban ganz bestimmt in diese Falle, und zwar nicht etwa zögernd, sondern schnell. Ich glaubte nicht, dass sie sich Zeit nehmen würden, die Örtlichkeit genau zu untersuchen, sondern ich war überzeugt, dass der Durst sie treiben werde, so rasch wie möglich über den Pass hinüber zu kommen. Das »Felsentor« stand ihnen offen, sollte aber hinter ihnen sofort besetzt werden. Wenn sie das »Felsenloch« erreichten, wurden sie nicht hindurch gelassen. Dann konnten sie weder vor- noch rückwärts und waren ganz in unserer Hand.
Es war mein Wunsch, dass gar kein Blut vergossen werde; aber wenn ich mich in die kommende Situation hineindachte, erschien es mir als sehr wahrscheinlich, dass wenigstens an beiden Enden der Falle ein Kampf nicht zu vermeiden sei. Denn es war anzunehmen, dass die Tschoban den Versuch machen würden, sich hier oder dort, vielleicht gar an beiden Stellen, den Durchlass zu erzwingen. Dass diese Versuche ebenso erfolglos wie blutig sein mussten, verstand sich ganz von selbst. Als ich während des Abendessens gegenüber dem Dschirbani hierüber eine Bemerkung machte, sagte er: »Sei ohne Sorge! Es wird kein einziger Tropfen Blut vergossen werden. Die Vorbereitungen sind schon getroffen, nur sahst du sie noch nicht, denn du hattest keine Zeit. Ich werde sie dir nach dem Essen zeigen. Ich habe mich mit allen vier Elementen verbunden «
»Etwa mit Feuer, Wasser, Luft und Erde?« unterbrach ich ihn.
»Ja. Und diese unsere vier Freunde sind, wie ich sehe, fest entschlossen, sich unserer Sache kräftigst anzunehmen.«
Indem er das sagte, warf er einen forschenden Blick auf die beiden Meere hinaus und dann zum Himmel empor. »Von zwei Elementen gebe ich das zu«, bemerkte ich. »Die Erde hat uns aus ihrem festesten Gestein die Riesenfalle gebaut, und das Wasser hält an beiden Seiten die Tschoban ab, diese Falle zu verlassen. Wie aber ist es mit dem Feuer und der Luft?«
»Schau zum Himmel auf! Zwar scheint der Mond, aber kein einziger Stern ist zu sehen, obgleich ihrer Tausende dort stehen müssten. Das Firmament gleicht einer Stubendecke, die mit gelber, dicker Tünche angestrichen ist. Nur der Mond dringt da hindurch, ein Stern aber nicht. Das fällt nur dir nicht auf, der du ein Fremder bist. Wir aber kennen unser Land und ebenso auch unsern Himmel. Morgen gibt es Sturm, und dann wirst du deutlich sehen, dass die Luft mit uns im Bunde ist.« »Und das Feuer?« fragte ich.
»Das wird uns Pulver ersparen«, antwortete er. »Sobald ich hier ankam, wurde ich von Halef und Merhameh auf das Felsentor geführt. Indem ich von da oben herab die ganze Falle überblickte, kam mir der Gedanke, ihre beiden Ausgänge nicht mit Pulver und Blei, sondern durch das Feuer bewachen zu lassen. Ich säumte nicht, die hierzu nötigen Vorbereitungen zu treffen. Eine Schar meiner Hukara musste zurückreiten, um da, wo der Wald beginnt, das nötige Holz zu fällen und mit Hilfe ihrer starken Pferde herbeizuschleppen. Schon liegt ein gro-ßer Vorrat hier, und sie arbeiten noch immer. Während der heutigen Nacht wird davon so viel, wie wir brauchen, nach dem Felsenloch geschafft, um dort, sobald es morgen dunkel wird, in Brand gesteckt zu werden «
»Das ist ja ein ganz vortrefflicher Gedanke!« unterbrach ich ihn. »Natürlich geschieht ganz Ähnliches am Felsentor? Nur dass wir das Holz leider nicht vorher dort aufstapeln können, denn es würde uns verraten. Wie werden wir das machen?«
»Es ist bereits gemacht oder doch wenigstens schon im Gange. Dieses Holz wird nämlich in Gestalt von kleinen Flößen längs des Ufers der heut noch ganz ruhigen See nach dem nördlichen Ende der Landenge gerudert und dort so versteckt, dass die Tschoban, wenn sie kommen vorüberreiten, ohne es zu sehen. Du weißt, wie prächtig die Ussul mit solchen Flößen umzugehen verstehen.«
»Das weiß ich wohl, und ich muss dich herzlich loben. Wie vortrefflich wäre es, wenn wir die Passage nicht nur teilweise, sondern ganz und vollständig mit Feuer verstopfen könnten. Leider aber ist, um nur von der einen Stelle zu reden, das >Felsenloch< nicht ein wirkliches, kleines Loch zu nennen, welches nur die Breite des Weges besitzt, sondern es kommt hierzu auch noch die ganze Breite des alten Flussbettes. Es ist aber ganz unmöglich, so viel Holz herbei zu schleppen, um ein Feuer von solcher Ausdehnung anzünden und unterhalten zu können.«
»Da kommt das Wasser zu Hilfe!« lächelte er. »Bei solchem Sturm, wie für morgen zu erwarten ist, füllt der Fluss sich schnell mit Wasser. Die Wogen werden hoch am Felsen emporgetrieben und treten da in Risse und Rinnen ein, die in das trockene Bett hinunterführen. Wenn der Sturm sich nach der Ebbe mit der steigenden Flut verbindet, kommt es vor, dass der alte Fluss das eindringende Seewasser nicht zu fassen vermag. Es tritt dann über die Ufer und steigt auch dort noch mehrere Fuß empor, um an dem Weg längs der Felsen Spuren zu hinterlassen, die du nur deshalb nicht bemerkt oder nicht beachtet hast, weil du so etwas für ausgeschlossen hältst.«
»Höchst wunderbar! Und einen solchen Sturm vermutest du grad für morgen, also für den Tag, an dem die Tschoban kommen und hier gezwungen werden sollen, Frieden zu halten. Ist das Zufall?«
»Zufall?« antwortete er. »Ich weiß, dass auch du nicht an den Zufall glaubst, Shahib. Sobald der Mensch nicht künstlichen Gesetzen folgt, sondern nur den natürlichen, die ihm Gott gebietet, steht ihm die ganze irdische Natur als Helferin zur Seite. Dann geschehen Zeichen und Wunder, deren Zusammenhang mit unserm Wünschen und Wollen nur Gott allein erklären könnte, wenn wir klug und gläubig genug wären, ihn zu begreifen. Doch, philosophieren wir nicht, sondern bleiben wir praktisch! Fassen wir dankbar zu, wenn uns der Himmel Hilfe schickt, obgleich wir nicht glauben, sie auf uns beziehen zu dürfen. Sie ist dennoch für uns bestimmt!«
Als wir uns nach dem Essen von unserm Wirt und unserer Wirtin verabschiedet hatten, führte er mich an die See, wo ich sah, wie die Flöße gebildet und dann längs der Küste fortgerudert wurden. Dann ritt ich mit Halef noch nach dem »Felsentor«, wo wir an derselben Stelle schlafen wollten, an der wir am ersten Abend nach unserer Ankunft hier geschlafen hatten, im weichen Sand, der zwischen schützenden Felsen lag, die den Sturm abhielten, falls er sich schon während der Nacht erheben sollte. Bei unserer Ankunft am »Felsenloch« fanden wir vor diesem schon solche Mengen Holz aufgestapelt, als ob wir glaubten, die beabsichtigten Feuer nicht nur einen Tag, sondern eine ganze Woche brennen lassen zu müssen. Und das war gut, wie sich bald zeigen wird! Mein kleiner Hadschi Halef war, ganz gegen seine sonstige Art und Weise, heut Abend auffallend still. Er fühlte, dass ich dies besonders bemerkte, und sagte, um mir eine Erklärung dafür zu geben: »Wir haben schon viel erlebt, Sihdi, aber so Wichtiges, wie jetzt, wohl noch nie. Selbst jenes alte Ereignis im >Tal der Stufen«, das dem gegenwärtigen so ähnlich scheint, hat mich nicht so tief ergriffen, wie mich die jetzige Zeit berührt. Und weißt du, was das Sonderbarste hierbei ist?« »Nun? Was?«
»Dass ich dem Dschirbani vollständig vertraue. Früher hätten alle Fäden in deiner und meiner Hand vereinigt sein müssen. Wenn nicht, so hätte ich von der ganzen Sache nichts wissen mögen. Und heute ist es ganz anders. Ich trete mit Vergnügen zurück. Ich gönne dem Dschirbani die Kraft und den Mut, seinen eigenen, großen, gefährlichen Weg zu gehen. Es ist mir ganz recht, dass wir nicht an der Spitze stehen. Wir wollen hinter ihm bleiben, ihn schützen, ihm helfen. Und so freue ich mich darüber, dass er jetzt beginnt, selbständig aufzutreten. Wie höflich er während des Essens mit dem Scheik war, und wie rücksichtsvoll gegen dessen Frau! Und doch wie energisch schob er jeden Versuch zurück, ihm Verhaltungsmaßregeln vorzuschreiben! Er sagte, es gebe hier nur einen einzigen Kommandanten, und der sei er. Der Scheik sei verpflichtet, für das Heer zu sorgen. Das nehme alle seine Kraft und Zeit so sehr in Anspruch, dass er sich ganz unmöglich auch noch um die Taktik und Strategie bekümmern könne. Und die Frau des Scheiks gab unserm Schützling recht! Er beginnt, sich zu fühlen und sich zu entwickeln!«
Es war still um uns her, als wir uns niederlegten, und es blieb auch ferner still. Wir schliefen, wie bereits gesagt, an derselben Stelle; aber heut erklang das »Gebet von Dschinnistan« nicht von der Höhe des Felsentores herab. Waren Vater und Tochter nicht oben? Oder schwiegen sie, weil ein Posten der Hukara hier in der Nähe lagerte? Übrigens verhielten sich diese Leute außerordentlich ruhig. Sie störten uns nicht. So schliefen wir ganz prächtig, von meinen Hunden bewacht, die in der ganzen Zeit, auch während des Essens, nicht von unserer Seite gekommen waren.
Wir erwachten erst bei Tagesanbruch. Es war ein wichtiger Tag, der schon gleich früh durch sein ungewöhnliches Aussehen zeigte, dass er sich nichts Übliches, sondern ganz Absonderliches vorgenommen hatte.
Wir befanden uns zwischen engen, steil anstrebenden Felsen und hatten infolgedessen einen kleinen, sehr schmalen Horizont. Aber so unbedeutend das Stück Himmel war, das wir über uns sahen oder vielmehr gar nicht sahen, es war doch groß genug, uns zu zeigen, dass der Dschirbani mit seiner Voraussage, es gebe heute Sturm, Recht gehabt hatte. Als wir vom Schlaf erwachten, hörten wir ein Brausen wie von den allertiefsten Orgelstimmen, durch welches von Zeit zu Zeit das hohe, spitze, schrille Pfeifen einer Klarinette fährt. Und dieses Pfeifen und Brausen hörte nicht auf; es dauerte fort. Wenn es ja einmal für einige Augenblicke schwächer wurde, so stieg es dann um so höher zur vollsten Stärke auf. Für uns wurde es durch die Felsen gemildert, die uns wie mächtige Wände beschützten und das Toben des Sturmes nicht direkt an unser Ohr gelangen ließen. Der Himmel hing, wie man sich auszudrücken pflegt, fast bis zur Erde herab. Er bestand nur aus dunklen, schweren Wolken, die aber keine kompakte Masse bildeten, sondern wie zerfetzte und zerrissene Teppiche, Tücher und Schleier quer über die Landenge dahingejagt wurden. Ich sage quer; denn der Sturm kam aus Ost und traf den Engpass also in seiner ganzen Länge. Er wühlte die Wasser des Meeres auf, hob sie hoch empor und zwang sie, an den Felsen hinaufzuklettern und jene Risse, Rinnen und Rillen zu finden, die bereits erwähnt worden sind. Aus diesen ergoss sich die Flut dann zu uns herein in das alte Flussbett. Sie stürzte, soweit wir sehen konnten, wie in zahlreichen Sturzbächen nieder, die nicht kontinuierlich, sondern stoßweise arbeiteten, ganz den Stößen des Orkans gemäß, die von Pause zu Pause erfolgten. Die Menge des Seewassers, die in dieser Weise draußen empor-, und dann zu uns hereingetrieben wurde, war sehr bedeutend. Sie hatte bis jetzt schon den ganzen Grund des Flusses ausgefüllt und stieg immer höher und höher. Hierzu kam, dass die Nordwinde den Sand der Wüste jahrhundertelang wie durch ein Blasrohr über die ganze Länge des Engpasses gepustet hatten. Auf der anderen Seite, also im Süden, hatte er sich angesetzt. Hierdurch war das Gefalle des Flussbettes so verringert worden, dass es fast gar keines mehr gab. Das Wasser stand; es floss nicht ab, wenigstens jetzt noch nicht. Vielleicht konnte es später, wenn es höher gestiegen war, ins Flie-ßen kommen. Es stand jetzt schon mehrere Fuß hoch. Wenn der Seegang in der bisherigen Weise arbeitete, handelte es sich nur um einige Stunden, so war das Flussbett vollständig unwegsam gemacht und wir konnten die beiden einzigen passierbaren Stellen, um mich des Ausdruckes zu bedienen, den der Dschirbani angewendet hatte, »mit Feuer verstopfen«.
Eben als wir aufgestanden waren, kam Merhameh. Sie hatte gewusst, wo wir schliefen, und uns ein Frühstück zubereitet, das sie uns jetzt brachte. Während wir es verzehrten, kam der Dschirbani, um nach Norden hin, woher wir die Tschoban erwarteten, Ausschau zu halten. Ich begleitete ihn. Er deutete nach dem Flusse und sagte: »Du siehst, der Sturm ist da. Ich vermute sogar, dass er sich zum Orkan erhebt. Und auch die Wasser kommen. Nur noch zwei Stunden, so sind nicht nur wir, sondern auch alle Elemente vollständig bereit, die Tschoban zu empfangen.«
»Die, wenn sie einmal kommen«, fügte ich hinzu, »gewiss keinen Augenblick säumen werden, in die Falle zu gehen.«
»Zu dem Durste gesellt sich nun auch der Sturm, um sie schnell hinein zu treiben.«
»Mich und Halef aber verhindert er, ihnen entgegen zu reiten.« »Du wolltest?« fragte er.
»Ja, natürlich! Unser Warten auf sie ist doch immerhin ein ungewisses; wir aber hätten euch Gewissheit gebracht. Darauf müssen wir nun leider verzichten. Draußen in der Wüste sieht es jetzt ja noch ganz anders aus als hier bei uns, die wir uns im Schutz der Felsen befinden. Da denke ich eben daran, dass sich die Flößerei des Brennholzes bei diesem Wogengang von selbst verbietet. Haben wir auf dieser Seite Holz genug?«
»Ich hoffe es. Wir werden ja gleich sehen. Der Transport auf dem Wasser ist nicht mehr möglich. Wird mehr gebraucht, als geschafft werden konnte, so muss es auf dem verborgenen Pfad geschehen, der das Felsenloch mit dem Felsentor verbindet. Komm!«
Mein und Halefs Schlaf war so fest gewesen, dass wir von den Vorbereitungen, die während der Nacht getroffen worden waren, gar nichts bemerkt hatten. Es lag in der Möglichkeit, dass die Tschoban sich nicht erst heut, sondern schon während der Nacht einstellten. Darum hatte der Dschirbani schon gestern Abend, noch während wir aßen, so viel Hukara nach Norden geschickt, wie nötig waren, die Falle hinter den Hineingeratenen zu schließen. Eine Anzahl von ihnen hatte sogar hinaus in die offene Wüste reiten müssen, um auch während der Nacht die etwaige Ankunft der Erwarteten zu erspähen und zu melden. Diese Leute lagen auch jetzt noch draußen, trotz des Sturmes und trotz der ungeheuren Mengen von Sand, mit denen er die Luft erfüllte und die es ganz unmöglich machten, einen Blick in die Feme zu werfen.
Die Hukara, welche außerhalb des Felsentores postiert waren, bildete ein Drittel unseres Heeres, also vielleicht vierhundert Mann. Das ist schon eine nicht unbedeutende Zahl. Dennoch war, als wir jetzt hinauskamen, keine Spur von ihnen zu sehen, so gut hatten sie sich versteckt. Auch das Brennholz lag verborgen. Der Dschirbani, der die Stelle kannte, führte mich hin. Es war kaum glaublich, welche Haufen von Stämmen, Klötzen, Ästen und Reisern man da zusammengeschleppt hatte. Mir kam es weit mehr als genügend vor, und doch stellte sich dann später heraus, dass es noch nicht reichte. Es musste noch mehr hinzugetragen werden, und zwar auf dem geheimen Bergpfad, ganz so, wie der Dschirbani gesagt hatte.
Hier auf diesem nördlichen Drittel des Engpasses befehligte Irahd. Als er uns sah, kam er aus seinem Versteck hervor und begleitete uns weiter. Das Wasser stieg im Flusse zusehends. Das Heulen des Sturmes war hier außen noch ganz anders zu hören als innerhalb des Felsentores. Und je weiter wir kamen, um so stärker fühlten wir die Luftbewegung, die auch uns erfasste. Der Sturm wurde so kräftig, dass es schien, als ob er uns umwerfen werde. Und als wir das Ende der hohen uns schützenden Felsendünen erreichten, war die Luftbewegung viel richtiger eine Sandbewegung zu nennen. Das ganze Sandmeer der Wüste schien aufgewühlt zu sein. Es wurde in riesigen Streuwürfen und Schwaden vor dem Winde hergetrieben, eine fliegende Wüste, die der Geist der Lüfte mit tausend Geißeln peitschte!
Wie gern wäre ich mit meinen Hunden mitten in dieses Unwetter hineingeritten, um selbst zu sehen, ob und wann die Tschoban zu erwarten seien. Ich traute den paar Ussul, die da draußen lagen, nicht die nötige Übung und Ausdauer zu. Aber mein Syrr war mir denn doch zu kostbar, als dass ich ihm zumuten durfte, Augen, Ohren und Nüstern in zehn Minuten voller Sand zu haben und um eines groben Dienstes willen, für den er viel zu fein und edel war, an einer Lungenentzündung zu Grunde zu gehen. Ich verzichtete also darauf und kehrte mit dem Dschirbani und Irahd zu dem Felsentor zurück, um sodann mit Halef nach dem Felsenloch zu reiten, wo auch vierhundert Hukara lagen, die den Anprall der Tschoban auszuhalten hatten. Sie waren hierzu so wohlgerüstet, dass an ein Misslingen ihrer Absicht gar nicht gedacht werden konnte. Denn das Wasser im Fluss war mittlerweile schon über einen Meter hoch gestiegen und begann nun, auch auf der Leeseite hereinzuströmen, nachdem sich der ungeheure Wogenschlag auch nach der westlichen Seite der Halbinsel der Ussul fortgepflanzt hatte. Nun, da die Füllung der Flussrinne von zwei Seiten aus geschah, war das Passieren des Felsenloches nur auf dem schmalen Uferpfad möglich, und diesen hatte man mit einem mächtigen Holzhaufen versperrt, der nur angezündet zu werden brauchte, um jeden Versuch, ihn zu entfernen, zu vereiteln. Dabei standen die Vierhundert mit ihren Waffen, um das Feuer unablässig zu schüren und jedes Vordringen der Feinde zurückzuweisen.
Hierauf ritten wir nach dem südlichen Ende des Engpasses, wo sich, um mich militärisch auszudrücken, das Hauptquartier befand. Noch gestern Abend hatte es draußen, vor den Felsenhöhen, auf der freien Ebene gelegen; jetzt aber war es wegen des Sturmes hereinverlegt worden, wenn auch nur für die Menschen, denn für die vielen Pferde gab es hier innen keinen Raum. Die letzten vierhundert Ussul, das dritte Drittel, das nicht direkt mit dem Feind zu tun bekam, war mit der Unterhaltung der Zwischenposten, der Beschaffung von Wasser und Proviant und ähnlichen wirtschaftlichen Dingen betraut, die zwar nicht kriegerisch sind, aber doch zum Kriege und auch zum Siege gehören. Ich erkundigte mich nach unsern Gefangenen und erfuhr, dass der Panther mich dringend zu sprechen wünsche; ich beschloss, noch im Lauf des Tages zu ihm zu gehen. Vor allen Dingen hatten wir unsere beiden Pferde, die wir jetzt nicht mehr brauchten, weil alle Wege zu Fuß gemacht werden mussten, so unterzubringen, wie es ihr Wert erheischte. Wir fanden zwischen schützenden Felsen einen Platz für sie, wo sie vor den Unbilden des Sturmes geschützt waren und von niemand belästigt werden konnten.
Von dem Augenblick an, da die Ankunft der Tschoban gemeldet wurde, war Folgendes vorgesehen: Der Dschirbani sollte als Kommandant seinen Platz möglichst in der Mitte der Aufstellung haben. Er wählte sich hierfür eine Stelle, die oben an dem verborgenen Pfad fast grad auf halbem Weg zwischen dem Felsenloch und dem Felsentor lag. Da gab es ein überhängendes, ausgehöhltes Felsenstück, welches Platz für wohl ein Dutzend Personen bot und selbst beim ärgsten Regen trocken blieb. Von hier aus hatte man gleich weit nach den beiden Punkten, wo die Feuer brennen sollten, und die Meldungen und Befehle konnten hin und hergehen, ohne von den dazwischen, aber tief unten liegenden Tschoban bemerkt und aufgefangen zu werden. Der Dschirbani bat Halef und mich, ihm an dieser Stelle Gesellschaft zu leisten; ich aber wollte ihm so viel wie möglich freien Willen und freie Hand lassen und erwirkte also seine Einwilligung, dahin zu gehen, wohin es mir beliebte.
Es war noch nicht Mittag, so gegen elf Uhr europäischer Zeit, als die in die Wüste hinausgesandten Posten mit der Meldung zurückkehrten, dass die Feinde im Anzug seien. Diese wackem Hukara hatten vom Sand und vom Sturm viel auszustehen gehabt und ihre Sache sehr gut gemacht. Sie waren ungesehen geblieben und sahen sehr mitgenommen aus. In welchem Zustand mussten sich da erst die Tschoban befinden! Der Dschirbani begab sich sofort nach seinem Posten. Wir beide, nämlich Halef und ich, schnallten meinen zwei Hunden so viel Proviant und Wasser auf, als wir von heut bis morgen brauchten. Dadurch machten wir uns frei von Ort, Zeit und Pflege. Dann gingen wir am immer höher wachsenden Fluss bis zum Felsentor. Indem wir hierbei die Falle in ihrer ganzen Länge durchschritten, sahen wir, dass die Hukara jede Spur von sich und uns sorgfältig getilgt hatten. Das machte mich noch ruhiger und zuversichtlicher, als ich ohnehin schon war. Vom Felsentor aus nahmen wir genau denselben Weg empor, den wir mit Merhameh hinaufgestiegen waren. Da oben wütete der Sturm so heftig, dass man sich zuweilen festhalten musste, um nicht umgerissen und weggefegt zu werden. Nach Abd el Fadls Steinhütte zu gelangen, war ganz und gar unmöglich. Wir waren froh, eine nach Norden offene Felsenritze zu finden, an welcher der von Osten wehende Sturm vorüberging. Wir setzten uns da hinein und brauchten auch gar nicht lange zu warten, so sahen wir sie kommen: es war ein dünner, oft unterbrochener, ewig langer Zug von ermüdeten, hungernden und durstenden Menschen und Pferden, denen man es schon von weitem ansah, dass sie sich kaum mehr aufrecht halten konnten. So, wie wir sie sahen, so konnten wir selbstverständlich auch von ihnen gesehen werden, und darum machten wir uns nun schleunigst von dannen, um ihre Ankunft in der Falle zu beobachten.
Wir gingen den heimlichen Hochpfad entlang, bis wir den Dschirbani erreichten, der es sich mit seinem Stab unter dem oben beschriebenen Felsen möglichst bequem gemacht hatte. Hier in der Nähe zweigte der Treppensteig ab, der nicht ganz nach unten, sondern nur bis zu der offenen Platte ging, die ich bereits beschrieben habe. Wir stiegen nicht ganz bis zu dieser Platte hinab, denn wir trafen auf Merhameh und ihren Vater, die an einer sehr praktisch gelegenen Stelle saßen, von der aus man fast die ganze Falle überblicken konnte, ohne selbst gesehen zu werden. Wir nahmen bei ihnen Platz und entlasteten die Hunde, indem wir ihnen die Tragsättel abschnallten. Für unsere Bedürfnisse war nun gesorgt, selbst wenn wir bis morgen an dieser Stelle bleiben mussten. Wir hatten sogar unsere Decken mitgenommen, für den Fall, dass wir gezwungen sein sollten, hier zu schlafen.
Wir saßen so, dass der Durchgang durch das Felsentor, sobald wir uns nach der linken Seite wendeten, gerad vor unsern Augen lag. Es dauerte ziemlich lange, ehe dort der erste der Tschoban erschien. Ich vermutete, dass man draußen vor dem Tor halt gemacht hatte, bis der Scheik kam, und zwar aus dem sehr selbstverständlichen Grunde, um seine Befehle für den Durchzug des Engpasses zu erfahren. Diese Vermutung war richtig, denn der erste, der endlich durch das Tor geritten kam, war der Scheik. Ich kannte ihn nicht; aber die Art und Weise, wie er sich gab und wie man ihn nahm, ließ es erraten. Er ritt ein starkknochiges, sehr kräftig gebautes Pferd von derselben Rasse, wie ich bei dem Panther, seinem Sohn, gesehen hatte. Freilich jetzt schien es mit dieser Kraft des Tieres vorüber zu sein. Denn es war so ermüdet, dass es nur noch langsam gehen konnte, und als er so weit vorgeritten war, dass er sich uns gegenüber befand, begann es gar, zu wanken, blieb stehen und wollte nicht weiter. Er schlug es nicht und peinigte es nicht. Er trug überhaupt sehr kleine Sporen, nicht die gro-ßen, fürchterlichen Marterwerkzeuge, die ich bei seinem Sohn und dessen Begleitern gesehen hatte. Er liebkoste das Pferd; er streichelte ihm den Hals und versuchte, es in Liebe zum Weitergehen zu bringen. Das gefiel mir sehr von ihm, war aber ohne Erfolg. Das Pferd wollte zwar, konnte aber nicht weiter. Da stieg er ab. Sobald es sich seiner Last ledig fühlte, ging auch der letzte Rest der künstlich erregten Energie verloren. Es begann zu zittern und brach dann halb zusammen, halb legte es sich hin. Da setzte er sich bei ihm nieder, nahm seinen Kopf in den Schoß, streichelte ihn und frug und schaute emsig aus, ob einer der Vorüberreitenden noch eine Spur von Wasser in seinem Schlauche habe.
»Sihdi, dieser Mann ist gut!« sagte Halef. »Der liebt sein Pferd. Dem darf nichts geschehen! Bist du einverstanden?«
Ich nickte nur. Meine ganze Aufmerksamkeit war durch die Menschen in Anspruch genommen, die sich durch das verhängnisvolle Tor, vom Durst getrieben, förmlich hereindrängten, ohne zu ahnen, dass sie sich dadurch um ihre Freiheit brachten. Und so, wie sie hereindrängten, so drängten sie weiter. Wie sahen ihre Kleider, ihre Gesichter, ihre Pferde aus! Jede Falte, jede Öffnung stak voll Sand. Sowohl Mensch wie auch Tier konnten kaum noch aus den Augen sehen. Alles hustete, keuchte und ächzte. Die Pferde waren bis zum Umstürzen ermüdet, wurden aber mit Hilfe von Peitsche und Sporen doch noch vorwärts getrieben. Nur von Zeit zu Zeit blieb einer bei dem Scheik halten, um ihm ein aufmunterndes Wort zu sagen, aber Wasser hatte kein einziger mehr, um es ihm für sein Pferd zu geben. Wir erfuhren später, dass diese Leute laut aufgejubelt hatten, als sie den Fluss erreichten. Schnell aber hatte sich ihre Freude in Schreck verwandelt, als sie schmeckten, was für Wasser er enthielt. Und dieser Schreck hatte sich zum Entsetzen gesteigert, als sie sich sagen mussten, dass dieses Seewasser sich aus dem oberen, ausgetrockneten Fluss in den unteren Fluss ergießen und auch dessen Wasser, von dem sie Rettung erwarteten, ungenießbar machen werde. Und dennoch drängten sie mit aller Gewalt nach vorwärts. Das Flussbett war noch nicht so weit gefüllt, dass das Seewasser Abfluss fand. Man sah, dass es stand. Es hatte sich noch nicht in die trinkbare Flut des Unterlaufs ergossen. Also vorwärts, weiter, weiter!
Nun folgte die Bagage, Kamelreiter mit leeren Schläuchen und abgetriebenen Tieren, ermüdete Reiter zu Fuß, die ihre Pferde am Zügel hinter sich herzogen, weil die armen Geschöpfe vor Durst und Hunger nicht mehr imstande waren, ihre Herren zu tragen. Und da, da krachten von unten herauf, von dem Felsenloch her, einige Schüsse. Draußen in der Wüste hätte der Orkan ihren Schall verschlungen; hier aber, wo seine Kraft von den Felsen gebrochen wurde, hörte man sie. Sie waren das verabredete Zeichen für uns, dass die Tschoban das Felsenloch erreicht hatten, aber nicht weiter konnten, weil von unseren Hukara der Holzstoß angezündet worden war. Es erhob sich da unten ein Geschrei, welches sehr schnell von Mann zu Mann bis zu uns herauf getragen wurde. Das Vorwärtsdrängen kam ins Stocken. Man blieb stehen. Von oben herab, also vom Felsentor her, kamen nur noch einige einzelne Tschoban, bis auch der letzte in der Falle war. Da krachten auch von dorther einige Schüsse. Jetzt sprang der Scheik auf und schrie in den Lärm hinein: »Schweigt, schweigt! Was ist geschehen? Warum reitet ihr nicht weiter?«
Das Getöse war so groß, dass man seine Worte nicht hörte. Doch sah man, dass er fragte, und jedermann antwortete ihm. Es entstand dadurch noch ein viel schlimmerer Tumult, aus dem nur wenige deutliche Worte wie »Ussul! Gefangen! Wasser! Feuer!« herauszuhören waren. Der Scheik wiederholte seine Frage, aber mit genau demselben Misserfolg. Da stand Merhameh auf, von niemand veranlasst und nur ihrer inneren Eingebung folgend. Sie ergriff einen unserer Wasserschläuche, stieg mit ihm bis zur Platte hinab, legte ihn dort hin, trat ganz bis an den Rand der Platte vor und gab mit erhobenem Arm den Befehl zu schweigen. Ich sage absichtlich, dass sie nicht das Zeichen, sondern den Befehl zum Schweigen gegeben habe. Wie sie so niederstieg, wie sie so dastand, mit erhobenem Arm und königlicher Haltung, das ist nicht zu beschreiben. Der Scheik war der erste, der sie sah. Er machte eine Bewegung der Überraschung, trat um einige Schritte zurück, um sie zu betrachten, deutete auf sie und gebot Ruhe. Auch diese seine Worte verhallten in dem allgemeinen Spektakel, aber man folgte mit den Augen seinem Wink, und jedermann, der Merhameh stehen sah, wurde still. Ihr Anblick besaß jene Macht, die nur dem begreiflich ist, der die unwiderstehliche Gewalt eines seelisch reinen Wesens an sich selbst erfahren hat. Jeder Blick war auf Merhameh gerichtet, und man hörte trotz des Sturmes deutlich, was sie mit heller, klarer Stimme dem Scheik zurief: »Wirf mir deinen Schlauch herauf! Ich will dir Wasser geben für dein armes Pferd!«
Sein Pferd war das müdeste und durstigste von allen. Er hatte es abgehetzt, um seine Schar im Sturm zusammenzuhalten, wie ein Schäferhund unausgesetzt die Herde umkreist, damit kein Schaf verloren gehe.
»Wasser? Für mein Pferd?« fragte er zu ihr hinauf. »Ja gib! Allah segne dich für deine Barmherzigkeit! Sag, wer du bist!« »Ich bin Merhameh«, antwortete sie einfach.
»Merhameh? Also die, von der ich rede, die Allah segnen soll, die Barmherzigkeit?«
Er nahm den Schlauch vom Sattel und warf ihn ihr zu. Sie füllte ihn aus dem unseren und reichte ihn, indem sie niederkniete, so weit hinab, dass er ihn auffangen konnte. Er trat sofort zu seinem Pferde, um es zu tränken. Während er dies tat, schaute Merhameh froh lächelnd zu ihm nieder. Und die Menge der Tschoban hielt Mann an Mann da unten auf dem Weg und schaute zu ihr hinauf. Es war doch eigentlich gar nichts Sonderliches, was da geschah! Ein Mädchen gab einem Reiter Wasser für sein durstiges Pferd. Ähnliches hatte man schon tausendmal gesehen. Wie kam es, dass der Anblick grad dieses Mädchens so unbedingt beruhigend wirkte und das vorherige Gezeter in plötzliches, tiefes Schweigen verwandelte?
Jetzt war der Schlauch leer. Der Scheik richtete sich aus seiner gebückten Stellung empor, und zu gleicher Zeit sprang sein Pferd vom Boden auf. Er schaute zu Merhameh hinauf, nickte ihr dankend zu und fragte: »Hat sich die himmlische Barmherzigkeit in irdische Form gekleidet? Oder ist hier Merhameh der Name eines wirklichen Menschenkindes?«
»Ich bin wirklich!« antwortete sie. »Mein Vater hat mich so genannt.«
»Dein Vater? Wer ist er?« »Er heißt Abd el Fadl.«
Da trat der Scheik mit dem Ausdruck der Überraschung noch einige Schritte zurück und fragte: »Etwa gar Abd el Fadl, der Fürst von Halihm, der das berühmte Gelübde tat?«
»Derselbe!« nickte sie. »Ist er hier?« »Ja.« »Darf ich ihn sprechen?«
»Nein. Sein Name sagt, was er ist und was er will. Er kennt keine andere Herrscherin als nur die Güte allein, der es verboten ist, mit Menschen zu verkehren, die rauben und morden und Blut vergießen wollen. Es gibt nur zwei, die mit euch reden können, nämlich die Strenge und die Barmherzigkeit.«
»Die Barmherzigkeit bist du. Und wer ist die Strenge? Wer gebietet hier? Warum hält man uns auf? Man scheint das Felsenloch besetzt zu haben und uns nicht weiterlassen zu wollen. Wer ist es, der das tut?« »Das bin ich!« erklang es neben Merhameh.
Der Dschirbani war von seiner hohen Stelle herabgestiegen und neben Merhameh getreten. Er glich in seiner edlen Haltung, seiner vornehmen Art, sich zu bewegen, und seinem ledernen Gewand einem Winnetou in Riesengestalt, und mit der herabwallenden Haarmähne einem noch nicht ganz gezähmten Löwen.
»Du?« fragte der Scheik der Tschoban. »Ich kenne dich nicht; ich habe dich noch nie gesehen.«
Der Gefragte brauchte nicht zu antworten. Es erhob sich unter seinen Leuten eine Stimme: »Der Dschirbani! Der Räudige, der Verrückte!« Und eine andere Stimme fügte hinzu: »Der, wenn er von den Ussul eingesperrt wurde, immer herüber zu uns floh, um hinauf nach Dschinnistan zu laufen. Wir aber ließen ihn nicht durch!«
»Der Dschirbani! Der Verrückte! Der Verachtete! Der Räudige!« rief ein Dritter und ein Vierter. »Der Verachtete! Der Räudige! Der Verrückte!« schrien ihnen viele andere nach.
»Ist das wahr?« fragte der Scheik zu ihm hinauf.
»Dass man mich den Dschirbani nennt, ist wahr«, antwortete der Geschmähte ruhig. »Ob ich verrückt oder räudig bin, das wirst du sehr bald selbst beurteilen können. Dein Sohn, der falsche Ilkewlad, der nicht der Erstgeborene ist, fiel in unsere Hände. Er plauderte eure Pläne aus. Da zogen wir euch entgegen, um euch eine Falle zu stellen. Wir sind weit über tausend Mann und haben da unten das Felsenloch besetzt, um euch nicht hindurch zu lassen «
»Eine Falle?« unterbrach ihn der Scheik. »Wir scheinen allerdings da unten nicht weiterzukönnen; wer aber hindert uns, dahin zurückzukehren, woher wir gekommen sind?«
»Der Hunger, der Durst und das Feuer. Schau hin!«
Er deutete nach dem Felsentor. Die wenigen Minuten hatten genügt, so viel Holz, wie nötig, herbeizuschaffen und in Brand zu stecken. Weil das Feuer draußen brannte, sah man es nicht; aber der Wind blies den Rauch herein, verhinderte ihn, emporzusteigen, und zwang ihn, wie eine sich tief am Boden windende Schlange dem Ufer des Flusses zu folgen. Der Scheik stieß einen Schreckensruf aus.
»Auch dein anderer Sohn, der wirkliche Erstgeborene, geriet in unsere Hände«, fuhr der Dschirbani fort. »Wir haben ihn gestern noch vor Abend ergriffen, als «
»Mein Sohn Sadik?« unterbrach ihn der Scheik. »Ja.« »Das ist nicht wahr! Das ist Lüge!« »Gut! Nimm es für Lüge!«
»Er kann nicht hier sein, ich glaube es nicht. Er ist daheim!«
»Ich wiederhole nur: Nimm es als Lüge! Und sei auch stolz genug, mit mir, dem Lügner, nicht weiter zu verkehren!«
Er wendete sich ab und stieg langsamen Schrittes wieder hinauf nach seinem Platze. Auch Merhameh verließ die Platte und gesellte sich wieder zu uns. Ich fand das sehr richtig. Des Dschirbani Weise war ganz die rechte, um sich in Respekt zu setzen. Der Scheik rief noch mehrere Male nach ihnen herauf, bekam aber keine Antwort. Da beschied er eine Anzahl seiner Leute zu sich, in denen ich die Ältesten vermutete. Sie setzten sich in einem Kreis nieder, um mit ihm zu beraten. Eine solche Beratung der Stammesältesten wird bekanntlich Dschemma genannt. Die jetzige fand grad vor unsern Augen statt. Es wurden Leute sowohl nach dem Felsentor wie auch nach dem Felsenloch gesandt, um über diese beiden Orte zu berichten. Was sie nach ihrer Rückkehr sagten, konnten wir natürlich nicht hören. Wir hatten wegen des Sturmes ja kaum das verstehen können, was zwischen uns und ihnen vorher sehr laut gerufen worden war. So weit unsere Augen reichten, hatte sich die anfängliche Aufregung der Tschoban gelegt. Die noch nicht von ihren Pferden gestiegen waren, taten das nun jetzt; sie setzten sich nieder, um das Ergebnis der Dschemma abzuwarten.





























