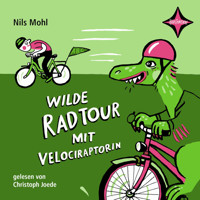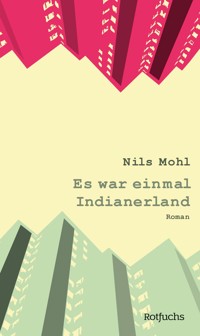9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Eine Tüte? Eine Frage, zig Antworten. Und der namenlose Kassierer kennt sie alle. Sein Leben – ein Pendeln zwischen dem alltäglichen Wahnsinn eines Technik-Kaufhauses und der Einsamkeit einer Plattenbauwohnung am Stadtrand. Sein Job –– ein Abenteuer Aug in Aug mit ärgerlichen, skurrilen und amüsanten Kunden. Und er erzählt uns von einer Woche. Davon, wie er trotz allem bei Verstand bleibt. «Der Preis der Waren ist nicht 39,99, der Preis wird im Kopf gezahlt.» (Ursula Krechel) «Ein böses, oft sehr witziges Gesellschaftsporträt.» (Hamburger Abendblatt) «Ein ungewöhnliches Buch, ein spannendes Buch.» (jetzt.de) «Sein Held ist der Kassierer, ein Mann ohne Eigenschaften und soziale Bindungen, dafür mit einer ausgeprägten Beobachtungsgabe und Sinn fürs Absurde. Der Mann sammelt Eindrücke wie Kassenbons, die das Format vorgeben, in dem er sie als Erzähl-Spots wieder ausstößt. Prima hellsichtig versponnen übrigens die Überlegungen zu einem fiktiven Studium der Enzyklopädie, die sich hier als erstaunlich lohnende Wissenschaft entpuppt.» (Kieler Nachrichten)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 194
Ähnliche
Nils Mohl
Kasse 53
Roman
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Eine Tüte?
Eine Frage, zig Antworten. Und der namenlose Kassierer kennt sie alle. Sein Leben – ein Pendeln zwischen dem alltäglichen Wahnsinn eines Technik-Kaufhauses und der Einsamkeit einer Plattenbauwohnung am Stadtrand. Sein Job – ein Abenteuer Aug in Aug mit ärgerlichen, skurrilen und amüsanten Kunden. Und er erzählt uns von einer Woche. Davon, wie er trotz allem bei Verstand bleibt.
«Der Preis der Waren ist nicht 39,99, der Preis wird im Kopf gezahlt.» (Ursula Krechel)
«Ein böses, oft sehr witziges Gesellschaftsporträt.» (Hamburger Abendblatt)
«Ein ungewöhnliches Buch, ein spannendes Buch.» (jetzt.de)
Über Nils Mohl
Inhaltsübersicht
Danke, Max
Alles hängt vom Zustand unserer Maschine ab.
La Mettrie
Innenstadt | ein Strom endlos anonymen Daseins
Tauben stelzen, dabei kaum vernehmlich girrend, gurrend, rucksend, zwischen den Abfällen umher, zwischen Zigarettenkippen, Speiseresten, zwischen Folien- und anderen Kunststoffschnipseln. Picken in der Nähe der Mülltonnen, unter den von kleinen Zierahorn-Bäumchen beschatteten Bänken der Fußgängerzone in den Ritzen und Fugen des in regelmäßigen Rechteckverbänden verlegten, rötlich glimmernden Granit-Pflasters nach Krumen, Körnern, Essbarem. Straßentauben mit schieferblauem, eng anliegendem Gefieder, schwärzlichen Schnäbeln, mit violett bis grün schimmernden Hälsen. Es ist kurz vor elf am Vormittag. Ein Obdachloser hockt unweit des Eingangs eines Schuhgeschäfts hinter einer Pappschachtel, an seiner Seite döst ein Hund in der Sonne. Gegenüber, vor dem Schaufenster einer Parfümerie, spielt eine blasse, nicht mehr junge Frau mit halb geschlossenen Augen und gesenkter Stirn Akkordeon. Passantinnen, Passanten hasten, schlendern, trotten, schreiten, hetzen, bummeln vorbei, einzeln und doch auch miteinander, aber jede und jeder in einem anderen, ganz eigenen Tempo, von gemächlich bis presto, von andante bis Stechschritt. Die meisten kommen aus Richtung des in der Nähe gelegenen Bahnhofs, eines Durchgangsbahnhofs, der täglich von knapp achthundert Fern- und etwa eintausend S-Bahn-Zügen angefahren wird. Eine weithin sichtbare Bahnsteighalle, eine knapp vierzig Meter hohe, freitragende Stahl-Glas-Konstruktion, überspannt den im ehemaligen Stadtgraben eingesenkten Gleiskörper. Hier, am Hauptbahnhof dieser knapp zwei Millionen Einwohner zählenden europäischen Hafenmetropole, treffen um diese Uhrzeit, kurz vor Beginn ihres Spätdienstes, noch eine ganze Reihe Angestellter der umliegenden Geschäfte, Gastronomiebetriebe und Warenhäuser ein, unter ihnen auch Mitarbeiter des größten technischen Kaufhauses der Stadt, die das Bahnhofsgebäude samt seiner Geräuschkulisse, eines hallenden Gewirrs aus Stimmenfetzen, Lautsprecheransagen, Signaltönen und dem pausenlosen Gelärme der an- und abfahrenden Züge, auf der Westseite verlassen. Ein böiger Wind weht über den Vorplatz. Die Luft ist mild, sommerlich warm. Über die den Bahnhof von der Innenstadt trennende, in beiden Richtungen zweispurige Straße schleppt sich immer wieder stockend der Autoverkehr. Die Mitarbeiter des großen technischen Kaufhauses queren die Straße an einem Ampelübergang, gelangen, als Teil eines in die City drängenden, schwärmenden, einfallenden Menschenpulks, in die Fußgängerzone: Hohe, auf massiven Sockeln ruhende Gebäude mit zumeist steinernen Fassaden links sowie verklinkerten Fassaden rechts dominieren den etwa zwanzig Meter breiten, korridorartigen Straßenzug, recken sich über fünf, zum Teil auch sechs, sieben Stockwerke in den nahezu wolkenlosen Augusthimmel. Farbige Markisen, Schilder, Banner, Leuchtreklamen, Schriftzüge prangen über den hohen, verglasten Erdgeschossen und offenen Eingangsbereichen. In einem fort strömen Neugierige in die Geschäfte hinein, Kunden aus den Geschäften heraus, mit Tüten, Jutebeuteln, Tragenetzen, Hand-, Unterarm- und Umhängetaschen, Köfferchen, Aktenmappen, Tüten und immer wieder Tüten in den Händen. Gelb-blau-weiß sind sie bei denen, die ihre Plastiktragetaschen nach dem Einkauf in dem großen technischen Kaufhaus bekommen haben: einem alten Familienunternehmen, das sich im Laufe der Jahre von einem kleinen, in einem Vorort der Stadt ansässigen Fahrrad- und Rundfunkgerätehandel zu einer Kaufhauskette mit über vierzig Filialen entwickelt hat. Geleitet wird dieser Einzelhandelskonzern inzwischen vom Enkel des vor zwanzig Jahren verstorbenen Firmengründers, und der heutige Sitz des Haupthauses, gelegen inmitten der längsten und bekanntesten Fußgängerzone der Stadt, gilt als Topadresse. Nirgends in der Innenstadt ist die Kundenfrequenz höher. Und das liegt nicht zuletzt auch an den Dimensionen des Hauses. Mit seiner sich über fünf Stockwerke vom Tiefparterre bis zur dritten Etage erstreckenden Gesamtverkaufsfläche von rund vierundzwanzigtausend Quadratmetern, was in etwa den Ausmaßen von drei bis vier Fußballfeldern entspricht, zählt es zu den größten seiner Art in Europa. Mehr als eintausendzweihundert Mitarbeiter sind hier beschäftigt.
Es ist kurz vor elf am Vormittag.
In der Kantine im vierten Stock werden Zigaretten in Glasaschenbechern ausgedrückt, weiße Kaffeetassen auf orangefarbene Hartplastiktabletts gestellt. Es riecht nach Großküche. Der Raum ist sonnendurchflutet, die Luft trotz der geöffneten, in den Dachschrägen versenkten Kippfenster stickig. Man schaut auf Handgelenksuhren, gähnt, stöhnt, lächelt, schaut zur Wanduhr hoch, beendet Gespräche, streckt sich, reckt sich, nickt sich zu: vier Minuten vor elf. Allgemeines Stühlerücken setzt ein. Die letzten an den in parallelen Reihen aufgestellten Tischen verteilt, allein oder in Grüppchen beieinander sitzenden Spätschichtmitarbeiter erheben sich, nicht gleichzeitig, aber nach und nach, bringen das benutzte Geschirr zur Geschirrrückgabe. Dort, am Kopfende des Raumes, hängt, in rahmenloses Plexiglas gefasst, an der Wand direkt neben der Geschirrrückgabe, der tabellarische, auf DIN A4 frisch ausgedruckte Menü- und Speisenplan für die aktuelle Woche, die 31. Kalenderwoche 1999. Man wirft einen flüchtigen Blick auf die Spalten Suppe, Stammessen I, Stammessen II, liest Altbekanntes: von Geschnetzeltem Züricher bis Fischfilet Müllerinart, keine Überraschungen. Die Tabletts werden auf ein leise vor sich hin brummendes Laufband gestellt, man steuert den Kantinenausgang an. Ein abgetretener, graumelierter Spannteppich schluckt die Schrittgeräusche. Die ersten, von ihren Kollegen bereits zur Pause abgelösten Frühschichtler erscheinen, kommen den die Kantine verlassenden Spätschichtlern entgegen, man grüßt sich, kurz, beiläufig, im Vorübergehen: Hallo, hallo, guten Morgen, Mahlzeit, alles klar, na, wie geht’s? Die Spätschichtler verlassen die Kantine durch eine Glastür, betreten einen kurzen Flur, gelangen in ein schmales, spärlich beleuchtetes Treppenhaus. Angenehm kühl ist es hier. Vor dem Fahrstuhl, den um diese Uhrzeit kaum jemand benutzt, geht es nach links, nach unten, in die dritte, zweite, erste Etage, ins Erdgeschoss, ins Tiefparterre. Man hört von oben die weiter unten durch den Schacht hallenden Schrittgeräusche, hört eine nicht zu bestimmende Anzahl Schuhpaare über die stumpfen, mattdunklen Quadrate, beige-grau marmorierte, schwarze Fliesen, tappen, treten, schlappen, quietschen, stöckeln. Der saure Geruch von äthylazetathaltigem Essigreiniger beißt in der Nase. Vor etwa einer halben Stunde hat die Putzkolonne den Boden Stufe für Stufe für Stufe, Treppenabsatz für Treppenabsatz, nass gewischt, ein paar verschwindende Spuren, feucht schimmernde Stellen, filmige Putzwasserrückstände an den Fußleisten, in den Ecken, weisen noch darauf hin. Zwei Minuten vor elf. Die letzten Spätschichtler verlassen das Treppenhaus, den Personalbereich, betreten durch von außen eher unscheinbare, teils halb verdeckte Zugangstüren die Verkaufsräume, begeben sich zu ihren Abteilungen, ihren Arbeitsplätzen: Verkäuferinnen, Verkäufer, Kassiererinnen, Kassierer, die Servicekräfte der Warenausgaben. Und alle, ohne Ausnahme, tragen sie auf ausdrücklichen Wunsch der Geschäftsleitung blassblau-weiß gestreifte, langarmige Firmenhemden. An den aufgenähten Hemdbrusttaschen, direkt über dem eingestickten Firmenlogo, einem etwa daumennagelgroßen, schräg nach rechts geneigten Versal, einem B, klemmen Namensschilder, auf die in maschinenschriftlichen Druckbuchstaben der jeweilige Nachname mit der entsprechenden, vorangestellten Anrede, Herr, Frau, geschrieben ist. Neun Stunden inklusive einer halbstündigen Mittags-, zweier Fünfzehn- und einer inoffiziellen Fünf-Minuten-Pause werden ab jetzt bis zum Feierabend vergehen.
Blassblau-weiß gestreifte, langarmige Firmenhemden.
Wie alle anderen männlichen Mitarbeiter trägst du eine Krawatte deiner Wahl, in diesem Fall eine mit schwarz-lila-silberfarbenem Rhombenmuster. Du rückst im Gehen noch einmal an dem Windsor-Knoten herum, verlässt dann das Treppenhaus im ersten Stock, trittst durch die Tür, die zur Lampenabteilung führt: Es blinkt von Kunststoff, Aluminium, Licht. Du hältst dich links, nimmst die Rolltreppe ins Erdgeschoss, auf der Zunge dieses markante, parasynthetische Arom, ein unaufdringliches, halbsteriles Bukett aus Originalverpackung, Pheromonrudiment, gefilterter Luft. Die Klimaanlage rauscht, leise, kaum hörbar, allgegenwärtig. Surrt, überlagert von dem wabernden Mischmasch aus Stimmen, Sprachschall, Lauten, Klängen, Geräuschen, Hintergrundmusik, summt als Grundton der polyphonen, akustischen Kulisse des Kaufhauses, untermalt von gleichmäßig getaktetem Geratter der Rolltreppen. Du gehst nach rechts, vorbei an der Information, vorbei an der Foto- und der Installationsabteilung, vorbei an lückenlos gefüllten Regalen, gehst über matt glänzendes, graues Linoleum in Richtung Haupteingang. Menschen, neben-, vor-, hintereinander herlaufend, strömen, selbst im größten Gewühl dabei einander nicht berührend, kaum einmal streifend, durch breite, gläserne Schwingtüren in den Laden, schwärmen, gefolgt von den ihnen nachströmenden Menschen, einzeln, im Pulk, als Paar, andere überholend, von anderen überholt werdend, aus, dir entgegen, an dir vorbei. Zehn, zwanzig Leben pro Sekunde, Teil keines Ganzen, keiner Ordnung, wie dir scheint, keiner für dich erkennbaren wenigstens. Teil einer undefinierbaren Masse vielleicht, die ihrerseits wieder Teil einer noch größeren Masse ist, Teil einfach eines augenscheinlich nicht abreißenden, nervös, scheinbar ziellos in das Kaufhaus hineinsprudelnden, hineinschwappenden Stroms. Ein Strom endlos anonymen Daseins. Die Anderen des Kaufhauses: Gesichter, Pigmente. Nichts, was sich bewegt, hinterlässt mehr als ein nur flüchtiges, unscharfes Bild auf deiner Netzhaut, trotz geradezu perfekter Lichtverhältnisse. Perfekt, weil das Licht der in parallelen Reihen, in einer Ebene mit der grau gesprenkelten, wabenartigen Kassettendecke angeordneten Lamellenrasterleuchten einfach alles, Einrichtung, Sortiment, Dekoration, in eine unaufdringliche, in eine sachliche Tageslichthelle taucht. Farben, Schrift, Preisetiketten, Schilder, Verpackungskartons, Ausstellware, Angestellte, Kunden, jede Ecke, jeder Winkel, jeder Tresen, jeder Gang, alles ist gleich ausgeleuchtet: gleich hell, gleich augenfreundlich, beinah schattenlos. Eine Minute vor elf. Kurz vor dem Eingang biegst du nach links ab, gelangst in die CD-Abteilung. Frau Kusch, deine Kollegin, die Ellbogen auf dem Tresen, das Kinn auf die Handrücken der ineinander gefalteten Hände abgestützt, lächelt dir entgegen. Du wünschst ihr einen guten Morgen. Guten Morgen, Frau Kusch. Frau Kusch grüßt zurück, schiebt einen Riegel auf der Rückseite der drei mal zwei Meter fünfzig großen, halb verglasten Box, in der sie sitzt, zurück. Die Tür schwingt auf.
Beinah schattenlos.
Die Kassen in diesem Kaufhaus sind keine dieser supermarkt-, fachmarkt-, discountkettentypischen Kassenschachteln, keine in Reihe aufgestellten und in Ausgangsnähe platzierten, an Legebatterien erinnernden, optisch völlig identischen Laufband-Kassenkästen. In diesem Kaufhaus sind die Kassen über alle Stockwerke, alle Abteilungen verteilt; insgesamt achtundzwanzig Stück, von denen an normalen Tagen, an Tagen wie diesem, aber nicht mehr als zwanzig besetzt sind. Ihr Design korrespondiert mit den jeweiligen Gegebenheiten der Abteilungen, und bei jedem Umbau werden sie neu gestaltet, erhalten bei Standortwechsel sogar eine neue Nummer, weshalb die Zählung, obwohl es keine entsprechende Anzahl Kassen im Haus gibt, mittlerweile bis zur Nummer dreiundfünfzig reicht. Kasse dreiundfünfzig, die Kasse, an der du arbeitest, gehört zu den schlicht, eckig, in erster Linie funktional, nicht zuletzt Platz sparend entworfenen Exemplaren: viele rechte Winkel auf wenig Raum. Mehr als der Drehstuhl, auf dem du sitzt, passt nicht hinein in die Box. Auf der schmaleren, der Abteilung zugewandten Längsseite, nach hinten und auch ein schmales Stück nach vorn, dort nämlich, wo die Kasse steht, schirmen ein Meter zwanzig hohe Plexiglasscheiben deinen Arbeitsplatz gegen den Verkaufsraum ab, der Tresenbereich ist offen und unverglast. Der Tresen selbst ist aus massivem, robustem Holz gefertigt, mit einem nebelgrauen, abwaschbaren Kunststoffbelag beschichtet, misst in der Tiefe exakt einen Meter und einen Meter fünfzig in der Breite. An den Kanten sind schmale Winkelleisten aus Aluminium verschraubt. Elf Uhr drei. Frau Kusch, die dich und die Kollegin von der Rundfunkkasse später im Wechsel, einem minutiös geregelten Pausenplan folgend, zum Mittag, zum Kaffee, zum Abendbrot ablösen wird, hat sich inzwischen auf den Weg in die Kantine gemacht. Du justierst den Drehstuhl, stellst ihn auf eine dir angenehme Höhe ein, kontrollierst Journal- und Bonrolle, öffnest die Kassenlade, schaust, ob genügend Münzgeld in den Fächern liegt, schließt die Kassenlade, überprüfst die Bestände an Wechselgeld in der Schublade rechts von dir. Zehn Rollen Pfennige, zwei Rollen Zweipfennige, zwei Rollen Markstücke, drei Rollen Zweimarkstücke, zwei Rollen Fünfer: das Wechselgeld, das deine Kollegin heute früh vor Ladenöffnung aus dem Kassenbüro geholt hat. Du angelst eine halb volle 1000-ml-Flasche eines Putzmittels mit dem Namen Kristall-Klar nebst einem bunt karierten, zweimal gefalteten Wischlappen, der täglich von der Putzkolonne dort bereitgelegt wird, unter dem Tresen hervor: Blau ist sie, die Flüssigkeit in der Kristall-Klar-Flasche, tief blau. Du schraubst den Deckel ab, drückst den Lappen gegen die Öffnung, drehst die Flasche einmal kurz auf den Kopf und wieder zurück, wischst mit dem benetzten Lappen über Konsole, Tastatur, Tresen, Ablage. Seit knapp einem Jahr machst du das so, jeden Morgen. Seit knapp einem Jahr arbeitest du an der Kasse der CD-Abteilung. Du bist achtundzwanzig Jahre alt. Vor zwei Tagen, am Samstag, hast du Geburtstag gehabt.
Kunde # 0001 – # 0746 Kaufhäuser sind für alle da
– Neunzehnneunundneunzig.
Den Pfennig habe ich schon in der Hand. Der Kunde, ein hemdsärmeliger, frisch gefönter, mittelgroßer Enddreißiger, fummelt an seinem Portemonnaie herum. Er sagt:
– Geht sofort los.
Die CD ist entsichert, der Preis eingescannt, der Bon gedruckt: Knapp achtzehn Sekunden hat das gedauert. Ich könnte längst den nächsten Kunden bedienen. Der Fummler sagt:
– Ah, da haben wir ihn ja.
Er legt einen Zwanzigmarkschein auf den Tresen, bekommt den Pfennig. Ich frage:
– Eine Tüte?
Der Fummler blickt auf die CD, zupft sich an der Nase, denkt nach, als würde die Antwort sein ganzes weiteres Leben entscheiden. Ich sage:
– Keine falsche Bescheidenheit, es sind reichlich da.
Ich deute auf den Tütenstapel. Der Fummler sagt:
– Überredet.
Ich lasse den Tonträger in eine Plastiktragetasche gleiten, sage:
– Danke schön.
Der Kunde greift zu. Und während ich mich von ihm verabschiede, entsichere ich bereits die nächste CD, einen aktuellen Charterfolg zum Aktionspreis:
– Vierundzwanzigneunundneunzig.
Geld wechselt die Seiten, ich biete eine Tüte an, der Käufer nickt:
– Darf ich Ihnen ein Kompliment machen?
Ich händige ihm die Ware aus, sage:
– Bitte. Davon kann ich nie genug bekommen.
Er schenkt mir ein ironiefreies, feierliches Lächeln, sagt:
– Sie sind der mit Abstand schnellste Kassierer, den ich kenne.
Montag | 2. August 1999
Knapp vierzig, schlank, feine Gesichtszüge: Die Kundin trägt einen Geigenkasten an einem Lederriemen über der Schulter. Bis auf ein auffälliges, avocadoschalenfarbenes Nicki-Halstuch ist sie dezent, komplett schwarz gekleidet. Sie fragt:
– Zweiunddreißigneunundneunzig, der Preis ist doch richtig, oder?
Ist er. Sie gibt mir einen Fünfzigmarkschein. Ich sage:
– Danke. Und siebzehn Mark und einen Pfennig bekommen Sie zurück.
Ich lege einen Zehner, einen Fünfer, ein Zweimark- und ein Pfennigstück auf den Tresen. Sie nimmt den Geigenkasten von der Schulter, öffnet die Klappverschlüsse. Ich frage:
– Möchten Sie eine Tüte haben, oder geht das so mit?
Die Kundin nestelt an ihrem Nicki-Halstuch, überlegt einen Moment, sagt:
– Mhm, ich glaube, ich hätte gern zwei kleine.
Eine CD, zwei Tüten. Das leuchtet nicht auf Anhieb ein. Ich sage:
– Sie können auch eine große haben, wenn Sie möchten.
Die Kundin schüttelt kurz, aber bestimmt den Kopf, meint:
– Das ist sehr nett, aber zwei kleine wären mir wirklich lieber.
Ich gebe sie ihr. Sie faltet sie zusammen, verstaut sie samt CD im Geigenkasten.
Tüten, präzise: Polyethylen-Tragetaschen aus weiß eingefärbter Niederdruckfolie mit Griffloch. Vier verschiedene Größen stehen zur Auswahl: sehr klein, klein, mittelgroß und groß. Jedem Kunden wird eine angeboten, und je nach Bedarf, Temperament, Laune, Geisteshaltung, Gesinnung und Charakter wird das Angebot ignoriert, angenommen oder ausgeschlagen: sachlich zurückhaltend oder gewollt witzig, begeistert zustimmend oder indigniert ablehnend, gut gelaunt oder offen patzig, freudestrahlend oder mürrisch, kopfnickend oder kopfschüttelnd, silbenreich oder wortlos. Eine Tüte? Die Vielfalt an Reaktionen auf eine Frage, die mit einem einfachen Ja oder einem einfachen Nein hinreichend beantwortet wäre, ist verblüffend. Bitte, gerne. Danke, nicht nötig. Heute mal. Heute nicht. Weil heute Montag ist. Montags nie. Von mir aus. Vielleicht später. Bevor ich mich schlagen lasse. Kann nicht schaden. Sind Sie so nett. Wenn’s denn sein muss. Wenn Sie eine hätten. Warum eigentlich nicht? Mensch, prima. Klar. Yo. Unbedingt. Großartig. Aber hallo. Ich bestehe darauf. Ganz lieb. Immer her damit. Auf jeden Fall. Yes, Sir. Das wäre wohl sinnvoll. Das wäre sehr nett. Das wäre praktisch. Das wäre nicht schlecht. Das wäre von Vorteil. Das wäre nützlich, ich habe nämlich keine Tasche dabei. Meine Tasche ist schon voll. In meiner Tasche ist leider kein Platz mehr. Ich habe meine Tasche zuhause liegen lassen. Kein Bedarf. Ich verzichte. Nö. Hab schon. I wo, man weiß ja gar nicht, wohin, vor lauter Tüten. Vielleicht ein andermal. Brauche ich nicht. Das geht noch so mit. Ich habe einen Rucksack dabei. Ich habe einen Jutebeutel dabei. Ich habe eine Sporttasche dabei. Wir wollen doch die Umwelt ein wenig schonen. Und so weiter. Und so fort. Die beiden seltensten Antworten sind: ein einfaches Ja, ein einfaches Nein.
– Eine Tüte?
Der Kunde starrt mich an, fragt:
– Bitte?
Anfang zwanzig, Tolle, Fusselbart, breiter Mund, riesige, weit vorstehende Augen: Er sieht aus, als hätte er mit einem Frosch gepokert und dessen Sehwerkzeuge gewonnen. Ich wiederhole:
– Eine Tüte?
Froschauge entblößt die ziemlich verwachsene Zahnreihe seines Oberkiefers:
– Wieso sagen Sie eigentlich alles zweimal?
Er bricht in schallendes Gelächter aus. Seine Tolle wippt auf und ab. Er meint:
– Entschuldigung, das ist gerade mein Lieblingswitz.
Was für ein Schenkelklopfer. Ich sage:
– Prima Timing, die Pointe sitzt. Wie war das nun mit der Tüte?
Froschauge deutet auf sein Sweatshirt mit Cannabisblatt-Motiv. Er sagt:
– No dope, no hope. Mit anderen Worten: Eine Tüte ist nie verkehrt.
Ich gebe ihm eine. Er kramt einen Zettel aus der Hosentasche:
– Haben Sie eine Ahnung, wo ich diese CD hier finde?
Der Zettel wird mir unter die Nase gehalten. Ich sage:
– Am besten fragen Sie einen der Verkäufer.
Froschauge furcht die Stirn:
– Sie sind doch einer.
Eben nicht. Ich bin Kassierer. Ich frage:
Um was für eine Musikrichtung handelt es sich denn?
Kunden dürfen dem Kassierer in der CD-Abteilung gerne etwas vorsingen. Es darf eine Melodie gepfiffen, ein Refrain gesummt werden. Man kann dem Kassierer gerne erklären, die Gruppe, deren Namen man leider nicht kenne, zu dem Song, den man sucht, dessen Titel einem aber dummerweise entfallen sei, mache schwer tanzbare Musik, einzuordnen vermutlich unter die Rubrik House meets Cajun gewürzt mit einer Prise Punk. Ein Kassierer hört sich das bereitwillig an. G-Funk, P-Funk, Hardrock, Heavy Metal, Krautrock, Rock ’n’ Roll, Speed Metal, Thrash-Metal, Death-Metal, Blues, Britpop, Grunge, Country, Easy Listening, Reggae, Muzak, Acid-Jazz, Cool-Jazz, Free Jazz, Electric Jazz, Electro-Boogie, Disco, New Wave, Schlager, Soul, R&B, Hip Hop, Trip Hop, Rap, Weltmusik, 2Step, Ambient, Dub, Goa, Gabber, Salsa, Jungle, Drum ’n’ Bass, Techno, Trance, Ska, Fusion: alles vorrätig. Einhunderttausend verschiedene Titel insgesamt. Und was nicht da ist, wird bestellt. Der erste Longplayer von diesem einarmigen, finnischen Country-Barden, der vor Jahrzehnten mal an irgendeinem Grand Prix teilgenommen hat? Kein Problem. Ein Sampler mit afrikanischen Nationalhymnen? Eine Minnesang-CD? Die aktuelle Audio-Kassette des Nasenflötenorchesters? Bekommt man sicher ohne Schwierigkeiten. Nur nicht an der Kasse. Kassierer sitzen acht Stunden am Tag auf einem Bürostuhl in einer Box. Vom Sortiment, das laufend ergänzt und umsortiert wird, haben sie so gut wie keine Ahnung. Sie können den Weg zu den Soundtracks weisen. Sie wissen, wo die Regale mit den Single- und Longplay-Charts aufgebaut sind, sie kennen den Standort der Kinderkassetten und Videofilme, sie wissen, wo man in der Abteilung das Zubehör, die Klassik, Konsolenspiele oder Hörbücher findet. Viel mehr wissen sie nicht. Kassierer gehören einer eigenständigen Abteilung an.
– Siebenundvierzigachtundneunzig.
Grüner Gehrock, beigebraune Bügelfaltenhose, Kaki-Hemd, Krawatte. Die Dienstmütze hat sich die Kundin, eine gut eins neunzig große Streifenpolizistin mit straff zurückgekämmtem Haar und Pferdeschwanz, unter den Arm geklemmt. Sie sagt:
– Eine Quittung mit Titeln und ausgewiesener Mehrwertsteuer bräuchte ich.
Die Beamtin legt drei Zehnmarkscheine und einen Zwanziger auf den Tresen. Ich nehme die vier Banknoten an mich, gebe ihr das Wechselgeld, deute auf den druckfrischen Bon, sage:
– Datum, Titel, Preis, Mehrwertsteueranteil – steht alles auf dem Kassenzettel.
Sie inspiziert ihn sorgfältig, knickt den Beleg dann in der Mitte und schiebt ihn in das Booklet einer der beiden Karaoke-CDs, die sie gerade bezahlt hat. Sie sagt:
– Okay, prima, das müsste reichen.
Sie setzt die Dienstmütze auf. Ich frage:
– Eine Tüte?
Die Polizistin schüttelt den Kopf, meint:
– Danke, das wird wohl noch so gehen.
Ihr Blick schweift dabei prüfend in Richtung Abteilung ab. Sie fragt:
– Meinen Kollegen haben Sie hier eben nicht zufällig vorbeikommen sehen?
Ich verneine. Ein Ordnungshüter in Uniform wäre mir aufgefallen. Selbst bei durchschnittlicher Körpergröße.
Museumsangestellte haben montags frei. Coiffeure, Haarstylisten und Friseurinnen auch. Hausfrauen können sich ihre Zeit nach Belieben einteilen. Für Ruheständler, Touristen, Studierende, Krankfeierer und Überstundenabbummler gilt im Prinzip dasselbe. DJs, Nachtclubbesitzer, Stripper und Stripperinnen brauchen sich über Ladenöffnungszeiten keine Gedanken zu machen. Pastoren, Bildhauer, Komponisten, Schauspieler, Schausteller, Schriftsteller, Arbeitslose, Arbeitssuchende, Piloten, Stewardessen und Schichtarbeiter meist ebenfalls nicht. Lehrer und Schüler gehen, so ihnen der Sinn danach steht, einfach am Nachmittag nach Schulschluss shoppen. Büro-, Einzelhandels-, Außenhandels-, Immobilien-, Speditions-, Werbe- sowie Versicherungskauffrauen mit Vorliebe in der Mittagspause. Ihre männlichen Kollegen halten das nicht anders. Vermutlich. Aber mit wem es ein Kassierer im Einzelfall zu tun hat, ist natürlich völlig unklar. Eine Nonne erkennt man. Nikotingelbe Finger verraten den Raucher, ein Schmiss die Zugehörigkeit zu einer schlagenden Verbindung, und Uniformen sind immer aufschlussreich: Heilsarmee, Marine, Heer, Luftwaffe, Schienenverkehr, Lebensrettung, Brandbekämpfung, Fast-Food-Kette, Freund und Helfer. Bei Uniformierten weiß man Bescheid. Bei allen anderen eher selten. Was nicht verkehrt sein muss, denn ein paar neben- oder hauptberufliche Kriminelle, ein paar Erpresser, Einbrecher, Falschmünzer, Scheckbetrüger, Urkundenfälscher, Hochstapler, Wechselreiter, Brunnenvergifter, Luftpiraten, Brandstifter, Schmuggler, Körperverletzer, Kidnapper, Totschläger, Mörder, Vergewaltiger, Kinderschänder, Investmentbanker und Hochverräter werden auch dabei sein. In die CD-Abteilung darf jeder, und zu spekulieren, wer tagsüber alles Zeit hat, einkaufen zu gehen, ist müßig – irgendwann, irgendwie wird sich jeder, der will, die Zeit nehmen und kommen. Kaufhäuser sind für alle da.
– Vierzehnneunundneunzig.
Der Kunde, ein junger Mann in entenschnabelgelbem Polohemd und wildgansbrauner Kordhose, pickt mit dürren, langgliedrigen Fingern Münzen aus seinem Portemonnaie. Er fragt:
– Entschuldigung, wie viel macht das, sagten Sie?
Ich wiederhole den Preis:
– Vierzehnneunundneunzig.
Der Kunde blickt auf die Barschaft in seiner Hand, sagt:
– Hm, ärgerlich. Das sieht schlecht aus.
Er lässt das Kleingeld zurück ins Münzfach klimpern, meint:
– Ich fürchte, da werde ich wohl meinen letzten Schein opfern müssen.
Er legt einen Zwanziger auf den Tresen, sagt:
– Aber einen Pfennig könnte ich Ihnen anbieten.
Ich schaue ihn fragend an. Er schaut lächelnd zurück, erklärt:
– Wegen dem Wechselgeld, verstehen Sie?
Verstehe. Ein Rechengenie. Ich sage:
– Klar. Natürlich. Ich stand gerade ein bisschen auf der Leitung.
Der Kunde winkt gönnerhaft ab, meint:
– Kein Problem. Das liegt an diesen seltsamen Preisen.
Er hält mir den angekündigten Pfennig hin, hebt die Brauen, sagt:
– Diese Neunundneunzigpfennigpreise sind wirklich der allerletzte Quatsch.
Ich gebe ihm ein Fünfmarkstück, lasse ihn geprellt, aber mit sich zufrieden ziehen.
Versuchte Manipulation, Volksverdummung, psychologischer Firlefanz: Neun Mark neunundneunzig klingt eben nicht wie zehn Mark.