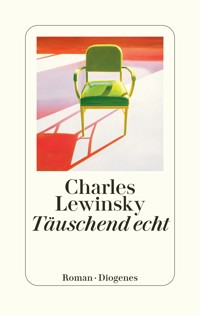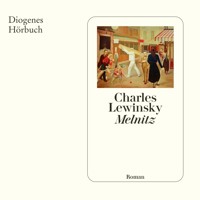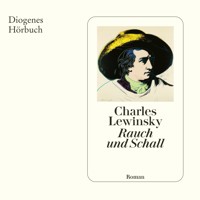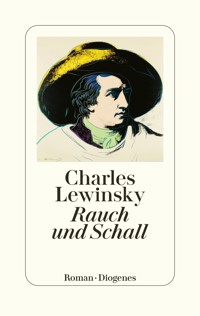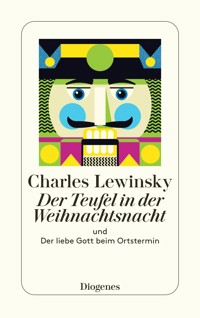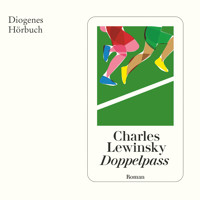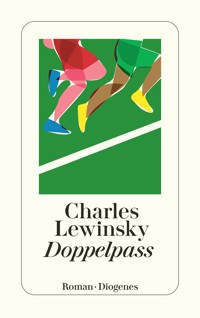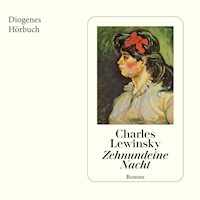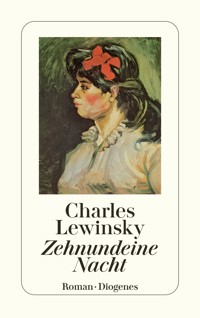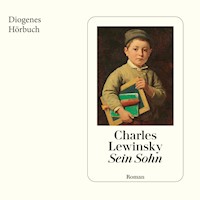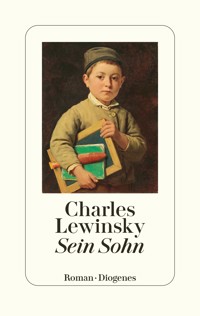10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Mann steht auf dem Walk of Fame von Hollywood und zerstört einen Stern mit der Spitzhacke. Warum tut er das? Die Sache führt zurück in den Winter 1944: Unter dem Vorwand, einen Propagandafilm zu drehen, setzt sich ein Berliner Filmteam in die Alpen ab. Doch im Dorf Kastelau wird das Drehen einer erfundenen Geschichte immer mehr zur erfundenen Geschichte eines Drehs.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 450
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Charles Lewinsky
Kastelau
Roman
Diogenes
Für meinen Sohn Micha,
der die Filmleute kennt
»Toto, I’ve got a feeling we’re not in Kansas anymore.«
Judy Garland in The Wizard Of Oz
In der Nacht vom 26. auf den 27. Juni 2011, kurz nach ein Uhr, fiel Automobilisten auf dem Hollywood Boulevard in Los Angeles ein Mann auf, der mit einer Spitzhacke über der Schulter mitten auf der Straße in östlicher Richtung unterwegs war. Eine herbeigerufene Polizeipatrouille entdeckte den Mann auf dem nördlichen Bürgersteig, nahe der Kreuzung mit der Sycamore Avenue, wo er mit seinem Werkzeug auf einen der in den Boden eingelassenen Sterne des Walk Of Fame einschlug. Auf die Aufforderung, seine Tätigkeit einzustellen, reagierte er nicht. Als die Beamten ihre Anweisung wiederholten, hob er die Hacke in bedrohlicher Weise gegen sie, worauf ihn Police Officer Milton D. Harlander jun. durch gezielten Einsatz seiner Dienstwaffe außer Gefecht setzte. Der Mann wurde mit einem Beindurchschuss ins Hollywood Community Hospital eingeliefert, wo er trotz intensiver ärztlicher Bemühungen in den frühen Morgenstunden verstarb. Bei der Obduktion wurde ein von der Schussverletzung unabhängiger Herzinfarkt als Todesursache festgestellt. Eine interne Untersuchung des LAPD bescheinigte Officer Harlander ein in jeder Hinsicht korrektes Vorgehen.
Bei dem Mann handelte es sich um einen gewissen Samuel A. Saunders, 49 Jahre alt, Besitzer der Videothek Movies Forever,14th Street, Santa Monica. Der von ihm beschädigte Stern war dem Schauspieler Arnie Walton (1914–1991) gewidmet. Ob Saunders das Ziel seines Vandalenakts zufällig ausgewählt hatte oder ob es sich um eine gezielte Attacke handelte, konnte nicht festgestellt werden. Aufgrund des Ablebens des Täters wurden die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingestellt.
Samuel A. Saunders hinterließ keine Verwandten. Eine letztwillige Verfügung wurde nicht gefunden. Die Bestände seiner Videothek wurden dem Film & Television Archive der UCLA übergeben. Es handelt sich dabei um historische Filme und Filmausschnitte auf verschiedenen Bildträgern sowie um persönliche Papiere und Aufzeichnungen. Die Materialien wurden bisher noch nicht archivarisch erfasst.
Die von Samuel Anthony Saunders hinterlassenen Unterlagen1bestehen aus Briefen, Listen, Notizen, Ausdrucken von Internetseiten, Tonbändern und verschiedenen Ansätzen zu einer literarischen oder wissenschaftlichen Arbeit. Zusammen ergeben sie eine Geschichte, deren Wahrheitsgehalt sich aus heutiger Sicht nur schwer überprüfen lässt.
Weder das Manuskript, von dem immer wieder die Rede ist, noch die Dissertation, auf der es basierte, haben sich in den Papieren erhalten. Im Sinne einer Rekonstruktion habe ich aus den Texten und Textfragmenten eine Auswahl getroffen und versucht, sie in eine logische Reihenfolge zu bringen. Die Abfolge der einzelnen Teile entspricht dabei nicht notwendigerweise der Chronologie ihrer Entstehung, soweit sich diese überhaupt feststellen lässt. Daten sind nur notiert, wo sie (wie bei den exakt dokumentierten Tonbandaufnahmen) feststehen oder sich mit großer Wahrscheinlichkeit rekonstruieren ließen.
Soweit nicht anders angegeben, sind die schriftlichen Dokumente mit Schreibmaschine oder Computer verfasst. Innerhalb der Texte habe ich – abgesehen von der Übersetzung ins Deutsche – keine Änderungen vorgenommen. Mehrfache Darstellungen desselben Sachverhalts wurden weggelassen. Wo es mir angebracht schien, habe ich in Fußnoten erklärende Anmerkungen hinzugefügt.
C.L.
Textfragment Samuel A. Saunders
Ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Noch aus dem Grab heraus macht er sich über mich lustig, freut sich grinsend über meine Enttäuschung und wendet sich dann mit einem Schulterzucken ab, so wie er sich in Real Men abwendet, nachdem er den Viehdieb erschossen hat. Dreht dem Besiegten den Rücken zu und schaut nicht zurück.
Ich kenne alle seine Gesten, das ganze Repertoire seiner schauspielerischen Mätzchen, die hochgezogene Augenbraue, der neckisch an die Wange gelegte Zeigefinger, das vorgeschobene Kinn. Ich kenne seinen Charme, der so künstlich ist wie das Erdbeeraroma in einem Milchshake. Ich kenne das Lachen, das er jetzt wahrscheinlich im Schauspielerhimmel lacht, denn aus der Hölle, die er verdient, wird er sich längst
[Handschriftlich angefügt:] NEIN!!! KEINEEMOTIONEN!!! SACHLICHBLEIBEN!!!
Manuskript Samuel A. Saunders
Soundstage Books, kein großer Verlag, aber auf Themen aus der Filmwelt spezialisiert, hatte ernsthaftes Interesse an dem Manuskript gezeigt. Der Lektor, ein Mr. Williams, war sogar regelrecht begeistert. Und trotzdem musste er mir schließlich mitteilen, sie hätten sich nun doch gegen eine Publikation entschieden. Es habe sich gezeigt, dass sich heute niemand mehr für Arnie Walton interessiere. Die meisten der Befragten hätten nicht einmal seinen Namen einordnen können. Das Risiko, mit dem Buch einen Flop zu landen, sei deshalb zu groß. Vor zwanzig Jahren, sagte er, wäre es noch etwas anderes gewesen. Er bedauerte die Absage und wünschte mir viel Glück. In einem der alten Filme, die ich so liebe, wäre in diesem Moment das Wort ENDE eingeblendet worden.
Soundstage Books waren meine letzte Hoffnung gewesen. Alle anderen Verlage, soweit sie überhaupt reagierten, hatten mich mit einem Formbrief abgewimmelt.
Vor zwanzig Jahren hätten sie zugegriffen. Aber damals hat man mich das Buch nicht publizieren lassen. Heute, wo sie mich ließen, will es niemand mehr haben.
Die Dramaturgie meines Ruins könnte aus einem Handbuch für Scriptwriting stammen. Jeder Anfänger weiß, dass man kurz vor der endgültigen Katastrophe noch einmal Hoffnung aufkeimen lässt.
Sie sah in meinem Fall so aus: Das Studio ließ mir einen Brief schreiben, mit der Mitteilung, sie hätten jetzt nichts mehr gegen das Buch. Im Gegenteil, sie würden mein Projekt sogar unterstützen und wären bereit, zweihundert Exemplare zum Ladenpreis abzunehmen.
Wahrscheinlich wollen sie seine alten Filme noch einmal auf den Markt bringen, als Blue-Ray-Special-Super-Gold-Edition oder wie man das heute nennt, wenn man alten Wein in neue Schläuche füllt. Damit sich irgendjemand für ihren vergessenen Alt-Star interessiert, brauchen sie für ihre Pressearbeit einen Skandal. Den ich ihnen liefern soll.
Zweihundert Exemplare! Hunderttausend hätte ich verkaufen können, damals.2
Als der Brief kam, habe ich gedacht, es sei die nächste Drohung. Sie hätten etwas von den neuen Beweisen erfahren – ich weiß nicht, wie das möglich gewesen wäre, aber damals, als es noch um eine Doktorarbeit ging, haben sie es auch geschafft – und wollten mich nun daran hindern, sie zu veröffentlichen. Schreiben von McIlroy & Partners haben noch nie etwas Gutes bedeutet. Aber der Brief war ganz höflich. Die Anwälte haben die Seiten gewechselt.
McIlroy & Partners. Diese ekelhaften Paragraphenroboter mit den geschniegelten Gesichtern und den geschniegelten Schriftsätzen. Einmal bin ich hingegangen, wollte mit McIlroy persönlich sprechen, ihm klarmachen, dass sie mein Leben ruinierten mit ihren Anwaltstricks. Sie haben mich nur angesehen, fast mitleidig. Niemand spricht mit McIlroy, schon gar nicht ein Würstchen wie du, sagten ihre Gesichter. Um dich fertigzumachen, reicht ein juristischer Anfänger, frisch von der Schulbank.
Ich weiß bis heute nicht, wer Arnie Walton damals das Manuskript meiner Dissertation zugespielt hat. Ich hatte sie noch nicht eingereicht, nur ein paar Leuten zum Lesen gegeben. Wollte mir Meinungen einholen, Verbesserungsvorschläge. Und dann hat mich Professor Styneberg zu sich bestellt.
Styneberg, den ich einmal so verehrt habe. Der berühmte Professor Styneberg, der Superliberale, der jedes Manifest, in dem es um die Freiheit der Kunst geht, als Erster unterzeichnete. Er gab mir in seiner väterlichen Art – seiner verlogenen väterlichen Art – den Rat, aus dem Umkreis meiner Recherchen doch besser ein anderes Thema zu wählen. Eine Arbeit über Arnie Walton sei einfach nicht opportun.
Ich konnte es nicht verstehen.
Bis ich nach Hause kam, und da lag der erste Brief von McIlroy & Partners. Rufschädigung. Verleumdung. Schadenersatz. Sie hätten mich durch die Gerichte getrieben, bis nichts von mir übrig geblieben wäre als ein Haufen Schulden.
Dabei hatte ich Belege für fast alles. Dokumente und Aussagen. Es hat mir nichts genützt.
Handschriftliche Notiz Samuel A. Saunders
Recht bekommt derjenige, der mehr Geld hat.
Manuskript Samuel A. Saunders
Wenn ich das Buch damals geschrieben hätte, so wie es mir ein Freund geraten hatte3, die Dissertation vergessen und mich direkt an das Buch gemacht, wenn ich das Manuskript vor dem Erscheinen niemandem gezeigt hätte, den Verlag zur Verschwiegenheit verpflichtet, wenn dieses Buch erschienen wäre und keine Klage hätte es mehr aus der Welt schaffen können – es wäre ohne Zweifel ein Bestseller geworden. Eine Sensation. In Scharen wären die Reporter am Roxbury Drive vorgefahren, mit ihren Teleobjektiven und Übertragungswagen. Den schmiedeeisernen Zaun mit den lächerlichen Messingspitzchen hätten sie ihm eingedrückt. Hätten ihm ihre Fragen per Megaphon zugebrüllt, und das ganze Land hätte sie gehört. Und er hätte sich feige in seiner Villa verbarrikadiert und sich geweigert, ihnen Antwort zu geben. No comment, no comment, no comment. Er wäre kein Held mehr gewesen von diesem Tag an. Die ganze Welt hätte sich über ihn lustig gemacht. Die Academy hätte ihm den Ehren-Oscar aberkannt.
Und ich wäre ein Star gewesen. Durch die Sender wäre ich getingelt, von Morning Show zu Morning Show. Ein Enthüllungsjournalist wie Bob Woodward. Watergate und Waltongate.
Meine Doktorarbeit hätte ich auch noch später schreiben können, mit all den Zitaten und Verweisen, die dazugehören, und heute wäre ich kein gescheiterter Akademiker ohne Abschluss, sondern Professor für Filmgeschichte. Stynebergs Büro, das Büro, in dem meine Welt untergegangen ist, würde mir gehören, nicht Barbara Cyslevski, dieser Harvard-Tussi mit ihren Gender-Analysen.
Manchmal mache ich auf dem Weg zu meinem Laden den Umweg über die Hilgard Avenue. Nur um am Campus vorbeizufahren. Dozent an der UCLA, das würde mir zustehen. Stattdessen muss ich mich mit einer Videothek für historische Filme über Wasser halten.
Über Wasser halten? Ich werde bald ersaufen. Mein kleiner Laden läuft jeden Monat schlechter. Was ich mühsam gesammelt habe, zum Teil in Archiven ausgegraben, an die vorher nie jemand gedacht hat, das findet sich heute fast alles im Internet. Mein Businessplan funktioniert nicht mehr. Früher, wenn jemand zum Beispiel auf der Suche nach Those Awful Hats4 war, dann hat er bei mir angerufen, ich habe ihm eine Kassette gezogen oder eine DVD gebrannt und ein paar Dollars verdient. Heute googelt er sich durchs Netz und hat den Film. Gratis. Die Zeiten haben sich geändert.
Movies Forever habe ich meinen Laden genannt. Die Ewigkeit ist auch nicht mehr, was sie mal war.
Und Arnie Walton residierte bis zu seinem Tod in diesem riesigen Anwesen am Roxbury Drive. In Interviews hat er immer erzählt, der Vorbesitzer der Villa mit den pseudogotischen Türmchen sei John Barrymore gewesen. Dabei hat nur Vince Rubenbauer, Barrymores Agent, dort gewohnt. Selbst in diesem Detail musste er sich etwas zurechtlügen.
Heute ist er so gut wie vergessen. Ich habe es ihm gewünscht, und jetzt leide ich selber darunter. Man kennt ihn nicht mehr. Die Aufmerksamkeitsmaschine dreht immer schneller, und außer den paar ganz großen Ikonen kommt alles unter die Räder, was nicht jeden Tag neues Futter liefert für Facebook und Twitter. 2001, an seinem zehnten Todestag, ist kein einziger Artikel über ihn erschienen. Kein einziger. Ich habe danach gesucht. Nur ein paar Freaks kennen ihn noch, Leute wie ich, die nachts um halb drei die Reruns alter Schwarzweißfilme aufzeichnen, und sich hinterher beim Sender beschweren, weil man die Schlusstitel mit den Namen der Mitwirkenden weggelassen hat. Auf dem Walk Of Fame stehen die Touristen vor seinem Stern und versuchen sich zu erinnern, wer zum Teufel das gewesen sein kann, Arnie Walton. Fragen sich, in welchem Film sie ihn wohl gesehen haben. Vielleicht haben sie ihren alten Opa auf den Ausflug an die Westküste mitgenommen, und der sagt dann: »Ich glaube, er hat immer den Helden gespielt.«
Du hast recht, Opa. Er hat immer den Helden gespielt.
Sein Ruhm hat sich nicht gehalten, und ich gönne ihm den Abstieg in die Rubriken »Wer war doch noch …?«. Aber wenn es ihn nicht mehr gibt, gibt es auch mich nicht mehr. Über einen Prominenten von vorgestern will niemand ein Buch lesen. Jetzt, wo sie mich ließen, interessiert sich niemand mehr dafür. Wir sind beide Fossilien, Überreste einer untergegangenen Zeit. Das Kino, das wirkliche Kino, existiert nicht mehr. Die Studios verdienen ihr Geld nur noch mit Popcorn-Filmen für Teenager. Explodierende Autos und Witze über Verdauungsfunktionen. Farbige Brillen soll man sich aufsetzen für ihre lächerlichen 3D-Effekte. Kinderkram. Sie schreien immer lauter, um sich gegenseitig zu übertönen. Weil sie das kunstvolle Lügen verlernt haben.
Das Lügen, das Arnie Walton so meisterhaft beherrschte.
Wir sind uns nie persönlich begegnet. Nicht ein einziges Mal. Er hat sich immer geweigert, mit mir zu sprechen.
Nur einmal wäre es beinahe dazu gekommen. Er war auf Werbetournee für die sogenannte Autobiografie5, die zu seinem siebzigsten Geburtstag erschienen war, und sollte bei Books And Stuff, nur zwei Straßen von meiner Videothek entfernt, das Machwerk signieren. Ich wollte hingehen und Skandal machen. Ihn mit den Tatsachen konfrontieren. Den versammelten Presseleuten erklären, dass nichts von dem stimmt, was er in dem Buch so salbungsvoll über die Anfänge seiner Karriere berichtet. Aber dann wurde die Autogrammstunde im letzten Moment abgesagt. Vielleicht hatte er einfach keine Lust, oder er litt damals schon unter dem Magenkrebs, an dem er dann schließlich gestorben ist.
Er hat wohl im Leben zu viel verschluckt.
[Handschriftlich angefügt:] ICHHASSEIHN!!!
Ausriss aus The Hollywood Reporter
vom 10.9.1991
In Erinnerung an den jüngst verstorbenen Schauspieler und Oscar-Preisträger Arnie Walton findet am 14. September 1991 in Mann’s Chinese Theatre eine lange Nacht seiner wichtigsten Filme statt. Gezeigt werden The Other Side Of Hell, The Good Fight und No Time For Tears.6 Einführende Worte: Professor Barbara Cyslevski, UCLA. Beginn 23:00 Uhr.
Manuskript Samuel A. Saunders
Natürlich hieß er nicht wirklich Arnie Walton. Marilyn Monroe hieß auch nicht Marilyn Monroe, und John Wayne hieß nicht John Wayne. Vielleicht hat er sich den Namen nicht einmal selber ausgedacht, hat nur nicht widersprochen, als die Werbeabteilung des Studios damit ankam. Anpassungsfähig ist er immer gewesen. Arnie Walton war die Amerikanisierung des Namens, unter dem er in Nazideutschland Karriere gemacht hatte. Und auch der war schon ein Pseudonym gewesen.
»Born Walter Arnold, March 23rd 1914, Neustadt, Germany.« So steht es in seinem Naturalization Certificate. Klingt exakt und zuverlässig, wie so vieles in seiner Biographie. Aber: Ich habe in Deutschland dreiundzwanzig Städte und Gemeinden mit dem Namen Neustadt gefunden (einschließlich der Stadt Wejherowo in Polen, die im Jahr 1919 noch »Neustadt in Westpreußen« hieß), und in keinem der dreiundzwanzig mit deutscher Gründlichkeit geführten Geburtsregister findet sich an diesem Datum ein Walter Arnold. Auch nicht in den Wochen davor oder danach.
Ich glaube trotzdem fündig geworden zu sein. Leider sogar doppelt, so dass keine eindeutige Zuordnung möglich ist. In Neustadt in Hessen (Landkreis Marburg-Biedenkopf) wurde am 23. März 1914 ein Walter Arnold Kreuzer geboren, und im Register von Neustadt an der Orla in Thüringen (Saale-Orla-Kreis) ist für den gleichen Tag ein Walter Arnold Blaschke vermerkt. Dafür, dass Schauspieler die eigenen Vornamen als Pseudonym wählen, gibt es viele Beispiele.
Kreuzer oder Blaschke. Eines von beiden dürfte sein wirklicher Name gewesen sein.
Der Künstlername Walter Arnold taucht zum ersten Mal im Deutschen Bühnen-Jahrbuch 1932 auf, wo er im Ensemble des Reußischen Theaters Gera als Schauspieler aufgeführt wird. Die allererste kritische Erwähnung findet sich in der Besprechung einer Neuinszenierung von Maria Stuart (Geraer Zeitung vom 11. Januar 1933), wo es heißt: »Herr Walter Arnold als Offizier der Leibwache machte seine Sache brav.«
Auch ich habe meine Arbeit brav gemacht, mit wissenschaftlicher Gründlichkeit. Ich weiß, dass er in Gera noch keine großen Rollen gespielt hat. Er war als Anfänger wohl nicht das sofort umjubelte schauspielerische Genie, als das er sich später gern darstellte.
Im November 1933, im zweiten Jahr seines Engagements, wurde sein Vertrag mitten in der Spielzeit vorzeitig aufgelöst. In seiner Autobiographie gibt er als Grund dafür an, er habe sich öffentlich mit einem Kollegen solidarisiert, der aufgrund seiner jüdischen Abstammung entlassen worden sei, habe also seiner Überzeugung halber die berufliche Karriere aufs Spiel gesetzt.7 Eine hübsche Geschichte, die gut ins Drehbuch seines Heldenepos passt. Nur entspricht sie nicht den Tatsachen.
Die lokale Presse jener Zeit berichtet ausführlich über die »Säuberung des Ensembles von volksfremden Elementen«. Während aber der Name des entlassenen Schauspielers, Siegfried Hirschberg, in allen Artikeln genannt wird, ist im gleichen Zusammenhang nirgends von Walter Arnold die Rede, auch nicht in jenen Publikationen, die sich darauf spezialisiert hatten, sogenannte »Judenlakaien« namentlich an den Pranger zu stellen.
Die wirkliche Erklärung für die abrupte Beendigung seines Vertrags fand ich im Thüringischen Staatsarchiv Greiz, wo die (nach einem Vernichtungsbefehl vom Februar 1945 sehr unvollständigen) Akten der obersten Polizeibehörde Gera aufbewahrt werden. Im handschriftlich geführten Journal vom November 1933 lässt sich unter dem 18. des Monats in der Rubrik »Festnahmen« der Name »Arnold, Walter« entziffern, mit dem Vermerk »wg. 175«. Es kann sich hier nur um den berüchtigten Paragraphen 175 des deutschen Reichsstrafgesetzbuches handeln, der »die widernatürliche Unzucht, welche zwischen Personen männlichen Geschlechts oder von Menschen mit Tieren verübt wird« mit Gefängnis von sechs Monaten bis zu vier Jahren bedrohte. Walter Arnold kam also wegen homosexueller Handlungen in Konflikt mit den Behörden. Da keine Anklage erhoben wurde, müssen sich die entsprechenden Vorwürfe entweder als gegenstandslos erwiesen haben, oder aber – im Hinblick auf sein späteres Verhalten in ähnlichen Situationen dürfte das wahrscheinlicher sein – er fand einen diskreten Weg, um die Eröffnung eines Verfahrens zu vermeiden. Vielleicht hat er den Behörden jemand anderen ans Messer geliefert, jemanden, der für sie interessanter war. Auf jeden Fall muss es einen Deal mit den Behörden gegeben haben. Vermutlich war die vorzeitige und fristlose Beendigung seines Vertrags am lokalen Theater eine damit verbundene Bedingung.
Für den weiteren Verlauf von Walter Arnolds Karriere blieb die Episode ohne negative Folgen. Bereits in der nächsten Spielzeit (1934/35) finden wir ihn als Ensemblemitglied am Hildesheimer Theater, wo er erstmals bedeutende Rollen wie den Grafen Wetter vom Strahl in Kleists Käthchen von Heilbronn spielt. Nur ein Jahr später ist er erster jugendlicher Held am privaten Leipziger Schauspielhaus (nicht zu verwechseln mit dem Städtischen Schauspiel). Seine Darstellung des Prinzen von Homburg – ebenfalls Kleist – wird in der Presse bejubelt und dürfte der Anlass für ein erstes Rollenangebot der UFA gewesen sein.
Mit Der Klassenprimus (1936) gelang ihm dann auch im Film sehr schnell der Durchbruch.8
Handschriftliche Notiz Samuel A. Saunders
Erklären, wie ich dazu kam. Wie ich zu ihm kam. Man darf nicht den Eindruck bekommen, ich hätte von Anfang an etwas gegen ihn gehabt.
Er war für mich ein Name auf einer Liste, mehr nicht. Alphabetisch geordnet. Die Liste muss noch irgendwo sein.9 Endlich einmal Ordnung machen. Die alten Papiere aussortieren. Das meiste wegschmeißen.
UFA-Schauspieler im Dritten Reich. Die Aufzählung begann mit Viktor Afritsch, das weiß ich noch.
Viktor Afritsch, Axel von Ambesser, Walter Arnold. Ein Name unter vielen.
Manuskript Samuel A. Saunders
Die UFA-Filme, die in den letzten Kriegsmonaten gedreht, aber während des Dritten Reiches nicht mehr fertiggestellt und aufgeführt wurden, das war der Bereich, in dem ich das Thema für meine Dissertation finden sollte. Professor Styneberg hatte mir dazu geraten, weil ich auf dem College Deutsch belegt hatte. (Die Familie meiner Großmutter ist aus Deutschland eingewandert. Ich selber habe die Sprache nie wirklich perfekt beherrscht, aber meine Kenntnisse reichen aus, um problemlos ein Gespräch oder ein Interview zu führen.10) Ein überschaubares Gebiet mit einem politischen Aspekt, genau das, was man damals suchte. Und als Thema noch nicht übermäßig bearbeitet. Ein Bergwerk, in dem man noch auf manche filmhistorische Goldader stoßen konnte. »Arbeiten Sie sich erst mal in die Problematik ein«, sagte Styneberg, »und picken Sie sich dann einen geeigneten Aspekt für Ihre Dissertation heraus.«
Am meisten gefiel mir an dem Vorschlag, dass man dafür nach Europa fahren musste. Ich war da vorher nicht gewesen. Vor allem Prag interessierte mich. Dort hatten die Deutschen, als es in Berlin kaum mehr ging, fleißig weitergedreht. »Weil der Lärm der Flugzeuge in der Reichshauptstadt die Tonaufnahmen stört«, wie Propagandaminister Goebbels offiziell verlauten ließ. Der eigentliche Grund war wohl eher, dass seine Stars nicht in einer Stadt bleiben wollten, die fast täglich bombardiert wurde.
Meine Recherchen haben mich dann einen anderen Weg nehmen lassen, und nach Prag bin ich nie gekommen. In den deutschen Archiven fand sich viel mehr Material, als ich erwartet hatte. Schon die erste Sichtung beschäftigte mich viele Wochen. Bei der Murnau-Stiftung in Wiesbaden waren sie anfänglich sehr korrekt und manchmal ein bisschen umständlich, vor allem, wenn es um die sogenannten »Vorbehaltsfilme« ging, die wegen ihrer nationalsozialistischen Tendenzen gesperrt sind. Man wollte dort zuerst überhaupt nicht einsehen, dass eine wissenschaftliche Arbeit etwas anderes ist als eine öffentliche Aufführung. Aber da waren auch zwei jüngere Archivare, mit denen habe ich mich angefreundet.
Bei der DEFA in Ostberlin war man überraschend freundlich und hilfreich. Im Staatlichen Filmarchiv der DDR habe ich sogar eine Entdeckung gemacht. Unter den eingelagerten Filmrollen von Der Mann, dem man den Namen stahl fand ich ein vollständig abgemischtes Tonnegativ, von dem niemand etwas gewusst hatte. Das Nitro noch in brauchbarem Zustand. Auf dieser Basis hätte man aus dem vorhandenen Schnittmaterial den ganzen Film, so wie ihn der Regisseur montiert hatte, rekonstruieren können.11 Es wäre zwar nur eine Fußnote in der Filmgeschichte gewesen, aber bestimmt eine karrierefördernde Fußnote.
Ich habe keine Karriere gemacht. Es ist anders gelaufen. Und das hatte indirekt auch mit meinem Fund in Ostberlin zu tun.
Ich war so glücklich über meine Entdeckung, dass ich ein paar Tage später die beiden Archivare der Murnau-Stiftung eingeladen habe, mit mir zu feiern. Wir sind essen gegangen, bei einem Jugoslawen, das weiß ich noch, was damals als recht exotisch galt, und dann empfahlen sie eine Kneipe, die sei zwar nichts Besonderes, aber für Filmverrückte wie uns ein echter Geheimtipp, ich würde schon sehen.
Bei Titi.
Ein schäbiges Lokal, nicht in der besten Gegend. Eng und ungelüftet. An den Wänden verblichene Filmstarporträts, manche signiert und gerahmt, andere aus Zeitungen ausgeschnitten und direkt auf die Täfelung geklebt. Eine Musikbox, aus der eine Frauenstimme einen alten Schlager schmetterte.
Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehn. Im Rückblick ein ironisch passender Titel.
Titi selber eine Frau, die mir uralt erschien. Rotgefärbte Haare in altmodischen Wasserwellen, aber so schütter, dass die Kopfhaut durchschimmerte. Über die tiefen Falten im Gesicht hatte sie sich ein jugendliches Lärvchen gemalt. Das dick aufgetragene Make-up konnte eine Narbe, die sich vom rechten Auge über die ganze Wange zog, nicht ganz unsichtbar machen. Titi rauchte Kette, eine Art Zigaretten, die ich vorher nie gesehen hatte, mit langen Pappmundstücken, auf denen ihre überschminkten Lippen immer neue Abdrücke hinterließen. An den Stummeln im Aschenbecher sah das aus wie Blut.
Es waren an diesem Abend nicht viele Gäste da, und sie setzte sich bald zu uns an den Tisch. Ich bilde mir ein, dass ich ihr Parfüm noch riechen kann, ein ältlicher Duft von künstlichen Blumen. Blumen und Zigarettenrauch.
Ihre Stimme so leise, dass man sie über dem Lärm der alten Schlagerplatten kaum verstand. Später, als ich sie besser kannte, wurde mir klar, dass sie nicht lauter sprach, weil ihre Stimme sonst kippte und schrill wurde. Manchmal, wenn sie sich über etwas erregte, vergaß sie das und klang dann wie eine ganz andere Frau. Wenn sie lachte – und sie lachte viel –, musste sie husten.
Meine Kollegen stellten mich als berühmten Wissenschaftler aus den USA vor. »Ein Spezialist für Filme der Dreißiger und Vierziger«, sagten sie. Worauf mich Titi einer regelrechten Prüfung unterzog. Fragte mich ab wie in der Schule. Ging mit mir von Fotografie zu Fotografie, und ich sollte die Namen nennen. Bei den großen Stars war das einfach, Willy Fritsch oder Jenny Jugo, aber bei den meisten andern versagte ich kläglich. Jedes Mal, wenn ich wieder nur hilflos die Schultern zuckte, bekam ich einen tadelnden Klaps auf die Backe. Das sollte neckisch wirken, war aber auf die Dauer ganz schön unangenehm.
Ein Bild – keine Autogrammpostkarte und kein Zeitungsausschnitt, sondern eine ganz gewöhnliche alte Fotografie, Sepia mit Büttenschnitt – zeigte eine junge, sehr blonde Frau, die mit aufgesetztem Lächeln in die Kamera strahlte. »Wer ist das?«, fragte Titi, und als ich es nicht wusste, gab es keinen Klaps, sondern eine ausgewachsene Ohrfeige.
Die Kollegen saßen hinter ihrem Bier und wollten sich ausschütten vor Lachen.
»Das bin ich«, sagte Titi.
Sie war, erzählte sie bei der nächsten Zigarette, auch einmal beim Film gewesen, nicht gerade ein Star, aber doch jemand, der ein Star hätte werden können, wenn die Zeiten anders gewesen wären, wenn der Krieg länger gedauert hätte, wenn, wenn, wenn.
»Ich war nämlich einmal hübsch«, sagte Titi. »Auch wenn man es mir nicht mehr ansieht.« Es war die Aufforderung zu einem Kompliment, das wir ihr dann auch wortreich machten.
Sie hieß Tiziana Adam, ein ungewöhnlicher Name, den ich zunächst für ein Pseudonym hielt. Später stellte sich dann heraus, dass sie tatsächlich so hieß.
Tiziana Adam, geboren am 4. April 1924 in Treuchtlingen in Bayern.
Sie hat, das habe ich im Archiv der UFA festgestellt, dort auch tatsächlich einmal einen Vertrag gehabt, wenn sie auch nur sehr wenige und kleine Rollen spielte. Sie muss neunzehn gewesen sein, als sie nach Berlin kam. Neunzehn Jahre alt und für die Karriere zu allem bereit.
Interview mit Tiziana Adam
(4. August 1986)12
Eine Uher, sehe ich. Habt ihr in Amerika keine moderneren Tonbandgeräte?
In der Stiftung ausgeliehen, ich verstehe. Ganz schön handlich. Die Dinger heute … Zu meiner Zeit … Es war eigentlich eine zweite Kamera. Eine für das Bild und die andere … Der Ton war immer das Problem. Dass man die beiden Filmstreifen synchron kriegte. Furchtbar umständlich. Sie wissen das natürlich. Sie sind ja Wissenschaftler.
Und die Kopfhörer … Elefantenohren. Man hat das so genannt, weil … So groß waren die Dinger. Wir hatten einen Tonmeister, der war taub. Völlig taub, können Sie sich das vorstellen? Ein Tonmeister. Das war, als wir …
Ja doch. Stellen Sie Ihre Fragen. Test, eins, zwo, drei. Test, eins, zwo, drei. Stellen Sie Ihre Fragen.
Das war eigentlich Zufall. Oder eigentlich doch nicht. Ich wollte immer zum Film. Schon als kleines Mädchen. So wie andere Prinzessin werden wollen. Tierärztin. Ich wollte zum Film, und mein kleiner Bruder … Sie wollten alle zur Eisenbahn. Treuchtlingen war ja eine Eisenbahnerstadt. Ein Knotenpunkt. Darum haben die Amerikaner dann auch 1945 … Ein Verbrechen war das, wenn Sie mich fragen. Auch wenn Sie Amerikaner sind, ich sage das einfach mal so. Ein Verbrechen. Mein Bruder ist bei dem Fliegerangriff … Fünfzehn Jahre alt. Ein Kind. Ich war damals schon in Berlin. Das heißt: Ich war schon nicht mehr in Berlin. Weil wir doch …
Sie müssen mich schon erzählen lassen, wenn ich mir die Zeit … In so einem Lokal … Die Arbeit hört nie auf. Das hätte ich mir damals auch nicht träumen lassen, dass ich einmal … Jede Nacht hinter der Theke. [Singt] »Meine Herren, heute sehn Sie mich Gläser abwaschen …« Kennen Sie das Lied? Die Seeräuberjenny. Solche Rollen hätte ich gern … Mit Tiefgang. Aber an so etwas kam ich damals natürlich noch nicht ran. Und später … Das Stück war ja auch verboten.
1943. Als Stenotypistin. Keine hundertfünfzig Silben oder so was Verrücktes, aber … Stellen waren in der Zeit leicht zu … Die Männer waren doch alle … Barras. Komisches Wort eigentlich.
Beim Militär.
Doch, doch, Ihr Deutsch ist ganz gut. Ziemlich gut.
Stenotypistin. Tippse. Außerdem sah ich damals wirklich gut aus. Das zählt immer auch etwas. Nicht nur beim Film. Ein ganz junges Mädchen. Meine Eltern waren überhaupt nicht damit einverstanden, dass ich allein nach Berlin … Meine Mutter … Machte sich Sorgen um meine Jungfräulichkeit.
[Langes Lachen, Husten]
Nehmen Sie die Kopfhörer halt so lang ab.
Damals war Berlin der Nabel der Welt. Wenig später war es der Arsch, aber damals … Wir hatten zwar schon aufgehört zu siegen, aber … Man merkt das nicht gleich. Heute ist man natürlich klüger, aber damals … Man hatte ja kein Buch, wo die Zukunft schon … Und wenn, hätte ich es nicht gelesen. Ich war so jung. »Du bist wie der Frühling«, hat jemand zu mir gesagt. Nicht irgendjemand. Reinhold Servatius. Der Regisseur. Sie werden den Namen kennen, als Wissenschaftler. »Wie der Frühling.« Das hat er gesagt. Wenn man mich heute ansieht, kann man sich das nicht mehr …
Nett, dass Sie das sagen. Ich weiß, wie ich aussehe. Nachts im Lokal geht’s ja noch. Wenn die Beleuchtung … Da sieht man nur, was man sehen soll. Aber jetzt am Tag? Wenn Sie Filmaufnahmen hätten machen wollen … Aber Sie wollen ja nur mit Ihrer Uher … Ich hätte nein gesagt. Mit einer Narbe im Gesicht gehört man nicht mehr vor die Kamera.
Zuerst in einer Kleiderfirma. Berghäuser und Co. Uniformen natürlich, das war damals das große Geschäft. Ein bisschen Mode. Für die Frauen von den Uniformierten. Und die kleinen Freundinnen, die sie sich nebenher hielten. Alle. Fast alle. Ich könnte Ihnen Geschichten erzählen. Von ganz bekannten Persönlichkeiten, die heimlich … Aber das ist ja nicht Ihr Thema.
Damals war es noch üblich … Heute nicht mehr, aber damals … Jede Firma hatte ihre eigenen Mannequins. Um den Kundinnen die Modelle … Und den Kunden natürlich. Die mussten ja am Ende die ganze Schönheit bezahlen. Kleidervorführerinnen. Das andere Wort war ihnen zu französisch. Bei Berghäuser sagten wir Mannequins. Ich hatte genau die richtige Figur dafür. Nicht so spindeldürr, wie sie heute … Wenn man das im Fernsehen … Modeschauen. Wo man immer das Gefühl hat, man hört die Knochen klappern. Ein bisschen was musste man schon auf den Rippen …
Das war natürlich ein interessanterer Job als bloß im Büro. Interessantere Leute. Man kam sich schnell näher, damals. Wenn so einer für gerade mal zwei Wochen auf Heimaturlaub war, dann … Sie hatten es alle eilig.
Wollen Sie wirklich keine Zigarette? Ich komme mir doof vor, wenn ich hier so ganz allein herumhuste.
[Pause]
Wo waren wir? Mannequin, ja. Mit Frontoffizieren habe ich mich nie eingelassen. Prinzipiell. Die waren immer … Zu schnell wieder weg. Da hatte man nichts von. Die andern, die sich einen Druckposten … Wenn sie in Berlin … Die konnten einem schon sehr viel nützlicher sein. Auch beruflich.
Einer … Mit Vornamen hieß er Rainer, den Rest weiß ich nicht mehr. Etwas Wichtiges im Vorstand der UFA. Vielleicht können Sie herausfinden, wer das war. Sie als Forscher. Der Name würde mich interessieren.
Nein, eigentlich nicht mehr.
Der hat mir die erste Rolle beim Film … Bloß bessere Statisterie, aber ich war … Stolz wie Oskar. »Sehr wohl, gnädige Frau«, das war mein einziger Satz. »Sehr wohl, gnädige Frau.« Als der Film fertig war … Herausgeschnitten. Mein einziger Satz.
Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas mit »Liebe«. Ist doch nicht wichtig, wie der Streifen … Später habe ich größere Rollen … Keine großen, aber größere.
Das hatte dann schon nichts mehr mit dem Rainer zu tun. Der war nur … Affäre ist ein guter Ausdruck. Passend. Das hat mir der Werner später mal … Der hatte es mit den Worten.
Werner Wagenknecht. Der Drehbuchautor. Den kennen Sie nicht? Ich denke, Sie sind Wissenschaftler. Wenn auch noch furchtbar jung. Aber ihr Amerikaner macht ja alles mit Tempo. Also mit dem Werner war es so …
Wie Sie meinen. Der Reihe nach. Wo waren wir stehengeblieben? Affäre, ja. Kommt aus dem Französischen, hat der Werner gesagt. Dort heißt es »Geschäft«. Passt gut zu dem, was ich mit dem Rainer hatte. Es war ein faires Geschäft. Er hat mir eine Rolle besorgt, und ich habe es ihm …
[Lachen, Husten]
Furchtbar, diese Husterei. Geben Sie mir Feuer. Früher hat man einer Dame ganz automatisch Feuer gegeben. Das waren andere Zeiten.
[Pause]
Ich hab dann einen Vertrag mit der UFA … Nichts Großes, keine eigene Garderobe oder so. Aber eben doch UFA. Nur wegen des Geldes hätte ich auch bei Berghäuser …
Das ist eine verdammt unhöfliche Frage. Warum? Weil ich Talent hatte, darum. Weil ich gut zu fotografieren war, von allen Seiten. Auch das Gesicht, damals. Nur die wirklich guten Beziehungen … Ich war ja neu in dem Geschäft.
Wenn ich zum Beispiel mit dem Walter Arnold zusammen gewesen wäre … Ich hab’s probiert. Heute kann ich das ja sagen. Eine alte Frau darf alles sagen. Es wär mir auch nicht schwergefallen. Ein attraktiver Mann. Äußerlich. Damals wusste ich noch nicht, was er … Damals war ich noch naiv.
Einmal waren wir sogar zusammen tanzen, ganz offiziell. Der Walter Arnold und ich. Ein Wohltätigkeitsball. Winterhilfe oder was man damals … Der Kleinpeter hatte das … Der Herstellungsleiter. Ein Kleid hatte ich an, davon träume ich heute noch. Allererste Sahne. Nach so was hätten sie sich bei Berghäuser … Ausgeliehen natürlich nur. Der Kleinpeter hatte überall seine Kontakte.
Der Zweck der Übung war … Man sollte uns zusammen sehen. Fotografieren. Ich kann mir heute noch in den Hintern beißen, dass ich die Zeitschrift nicht mehr habe. Für die Frau. Ein großes Foto und darunter … »Das neue Traumpaar?« Nur mit Fragezeichen, aber immerhin. Traumpaar. Walter Arnold und Tiziana Adam. Ein großes Bild. Das war die Sorte Klatsch, die sie in der Reklameabteilung …
Er war der perfekte Gentleman. Solang wir dort waren. Champagner und Pralinen und das ganze Pipapo. Küsschen. Tanzte wie ein Engel. [Summt den Anfang einer Walzermelodie] Man hätte meinen können … Man sollte ja auch meinen.
Hinterher … Nicht einmal nach Hause gebracht. Geschweige denn … Gar nichts. Hat mir eine Taxe bestellt. Die durfte ich auch noch selber … Immerhin: Der Kleinpeter hat mir das zurückerstattet. Als Dienstfahrt.
Wenn Sie mich fragen: Beim Walter Arnold war immer nur alles Fassade. Auch seine Verführungskünste. Eine Frau spürt so etwas. Eine Rolle. Solang die Kamera lief, war er … Oder wenn ein Fotograf da war. Aber sonst? Alles Fassade. Und dahinter … Ich könnte Ihnen Dinge erzählen …
Haben Sie Zigaretten? Meine sind alle.
Manuskript Samuel A. Saunders
Tiziana Adams Erinnerungen sollten in meiner Arbeit eine kleine Ergänzung zu den trockenen Fakten werden. Jemand, der die Leute noch persönlich gekannt hat.
Die großen Namen, so weit sie noch lebten, waren schon alle abgegrast. Tausendmal interviewt. Titi war noch unverbraucht. Gerade, weil sie kein Star gewesen war, noch nicht einmal ein Starlet, bestand die Chance, von ihr eine neue Sicht auf Personen und Ereignisse vermittelt zu bekommen. Nicht zuverlässig natürlich – oral history ist selten wirklich zuverlässig –, aber interessant.
Außerdem, das behaupteten zumindest die Kollegen vom Murnau-Archiv, war sie eine eifrige Sammlerin von Dingen aus jener Zeit. Es sei unglaublich, was sie alles gehortet habe, schwärmten mir die beiden vor, eine wahre Schatzgrube für filmhistorische Entdeckungen. Zuerst nahm ich das nicht ernst, war fest davon überzeugt, dass sie sich nur wieder einen Jux mit mir machten. Eine Wand voll alter Starporträts ist kein Material für wissenschaftliche Forschungsarbeit.
Bis mir Titi dann ihre Schätze zeigte. Nicht auf Anhieb, sondern erst, als sie nach mehreren Interviews Vertrauen zu mir gefasst hatte.
In ihrer kleinen Wohnung über der Kneipe stapelten sich Bananenkisten voller Erinnerungsstücke. Das meiste davon wertloser Krempel, Dinge, die sie nur aufbewahrte, um sich selber zu beweisen, dass sie tatsächlich einmal beim Film gewesen war. Aber da war auch anderes, Überraschendes. Eine originale alte UFA-Filmklappe, der Name des Films, der dort einmal gestanden hatte, mit einem spitzen Gegenstand ausgekratzt. Eine Pistole, die sie mir aus der Hand riss, als ich sie mir näher ansehen wollte. »Sie ist noch geladen«, sagte sie. Ich weiß bis heute nicht, ob das der Wahrheit entsprach oder nur ihrem Sinn für Dramatik. Funktionstüchtig war die Waffe auf jeden Fall, das hat sich dann später auf tragische Weise herausgestellt. »Eine Walther P38«, sagte sie. Der Fachausdruck hörte sich aus ihrem Mund seltsam an, aber sie schien stolz darauf zu sein, ihn zu kennen.
Und Dokumente. Mehrere Waschpulverkartons voller Papiere. Als ich sie endlich lesen durfte – nur bei ihr in der Wohnung, mitnehmen durfte ich nichts –, brachte mich der Geruch immer wieder zum Niesen. Ich konnte es erst kaum glauben, aber bei dieser schrillen alten Dame war ich auf das gestoßen, was sich jeder Wissenschaftler wünscht: eine Informationsquelle, die noch niemand ausgewertet hatte. Und, das war das Wichtigste, auf eine Geschichte, die sehr viel interessanter war als nur eine Chronologie der beim Zusammenbruch des Dritten Reichs nicht fertiggedrehten Filme und ihrer Mitarbeiter.13
Interview mit Tiziana Adam
(6. August 1986)
Es war keine große Rolle. Zuerst nicht. Dann wurde sie immer größer und zum Schluss … Zum Schluss war da überhaupt nichts mehr. Nicht für mich. Es ist eine lange Geschichte.
Haben Sie die Zigaretten mitgebracht? Man muss sich auch mal was leisten, wenn ein anderer bezahlt.
[Lachen, Husten]
Es hat keinen Sinn, dass Sie mir auf den Rücken … Das nützt überhaupt nichts. Überhaupt: Wer mehr hustet, raucht dafür weniger.
Lied der Freiheit hieß der Film. Regie: Reinhold Servatius. Drehbuch: Frank Ehrenfels. Müssten Sie eigentlich kennen, Herr Wissenschaftler. Das ist doch genau einer von den Streifen, die Sie … Nie fertiggedreht.
Es gibt eine Menge Dinge, die auf keiner Liste stehen und trotzdem … Lied der Freiheit, ja. Song of … Was immer »Freiheit« auf Amerikanisch heißt.
Liberty. Wie eure Schiffe damals im Krieg. Song of Liberty. Eigentlich sollte es so ein Historienschinken … Krieg gegen Napoleon, heldenhafter Tod des Publikumslieblings, allgemeine Rührung. Alles auf Kammerspiel. Keine Schlachtenszenen und so was. Der Krieg dauerte schon ein paar Jahre, da war die Soldaterei nicht mehr so … Nicht mehr publikumswirksam. Am Schluss wird seine Leiche ins Schloss getragen, und die Reichsklagefrau …
Ich denke, Sie kennen sich aus. Die Reichsklagefrau, das war Maria Maar. Die ist Ihnen aber schon …? Immerhin. Das war ihr Übername. Es gab die Reichswasserleiche, das war die Kristina Söderbaum, und die Reichsklagefrau, das war eben die Maar. Weil die eine so schön sterben konnte und die andere … Die Maar heulte Ihnen aufs Stichwort, da brauchte die Maske nicht mal mit Glyzerin …
Lied der Freiheit. Vielleicht hätten sie den Namen auch noch geändert, wie alles andere. Es ging vieles durcheinander in den letzten Tagen.
Der Reihe nach, ja, ja, ja. Sie sind doch der, der hier ständig unterbricht.
Ursprünglich sollte es eine reine Studioproduktion werden. Atelier 2, nicht das ganz große. Ein kleiner Film, ohne Massenszenen. Außer der einen, wo die Soldaten im Saal des Schlosses … Sie verlangen vom Herzog, dass er sie in die Schlacht … Vom Großherzog.
Das war auch so eine Sache. Typisch. Im allerersten Drehbuch war er noch ein gewöhnlicher Herzog gewesen. Aber dann hat jemand … So ein Schreibtischgenie aus der Dramaturgie. Hat herausgefunden, dass man nur einen Großherzog mit »Königliche Hoheit« anspricht, während ein gewöhnlicher Herzog … So wurde er dann befördert. Wir durften die Änderung nicht selber in den Text reinschreiben, sondern in allen Büchern mussten die entsprechenden Seiten neu … Für so einen Scheiß hatten sie noch Zeit damals. Und Material. Dabei war Papier schon … Alles war Mangelware. Auf den Klos zum Beispiel …
Ach ja, wenn Sie morgen weitermachen wollen … Wenn es wirklich so wichtig für Sie ist … Bringen Sie doch bitte zwei Packungen Klopapier mit. Ich schlepp mich jedes Mal krumm an dem Zeug. Ich geb Ihnen meine Kundenkarte vom Cash and Carry und damit … Sie können auch für sich selber … Da sparen Sie eine Menge Geld. Sind allerdings alles Großpackungen. Aber wenn Sie sich mit Ihren Kollegen zusammentun …
Ja doch.
Lied der Freiheit. Walter Arnold war der junge Herzog … Großherzog. So ein Hamlet-Verschnitt für Arme. Im ersten Akt eiert er nur rum, von wegen »Wir haben doch keine Chance«. Im zweiten entschließt er sich zu kämpfen, und im dritten … Kommt als Leiche nach Hause. Dafür ist Napoleon besiegt und Deutschland endlich wieder … Muss man auch nicht lang überlegen, warum die sich so eine Geschichte … 1944.
Also: der Walter Arnold, die Maar als alte Großherzogin, der Augustin Schramm als Hofmarschall und … Den Schramm kennen Sie aber schon? Eben. Der war ja in der Zeit gewissermaßen unvermeidlich. »Wenn die UFA zwei Filme dreht, ist der Schramm in dreien drin.« Das war damals der Kantinenschnack. Immer die gleiche Rolle: der fröhliche Dicke mit dem Herzen aus Gold. Lebt auch schon nicht mehr, der Arme. Ich wäre ja zu seiner Beerdigung … Gar nicht so weit weg. In Frankfurt. Ich habe es zu spät … Man hat sich aus den Augen … Seine Autogrammkarte hängt dort drüben. Links vom runden Tisch. Mit persönlicher Widmung. Auch ein Foto, das Sie nicht erkannt haben.
Die andern weiß ich nicht mehr. Die waren ja nur bei der Leseprobe … Und nachdem es dann im Atelier gebrannt hat …
Ja doch. Obwohl: Sie könnten mich auch einfach erzählen lassen. Sich die Dinge selber hintereinander sortieren. Hinterher. Aber wie Sie wollen. Nur noch schnell eine Zigarette …
[Pause]
Meine Rolle? Am Anfang bloß Kammerzofe der Großherzogin. Später dann …
Ja doch.
Zugegeben, es war keine Hauptrolle. Nichts, wofür man die Filmnadel in Gold … Aber für mich die ganz große Chance. Ich hatte immerhin drei Szenen mit der Maar, nur wir beide. Natürlich, den ganzen Text hatte sie, und ich immer nur die Gurkenscheibchen.
Gurkenscheibchen. Kennen Sie den Ausdruck nicht? Was man bei einem Sandwich auch noch dazupackt, damit das Fleisch nicht so allein ist. Kleine Sätze. So Zeug, dass man beim Schnitt … Weil es für die Handlung nicht wichtig … »Das Kleid mit den Seidenbändern, Königliche Hoheit?« und so was alles. Gurkenscheibchen eben. Aber egal: Dialog mit Maria Maar. Das war nicht nichts, für eine Anfängerin. Man konnte sich immerhin zeigen. Nur das Kostüm, das sie für mich vorgesehen hatten … Wie so ’ne Nonne. Der Rock viel zu lang. Als ob man was verstecken müsste. Dabei hatte ich sehr schöne Beine. Habe ich immer noch. Meine Beine sind das Einzige, was sich gehalten hat. Wollen Sie mal sehen?
Süß. Der Bubi ist erschrocken. Hast du Angst, dass die böse Oma dich vernaschen will? [Lachen]
In der Kostümabteilung haben sie gesagt, ein kürzerer Rock wäre nicht stilgerecht. Stilgerecht, du lieber Gott! Als ob auch nur ein einziger Zuschauer … Man geht doch nicht ins Kino, um eine Lektion in Kostümkunde zu kriegen. Wieder mal was Nettes sehen, dafür … Wenn die Rökk in ihren Filmen lange Kleider getragen hätte – keine Sau hätte sich ihre Hopsereien ansehen wollen. Aber da war nichts zu machen. Das war mein Kostüm und damit basta. Ich war richtig froh, als es dann … Nicht bei dem Brand im Atelier. Bei dem andern Brand. Als wir auf dem Weg …
Nö, sag ich Ihnen noch nicht. Sie wollen doch, dass ich der Reihe nach …
Drei Szenen mit der Maar. Was uns doch gewissermaßen zu Kolleginnen … Aber sie hat mich behandelt wie den letzten Dreck. Immer nur von ganz oben herab. Als ob sie ein Fernglas brauchte, um ein Nichts wie mich überhaupt nur … Ich hab’s versucht. Hab’s wirklich versucht. »Es ist mir eine große Ehre, mit Ihnen vor der Kamera stehen zu dürfen, gnädige Frau« und all so was. Aber sie? Hoch vom Himmel komm ich her.
Und dann hab ich Scheiße gebaut. Mein Gott, ich war jung und dumm. Jung bin ich nicht mehr, nur dumm.
Sie könnten mir ruhig widersprechen.
Ich habe doch tatsächlich … Nein, das erzähle ich Ihnen morgen. Wenn Sie das Klopapier … Zwei Großpackungen. Zweilagig, das reicht. Die Leute sollen zum Trinken zu Titi kommen und nicht zum Scheißen.
Seite aus dem Drehbuch Lied der Freiheit
(1. Fassung)14
Privatkabinett des Großherzogs. Innen. Tag.
Der Großherzog hinter seinem mit Papieren überladenen Schreibtisch. Er studiert ein Dokument. Hofmarschall Wackerstein wartet in unterwürfiger Haltung.
Der Großherzog taucht die Feder ins Tintenfass, will unterschreiben, zögert. Stützt nachdenklich den Kopf in die Hand.
Wackerstein hüstelt mahnend.
Der Großherzog schreckt aus seinen Gedanken auf. Unterschreibt das Dokument, reicht es Wackerstein.
Wackerstein nimmt das Dokument mit einer tiefen Verbeugung.
WACKERSTEIN
Königliche Hoheit … Will sich rückwärtsgehend entfernen. Wedelt dabei mit dem Dokument, um die Tinte zu trocknen.
GROSSHERZOG
Sag Er einmal, Wackerstein …
Wackerstein bleibt stehen.
WACKERSTEIN
Königliche Hoheit?
GROSSHERZOG
Sag Er einmal, versteht Er den Napoleon?
WACKERSTEIN
Zu Befehl, Königliche Hoheit, ich verstehe ihn sehr gut. Ich wage sogar zu behaupten: Ich fühle mich ihm verwandt.
GROSSHERZOG überrascht
Verwandt? Kann Er mir diese Verwandtschaft erklären?
WACKERSTEIN
Sehr wohl, Königliche Hoheit. Ich trinke gern mal einen guten Schluck, und Napoleon, scheint mir, ist ein Säufer. Allerdings einer, der sich nicht am Wein berauscht, sondern an Schlachten. Und wie jeder Säufer weiß er nicht rechtzeitig aufzuhören. Das ist der Augenblick, wo er ins Schwanken gerät. Wenn man ihn in diesem Augenblick15
Interview mit Tiziana Adam
(7. August 1986)
Sie können das Ding gleich wieder ausschalten. Ich habe heute … Keine Lust. Keine Kraft. Ich bin kein junges Mädchen mehr.
Nein, wirklich. Heute nicht. Wir haben ja schließlich keinen Vertrag …
Klopapier? Was interessiert mich …? Ach so. Auf Ihre Kosten? Wissen Sie, was das ist? Ein Scheißhonorar ist das. [Lachen]
Ein Scheißhonorar. Verstehen Sie? Sind eigentlich alle Amerikaner so humorlos?
Na schön. Aber heute nicht so lang. Ich bin müde. Über was soll ich …?
Die Dummheit, die ich damals …? Dummheit ist untertrieben. Das war so was von … Wenn’s für Blödheit eine Olympiade gäbe, hätte ich die Goldmedaille … Mit Eichenlaub und Schwertern. Ich war noch so furchtbar jung. Hinterher kann man gar nicht mehr glauben, wie jung man einmal war. Sie werden das auch noch …
Es war, weil mich die Maar so herablassend … Als ob ich wirklich ihre Kammerzofe wäre, nicht nur als Rolle. Einmal hat sie mich vor allen Leuten … Weil ich es gewagt hatte, mich im Atelier eine Sekunde lang auf ihren persönlichen Stuhl zu setzen. Hat mich fertiggemacht, das können Sie sich überhaupt nicht … Als ob ich mindestens einen Altar geschändet … Auf ein Hitlerbild gespuckt.
Zu wichtigen Leuten war sie dafür zuckersüß. Wenn einer politischen Einfluss hatte oder Verbindungen nach ganz oben, dann … Ein Lächeln wie türkischer Honig. Gibt’s das eigentlich heute noch? So ein klebriges Zeug, das man aus den Zähnen nicht mehr rauskriegt?
Blöd von mir. Sie können das gar nicht kennen. Sie sind Amerikaner.
Der Schramm zum Beispiel … Hat ihn immer nur angelächelt. Weil man von dem wusste … Er gehörte zu einer Saufrunde von ganz wichtigen Leuten. Lauter Bonzen und Goldfasane. Für die war er so eine Art Hofnarr, glaube ich. Hat den Komiker gegeben, und dafür durfte er bei ihren Kameradschaftsabenden … Für die Kinder hatten sie kaum mehr Milch, aber für die Herren … Champagner wie Wasser. Wenn der Augustin mit denen gesoffen hat, war er dann am nächsten Morgen jedes Mal … In der Maske wussten sie nicht, wie sie ihn wieder als Mensch … Dabei war er gar kein Hundertprozentiger. Nicht dunkelbraun. Überhaupt nicht. Parteigenosse, natürlich. Das waren sie alle. Das musste man damals einfach … Aber sonst … »Ich bin kein großer Schauspieler«, hat er mal zu mir gesagt. »Aber ich komme mit allen Leuten gut aus. Das ist das Wichtigste in unserem Gewerbe.«
Sie wollen doch, dass ich Ihnen die Dinge erkläre.
Beim Augustin, weil der eben die richtigen Beziehungen hatte, machte die Maar auf charmant. Aber zu mir … Da hab ich mir gedacht: Ich muss dafür sorgen, dass sie mich auch für etwas Wichtiges halten. Und am Anfang hat es ja auch funktioniert. Bis dann …
Können wir nicht morgen? Mir fehlt mein Schönheitsschlaf. Gestern sind die Leute mal wieder … Bis in die Puppen. Manchmal muss man ein Glas mittrinken als Wirtin, sonst sind sie beleidigt.
Na schön. Geben Sie mir noch mal Feuer, und dann … Bringen wir’s hinter uns.
[Pause]
Ich hab halt so Andeutungen gemacht. Immer mal wieder eine Bemerkung fallenlassen, wie aus Versehen. Von wegen, ich hätte da einen Verehrer, das wäre ein ganz wichtiger Mann, auch für die UFA. Der würde mich protegieren. Habe mir Rollen versprochen. Die andern würden schon sehen. Das hat sie natürlich spitz gemacht wie … Wollten immer noch mehr … Haben mich regelrecht ausgefragt. Und ich immer nur: Diskretion und zur Verschwiegenheit verpflichtet, und meine Lippen sind versiegelt. Was die Leute halt neugierig macht.
Hat auch bestens funktioniert. Die Maar wurde scheißfreundlich. Die konnte da umschalten, wie’s ihr gerade passte.
Aber ich hab’s dann … Übertreibung ist der größte Fehler. Ich war eben noch keine erfahrene Schauspielerin. Bin auch keine mehr geworden. Habe nicht mehr die Chance … Das Talent wäre da gewesen, das haben mir viele Leute gesagt. Fachleute.
Mein Beschützer, habe ich Rindvieh erzählt, hinke zwar ein bisschen, aber das mache ihn nur … Wenn es um Filme gehe, habe keiner so viel zu sagen wie er. Einen Namen habe ich nicht genannt, so blöd war nicht einmal ich, aber die andern haben natürlich gedacht …
Sie können sich ja denken, was sie gedacht haben.
Goebbels. So eine blöde Kuh war ich.
Eigentlich gehört das ja nicht zu Ihrem Thema. Kann Ihnen für Ihre Arbeit gar nichts … Können wir es nicht einfach …?
Es wäre mir wirklich lieber, wenn wir …
Ja doch. Wenn’s denn sein muss. Aber morgen fahren Sie noch einmal zum Cash and Carry für mich.
Mitten in der Nacht hat bei mir das Telefon geklingelt. Ich hatte damals eine hübsche kleine Wohnung. Schlüterstraße, Ecke Mommsen. Die hatte mir so ein Warenhausheini eingerichtet, den ich bei Berghäuser … Aus schlechtem Gewissen, weil er seine Frau dann doch nicht … Das Schlafzimmer ganz in hellrosa Schleiflack. Ich liege im Bett, und da kommt ein Anruf. Mitten in der Nacht. Am frühen Morgen. Gegen vier Uhr. Ein Mann, der hat sich nicht vorgestellt, keinen Namen genannt, gar nichts, sondern gleich angefangen, Fragen zu stellen. Immer wieder dieselben Fragen. Wie das mit meinem Freund sei, wann ich ihn zum letzten Mal getroffen habe, und was der denn immer so treibe. Lauter solche Sachen. Und im Hintergrund … Männer, die haben gelacht. So auf ganz rohe Weise gelacht. Ich habe mir vor Angst in die Hosen … Das ist jetzt nicht nur so ein Ausdruck, ich habe mich tatsächlich … Das schreiben Sie aber bitte nicht in Ihre Arbeit. Bepinkelt habe ich mich. Weil ich gedacht habe: Jetzt ist alles aus. Jetzt kann ich nur noch die Zahnbürste einpacken und darauf warten, dass sie mich …
Was ist das für eine saudumme Frage? »Nur wegen eines Anrufs?« Natürlich wegen eines Anrufs. Sie haben nicht in der Zeit gelebt. Sie kennen so was nicht. Ich hatte eine Geschichte über Goebbels erfunden, das war damals schlimmer als Mord und Totschlag. Da konnte man gleich einen Witz über den Führer … Erklären, dass der Krieg nicht zu gewinnen sei.
Ich habe natürlich versucht, mich herauszureden. Hab auf naives Dummchen gemacht und so getan, als ob ich überhaupt nicht verstünde, von was er … Ich hätte überhaupt keinen Freund, würde an Männer nicht einmal denken, die Filmerei ließe mir überhaupt nicht die Zeit dazu. Der Mann hat mir nicht geglaubt, das habe ich ganz deutlich gemerkt, ganz streng ist er geworden und … Er könne auch andere Saiten … Es sei nicht das letzte Mal, dass ich von ihm gehört habe, da könne ich mich drauf verlassen, ganz bestimmt nicht das letzte Mal. Dann hat er eingehängt.
»Und dann? Und dann?« Was soll die doofe Fragerei? Und dann nichts. Ich war ja dann bald nicht mehr in Berlin. Aus der Wohnung bin ich ausgezogen. Noch am selben Tag. Habe alles zurückgelassen. Hellrosa Schleiflack, das war damals das Schickste, was man haben konnte. Und im Wohnzimmer zwei Sessel mit echtem Damast. Beinahe echt. Ein Köfferchen habe ich mitgenommen, und sonst gar nichts.
Zu meinem Freund. Meinem Exfreund. Wir hatten uns … Ich sage jetzt mal: getrennt. Ich bin ihm weggelaufen. Aber er war immer noch … Verliebt wie ein Schulbub. Hat überhaupt nichts gefragt, als ich mit meinem Köfferchen … Hat nur gesagt: »Wenn ich gewusst hätte, dass du kommst, hätte ich das Bett frisch bezogen.«
Nein, ich habe nicht geglaubt, dass sie mich bei ihm nicht … Ganz blöd war ich auch nicht. Wo sie mich im Atelier … Es war etwas anderes. In meiner Wohnung hätte ich nicht mehr ruhig schlafen können. Hätte nur noch pausenlos Angst gehabt, dass das Telefon wieder … Werner hatte kein Telefon.
Werner Wagenknecht. Der das Drehbuch zu Lied der Freiheit geschrieben hat.
Sie brauchen gar nicht in Ihren Notizen nachsehen. Ich weiß, dass ich Ihnen einen anderen Namen gesagt habe. Frank Ehrenfels. Das ist der Werner.
Ausdruck aus Wikipedia
Werner Wagenknecht
Werner Wagenknecht (*31. Mai 1898 in Fürstenwalde; †20. April 1945 in Kastelau) war ein deutscher Schriftsteller und Drehbuchautor.
Leben [Bearbeiten]
Jugend- und Kriegszeit (1898–1918) [Bearbeiten]
Werner Wagenknecht wurde am 31. März 1898 in Fürstenwalde/Spree als Sohn des Postbeamten Othmar Wagenknecht und seiner Frau Sophie geboren. Der Vater verstarb früh, ein einschneidendes Ereignis, das Wagenknecht später in einem autobiografischen Roman verarbeitete.
Wagenknecht besuchte das städtische Gymnasium Fürstenwalde (heute Geschwister-Scholl-Gymnasium), das er 1916 mit dem Notabitur abschloss. Er wurde als Soldat eingezogen, diente Manuskript Samuel A. Saundersaber wegen schwacher Konstitution nur in einer Schreibstube.
Nach Kriegsende begann er ein Studium der Germanistik an der Humboldt-Universität Berlin. Er verließ die Universität ohne Abschluss.
Literarische Anfänge (1919–1924) [Bearbeiten]
Wagenknechts erste Gedichte zeigen noch stark expressionistische Züge, beeinflusst vor allem durch Georg Trakl. Schon sehr bald wandte er sich der Prosa und einer immer realistischeren Schreibweise zu. Vereinzelte in Zeitschriften veröffentlichte Kurzgeschichten stießen noch auf keinen größeren Widerhall. Wagenknecht verdiente seinen Lebensunterhalt mit dem Verfassen von Zwischentiteln für Stummfilme.
Die Zeit der Erfolge (1925–1933) [Bearbeiten]
Mit dem Roman Kommando Null (1925), einer bitteren Abrechnung mit der Sinnlosigkeit des Krieges wurde Wagenknecht schlagartig einem größeren Publikum bekannt. Das Werk wurde – zum Beispiel von Carl von Ossietzky in der Weltbühne – enthusiastisch gelobt, zum Teil aber auch aus politischen Gründen scharf angegriffen. Bei der Verleihung des Buchpreises der Pazifisten kam es sogar zu Krawallen.
Wagenknecht war nun in der Lage, sich ganz der Schriftstellerei zu widmen. Es gelang ihm aber zunächst nicht, mit weiteren Werken an den Erfolg seines Erstlings anzuknüpfen. Der sehr persönliche Erinnerungsband Zu zweit allein wurde zwar von der Kritik wohlwollend besprochen, erreichte aber keine hohe Auflage.
Er arbeitete deshalb gleichzeitig als Drehbuchautor, vor allem für die UFA, eine Tätigkeit, die er einmal als »Tage am Fließband« bezeichnete. Mit dem Aufkommen des Tonfilms wurde vor allem sein Talent für lebensechte Dialoge immer mehr gefragt. Wagenknecht schrieb die Drehbücher für mehrere erfolgreiche Filme.
Mit dem Roman Stahlseele (1930) gelang ihm ein weiterer großer Erfolg. Das sozialkritische Werk schildert das mühsame Leben einer Berliner Arbeiterfamilie in den Jahren von Weltwirtschaftskrise und Inflation. Die Hauptfigur, der ehemalige Soldat Manni Trost, verliert seine Anstellung in einer Kabelfabrik (wo – daher der Buchtitel – Kabel mit »Drahtseele« hergestellt werden) und rutscht immer mehr ins Elend ab. Er wird kriminell, tritt schließlich, aus Verzweiflung, nicht aus Überzeugung, einem SA-Sturm bei und kommt bei einer Straßenschlacht ums Leben. Das negative Fazit des Buches, vor allem die letzten Worte der Hauptfigur (»Sinnlos! Es war alles sinnlos!«) lösten von Seiten der Nationalsozialisten erbitterte Proteste aus, die aber den Erfolg des Werks nicht verhindern konnten.
Zeit des Nationalsozialismus (1933–1945) [Bearbeiten]
Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten wurde Werner Wagenknecht zur Unperson. Im Rahmen der Aktion »Wider den undeutschen Geist« wurden seine Bücher am 10. Mai 1933 öffentlich verbrannt.
Da Wagenknechts Werke als »volksschädlich« eingestuft waren, wurde ihm die Mitgliedschaft in der Reichsschriftumskammer verweigert, was ein totales Publikationsverbot bedeutete. Obwohl er aus denselben Gründen auch nicht Mitglied der Reichsfilmkammer werden konnte, schrieb er unter verschiedenen Pseudonymen (Werner Anders, Anton Helfer u.a.) weiterhin Drehbücher für die UFA.