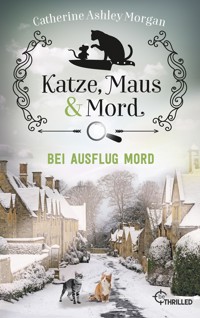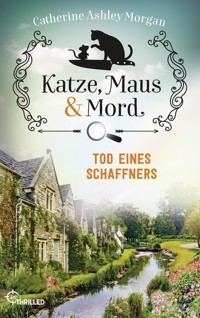4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Katzen mit der Spürnase
- Sprache: Deutsch
Catherine Ashley Morgan ist ein Pseudonym des Autors Ralph Sander, der mit seiner Katzen-Krimi-Serie "Kater Brown" viele Leserinnen und Leser begeistert
Willkommen beim »Mörderspiel«! Auf einer kleinen Insel im Südwesten Englands veranstaltet der Geschäftsmann Siddarth Kapoor regelmäßig eine unterhaltsame Jagd nach einem imaginären Mörder. Diesmal ist sogar eine echte Polizistin eingeladen, um das Spiel noch spannender zu machen: DCI Anne Remington. Doch aus dem Spiel wird schnell Ernst, als ein echter Mord geschieht. Und dann wird auch noch ein Anschlag auf Kapoors wertvolle Katze Phaedra verübt! Anne sucht unter den Gästen des Mörderspiels nach dem Täter und erkennt bald, dass dieser vor nichts zurückschreckt ...
Bei diesem Katzen-Krimi handelt es sich um eine eBook-Neuauflage von »Der Tod hat schwarze Tatzen« von Catherine Ashley Morgan um DCI Anne Remington und ihre samtpfotigen Helfer.
Alle Bände der Reihe um Christine und Isabelle bei beTHRILLED:
Katze, Maus und Mord - Ein rätselhafter Nachbar
Katze, Maus und Mord - Die verhängnisvolle Botschaft
Katze, Maus und Mord - Tod eines Schaffners
Katze, Maus und Mord - Das tödliche Drehbuch
Und hier ermittelt Anne Remington:
Katze, Maus und Mord - Die Entführung der Lady Agatha
Katze, Maus und Mord - Ein tödliches Spiel
Katze, Maus und Mord - Bei Ausflug Mord
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 495
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Cover
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Epilog
Über die Autorin
Weitere Titel der Autorin
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
vielen Dank, dass du dich für ein Buch von beTHRILLED entschieden hast. Damit du mit jedem unserer Krimis und Thriller spannende Lesestunden genießen kannst, haben wir die Bücher in unserem Programm sorgfältig ausgewählt und lektoriert.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beTHRILLED-Community werden und dich mit uns und anderen Krimi-Fans austauschen möchtest. Du findest uns unter be-thrilled.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich auf be-thrilled.de/newsletter für unseren kostenlosen Newsletter an.
Spannende Lesestunden und viel Spaß beim Miträtseln!
Dein beTHRILLED-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
Willkommen beim »Mörderspiel«! Auf einer kleinen Insel im Südwesten Englands veranstaltet der Geschäftsmann Siddarth Kapoor regelmäßig eine unterhaltsame Jagd nach einem imaginären Mörder. Diesmal ist sogar eine echte Polizistin eingeladen, um das Spiel noch spannender zu machen: DCI Anne Remington. Doch aus dem Spiel wird schnell Ernst, als ein echter Mord geschieht. Und dann wird auch noch ein Anschlag auf Kapoors wertvolle Katze Phaedra verübt! Anne sucht unter den Gästen des Mörderspiels nach dem Täter und erkennt bald, dass dieser vor nichts zurückschreckt ...
Catherine Ashley Morgan
Katze, Maus und Mord – Anne Remington ermittelt
Ein tödliches Spiel
Prolog
Feuchte, kalte Luft schlug dem Mann entgegen, als er die rostige Eisentür öffnete. Er fasste den Bewusstlosen unter den Achseln, dann hob er ihn an und zog ihn durch den Gang bis zur nächsten Tür. Bis dort waren es zwar nur ein paar Meter, aber das änderte nichts daran, dass der Ballast, den er von der Stelle bewegen musste, mehr wog als vermutet.
»Du hättest dich auch vor dem Abendessen von mir erwischen lassen können«, beklagte er sich schwer atmend. »Dann hättest du dir wenigstens nicht mehr so die Wampe vollgeschlagen.«
Er könnte den Bewusstlosen auch einfach unter Wasser drücken, bis er tot war, und ihn dann irgendwo am Ufer ablegen, doch dann würde es vielleicht eher nach einem Unfall aussehen, und einen solchen Eindruck wollte er doch unbedingt vermeiden.
Schnaufend zog er den Mann weiter durch den Gang, bis die andere Tür erreicht war, die nur von dieser Seite als solche erkennbar war, während man sich für die im Gebäude selbst gelegene Seite eine raffinierte Tarnung ausgedacht hatte, die sie für jeden nichts ahnenden Betrachter praktisch unsichtbar machte.
Er legte den Schalter um, mit dem sich die Geheimtür öffnen ließ, überzeugte sich davon, dass der andere Mann tatsächlich noch bewusstlos war, und zog ihn durch die Tür, die er hinter sich offen stehen ließ. Dann nahm er die Hände weg, und der Bewusstlose fiel zu Boden, wo sein Kopf mit einem dumpfen Knall aufschlug. Es war zwar achtlos von dem Mann, wie er mit seinem Opfer umging, aber für das, was er vorhatte, war es letztlich egal, wie unsanft oder rücksichtsvoll er es behandelte. Im Schein der mitgebrachten Taschenlampe bewegte er sich durch den dunklen Raum, bis er an der regulären Tür angekommen war, wo er den Lichtschalter umlegte.
Eine Reihe von Leuchtstoffröhren erwachte flackernd zum Leben und beleuchtete einen lang gestreckten, gewölbeartigen Kellerraum. Der Mann sah sich um und betrachtete die diversen Gerätschaften, die dort verteilt standen und alle vor vielen Jahrhunderten zum letzten Mal zum Einsatz gekommen waren. Er brauchte nicht lange, bis er seinen Entschluss gefasst hatte, welches Instrument es sein sollte. Eigentlich hatte er von Anfang an diese Lösung bevorzugt, dennoch war es ihm wichtig gewesen, sich erst noch einmal umzusehen und alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten in Erwägung zu ziehen.
Er bückte sich und hob den Bewusstlosen vom kühlen Steinboden hoch, um ihn rücklings auf eine lange Bank zu legen. Dort schob er ihn noch ein Stück bis ans andere Ende, bis er genau richtig lag, dann brachte er das Holz mit der Aussparung in die richtige Position, damit der Mann seine Lage nicht noch im letzten Moment verändern konnte.
Er überprüfte, ob das Textilklebeband um die Hand- und Fußgelenke seines Opfers noch fest saß, das Gleiche machte er bei dem breiten Band, mit dem er ihm den Mund verklebt hatte. Auch das saß noch perfekt, und so sehr der Mann sich auch anstrengen mochte, es würde ihm nicht gelingen, sich davon zu befreien, solange er nicht die Finger zu Hilfe nehmen konnte.
Aus der Innentasche seiner Jacke zog er eine kleine Plastikflasche, die noch zur Hälfte mit Mineralwasser gefüllt war, öffnete sie und kippte dem Mann einen Teil des Inhalts ins Gesicht. Der schüttelte sich und erlangte leise stöhnend das Bewusstsein wieder, dann sah er seinen Entführer an, musste dabei aber die Augen zusammenkneifen, weil er ins Licht einer grellen Lampe blickte, die über ihm an der Decke montiert war.
Der größere, fast schlaksige Mann lächelte sein Opfer an, dann zeigte er nach oben. Der Gefesselte folgte mit den Augen der angezeigten Richtung, brauchte jedoch einen Moment, ehe er verstand, was diese Holzkonstruktion zu bedeuten hatte.
Dann begann er, sich verzweifelt zu winden, konnte sich aber nicht befreien. Außer erstickten Lauten drang nichts durch das Klebeband vor seinem Mund, und auch die verstummten, als die mit einem Gewicht beschwerte Klinge nach unten sauste.
Sekunden später war es vorbei, und der schlaksige Mann nickte zufrieden. Alles Weitere würden die anderen erledigen.
Ein leises »Miau« ließ ihn aufhorchen, und als er sich umdrehte, sah er, dass die Katze sich in den Raum geschlichen hatte. Offenbar war die Kellertür nur angelehnt gewesen, und sie hatte sie aufgedrückt, um herauszufinden, wer sich um diese Zeit noch hier zu schaffen machte. Er ging zu ihr, schob sie durch den Türspalt unsanft nach draußen und knurrte: »Verschwinde, du bist noch nicht an der Reihe.«
Dann kehrte er zur Geheimtür zurück, stieß einen leisen Pfiff aus und wartete kurz. Zwei Männer in ölverschmierten blauen Overalls kamen durch den Gang zu ihm. Er zeigte auf die Guillotine und sagte: »Ihr wisst, was ihr zu tun habt.« Nachdem die beiden hastig genickt hatten, ließ er sie allein.
Kapitel 1
»Es war quasi so etwas wie eine Hinrichtung«, erklärte Dr. Kelley und zog das Laken zurück, um den Leichnam wieder zu bedecken.
»›Quasi so etwas wie‹?«, wiederholte Detective Inspector Franklin, der sich neben den Rechtsmediziner gestellt hatte.
Kelley zuckte mit den Schultern. »Meinetwegen kann ich das auch verkürzen auf: ›Es war eine Hinrichtung.‹ Aber dann wäre unsere angenehme Unterhaltung viel schneller beendet, und das wäre doch schade, nicht wahr, DCI Remington?«
Anne Remington, die Vorgesetzte von Franklin und DI Hennessy, der sich beim Anblick des Leichnams hatte abwenden müssen, setzte ein demonstratives Lächeln auf und stimmte ihm zu. »Ja, das wäre wirklich zu schade.« Sie konnte nur froh sein, dass sie von ihren Mitarbeitern vorgewarnt worden war, was diesen neuen Rechtsmediziner anging, mit dem sie zusammenarbeiten mussten und der gar nicht so neu war. Immerhin hatte Dr. Jeremiah Kelley diese Stelle über dreißig Jahre lang innegehabt und war erst vor ein paar Jahren in den Ruhestand gegangen.
Nachdem sich vor einigen Monaten die Notwendigkeit ergeben hatte, die Stelle des Rechtsmediziners neu zu besetzen, sich aber niemand bewarb und die umliegenden Grafschaften auch so schon unterbesetzt und überlastet waren, sodass man von dort niemanden abziehen konnte, war die Verwaltung auf eine List verfallen. In den Richtlinien stieß man auf eine – wie Kelley es formulierte – »kaum bekannte und selten benutzte Reserveaktivierungsklausel« und zwangsverpflichtete ihn, begleitet von dem beiläufigen Hinweis, seine Pensionszahlungen zu kürzen, falls er der Aufforderung nicht nachkam.
»Ich möchte wetten, dass das vor Gericht keinen Bestand hätte«, hatte Kelley gesagt, als sie ihm kurz nach der Einstellung das erste Mal begegnet war.
»Warum gehen Sie dann nicht vor Gericht?«
»Ich habe mich mit einem Bekannten unterhalten, der selbst Rechtsanwalt ist und der sogar mit einem ähnlichen Fall beschäftigt war. Er konnte mir aus eigener Erfahrung berichten, dass das öffentliche Interesse an meiner Arbeitskraft schwerer wiegt als mein Recht auf eine ungekürzte Pension – natürlich alles nur hinter vorgehaltener Hand, genauso wie die Auskunft, dass solche Verfahren fünf Jahre und länger hinausgezögert werden.« Er hatte wütend geschnaubt, als er ihr davon erzählte. »Vielleicht können Sie ja die nächsten fünf Jahre auf fünfzig Prozent Ihrer Bezüge verzichten, ich kann es jedenfalls nicht.« Nach einer kurzen Pause hatte er dann hinzugefügt: »Sie sehen, der Staat bekommt, was der Staat will. Aber keine Sorge, DCI Remington, ich werde Sie nicht im Stich lassen, nur weil ich zwangsverpflichtet wurde. Ich werde meine Arbeit weiterhin gewissenhaft erledigen, und wenn ich weiß, dass es sich tatsächlich um etwas Dringendes handelt, um einen Täter dingfest zu machen, dann werde ich auch nicht um fünf Uhr Feierabend machen und nach Hause gehen.«
»Danke, Doktor«, hatte sie lächelnd erwidert und ihm die Hand gereicht. »Auf gute Zusammenarbeit.«
»Eines noch«, bemerkte er abschließend. »Versuchen Sie, die Kriminalität an der Wurzel zu bekämpfen, dann habe ich weniger Arbeit.«
Der heutige Tag war der unerfreuliche Beleg dafür, dass sie mindestens einmal zu wenig versucht hatte, seiner Bitte zu entsprechen, sonst hätte Dr. Kelley nicht um diese Uhrzeit in der Gerichtsmedizin sein müssen. »Was können Sie uns denn erzählen?«, wollte sie wissen.
Kelley griff nach seinem Notizblock, auf dem er alles Wesentliche notiert hatte. »Die Kollegen von der Spurensicherung haben festgestellt, dass jemand den Massagesessel und die Fernbedienung für den Fernseher manipuliert hat. Der Massagesessel wurde so verändert, dass er den Strom an die Person weiterleitet, die in ihm sitzt, sobald diese Person oder auch jemand anders auf der Fernbedienung die Lautstärke verändert, also spätestens zu Beginn der ersten Werbeunterbrechung. Die Taste hat nur den Startimpuls gegeben, es war also nicht möglich, den Strom noch schnell abzustellen. Ein Druck auf die Taste, und das Opfer wird geröstet. So wie in diesem Fall. Meine Untersuchungsergebnisse entsprechen den Beobachtungen der Kollegen. Mrs Boyle wurde durch einen Stromschlag getötet.«
»Und ein Unfall ist ausgeschlossen?«, meldete sich DI Hennessy zu Wort, der größere von Annes beiden Kollegen.
»Hm«, machte Kelley und setzte ein süffisantes Lächeln auf. »Das würde ich gern so formulieren: Wenn Sie eine logische Erklärung dafür finden, wie sich ein Funksender in die Fernbedienung und ein passender Empfänger in einen Massagesessel einschleichen können, ohne dass irgendein Mensch die Finger im Spiel hatte, dann sollten Sie einen Unfall natürlich nicht ausschließen. Ich hoffe, das war klar genug.«
»Ja, zumindest so klar, wie man es von einem Rechtsmediziner erwarten kann«, konterte der Detective Inspector und drehte sich zu Anne um. »Und was meinen Sie, Chief?«
Ein lautes Räuspern von Kelley klang ganz danach, als ob er sich übergangen fühlte.
Anne hätte Hennessy auffordern können, damit aufzuhören, aber zum Glück war sie frühzeitig von ihm und Franklin darüber aufgeklärt worden, dass die beiden jahrelange Erfahrung mit dem Rechtsmediziner hatten und diese gegenseitigen scheinbaren Anfeindungen einfach dazugehörten. Zwar war sie anfangs im Zweifel gewesen, ob die beiden ihr das vielleicht nur auftischten, damit sie sich nicht einmischte, doch nachdem sie ein paar Mal das amüsierte Funkeln in Kelleys Augen gesehen hatte, wusste sie, es entsprach der Wahrheit.
»Dass wir nach einem Motiv suchen müssen, warum jemand ihren Tod wollte«, sagte sie in nüchternem Tonfall. »Und warum er sich auch noch so viel Arbeit gemacht hat.«
»Vielleicht macht sich der Täter ja nicht gern die Finger schmutzig«, gab Franklin zu bedenken, dessen Gesicht wie immer leicht rot angelaufen war, so als käme er gerade vom Jogging oder aus der Sauna. »Er bereitet alles vor, aber das Opfer bringt sich praktisch selbst um. Er muss keine Waffe abfeuern, nicht mit dem Messer auf jemanden losgehen und auch niemanden mit bloßen Händen erwürgen. Wenn er seine Arbeit getan hat, lebt sein Opfer ja noch, und er hat vermutlich ein reines Gewissen.«
»Die Frage ist, wer sich so über Mrs Boyle geärgert hat, dass er überhaupt zu solchen Maßnahmen greifen würde«, steuerte Hennessy zur laufenden Diskussion bei.
»Wenn Sie mich fragen, was Sie wahrscheinlich gar nicht vorhaben, weshalb ich es Ihnen trotzdem sage, nur damit ich später sagen kann: ›Ich hab’s ja gleich gesagt‹«, mischte sich der Rechtsmediziner ein, »dann hat sich da zwar jemand sehr viel Mühe gemacht, um Mrs Boyles Ableben herbeizuführen, aber das ist zumindest für meinen Geschmack zu viel Mühe.«
»Wie meinen Sie das?«, fragte Anne, die sich schon vor längerer Zeit angewöhnt hatte, alle Beteiligten zu Wort kommen zu lassen und dabei auch für jene Erklärungsversuche offen zu sein, die eigentlich völlig unwahrscheinlich, aber eben nicht unmöglich waren. Seit sie auf ihrem vorangegangenen Posten bei der Greater Dartmoor Police einmal den Fehler gemacht hatte, integer scheinende Personen für unschuldig zu halten und nicht einmal die Möglichkeit ihrer Schuld in Erwägung zu ziehen, würde ihr das kein zweites Mal passieren. Und ja, es hatte auch etwas damit zu tun, dass sie sich in ihrem Stolz gekränkt fühlte, wenn ein Bürger – in dem Fall die Buchautorin Christine Bell zusammen mit ihrer Katze Isabelle – einen Fall aufklärte und ihr auch noch den Täter präsentierte, obwohl sie selbst nicht mal einen Fall für möglich gehalten hatte.
»Na ja, wenn ich jemanden aus welchen Gründen auch immer umbringen wollte«, begann Kelley, schob die Hände in die Taschen seines weißen Kittels und lehnte sich gegen die Edelstahlwanne an der Wand hinter ihm, »dann würde ich doch wohl versuchen, keine Spuren zu hinterlassen. Oder ich würde versuchen, das Ganze wie einen Unfall zu arrangieren. Ich persönlich könnte Ihnen natürlich eine Handvoll Gifte und den einen oder anderen Kniff aufzählen, wie man einen Mord begeht, ohne eine verfolgbare Spur zu hinterlassen, aber wir dürfen nicht von mir ausgehen.« Mit einer Hand fuhr er durch sein volles graues Haar. »Dieser Täter hat weder das eine noch das andere gemacht. Durch den Sender hat er eine Spur hinterlassen – natürlich eine ohne Fingerabdrücke und ohne DNS-Spuren, mit denen man ihn überführen könnte, aber es ist trotzdem eine Spur. Und er hat eine Vorgehensweise gewählt, die einen Unfall oder eine Selbsttötung ausschließt ...«
»Es sei denn, Mrs Boyle wollte sich so aus dem Leben verabschieden«, warf Franklin grinsend ein.
»Dann würde ich ein Bad in Salzsäure vorschlagen«, gab Dr. Kelley ungerührt zurück. »Aber ruhig ein wenig verdünnt, dann haben Sie auch was davon, DI Franklin.«
Der zuckte mit den Schultern. »War ja nur so ein Gedanke.«
Kelley wollte weiterreden, stutzte dann aber und fragte: »Ein Gedanke? Sie hatten einen Gedanken? Sagen Sie, ist das früher auch schon mal vorgekommen? Ich meine ... wenn Sie noch nie einen Gedanken hatten, wovon ich ziemlich überzeugt bin, woran wollen Sie erkennen, dass es sich jetzt um einen handelt? Welche Erfahrungswerte haben Sie?«
»Ich habe ihm mal erklärt, wie das mit den Gedanken funktioniert, Doc«, ging Hennessy dazwischen und klopfte seinem Kollegen auf die Schulter. »Seitdem weiß er, worauf er achten muss.«
»Tatsächlich?« Kelley schien beeindruckt. »Und Sie haben ihm das erklärt?«
Die beiden DIs begannen schallend zu lachend, und auch der Doktor konnte nicht länger ernst bleiben.
»Könnten wir ...«, begann Anne behutsam, da sie nicht Kelleys gute Laune stören wollte, »... denn mal zum Thema zurückkommen? Bitte?«
»Von mir aus«, antwortete der Rechtsmediziner und wandte sich wieder ihr zu.
Franklin wollte ebenfalls sein Einverständnis kundtun, aber dann sah er, dass seine Chefin warnend einen Zeigefinger hochhielt.
Er räusperte sich und sah zu Kelley.
»Worauf ich eigentlich hinaus will, ist Folgendes: Wenn ein so offensichtlicher Mord begangen wird, dann würde ich das für einen ... einen Racheakt halten. Oder eine Warnung.«
»Eine Warnung?«, gab Anne bissig zurück. »Mrs Boyle ist in ihrem Massagesessel geröstet worden. Diese Warnung dürfte über das Ziel hinausgeschossen sein.«
»Ich dachte eher an eine Warnung, die an eine andere Adresse gerichtet ist«, stellte er klar. »Etwas in der Art von: ›Jetzt siehst du, was dir blüht, wenn du nicht spurst.‹«
Sie dachte einen Moment lang darüber nach, schließlich nickte sie. »Ja, das sollten wir in Erwägung ziehen. Danke, Dr. Kelley.«
»Danken Sie nicht mir, danken Sie unserem wunderbaren Staat dafür, dass er mich wieder zu diesem erfüllenden Dienst an unserem Vaterland heranzogen hat«, gab Kelley schroff zurück und zog die Mundwinkel nach unten, was aber kaum auffiel, da jahrzehntelanger Ärger mit inkompetenten Vorgesetzten, drängelnden Kollegen und arroganten Anwälten seine dauerhaft missmutige Miene geprägt hatte.
»Ach, wissen Sie, ich danke lieber Ihnen«, sagte Anne und wandte sich zum Gehen. »Bei Ihnen weiß ich wenigstens, was Sie getan haben. Bei unserem Staat dagegen ...« Sie zog vielsagend die Augenbrauen hoch und gab den DIs ein Zeichen, damit sie ihr folgten.
Auf dem Weg durch den Korridor ging sie durch, was sie auf ihrem Notizblock festgehalten hatte. »Viel wissen wir noch nicht«, stellte sie nachdenklich fest. »Aber die Sache mit der Warnung sollten wir nicht außer Acht lassen.«
»Wären wir da nicht auch von selbst drauf gekommen, Chief?«, fragte Franklin, als sie das Gebäude verließen und er an ihr vorbeiging, um ihr die Tür aufzuhalten.
Sie zuckte mit den Schultern. »Denken Sie dran, dass Kelley nicht freiwillig da unten sitzt und Leichen aufschneidet. Wenn es ihm guttut, seine Ansichten zu äußern, dann werde ich ihn nicht davon abhalten. Erstens haben wir alle nichts davon, wenn der Doktor verärgert dazu übergeht, Dienst nach Vorschrift zu machen und nur noch die nötigsten Untersuchungen vorzunehmen, und zweitens kann er ja beim nächsten Mal eine Idee haben, auf die wir noch nicht gekommen sind.« Sie ging an ihm vorbei zu dem neuen Dienstwagen, einem dunkelblauen Ford Mondeo, der ihr zugestanden worden war, nachdem sie praktisch an ihrem ersten Arbeitstag in Northgate eine ganze Mordserie hatte aufklären können – die ihr selbst zunächst einen Kater und später noch zwei Kätzchen eingebracht hatte, die beide inzwischen gut ein halbes Jahr alt waren.
»Sind Sie mit Kelley eigentlich immer schon so locker umgegangen?«, fragte sie, während sie per Fernbedienung den Wagen entriegelte.
Die beiden DIs tauschten kurz einen Blick aus, dann antwortete Hennessy: »Das ist Kelleys Art, mit dem Anblick der Toten auf seinem Edelstahltisch fertig zu werden. Er hat früher in London gearbeitet, und da wurden die Leichen praktisch im Viertelstundentakt angeliefert. Da muss er auch schon diese zynische Ader gehabt haben. Seine Vorgesetzten hielten ihn für taktlos und arrogant, weil sie nichts kapiert hatten, und deswegen wurde er nach Northgate versetzt. Die Ironie dabei ist ja, dass seine Chefs dachten, sie würden ihn damit bestrafen, ihn aufs Land zu schicken, aber im Grunde haben sie ihm den größten Gefallen seines Lebens getan. Ab und zu mal ein Toter und alles nur natürliche Todesursachen. Er hat hier wirklich nicht viel tun müssen, aber er saß auf einer vollen Planstelle und wurde dementsprechend bezahlt.«
»Hat er Ihnen das erzählt?«, erkundigte sie sich.
»Zum Teil ja, also eigentlich nur das, was ich zuletzt gesagt habe. Was London und die Gründe für seine Versetzung angeht ...« Er druckste einen Moment lang herum. »Also ... ich hatte mal eine Freundin bei der Londoner Polizei ... in der Personalabteilung. Ich hatte sie gebeten, einen Blick in Kelleys Akte zu werfen, daher ... daher weiß ich von den anderen Sachen.«
Sie stiegen ein, und Anne fuhr los in Richtung Wache, während Franklin schon mal dort anrief, um zu fragen, ob es irgendwelche wichtigen Neuigkeiten gab. »Okay, danke«, erwiderte er schließlich und steckte das Telefon weg.
»Und?«, fragte Anne, als sie im Rückspiegel sah, dass der DI nicht mehr telefonierte. »Irgendwas passiert, während wir weg waren?«
»Keine Morde, keine Überfälle«, meldete er. »Aber auf Sie wartet ein Besucher.«
»Und wer? Jemand, den ich kenne?«
»Kommen Sie, Chief, lassen Sie sich überraschen«, antwortete Hennessy, bevor sein Kollege noch etwas sagen konnte. »Ein bisschen Spannung gehört zum Polizeialltag.«
Als sie die Wache betraten, fiel Annes Blick sofort auf ihren Besucher, der im Wartebereich vor der Theke saß und wirklich so etwas wie ein alter Bekannter war. Schließlich hatte er ihr an ihrem ersten Arbeitstag nur wenige Minuten nach Dienstantritt bereits einen Fall eingebrockt, der sie auf der Suche nach einer geraubten Kartäuserkatze namens Lady Agatha durch die gesamte Grafschaft geführt hatte.
Lord Bromshire.
Der grauhaarige ältere Herr mit Stirnglatze und Backenbart trug wie üblich einen Anzug aus fein kariertem dunkelbraunem Tweed, dazu eine beige Krawatte mit einem dezenten Wappen. Als er aufstand, stützte er sich auf seinen Spazierstock, dessen versilberte Krücke die Form eines Entenkopfs hatte.
»Miss Remington, da sind Sie ja!«, begrüßte er sie und kam zu ihr, nahm ihre Hand und deutete eine Verbeugung an.
»Lord Bromshire«, erwiderte sie mit einem Nicken. »Was führt Sie zu mir?«
Seit sie den Fall seiner verschwundenen Kartäuserdame Lady Agatha gelöst und die Katze wohlbehalten wiedergefunden hatte, war dieser Mann wie ausgewechselt. Seine mürrische, vorlaute Art war einem freundlichen und zuvorkommenden Wesen gewichen, und was Anne vor allem freute, war die Tatsache, dass er sie als Nachfolgerin von DCI Heddleswaithe akzeptiert hatte. Es hätte ihr zwar letztlich egal sein können, wenn er weiterhin den Macho gegeben hätte, weil sie nicht von seinem Wohlwollen abhängig war, trotzdem hatte sie nichts dagegen, dass er jetzt ein deutlich besser gelaunter Mann war als noch bei ihrer ersten Begegnung.
»Was machen meine Babys?«, fragte er interessiert, anstatt auf ihre Frage zu antworten. »Sind sie alle wohlauf?«
»Die beiden wachsen und gedeihen prächtig«, versicherte sie ihm und strich sich eine dunkle Haarsträhne aus dem Gesicht. »Und sie verstehen sich wunderbar mit meinem Toby, auch wenn er mir manchmal ein bisschen leidtut, wenn die beiden immer weiter rumtollen, obwohl er lieber schlafen würde. Aber er hat eine Engelsgeduld mit ihnen. Und was machen die drei Kleinen, die Sie behalten haben?« Sie hatte seine Haushälterin Mrs Marsh zwar erst letzte Woche noch gesehen und sich nach dem restlichen Nachwuchs von Lady Agatha erkundigt, aber die drei hatten ständig so viel Unsinn im Sinn, dass man wohl jeden Tag etwas Neues hätte berichten können.
Lord Bromshire winkte ab. »Seien Sie froh, dass ich Ihnen die beiden Babys aus dem Wurf schon vor der Geburt versprochen hatte, sonst hätte ich keines von den kleinen Schätzchen hergegeben. Ich hätte nie gedacht, dass man mit Katzen so viel Spaß haben kann.« Er lächelte sie fast verlegen an. »Wissen Sie, diese Katzenausstellungen sind ja schön und gut, aber ich muss inzwischen ehrlich sagen, dass ich mehr davon habe, wenn diese Tiere mein Haus auf den Kopf stellen, anstatt nur den ganzen Tag auf einem Sofakissen zu liegen und gelangweilt in die Gegend zu starren.«
Sie nickte bestätigend. »Und ich dachte schon, Sie wollten wieder ein Verbrechen melden.«
»Nein, nein«, wehrte er ab und folgte ihr zu ihrem Schreibtisch. »Das Verbrechen hat sich noch gar nicht ereignet, das kommt erst noch.«
Im Vorbeigehen deutete sie auf den Besucherstuhl, dann ging sie um den Schreibtisch herum und nahm Platz. Beiläufig überflog sie die Notizen, die der wachhabende Constable Flaherty während der Nachtschicht gemacht und ihr hingelegt hatte. Viel war in dieser Nacht nicht geschehen: zwei Fälle von Ruhestörung und ein Autofahrer, dessen Wagen in einem Vorgarten gelandet war, weil angeblich sein Navigationsgerät darauf bestanden hatte, genau an dieser Stelle rechts abzubiegen. Zwischendurch warf sie Bromshire einen argwöhnischen Blick zu. »Sie wissen von einem Verbrechen, das erst noch geschehen wird. Haben Sie eine Drohung erhalten, oder wie darf ich das verstehen?«
»Eine Drohung?« Bromshire machte eine verdutzte Miene. »Warum sollte mir jemand eine Drohung geschickt haben? Nein, nein, ich habe eine Einladung bekommen.«
»Zu einem Verbrechen?«
»Ja, ganz genau«, bestätigte er und sah Anne einen Moment lang an. »Oh, warten Sie, ich glaube, Sie wissen gar nicht, um was es geht, nicht wahr?«
Anne schüttelte den Kopf. »Ich habe keine Ahnung.«
Bromshire überlegte sekundenlang, dann nickte er verstehend. »Ja, natürlich. Sie waren letztes Mal ja noch gar nicht hier.« Er lehnte sich auf seinem Stuhl nach hinten und machte den Eindruck, als wollte er sehr, sehr weit ausholen, um auf den Punkt zu kommen. »Sagt Ihnen der Name Siddarth Kapoor etwas?«
»Nicht dass ich wüsste. Ist das ein Bollywood-Schauspieler?«
»Nein, ein schwerreicher indischer Geschäftsmann. Ich kenne ihn schon seit ... ach, ich weiß gar nicht mehr, fünfundzwanzig Jahren? Nein, sogar noch länger. Der Mann hat mehr Geld, als ein Mensch in seinem ganzen Leben ausgeben kann. Ich hatte früher mit ihm geschäftlich zu tun. Ein absolut korrekter Mann, das lief immer alles ohne Probleme ab. Vor ein paar Jahren hat er hier an der Küste eine alte Burg gekauft, und immer wenn er nach England kommt, was üblicherweise zweimal im Jahr ist, dann lädt er seine Geschäftsfreunde auf die Burg ein, um mit ihnen eine Mördersuche zu veranstalten ...«
»Sie meinen ein Spiel, richtig?«, vergewisserte sich Anne.
»Ja, ja, natürlich«, beteuerte Bromshire hastig. »Kapoor ist ein großer Fan von Agatha Christie und anderen englischen Krimiautoren, und er denkt sich jedes Mal einen neuen Fall für seine Gäste aus.«
»Hm, ist doch nett.«
»Grundsätzlich ja, und ich habe bislang auch jedes Mal die Einladung angenommen. Kapoor denkt nicht nur an seine momentanen Geschäftspartner, sondern auch an Leute wie mich, die längst im Ruhestand sind, die ihm aber in der Anfangszeit geholfen haben, hier bei uns Fuß zu fassen.«
»Was für ein Unternehmen hat er denn eigentlich?«, wollte sie wissen und fuhr den Rechner hoch.
»Oh, angefangen hat er mal mit Stoffen, dann kamen irgendwann Spielwaren dazu, Computer, Mobiltelefone ... eigentlich alles, womit man Geld machen kann, aber immer nur Qualitätsware, nie irgendwelchen Ramsch, den man in diesen schrecklichen Geschäften kaufen kann, die überall in den Großstädten wie Pilze aus dem Boden schießen. Er ist ein angesehener Geschäftsmann ...«
Während Bromshire weiterredete, ließ Anne ihren Blick über den Schreibtisch wandern und betrachtete einmal mehr die sonderbare Kombination aus ultraflachem Laptop und uraltem Telefon, die beide nicht gegensätzlicher hätten sein können. Den Laptop hatte sie erst vor zwei Wochen angeschafft, nachdem ihre vierbeinige Dreierbande es zu Hause geschafft hatte, eine Dose Farbe über die Tastatur ihres alten Laptops zu kippen. Ein Stück daneben stand ein schwarzes, unglaublich klobiges Telefon aus den späten Fünfziger- oder den frühen Sechzigerjahren, das zweifellos noch zur Erstausstattung der Wache gehörte, so wie viele andere Dinge auch. Der Hörer schien einen halben Zentner zu wiegen, jedenfalls im Vergleich zu modernen Telefonen, und man musste noch eine Wählscheibe benutzen.
Nach anfänglichen Bemühungen, das Ding so schnell wie möglich loszuwerden, hatte Anne es sich dann doch anders überlegt und es nicht übers Herz gebracht, es auf den Müll zu werfen. Dieser Apparat hatte schließlich all die Jahre wie ein Fels in der Brandung dagestanden und jedem technologischen Fortschritt getrotzt.
»Okay«, sagte sie schließlich geduldig, obwohl ihr Blick schon ein paar Mal zur Uhr gewandert war. Allmählich konnte er mal auf den Grund seines Besuchs zu sprechen kommen. »Sie sind also zu so einer Art Detektivspiel auf eine Burg eingeladen, aber was hat das mit mir zu tun?«
Lord Bromshire legte den Kopf ein wenig schräg. »Mehr, als Sie für möglich halten.« Nach einer kurzen, wohl als bedeutungsschwanger gedachten Pause fuhr er fort: »Ich möchte Sie nämlich bitten, an meiner Stelle die Einladung anzunehmen.«
Sie kniff argwöhnisch die Augen zusammen. »Wieso? Vermuten Sie, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht?«
»Allerdings«, antwortete er, hob aber hastig die Hand zu einer beschwichtigenden Geste. »Nicht im Sinne eines echten Verbrechens, so meinte ich das nicht. Aber wir werden da in mehrere Teams aufgeteilt, und mein Team hat noch nie gewonnen, egal in welcher Kombination.«
»Seien Sie doch einfach ein guter Verlierer«, schlug Anne ihm vor.
»Darum geht es nicht, Miss Remington. Ich bin davon überzeugt, dass Kapoor vor allem einigen Damen heimlich Tipps gibt, um sie auf die richtige Fährte zu führen. Jedes Mal, wenn mein Team kurz davor steht, den Täter festzunageln, bringt er über die Tat noch irgendein Detail ins Spiel, das genau zu der Lösung einer der anderen Gruppen passt, obwohl das von denen keiner wissen kann.«
»Und was soll ich da machen?«, fragte sie in einem Tonfall, der ihm hoffentlich klarmachte, dass sie gar nicht daran dachte, sich auf eine solche Aktion einzulassen.
»Sie sind vom Fach, Miss Remington«, antwortete er. »Sie können den Mann widerlegen und beweisen, dass er bestimmte Gäste bevorzugt. Ihnen werden die anderen glauben, weil Sie Polizistin sind – was Sie übrigens erst dann enthüllen dürfen, wenn Sie den Täter kennen, damit Kapoor nicht vorgewarnt ist.«
»Gibt es irgendeinen bestimmten Grund, warum Sie Kapoor vor all seinen Gästen blamieren wollen?«, erkundigte sie sich ohne Umschweife.
»Wie meinen Sie das?«
»So wie ich es gesagt habe, Lord Bromshire.«
Er zuckte scheinbar ratlos mit den Schultern.
»Lord Bromshire, Ihnen ist doch klar, dass dieser Mr Kapoor sich vor all seinen Gästen zum Narren macht, wenn ich den Beweis erbringe, dass er falsch spielt, um bestimmte Leute zu bevorzugen. Was hat er Ihnen getan, dass Sie es ihm heimzahlen wollen? Warum lassen Sie ihm nicht seinen Spaß?«
Nach längerem Zögern rückte er schließlich mit der Sprache heraus. »Zum einen, weil die Sieger unter sich eine Kiste voll Goldbarren aufteilen dürfen. Es geht mir dabei nicht so sehr um das Gold, auch wenn ich nichts gegen einen Goldbarren als Siegerprämie einzuwenden hätte. Mir geht es ums Prinzip, dass ein ehrlicher Sieg nicht möglich zu sein scheint. Zum anderen, weil ich das Gefühl nicht loswerde, dass Kapoor mit seiner Masche über irgendetwas anderes hinwegtäuschen will. Was das sein könnte, weiß ich nicht, aber bei ihm komme ich mir manchmal wie bei einem Zauberkünstler vor, der theatralisch die linke Hand zum Himmel streckt, damit alle auf sie achten, während er mit der rechten die weiße Taube aus seinem Umhang hervorholt. Ich habe auch schon mit den anderen Gästen gesprochen, und ein paar sehen das ganz ähnlich, aber keiner von ihnen traut sich, etwas zu sagen, weil sie alle fürchten, dass ihnen lukrative Aufträge entgehen. Die ehemaligen Geschäftspartner verteilt er immer geschickt auf Gruppen mit Leuten, mit denen er erst seit kurzer Zeit zu tun hat, und die wollen natürlich nicht unangenehm auffallen, weil sie auch weiterhin mit ihm Geschäfte machen wollen. Also halten alle den Mund.«
»Und ich soll für Sie die Spielverderberin geben, verstehe ich das richtig?«
Bromshire lachte kurz auf. »So hätte ich es zwar nicht formuliert, aber im Wesentlichen geht es darum. Wenn Sie den ›Meisterdetektiv Hercule Kapoor‹ widerlegen, fällt das auf keinen seiner Geschäftspartner zurück. Sie stehen sozusagen losgelöst von der Gruppe da.«
»Mit welchem Argument wollen Sie sich denn davonstehlen?«
»Ich habe ein leider sehr stichhaltiges Argument«, erklärte er. »Eine Bescheinigung meines Hausarztes. Letzte Woche hat Lord Brandenburg drüben in Millersfield ein Bankett gegeben, das wohl etwas zu üppig war. Mir wurde unwohl, und Brandenburg rief einen Arzt. Ich wurde untersucht, und mir wurden strikte Diät und viel Ruhe verordnet. Wenn Sie erst mal sehen, welche Berge von indischen Spezialitäten Kapoor seinen Gästen serviert, dann kann von Diät keine Rede sein. Und abgesehen davon herrscht bei dieser Mördersuche auch alles andere, aber keine Ruhe. Der Vorfall bei Lord Brandenburg hat sich natürlich herumgesprochen, weshalb Kapoor keinen Verdacht schöpfen wird, wenn Sie mich vertreten.«
Anne starrte auf die Liste der eingegangenen E-Mails auf ihrem Laptop, ohne auch nur einen der Namen bewusst wahrzunehmen. Auch wenn sie es eigentlich nicht zugeben wollte, reizte sie der Gedanke, sich diesen Mr Kapoor einmal anzusehen, um herauszufinden, ob er tatsächlich so unfair spielte, wie Bromshire behauptete. Allerdings ...
»Wann findet das Ganze denn statt?«, erkundigte sie sich.
»Was haben wir heute? Mittwoch?«, gab Bromshire zurück und antwortete auch direkt: »Ja, richtig, also am Freitagmittag, und das geht bis Sonntagmittag, wegen der Ebbe«, fügte er noch hinzu.
»Zwei Tage? Und übermorgen geht es schon los?« Sie schüttelte den Kopf. »Das kann ich nicht machen. Sehen Sie, wir haben gerade einen Mordfall zu klären. Ich kann nicht einfach zwei Tage lang alles stehen und liegen lassen. Das ist ...«
»Kommen Sie, Chief«, warf Franklin ein, der sich an seinen Schreibtisch gegenüber von ihrem gesetzt und die Unterhaltung zwangsläufig mit angehört hatte. »Die Leute befragen können wir auch mal ohne Sie. Wir wissen ja, was passiert ist, jetzt kommt doch nur die Fleißarbeit, alle auszuquetschen, die mal irgendwas mit Mrs Boyle zu tun hatten ...«
»Ach, es geht um die alte Mrs Boyle?«, fragte Bromshire.
»Alt?«, wiederholte Anne verwundert. »Reden wir hier von der gleichen Mrs Boyle? Unsere war nämlich erst fünfundvierzig.«
»Ja, aber sie hat sich immer benommen wie eine alte Frau. Sie hatte an allem was zu nörgeln und auszusetzen, und wenn sie selbst was gemacht hat, dann hat sie sich nicht um andere Leute gekümmert«, erklärte der Lord. »Aber umgekehrt wollte sie allen Vorschriften machen, was sie zu tun und zu lassen haben.«
»Ihnen auch?«
»Was? Nein, ich hatte mit ihr nie zu tun.« Er schwieg kurz. »Obwohl, warten Sie. Einmal wollte sie mich anzeigen, weil ich sie angeblich beinahe überfahren hätte. Dabei stand sie vor ihrem Haus und hatte volle Einkaufstaschen in der Hand. Direkt bei ihr vor dem Haus gibt es einen Fußgängerüberweg, und obwohl sie auf dem Weg zur Haustür war, machte sie in dem Moment einen Schritt auf den Überweg zu, so als wollte sie auf die andere Straßenseite wechseln – mit ihren Einkäufen und fort von ihrem Haus! Ich war mit meinem Wagen dicht vor dem Überweg, und ich wusste, das ist nur wieder eine von ihren Schikanen, und deshalb habe ich nicht angehalten. Anschließend ist sie dann zur Polizei marschiert, um mich anzuzeigen, aber das hatte sich schnell von selbst erledigt, weil ein Nachbar auf der Wache erschien, um seinerseits Mrs Boyle wegen versuchten gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr anzuzeigen. Er hatte sie beobachtet, wie sie mich zum Bremsen nötigen wollte, und damit war die Angelegenheit dann auch erledigt. Keine der Anzeigen wurde aufgenommen, und ich hatte seitdem Ruhe vor ihr.«
DI Franklin begann zu lachen, als er das hörte. »Ja, das weiß ich noch, als wär’s erst gestern gewesen. Das Gesicht von Mrs Boyle war unbeschreiblich, als auf einmal dieser Nachbar neben ihr an der Theke stand und sie mit ihren eigenen Waffen schlug.«
»Das hat sich sofort rumgesprochen«, ergänzte Hennessy, der eine Tasse Kaffee in der Hand hielt und sich gegen seinen Schreibtisch lehnte.
»Danach standen die Leute hier Schlange, um die gute Mrs Boyle mit Anzeigen zu überschütten. Wir haben das zwar alles der Form halber aufgenommen, aber nie weitergeleitet, weil es zu neunundneunzig Prozent so banal war, dass sich kein Richter damit befasst hätte. Aber es hat Mrs Boyle für eine Weile ziemlich kleinlaut werden lassen.«
»Das heißt, Sie müssen jede Menge Leute befragen«, machte Anne den beiden Detectives klar. »Zu zweit werden Sie da aber zu viel zu tun haben. Ich kann unter solchen Umständen nicht einfach ein paar Tage fehlen.«
»Sie wissen doch, was der Superintendent gesagt hat«, entgegnete Franklin. »Seit einem halben Jahr haben Sie sich keinen freien Tag gegönnt, und das ...«
»Detective, seit ich hier bin, hatte ich fast jedes Wochenende frei«, wandte sie ein, kam aber nicht so weit, wie sie es eigentlich wollte.
»Na, sehen Sie«, ging Hennessy dazwischen. »Dann macht es doch nichts aus, wenn Sie an diesem Wochenende auch nicht ins Büro kommen. Genau genommen nehmen Sie sich ja nur den Freitag frei.«
»Und wer weiß?«, fügte sein Kollege hinzu. »Vielleicht stoßen Sie dabei ja auf den nächsten großen Fall.«
»Außerdem kümmern wir uns um Ihre drei Katzen«, versicherte Hennessy ihr. »Wir fahren abwechselnd ein paar Mal am Tag bei Ihnen zu Hause vorbei und sehen nach dem Rechten.«
Unschlüssig sah sie zwischen den beiden und Bromshire hin und her, schließlich nickte sie. »Also gut, wenn mich hier alle loswerden wollen, dann gehe ich eben dorthin.«
»Großartig«, freute sich Bromshire und stand auf. »Ich hole nur schnell die Wegbeschreibung aus dem Wagen, damit Sie wissen, wie Sie nach Bhatpara Castle kommen.«
»Bhatpara Castle?«
»Kapoors Geburtsstadt«, sagte er. »Nachdem er Grennich Castle gekauft hat, hat er die Burg umbenannt.«
»Aha«, machte sie nur, weil es weiter auch nicht wichtig war. Zweifellos gab es irgendeine Behörde in diesem Land, die über solche Umbenennungen informiert werden musste und darüber entschied, ob das alles seine Richtigkeit hatte. Allerdings vermutete sie, dass das ohnehin kaum jemanden kümmerte, solange nicht eine chinesische Investorengruppe den Buckingham Palace kaufte und ihn in Chang Palace umbenannte.
»Sie werden ihren Spaß haben, glauben Sie mir«, versicherte er ihr. »Sie werden es nicht bereuen.«
Kapitel 2
Lord Bromshires Versprechen sollte sich schon zwei Tage später als frommer Wunsch entpuppen.
Anne schlief noch fest, als auf einmal jemand Sturm klingelte und sie aus irgendeinem ganz angenehmen Traum gerissen wurde. Sie hob den Kopf und sah, dass Kater Toby noch immer zusammengerollt auf ihrem Kissen lag und laut schnarchend schlief, während die Kartäusermädchen Laverne und Shirley sofort hellwach waren. Sie hatten die Nacht in Annes Kniekehlen gepresst verbracht und saßen nun da, den Hals gereckt und die Ohren gespitzt, während sie mit großen Augen zwischen Anne und der Schlafzimmertür hin und her schauten.
Sie warf einen Blick auf den Wecker und schüttelte ratlos den Kopf. Wenn irgendwo etwas passiert wäre, hätten ihre Detectives sie angerufen, anstatt erst herzufahren und sie aus dem Schlaf zu klingeln.
Und Besuch erwartete sie auch keinen, schon gar nicht um diese Uhrzeit.
»Vielleicht hat Bromshire ja noch was vergessen«, murmelte sie und stand vorsichtig auf, um die beiden Jungtiere nicht zusätzlich zu erschrecken, die ihr mit einigem Abstand nach unten folgten, nachdem Anne in einen Morgenmantel geschlüpft war.
Als sie im Erdgeschoss angekommen vom Wohnzimmer in den kurzen Flur ging, zog sie die Tür hinter sich zu, damit die Katzen nicht nach draußen schlüpfen konnten. Bei Toby wusste sie, dass der nur die wenigen Schritte bis zur Gartenmauer zurücklegte, aber bei den Jungtieren wollte sie kein solches Experiment wagen. Die mussten erst mal etwas älter sein und ruhiger werden, und selbst dann würde der erste Ausflug ohnehin nur angeleint erfolgen.
Durch die kleinen Buntglasscheiben in der Tür konnte sie eine Frau ausmachen, eine sehr blonde Frau, aber mehr auch nicht. Wer sollte das sein? Eine Nachbarin war sie nicht, da war sich Anne sicher. Ohne die Sicherheitskette zu entfernen, öffnete sie die Tür einen Spaltbreit. »Ja, bitte?«, fragte sie.
»Hallo, da bin ich«, bekam sie zur Antwort.
Durch den Spalt konnte Anne jetzt erkennen, dass es sich um eine junge Frau handelte, deren Alter irgendwo zwischen achtzehn und zwanzig liegen musste. »Ähm ... das sehe ich auch«, gab sie zurück. »Aber wer sind Sie überhaupt?«
»Ich bin Jess.« Wieder folgte eine lange Pause, als sei alles gesagt, was gesagt werden musste.
»Ich bin noch nicht ganz wach, Jess. Könnten Sie etwas genauer sagen, wer Sie sind und was Sie hier wollen?«
»Jessica Randall«, kam die gedehnte Antwort, als stelle jedes Wort mit mehr als einer Silbe eine körperliche Belastung dar.
»Und weiter?«
»Wie weiter?«
Anne atmete tief durch. »Ich habe Sie gefragt, wer Sie sind und was Sie hier wollen. Ich weiß jetzt, wer Sie sind, aber nicht, was Sie hier wollen.«
»Mr Bromshire hat mich hier abgesetzt«, sagte Jessica Randall und zog ein Handy aus der Tasche. Sie strich mit dem Zeigefinger über das Display, dann begann sie auf einmal zu kichern, tippte etwas ein und steckte das Handy wieder weg. »Er meinte, Sie wüssten dann schon Bescheid.«
»Tut mir leid, aber da irrt er sich.«
»Okay«, meinte die junge Frau, blieb aber vor der Tür stehen. »Kann ich jetzt reinkommen?«
»Miss Randall ...«
»Sie können ruhig Jess sagen, das machen alle«, unterbrach sie sie.
»Jess, ich habe keine Ahnung, wieso Sie hier sind ...«
»Sie können mich ruhig duzen«, warf sie nun ein.
»Fein, aber vielleicht könntest du mich ja erst mal ausreden lassen. Alles andere können wir dann immer noch regeln.«
Jess zuckte mit den Schultern. »Warum denn? Ist doch alles geregelt.«
Es fiel Anne schwer, die Geduld zu bewahren, also atmete sie erst noch einmal tief durch, dann sagte sie: »Hör zu, Jess, ich weiß nicht, wieso du hier bist und warum Mr Bromshire dich hier abgesetzt hat. Du weißt das offenbar, aber ich nicht. Wärst du bitte so freundlich, mir so genau wie möglich zu erklären, was du hier willst?«
Wieder kam zuerst ein Schulterzucken. »Okay. Mr Bromshire hat mir versprochen, dass er mich beim nächsten Mal mit zur Burg nimmt, wenn er wieder eingeladen ist, aber jetzt kann er nicht, weil er krank ist oder so was, und er hat mir gesagt, dass Sie jetzt hinfahren und dass Sie mich mitnehmen, und darum hat er mich eben bei Ihnen abgesetzt, damit wir nicht zu spät sind, weil wir irgendwie um zwölf oder so da sein müssen, weil da Ebbe ist oder so.« Jess verzog den Mund. »Ich glaub, so hat er das gesagt. Meine ich jedenfalls.«
»Bist du mit Mr Bromshire verwandt?«
»Ist das hier ’n Verhör oder was?«, kam die etwas patzige Antwort.
Kopfschüttelnd schloss Anne die Tür und ging zurück ins Wohnzimmer, wo sie in ihrem Adressbuch nach Bromshires Handynummer suchte.
»Ja, bitte?«, meldete sich Bromshire nach dem zweiten Klingeln.
»Remington«, sagte sie nur.
»Chief Remington? Was kann ich für Sie tun?«
»Wer ist Jess?«
»Na, die Enkelin.«
Anne stieß frustriert die Luft aus. »Welche Enkelin?«
»Von der ich Ihnen erzählt habe«, antwortete er.
»Lord Bromshire, vielleicht befinden Sie sich ja in einem Paralleluniversum oder etwas in der Art, in dem Sie mir das alles bereits erzählt haben, aber ich hinke da wohl hinterher, weil ich von nichts weiß. Fahren Sie jetzt rechts ran, und dann holen Sie das nach, was Sie Ihrer Meinung nach längst erledigt haben.«
»Woher wissen Sie, dass ich unterw...«
»Ich wusste es nicht, aber Sie haben es mir gerade bestätigt«, knurrte sie. »Und jetzt halten Sie an, bevor ich vor dem Europäischen Gerichtshof durchsetze, dass Leuten, die beim Autofahren telefonieren, das Bußgeld noch während des Gesprächs von ihrem Konto abgebucht wird.«
Das Motorengeräusch wurde leiser, dann sagte Bromshire: »So, da bin ich.«
»Wer ist Jess? Und warum ist sie hier?«, hakte Anne nach. »Und antworten Sie nach Möglichkeit in ganzen Sätzen, die keinen Spielraum für Gegenfragen von meiner Seite lassen. In dem Punkt habe ich nämlich jetzt wirklich genug.«
»Jessica ist die Enkelin von Brian Thorpe, einem alten Freund«, erklärte er. »Ich habe sie für dieses Mal zur Mördersuche eingeladen, als ich noch nicht wusste, dass ich gar nicht hinfahren würde. Sie ist gestern bei mir eingetroffen, und ich habe sie wie vereinbart heute Morgen bei Ihnen abgesetzt.«
»Wie vereinbart?«, wiederholte sie ungläubig. »Wann haben wir das denn vereinbart?«
»Na, am Mittwochmorgen, als ich bei Ihnen auf der Wache war.«
»Lord Bromshire, wenn Sie wollen, fragen Sie gern bei meinen Detectives nach«, sagte Anne. »Die werden Ihnen die gleiche Antwort geben, nämlich die, dass Sie mit keinem Wort die Enkelin eines alten Freundes erwähnt haben. Und jetzt werde ich früh am Morgen von einer jungen Frau überfallen, die nicht in der Lage ist, eine Frage zu verstehen, die über drei Worte hinausgeht.«
»Ach, Jess ist nicht dumm, falls Sie das meinen«, versuchte er sie zu beruhigen. »Sie ist nur meistens mit den Gedanken woanders. Sie wissen ja, wie die Jugend von heute ist. Ständig telefonieren sie oder schicken sich diese ... SMS oder wie das heißt.«
»Das ist mir auch schon aufgefallen«, kommentierte sie.
»Miss Remington, ich hoffe, Sie sind mir nicht böse«, sagte Bromshire schließlich. »Aber ich war fest davon überzeugt, dass ich Ihnen das mit Jessica erzählt habe. Es tut mir wirklich leid. Wenn Sie keine Lust haben, die Fahrt zusammen mit Jessica zu unternehmen, dann müssen Sie das nur sagen. Dann hole ich sie wieder ab, und sie fährt mit dem nächsten Bus nach Hause.«
Ja, machen Sie das, hätte sie am liebsten geantwortet. Und holen Sie sich auf dem Weg auch gleich Ihren Brit Award ab in der Kategorie ›Beste schauspielerische Leistung während eines Telefonats‹. Sie glaubte ihm kein Wort, aber sie konnte ihm seine dreiste Lüge nicht beweisen. Bromshire wusste ganz genau, warum er Jess »vergessen« hatte zu erwähnen. »Na ja, wenn sie schon eine so weite Reise unternommen hat, dann kann ich sie ja wohl schlecht wieder nach Hause schicken«, hörte sie sich selbst sagen und fragte sich, welcher Teil ihres Verstands wohl diese Worte über ihre Lippen geschickt hatte.
»Oh, vielen Dank, Miss Remington, Sie werden es auch nicht bereuen«, erwiderte er. »Und denken Sie daran, dass Sie bis um zwölf das Ziel erreicht haben müssen«, betonte er. »Wegen der Ebbe.«
»Ja, ich weiß«, erwiderte sie, auch wenn sie immer noch nicht verstand, was daran so wichtig sein sollte. Und wieso bekam sie schon wieder zu hören, sie werde es nicht bereuen? Tatsächlich bereute sie es doch längst. Sie konnte nur hoffen, dass es sie nicht noch mehr bereuen würde.
Sie legte auf und kehrte zurück zur Haustür. Laverne und Shirley hatten es sich inzwischen auf dem Sofa bequem gemacht, ließen Anne aber nicht aus den Augen, bis sie die Flurtür hinter sich zugezogen hatte. Dann entfernte sie die Sicherheitskette und öffnete die Haustür. »Dann komm mal re...«, begann sie ... doch von Jess war nichts mehr zu sehen. »Jess?«, rief sie.
Keine Antwort.
»Jess?«
Nichts.
Verdutzt ging sie bis zum Gartentor und sah dabei nach links und rechts. Hatte Jessica Randall etwa die geschlossene Haustür als Aufforderung aufgefasst, dass sie weggehen sollte? Plötzlich hörte sie ein Kichern und entdeckte die junge Frau, die sich zwischen zwei Wagen auf die Bordsteinkante gesetzt hatte und gebannt auf ihr Handydisplay schaute.
»Jess, was machst du da?«, rief Anne ihr zu, die keine Lust hatte, mit Morgenmantel auch noch bis auf die Straße zu laufen. Es reichte, dass sie sich so in den Vorgarten begeben hatte. »Steh auf und komm rein.«
Jess drehte sich um und lächelte Anne an, als hätte die ihr nicht gerade eben die Tür vor der Nase zugeschlagen. »Ist alles klar?«, fragte sie.
»Ja, komm rein«, sagte Anne. »Du kannst schließlich nicht auf der Straße rumsitzen.«
»Okay.« Die junge Frau stand auf und kam zu ihr, schrieb aber weiter fleißig allein mit dem linken Daumen an einer SMS. Mit der freien Hand drückte sie das Gartentor auf, schnappte sich ihre kleine Reisetasche, die sie neben der Haustür hatte stehen lassen, und ging an Anne vorbei nach drinnen.
»Ach, Jess, bist du eigentlich gegen Katzen allergisch?«, fragte Anne, als sie ihr ins Haus folgte.
»Keine Ahnung, wir haben zu Hause keine. Wieso?«
»Nur so«, gab Anne zurück und schüttelte den Kopf. Wie konnte Bromshire nur behaupten, sie würde es nicht bereuen?
»Da vorne muss es sein«, sagte Jess, als sie vor Anne eine Lücke in der dichten Baumreihe entdeckte, die die linke Fahrbahnseite säumte.
Anne nahm Gas weg und ließ ihren Dienstwagen langsamer werden, damit sie den Weg nicht verpasste, den sie nehmen musste, um das letzte Stück in Richtung Küste zurücklegen zu können.
»Ja, du hast recht, glaube ich«, erwiderte sie und hielt an, um sich erst mal den Weg anzusehen, der da von der engen Landstraße abzweigte. »Hm, das müsste es wohl sein.« Sie ließ sich von ihrer Beifahrerin den Plan zeigen, den sie von Bromshire erhalten hatte, dann schaute sie zur anderen Straßenseite. »Ja, genau, da ist ein alter Meilenstein mit ... einer eingravierten ›15‹. Wir sind richtig, Gut gemacht, Jess.«
»Danke, Anne«, antwortete sie und konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen.
Anne ihrerseits reagierte darauf mit einem zufriedenen Lächeln. Wenigstens hatte in Jessicas Fall der erste Eindruck ein völlig falsches Bild vermittelt, das schon in dem Moment korrigiert worden war, als sie das Haus betreten und die beiden jungen Kartäuser auf dem Sofa hatte liegen sehen. Sie war völlig begeistert von den Kleinen gewesen und hatte sich die ganze Zeit über liebevoll mit ihnen beschäftigt, während Anne geduscht und sich reisefertig gemacht hatte. Toby alias Tobias Eugene Rustleborne VIII hatte in der Zwischenzeit ebenfalls das Bett verlassen und sich demonstrativ auf Jessicas Rücken gelegt, um dort weiterzuschlafen, da sie bäuchlings auf dem Boden gelegen und mit Laverne und Shirley gespielt hatte.
Es war nicht so einfach gewesen, Toby von ihrem Rücken zu nehmen, da er sich in Jessicas Pullover festgekrallt hatte, was die zu einem amüsierten Kreischen veranlasst hatte – was für Toby wiederum Grund genug gewesen war, sich noch fester in die Maschen zu krallen. Aber schließlich war es der Lockruf des Fressnapfs gewesen, der ihn davon überzeugt hatte, doch nicht den idealen Schlafplatz gefunden zu haben.
Nach einer ausgiebigen Verabschiedung von ihren drei Katzen hatten sie sich auf den Weg nach Bhatpara Castle oder Grennich Castle gemacht, und zu Annes großem Erstaunen hatte sich nach einer Weile eine Unterhaltung über alle möglichen Themen von Musik über Politik bis hin zu Prominenten entwickelt, in deren Verlauf sich Jess als ausgesprochen intelligentes Mädchen entpuppt hatte. Für ihre neunzehn Jahre war sie wirklich erstaunlich belesen und vielseitig interessiert. Möglicherweise war Jess ja so wie Anne um kurz nach sieben einfach noch nicht wach genug gewesen, um die Fragen zu erfassen, die sie ihr gestellt hatte. Auf jeden Fall war Anne mittlerweile angenehm überrascht, und auch wenn sie lieber skeptisch blieb, konnte sie sich dennoch vorstellen, dass sie es vielleicht wirklich nicht bereuen würde, auf Bromshires Vorschlag eingegangen zu sein.
Sie verließ die Straße und bog in den unbefestigten Weg ein, der sich durch den dichten Wald schlängelte. Dort war es so dunkel, dass sich nach wenigen Metern die Scheinwerfer des Wagens automatisch einschalteten. »Eines sage ich dir, Jess«, erklärte Anne nach ein paar Minuten. »Ein Stück weit fahre ich noch, aber wenn dann noch kein Ende dieser Strecke abzusehen ist, kehren wir um. Ich möchte hier nicht irgendwo mit dem Wagen liegen bleiben, wenn ich niemanden zu Hilfe rufen kann, weil ich nicht weiß, wo wir überhaupt sind. Wir sind seit Ewigkeiten an keinem Haus mehr vorbeigekommen!«
»Ich weiß, Anne«, stimmte sie ihr zu. »So langsam find ich’s auch ein bisschen unheimlich.«
»Natürlich werden wir dann zu spät kommen, falls wir überhaupt noch den richtigen Weg finden«, ergänzte Anne.
»Ist schon okay«, meinte Jess, die ihre Umgebung mit einigem Unbehagen betrachtete.
Gerade wollte sie noch etwas anfügen, da hörte der Wald so plötzlich auf, dass Anne eine Vollbremsung machte, da sie fürchtete, unmittelbar vor sich eine Klippe zu haben. Sie kniff die Augen zusammen und spähte in den grellen Sonnenschein, der die weite Fläche hinter dem Waldstück in blendende Helligkeit tauchte.
»Wir sind wohl richtig«, stellte Jess fest und zeigte auf eine Gruppe von Personenwagen, die in gut hundert Metern Entfernung auf einem freien Platz direkt an der felsigen Küste standen. Die Burg war ebenfalls auszumachen, allerdings war sie deutlich weiter weg und – sie stand auf einer Insel!
»Eine Insel?«, platzte Anne heraus, während sie wieder losfuhr, um sich zu den anderen Wagen zu begeben, die da vorn auf irgendetwas warteten. »Sollen wir mit einer Fähre übersetzen, oder wie läuft das hier?«
Jess zuckte mit den Schultern und erwiderte nichts.
Beim Näherkommen fiel Anne auf, dass auf dem Platz nur Fahrzeuge der teuersten Marken versammelt waren: Jaguar, Rolls-Royce, Bentley, Mercedes, BMW ... und nun stellte sie sich mit ihrem Mondeo zu dieser erlesenen Gesellschaft. Da hätte sie ja auch direkt mit dem alten Ford Escort Streifenwagen herkommen können, aufgefallen wäre sie so oder so. Nur dass sie sich dann gleich zu erkennen gegeben hätte, was sie aber nicht tun wollte.
Sie ließ den Wagen ausrollen und kam hinter einem protzigen goldfarbenen Mercedes der S-Klasse zum Stehen, der zwei Dinge bewies: dass sein Besitzer genug Geld hatte, um sich so etwas leisten zu können, und dass er gleichzeitig keinen Funken Geschmack besaß, wenn er mit einer solchen Sonderlackierung durch die Gegend fuhr. Ein Mann mit einem genauso stillosen Toupet stieg aus dem Mercedes aus und kam zu ihnen, gerade als sie und Jess ihren Wagen verließen. Der Mopp auf seinem Kopf war pechschwarz und saß so schief, dass an allen Seiten die echten grauen Haare zum Vorschein kamen. Dem faltigen Gesicht nach musste er weit über siebzig sein, aber sein Erscheinungsbild sollte wohl einem mindestens vierzig Jahre jüngeren Mann entsprechen.
Aus dem Augenwinkel bemerkte Anne, dass Jess sich schnell die Hand vor den Mund hielt, damit niemand ihr breites Grinsen bemerkte.
»Sie müssen Miss Remington sein«, sagte der Mann, als er nur noch zwei oder drei Meter von ihr entfernt war. »Der alte Bromshire hatte Sie schon angekündigt.«
»Ach, tatsächlich?«, erwiderte Anne und schüttelte seine Hand. »Wann hat er das denn gemacht?«
Der ältere Mann zuckte mit den Schultern. »Ich weiß nicht mehr so genau, aber ... das müsste am Montag gewesen sein.«
»Am Montag?«
Er dachte kurz nach, dann nickte er. »Ja, das war am Montag. Er rief an, als ich mir gerade Coronation Street ansehen wollte. Typisch Bromshire. Nur weil er die Serie nicht einschaltet, meint er, das würde auch sonst niemand tun.« Er schüttelte den Kopf. »Oh, verzeihen Sie, was ist denn nur mit meinen Manieren los? Ich habe doch völlig vergessen, mich vorzustellen. Gestatten Sie? Sir Lester Fitzgerald.«
»Angenehm, Sir Lester. Anne Remington, und das ist Jessica ...«
»Doch nicht etwa Ihre Tochter?«, unterbrach er sie. »Sie können unmöglich schon Mutter einer fast erwachsenen Tochter sein.«
»Sie ist tatsächlich nicht meine Tochter«, bestätigte Anne und ging kommentarlos über das abgegriffene Kompliment hinweg. Allerdings passte es zu diesem Mann, wie sie fand. »Sie heißt Jessica Randall und ist die Enkelin eines Bekannten von Lord Bromshire, er hatte ihr versprochen, sie dieses Mal mitzunehmen, aber da er gesundheitlich nicht dazu in der Lage ist ...«
»Ja, ich weiß«, sagte Sir Lester, als er die kurze Pause bemerkte, die Anne absichtlich eingelegt hatte, um ihm die Gelegenheit für eine Erwiderung zu geben. »Ich war dabei, als er bei Lord Brandenburg plötzlich zusammenbrach. Schrecklich war das. Ich dachte schon, es geht mit ihm zu Ende.« Sein Blick war mit einem Mal auf einen weit entfernten Punkt gerichtet. »Wenn ich mal in sein Alter komme, dann hoffe ich, dass ich auch noch so fit bin, um so einen Zusammenbruch zu überstehen.«
Anne konnte daraufhin nur nicken, da es ihr die Sprache verschlagen hatte. Bromshire war ihrer Meinung nach deutlich jünger als Sir Lester, doch der schien da wohl anderer Ansicht zu sein.
»Aber zu etwas anderem«, fuhr er fort. »Ich hatte mich schon auf den Wagen gefreut, mit dem Sie herkommen würden. Nicht den da, sondern Ihren kleinen Flitzer.«
»Sie meinen den Sunbeam?«
»Genau den«, bestätigte Sir Lester. »Ein Sunbeam Tiger, wenn ich den alten Bromshire richtig verstanden habe. Ein Mark I oder Mark II?«
»Mark I, das Original«, antwortete Anne und konnte sich ein stolzes Lächeln nicht verkneifen, als sie seine anerkennende Miene sah. »Ein Erbstück von meinem Großvater.«
»Sie Glückliche. Ich wollte immer einen kaufen, aber meine Frau war strikt dagegen, müssen Sie wissen. Wir waren uns seinerzeit einig, dass sie nichts gegen dieses oder jenes Auto mehr in unserer Garage einwenden würde, solange sie auf dem Beifahrersitz bequem sitzen konnte und Platz genug hatte. Ich war damit einverstanden, aber als ich dann den Sunbeam sah, da wünschte ich mir, ich hätte sie vorher zu irgendeiner Ausnahmeregelung überredet. Sie fand den Wagen schrecklich unbequem, er war ihr zu eng, der Sitz war zu hart ... es war einfach nichts zu machen, also musste ich auf den Wagen verzichten.«
»Ach, das tut mir leid«, sagte sie. »Aber wenn ich ehrlich sein soll, dann muss ich Ihrer Frau zustimmen. Ich finde es auch nicht immer ein Vergnügen, den Wagen zu fahren. Da sitzt man in dem hier schon viel bequemer.« Dabei zeigte sie auf den Mondeo, ohne aber die Marke oder das Modell auch noch beim Namen zu nennen. Sie selbst empfand das Auto als luxuriös, da sie zuvor noch nie etwas in dieser Größenordnung gefahren hatte, doch neben den Werten, die hier versammelt waren, wirkte sie mit dem Mondeo wie die verarmte Tante beim Familientreffen der Millionäre.
»Sagen Sie«, fuhr sie nach einem Augenblick fort. »Wieso stehen wir eigentlich alle hier herum? Warten wir auf eine Fähre?«
»Oh, hat der alte Bromshire nichts dazu gesagt?«
»Nein, nur dass wir unbedingt zeitig ankommen müssten, ansonsten nichts.« Sie setzte eine ahnungslose Miene auf. »Man könnte ja fast meinen, dass es sich um irgendein Geheimnis handelt, das er nicht verraten durfte.«
Sir Lester schüttelte den Kopf. »Nein, das ist kein Geheimnis. Ganz im Gegenteil, die Geschichte von Grennich Castle ist sogar relativ weit verbreitet, jedenfalls, wenn man sich für Burgen interessiert. Historisch gesehen hat sich hier nie etwas Bedeutendes ereignet.« Er ließ eine kurze Pause folgen, dann fügte er schnaubend hinzu: »Außer natürlich, dass dieser indische Großkotz meint, er müsste nicht nur unsere historischen Bauwerke aufkaufen, sondern ihnen auch noch indische Namen geben. Zustände sind das, einfach unfassbar. Man könnte fast meinen, dass sie unser ganzes Land vereinnahmen wollen.«
Anne verkniff sich die Bemerkung, dass es noch gar nicht so schrecklich lange her war, dass die Inder dachten, die Engländer wollten ihr ganzes Land vereinnahmen. Aber es wäre ein sinnloses Unterfangen gewesen, mit diesem Sir Lester darüber zu diskutieren, auch wenn er zumindest den Falten in seinem Gesicht nach zu urteilen fast alt genug sein dürfte, um sich noch an die Zeit in Indien erinnern zu können. Stattdessen fragte sie arglos: »Sie mögen diesen Mr Kapoor nicht?«
»Hah!«, machte er. »Ich weiß nicht, wer aus der eingeladenen Gesellschaft ihn überhaupt leiden kann. Ein paar von den Leuten vermutlich, aber die Mehrheit mag ihn gar nicht, auch wenn das niemand offen sagt. Nur ... was soll man als Unternehmer machen, wenn man die eigenen Umsätze zu dreißig oder mehr Prozent mit dem Zeugs bestreitet, das er einem zu einem guten Preis anbietet? Kein guter Kaufmann will es sich mit einem solchen Großhändler verscherzen, wenn die Konkurrenz mit höheren Einkaufspreisen kalkulieren muss.«
»Ich dachte, so etwas würde ihn sympathisch machen«, wunderte sich Anne.
»Als Kaufmann ja, aber nicht als Mensch«, stellte Sir Lester klar. »Ich habe geschäftlich ehrlich gesagt nicht mit vielen Indern zu tun, darum weiß ich nicht, ob die meisten so sind wie er oder ob er die Ausnahme darstellt, auf jeden Fall hat er eine grässliche gönnerhafte Art an sich. Sie wissen schon, so von oben herab. Das werden Sie schon merken, wenn Sie ihn erst mal kennengelernt haben.« Wieder gab er einen verächtlichen Laut von sich. »Und dann dieses alberne Mörderspiel, zu dem er einlädt. Er lässt immer das Team gewinnen, in dem die attraktivste Frau mitspielt, weil er sich auf der anschließenden Siegesfeier dann an sie ranmacht. Egal, ob sie eine Kundin ist oder die Ehefrau eines Kunden – die Nacht von Samstag auf Sonntag verbringt sie mit Kapoor. Und alle sehen geflissentlich weg.« Mit einer Miene, als hätte er auf eine Zitrone gebissen, fügte er hinzu: »Schließlich will es sich niemand mit ihm verscherzen. Das einzig Gute daran ist, dass er dieses Spiel nur zweimal im Jahr veranstaltet und den Rest der Zeit in seiner Heimat verbringt.«
»Das klingt ja gar nicht so vergnüglich, wie Lord Bromshire es dargestellt hat«, merkte Anne etwas pikiert an. »Das heißt, er sprach zwar von ... na, nennen wir es mal ›Auffälligkeiten‹ bei der Bestimmung des Siegers, aber von diesen anderen Dingen hat er mir nichts gesagt.« Sie fragte sich angesichts dieser Enthüllungen, wie der alte Lord nur auf die Idee gekommen sein konnte, eine junge, attraktive Frau wie Jessica auf die Burg und damit quasi in die Höhle des Löwen mitzunehmen.
»Bromshire hat sein Geschäft auch vor Jahren mit einem saftigen Gewinn verkaufen können, mit dem sein Lebensabend gesichert ist«, sagte Sir Lester. »Seitdem hat er mit Kapoor geschäftlich nichts mehr zu tun, er wird nur weiter eingeladen, und es ist pure englische Höflichkeit, die ihn noch dazu veranlasst, dem Ruf von Mr Bollywood zu folgen.«