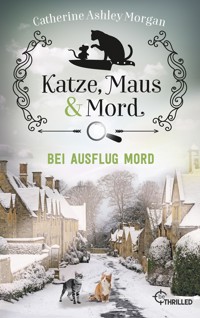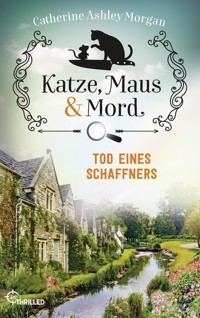4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Katzen mit der Spürnase
- Sprache: Deutsch
Catherine Ashley Morgan ist ein Pseudonym des Autors Ralph Sander, der mit seiner Katzen-Krimi-Serie "Kater Brown" viele Leserinnen und Leser begeistert
Band 2: Christine Bell besucht zusammen mit ihrer Katze Isabelle das Nobel-Seebad Beechwood. Und da ist grad einiges los: Die Stadt erwartet hohen Staatsbesuch und zeitgleich findet eine Science-Fiction-Convention statt. Und dann stolpern Christine und Isabelle auch noch über eine Leiche - im Superman-Kostüm. Die Polizei hat mit den Sicherheitsvorkehrungen alle Hände voll zu tun und stempelt den Tod des »Verrückten« schnell als Unfall ab. Christine ist sich da nicht so sicher. Vor allem, als Isabelle einen geheimen Zettel findet, der auf ein Mordmotiv hindeutet ...
Bei diesem Katzen-Krimi handelt es sich um eine eBook-Neuauflage von »Die List der roten Katze« von Catherine Ashley Morgan um die kluge Katze Isabelle, die ein Pfötchen für Mordfälle hat!
Alle Bände der Reihe um Christine und Isabelle bei beTHRILLED:
Katze, Maus und Mord - Ein rätselhafter Nachbar
Katze, Maus und Mord - Die verhängnisvolle Botschaft
Katze, Maus und Mord - Tod eines Schaffners
Katze, Maus und Mord - Das tödliche Drehbuch
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 544
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Cover
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
Widmung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Über die Autorin
Weitere Titel der Autorin
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
vielen Dank, dass du dich für ein Buch von beTHRILLED entschieden hast. Damit du mit jedem unserer Krimis und Thriller spannende Lesestunden genießen kannst, haben wir die Bücher in unserem Programm sorgfältig ausgewählt und lektoriert.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beTHRILLED-Community werden und dich mit uns und anderen Krimi-Fans austauschen möchtest. Du findest uns unter be-thrilled.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich auf be-thrilled.de/newsletter für unseren kostenlosen Newsletter an.
Spannende Lesestunden und viel Spaß beim Miträtseln!
Dein beTHRILLED-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
Christine Bell besucht mit ihrer Katze Isabelle ihre Tante im Seebad Beechwood. Und da ist grad einiges los: Die Behörden erwarten hohen Staatsbesuch und zeitgleich findet eine Science-Fiction-Convention statt. Kurz nach ihrer Ankunft finden Christine und Isabelle jedoch eine Leiche – im Superman-Kostüm. Die Polizei hat mit den Sicherheitsvorkehrungen alle Hände voll zu tun und stempelt den Tod des „Verrückten“ schnell als Unfall ab. Christine ist sich da jedoch nicht so sicher. Vor allem, als Isabelle ihr einen Hinweis liefert, der auf ein Mordmotiv hindeutet. Doch dann gibt es weitere Tote und Isabelle erweist sich wieder einmal als Katze mit der gewissen Spürnase für Mord ...
Der zweite Band um die kluge Katze Isabelle und die Autorin Christine Bell!
Catherine Ashley Morgan
Katze, Maus und Mord – Isabelle und Christine ermitteln
Die verhängnisvolle Botschaft
Für alle unsere »Geflügelten« –Ihr wisst, dass Ihr gemeint seid
Kapitel 1
»Bringen Sie sie herein«, forderte der Chief Inspector den uniformierten Polizisten auf und zündete seine Pfeife an.
»Jawohl«, erwiderte der Mann, entfernte sich vom Schreibtisch und öffnete die Tür. »Wenn ich bitten darf.«
Mehrere Personen kamen aus dem Vorzimmer ins Büro des Chief Inspectors. Das leise Stimmengewirr der Eintretenden verebbte, Ruhe kehrte ein.
Der Chief Inspector blies den Pfeifenrauch aus, summte leise vor sich hin, während er in seinen Unterlagen blätterte, und wandte sich schließlich an seine Besucher. »Sie werden sich vermutlich fragen, meine Damen, warum ich Sie herbestellt habe; immerhin herrscht bei Ihnen allen ja die Meinung vor, dass der junge Lord Henderson durch einen Unfall zu Tode kam.«
Zustimmendes Gemurmel machte sich breit, nahm aber schnell einen besorgten Unterton an, da den Anwesenden deutlich wurde, worauf der Chief Inspector hinauswollte.
»Sie meinen ...«, begann Juliette Pavernier, eine Galeristin aus Marseille.
»Ganz genau«, bestätigte der Chief Inspector. »Was für den Laien aussehen mag wie ein tragischer Unfall, entpuppt sich oft als raffiniertes Täuschungsmanöver, das den wahren Sachverhalt verschleiern soll ...«
»Von welchem wahren Sachverhalt sprechen Sie, Inspector?«, warf Tilly Henderson-Macomber ein, Lord Hendersons zweite Ehefrau, eine blonde Schönheit, die abgesehen von ihrem Aussehen keine erkennbaren Qualitäten besaß.
Der Chief Inspector räusperte sich, zog an seiner Pfeife und legte sie zur Seite. »Von ... Mord.«
Ein Raunen ging durch das Büro.
»Aber wer ...?« ... »Unmöglich ...« ... »Wie können Sie nur ...?«, redeten sie alle so laut und erregt durcheinander, dass lediglich ein paar Wortfetzen zu verstehen waren.
»Ich bitte Sie, meine Damen!«, rief der Chief Inspector. »Ich werde Ihnen erklären, was unsere Untersuchungen ergeben haben, aber ich erwarte, dass Sie mir in Ruhe zuhören.« Er griff wieder nach seiner Pfeife und zog daran. »Miss Pavernier, Sie haben behauptet, Sie seien am fraglichen Abend in einer Galerie in der Newberry Road gewesen.«
»Das ist richtig.«
»Es ist richtig, dass Sie das behauptet haben«, präzisierte der Chief Inspector. »Tatsache jedoch ist, dass Sie für etwa eine halbe Stunde verschwunden waren, und zwar mit dem Ehemann von Alyssa Mumford, deren Bilder dort ausgestellt werden. Peter Mumford hat Ihnen ein Alibi gegeben, indem er beteuerte, er habe Sie den ganzen Abend in der Galerie gesehen. Das ist zwar inhaltlich richtig, aber er hat uns verschwiegen, dass Sie beide sich für eine halbe Stunde in einen Lagerraum zurückgezogen hatten, der so gesehen auch ein Teil der Galerie ist. Allerdings haben wir Zeugen ausfindig machen können, die bestätigen konnten, dass Sie beide in der fraglichen Zeit nicht im Ausstellungsraum waren. Eine halbe Stunde war mehr als genug, um Lord Henderson aufzusuchen und ihn aus dem Fenster zu stoßen.«
»Aber ich ...«, warf die Angesprochene ein.
»Lassen Sie mich erst sagen, was ich zu sagen habe«, unterbrach sie der Chief Inspector. »Henderson hatte eine Reihe wertvolle Bilder ersteigert, die Sie unbedingt haben wollten. Da er sie noch nicht bezahlt hatte, würden Sie den Zuschlag bekommen, wenn Henderson nicht mehr als Käufer zur Verfügung stand.«
Der Chief Inspector legte das oberste Blatt zur Seite und wandte sich der zweiten Anwesenden zu. »Miss Winters, Sie haben für die fragliche Zeit kein brauchbares Alibi beibringen können, und Sie ...«
»Fangen Sie jetzt schon wieder damit an?«, fauchte sie ihn an. »Ich habe Ihnen bereits gesagt, dass ich diesen ... Henderson überhaupt nicht kenne. Woher der meine Telefonnummer hat, ist mir noch immer ein Rätsel. Ich habe überhaupt kein Motiv.«
»Bis auf die Tatsache, dass Henderson und Sie eigentlich alte Bekannte sind.«
»Wie bitte?«
Der Chief Inspector gab einen ungehaltenen Laut von sich. »Hören Sie auf mit Ihrem Theater. Henderson kannte Sie aus Ihrer Zeit als Stripperin im Le Fouquet, als Sie sich noch Melody Mountains nannten. Sie hatten Angst, er könnte Ihre wahre Identität preisgeben, weil Sie wussten, dass das Ihrer Karriere als Kinderbuchautorin den Todesstoß versetzt hätte.«
»Und was werfen Sie mir vor?«, fragte Tilly Henderson-Macomber. »Ich war schließlich mit ihm verheiratet, mir gehörte damit die Hälfte seines Vermögens. Was sollte ich noch mehr wollen?«
»Macht, Mrs Henderson-Macomber. Und zwar durch seinen Sitz im Aufsichtsrat der Henderson Anglia Company. Ihr findiger Anwalt hatte im Ehevertrag eine Klausel eingebaut, die Ihrem Mann – und das entsprach durchaus Ihren Absichten – offenbar nicht aufgefallen war. Demnach rücken Sie in den Aufsichtsrat nach, sobald Ihr Mann verstirbt. Da Ihr Vater selbst im Importhandel tätig ist, können Sie jetzt gegen Geschäfte der Henderson Anglia Company stimmen, um auf diese Weise die Marktposition Ihres Vaters zu stärken.«
»Das ist doch abs...«, begann sie.
»Es ist absolut ausreichend als Motiv für den Mord an Ihrem Mann«, schnitt der Chief Inspector ihr das Wort ab. »Sie sehen also, dass vieles für einen Mord als Todesursache spricht, aber sehr wenig für einen banalen Unfall.« Er klopfte seine Pfeife aus. »Natürlich ist nichts von dem, was ich soeben gesagt habe, als handfester Beweis zu gebrauchen. Aber ... auch wenn das in der Öffentlichkeit oft nicht so wahrgenommen wird, so sind wir Polizisten doch fleißige und vor allem neugierige Menschen, die erst Ruhe geben, wenn sie alles wissen. Und bei der Durchsuchung des Zimmers, aus dem Lord Henderson in den Tod gestürzt ist, stießen wir auf etwas, das sich dort nicht hätte befinden dürfen, wenn Henderson tatsächlich allein gewesen wäre.« Er zog ein Foto aus einer Mappe und hielt es hoch. »Was Sie auf diesem Foto sehen, ist ein Splitter, der zu einem künstlichen Fingernagel gehört. Wir haben den Kunststoff und den Nagellack analysieren lassen, und das Ergebnis führte uns zu einem Nagelstudio in der Heather Street. Nur eine von Ihnen ist dort Kundin, nicht wahr, M...«
»... hier ist Seaside FM mit einer dringenden Verkehrsdurchsage für die M20 in Fahrtrichtung London: Zwischen den Anschlussstellen Ashford und Folkestone kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie bitte äußerst links, überholen Sie nicht und warnen Sie den Falschfahrer mit Lichthupe. Ich wiederhole: ein Falschfahrer auf der M20 in Fahrtrichtung London zwischen den Anschlussstellen Ashford und Folkestone. Wir melden es, wenn die Gefahr vorüber ist.«
»... führen Sie sie ab«, befahl der Chief Inspector. »Der Mord ist geklärt.«
Leise Jazzmusik setzte ein, und ein Sprecher begann: »Das war unser Hörspiel Inspector Branson und der Fenstersturz nach einem Roman von Ra...«
»So ein Mist«, murmelte Christine und drehte das Radio leiser. »Konnte dieser verdammte Geisterfahrer nicht noch zwei Minuten warten?«
Von der Rückbank war ein leises Miauen zu hören, in dem Zustimmung mitzuschwingen schien. Christine schaute in den Rückspiegel zu Isabelle, die in ihrem neuen Transportkorb saß und versuchte, etwas von der vorüberziehenden Landschaft zu sehen.
»Du hättest wohl auch gern gewusst, wer von den drei Grazien den armen Kerl umgebracht hat, wie?« Christine schüttelte den Kopf und konzentrierte sich wieder auf die Straße. Sie war durch Zufall auf dieses Hörspiel gestoßen, als sich der Sendersuchlauf auf einmal selbstständig gemacht hatte, und dann war sie dabei geblieben. Dass ihr jetzt die Auflösung vorenthalten worden war, fand sie ausgesprochen ärgerlich. Vielleicht sollte sie beim Sender anrufen und fragen, wer denn nun die Mörderin war? Aber vermutlich würde man ihr dann anbieten, das Hörspiel im Shop des Senders als CD oder als Download zu kaufen. Die Story war nicht schlecht gewesen, doch so gut nun auch wieder nicht ...
Soeben tauchte am Straßenrand das Ortsschild von Beechwood auf. Christine ging vom Gas, da kurz nach dem Schild eine scharfe Linkskurve folgte. Kaum hatte sie sie durchfahren, fiel die Straße in Richtung Küste leicht ab, und es bot sich ihr ein Anblick, der mit zahllosen schönen Erinnerungen verbunden war. Über die Dächer der Reihenhäuser hinweg, die sich bis dicht an die Strandpromenade erstreckten, war das Meer zu sehen. Unzählige Schaumkronen sprenkelten das Wasser, das bis zum Horizont reichte. In der Ferne waren die grauen Konturen großer Frachtschiffe zu sehen, näher an der Küste konnte sie vereinzelte Segelboote erkennen, und über dem Strand, der Christines Blicken durch die Häuser verborgen war, standen ein paar bunte Drachen in der Luft.
Die Straße schlängelte sich zwischen den Reihenhäusern hindurch, die auch schon bessere Zeiten gesehen hatten, ab und zu kamen ihr Fahrzeuge entgegen. Im März war es den meisten Touristen noch zu kalt und zu stürmisch, um ihren Urlaub am Meer zu verbringen, aber zum Sommer hin würde es hier wesentlich belebter werden. Das galt für Beechwood ebenso wie für das benachbarte Brighton im Westen und Eastbourne im Osten. Die Strandpromenade war hier jedoch nur einige hundert Meter lang, was dadurch bedingt war, dass der Strand im Westen und Osten in hohe Kreidefelsen überging, die der Flaniermeile ein natürliches Ende setzten. Dazwischen lag Beechwood selbst wie in einer Senke, die von etlichen Erhebungen durchzogen wurde, sodass viele Straßen ein Gefälle beziehungsweise eine Steigung aufwiesen.
Es war für Christine das erste Mal seit ihrer Jugend, dass sie herkam, und als sie jetzt diese Straße entlangfuhr, fühlte sie sich wieder wie zehn oder zwölf. Damals hatte sie auf dem Rücksitz eines alten, klapprigen Morris gesessen, der einen solchen Höllenlärm machte, dass man meinen konnte, während der Fahrt würden sich regelmäßig irgendwelche Teile des Motors verabschieden. Es war ihr stets wie ein Wunder erschienen, wenn sie Beechwood und das Haus von Tante Betty und Onkel Cyril erreichten, nachdem sie unterwegs immer wieder mit einem anderen Defekt liegengeblieben waren.
Irgendwann war ihr Vater schließlich zu der Einsicht gekommen, dass es an der Zeit wäre, sich doch mal einen neuen Wagen zuzulegen. Mit großem Widerwillen hatte er sich für einen Ford entschieden, die einzige Marke, die in seinen Augen nach dem Konkurs der anderen Autohersteller oder deren Übernahme durch japanische Konkurrenten für einen Briten noch akzeptabel war. Im gleichen Jahr kam es zu einem heftigen Streit zwischen ihrem Vater und seiner Schwester, der fast zehn Jahre eisiges Schweigen nach sich zog, sodass Christine nicht in den Genuss kam, auf dem Rücksitz des neuen Wagens nach Beechwood zu fahren. Als die beiden sich schließlich wieder zusammenrauften, war Christine längst zu Hause ausgezogen.
Nach dem Tod von Onkel Cyril war Tante Betty ein paar Mal nach London gekommen, um ihren Bruder und ihre Schwägerin zu besuchen, doch eine Fahrt nach Beechwood hatte seit rund zwanzig Jahren keiner von ihnen mehr unternommen.
Sie fuhr durch die Slaughterhouse Road und bog in die letzte Straße links – die Road by the Sea – ein. Nach gut zweihundert Metern hob sich auf der rechten Seite eines der Häuser von den anderen deutlich ab, da es nicht weiß, sondern in einem kräftigen Gelb gestrichen war.
Das war Tante Bettys Haus.
Christine ließ den Wagen ausrollen und hielt vor dem Gebäude an, einem Backsteinbau aus den Fünfzigerjahren. Als sie den Motor abgestellt und die Tür geöffnet hatte, konnte sie das Meeresrauschen hören, das sie automatisch in Urlaubsstimmung versetzte. Einen Moment lang blieb sie neben dem Wagen stehen und schloss die Augen, um die Geräuschkulisse zu genießen, die etwas Beruhigendes, fast Einschläferndes hatte.
Ein energisches Miauen holte sie aus ihrer Träumerei, und sie schlug die Augen auf. Isabelle saß in ihrer Box, die Nase gegen die Gittertür gedrückt und musterte sie vorwurfsvoll.
»Ja, ja, schon gut«, murmelte sie, ging um den Wagen herum und öffnete die Schiebetür, um an die hintere Sitzbank zu gelangen.
Mit Isabelles Transportbox ging sie zum Gartentor, öffnete es und stellte die Box dahinter auf die Steinplatten, die zur Haustür führten. Dann kehrte sie zum Wagen zurück und holte ihr Gepäck aus dem Kofferraum.
Aus dem Haus gegenüber kam eine dunkelhaarige Frau, warf einen Abfallbeutel in die Mülltonne und nickte Christine grüßend zu. Nachdem sie sich bereits wieder umgedreht hatte, stutzte sie plötzlich. Dann wandte sie sich noch einmal zu Christine um, die sich ein Grinsen verkneifen musste, während sie abwartend neben dem Wagen stand.
»Chrissy?«, rief sie. »Bist du das wirklich?«
»Wenn du noch immer Polly Hagan bist«, erwiderte sie. Polly war die Nachbarstochter gewesen, mit der Christine einen Teil des Sommers verbracht hatte, wenn Pollys Eltern nicht gerade zur gleichen Zeit in Spanien Urlaub machten. Da Polly drei oder vier Jahre älter war, hatte sich zwischen ihnen nie eine engere Freundschaft entwickelt, dafür waren ihre Interessen damals zu verschieden gewesen. Nicht einmal bei der Musik hatten sie beide auf der gleichen Wellenlänge gelegen, und so war es bei einer losen Bekanntschaft geblieben, die schließlich einschlief, als Christines Familie nicht mehr in den Ferien nach Beechwood kam.
»Sorry, aber mit Polly Hagan kann ich nicht dienen«, sagte die andere Frau. »Ich bin ihre Nachfolgerin. Wenn ich mich vorstellen darf: Polly Curtis, geborene Hagan.«
Christine musste lachen, und dabei wurde ihr zum ersten Mal klar, dass Pollys seinerzeit reiferer Sinn für Humor ein weiterer Grund gewesen war, warum sie keine Freundinnen geworden waren.
Polly legte den Kopf schräg und musterte sie. »Du hattest doch immer so schöne lange Haare.«
»Oh, vorgestern hatte ich die sogar noch. Allerdings hat es mich früher schon wahnsinnig gemacht, wenn wir in den Ferien hier waren und mir der Wind drei Wochen lang die Haare ins Gesicht wehte.« Bei der Erinnerung daran verzog sie den Mund. »Na ja, und da ganz kurze Frisuren momentan sowieso angesagt sind, dachte ich mir, ich verbinde das Modische mit dem Nützlichen.«
»Steht dir gut. Eigentlich ist es auch das Einzige, was an dir anders ist. Du hast dich gut gehalten.«
»Danke. Du hast dich aber auch nicht sehr verändert«, entgegnete Christine.
Polly lächelte wehmütig. »Du musst mir nichts vormachen, Chrissy. Ich lebe nicht in einem Haus, in dem alle Spiegel verhüllt sind. Drei Kinder haben ihre Spuren hinterlassen. Für jede schlaflose Nacht ein graues Haar und im Gesicht eine Falte mehr. Irgendwann habe ich mit dem Zählen aufgehört. Meine Haare kann ich wenigstens noch färben.«
»Du Ärmste«, sagte sie bedauernd, doch gegen ihren Willen nahm ihre Stimme diesen hässlichen ›Das ist doch deine eigene Schuld‹-Tonfall an. »Ich ...«
»Nein, nein, erzähl mir jetzt nicht«, fiel Polly ihr mit einem verbitterten Lachen ins Wort, »dass du dir das vorstellen kannst. Wenn ich dich so ansehe, dann kann ich nur sagen, dass jemand mit deiner Figur noch nie schwanger gewesen sein kann. Stimmt’s?«
»Stimmt.«
»Siehst du? Ich wusste es doch.« Schulterzuckend wechselte sie das Thema: »Aber verrat mir lieber, was dich nach so vielen Jahren in dieses Kaff zurücktreibt.«
»Als ›Kaff‹ würde ich Beechwood nicht gerade bezeichnen«, wandte Christine ein. »Ich meine, wir haben erst März, da war hier doch noch nie viel los, oder?«
»Warst du schon unten auf der Promenade? Und hast du den Pier gesehen? Oder die Oxford Street?«
»Nein, ich bin über die Slaughterhouse Road hergekommen und dann abgebogen, um direkt zu Tante Betty zu fahren.«
»Na, da hast du was verpasst. Da unten ...« Polly hielt inne und legte die Stirn in Falten. »Ach, was rede ich groß, das solltest du dir besser selbst ansehen. Doch zurück zu meiner eigentlichen Frage: Was machst du hier?«
»Tante Betty hat sich das Bein gebrochen«, sagte Christine.
»Oh ja, ich weiß. Wir haben für sie mit eingekauft, weil sie momentan allein gar nicht aus dem Haus kommt.«
»Tatsächlich? Oh, das ist wirklich lieb von euch. Aber ihr habt sicher auch so schon genug um die Ohren, und weil Tante Betty nicht ständig die ganze Nachbarschaft bemühen möchte, habe ich angeboten, mich für ein paar Wochen bei ihr einzuquartieren.«
»Ach, weißt du«, gab Polly zurück. »Jeder hier macht das gerne. Deine Tante ist so eine nette Frau, da würde sich keiner beschweren, wenn es mal etwas für sie zu erledigen gibt.«
Christine nickte. »Das glaube ich dir, aber ich entwickele momentan ein neues Reihenkonzept, da bin ich nicht rund um die Uhr eingebunden, und als Mom vor ein paar Jahren für einige Wochen zur Kur weg war, da kam Tante Betty nach London und half Dad, womit sie mir und meiner Schwester eine Menge Arbeit abnahm. Da finde ich es nur richtig, wenn ich mich jetzt revanchiere.«
»Ach, stimmt ja. Du schreibst Romane. Deine Tante hatte mir irgendwann mal einen zum Lesen gegeben. Beeindruckend, so was.«
»Welcher war es?«
Polly schüttelte den Kopf. »Weiß ich nicht mehr. Ich bin eigentlich keine Leseratte. Aber ich find’s toll, wenn jemand Hunderte von Seiten schreiben kann und am Ende noch weiß, auf was er am Anfang hinauswollte. Ich könnte das nicht. Dem einen ist es halt gegeben, dem anderen nicht.«
»Genau. Viele fühlen sich berufen, nur wenige sind auserwählt«, scherzte Christine, doch das kam bei Polly offenbar nicht an.
»Wie?«, fragte die und sah sie verständnislos an.
»Ach.« Sie machte eine wegwerfende Handbewegung. »Das ist nur so ein Spruch, den ich mal irgendwo gelesen habe.«
Polly nickte, obwohl sie genauso ratlos war wie noch vor ein paar Sekunden. »Und wie lange bleibst du?«
»Bis sie Tante Betty den Gips abnehmen. Vielleicht auch noch ein paar Tage länger, aber das kommt darauf an, wie schnell sie danach wieder richtig gehen kann.«
»Und danach geht’s zurück nach London?«
»Richtig.«
»Ich glaube, ich würde auch lieber in London wohnen als hier«, seufzte Polly.
»Warum ziehst du nicht weg, wenn es hier so schlimm ist?«
»Wenn ich das könnte! Meine Eltern haben sich auf Mallorca niedergelassen und meinem Mann und mir das Haus zur Verfügung gestellt, aber offiziell gehört es uns nicht. Wir können es also nicht verkaufen, und meine Eltern wollen sich nicht davon trennen. Das hat irgendwelche steuerlichen Gründe, aber frag mich nicht nach den Einzelheiten. Steuern sind für mich ein rotes Tuch.« Plötzlich sah Polly auf ihre Armbanduhr. »Oh, ich muss wieder ins Haus. Der Kleine braucht etwas zu essen.« Sie drückte Christines Schultern. »Wir sehen uns bestimmt noch.«
»Das wird sich wohl kaum vermeiden lassen«, meinte Christine mit einem Augenzwinkern. Als Polly ihr daraufhin einen rätselnden Blick zuwarf, wusste sie, dass ihr eigener Humor inzwischen den von Polly überholt hatte.
Sie zog den Koffer hinter sich her, schloss das Gartentor, nahm den Katzenkorb und folgte dem gepflasterten Weg zur Haustür. Wie mit ihrer Tante verabredet, lag der Schlüssel hinter dem Blumenkasten, damit sie ins Haus gelangen konnte, sobald sie angekommen war.
»Huhuu, Tante Betty«, rief sie, als sie eintrat. »Ich bin’s, Christine!«
»Ich bin im Wohnzimmer«, kam die prompte Antwort.
Den Koffer ließ sie vor der Kellertreppe stehen, mit dem Transportkorb ging sie durch den schmalen Flur am Badezimmer vorbei zur nächsten Tür, die ins Wohnzimmer führte.
Tante Betty saß in einem für den Raum viel zu wuchtigen weinroten Ledersessel – wahrscheinlicher war, dass es sich um einen Kunstledersessel handelte – und hatte das eingegipste Bein auf einen dazu passenden Lederhocker gelegt.
Das Zimmer war noch immer so vollgestellt, wie Christine es in Erinnerung hatte, mit dem Unterschied, dass die Sachen von damals neuem Kitsch gewichen und von Onkel Cyrils umfangreicher Fußballsammlung nichts mehr zu sehen war. Er war ein leidenschaftlicher Fan von Tottenham gewesen, und eine Ecke des Wohnzimmers war früher mit allen nur erdenklichen Fanartikeln dekoriert. Dort stand nun eine Sammlung Hummel-Figuren, von denen Christine zwar wusste, dass sie recht teuer waren, an denen sie dennoch persönlich keinen Gefallen fand.
Das erinnerte sie an das Päckchen in ihrer Jackentasche. Sie zog es heraus und gab es ihrer Tante, nachdem sie die Katzenbox zur Seite gestellt und Betty auf die Wange geküsst hatte. »Das ist für dich.«
Betty strahlte sie an. »Was ist es?«
»Wenn ich dir das verraten wollte, hätte ich es ja gar nicht erst eingepackt.«
Während Betty das Präsent auspackte, beobachtete Christine ihre Tante. Sie machte einen guten Eindruck, wenn man das Gipsbein einmal außer Acht ließ, und dass sie Mitte sechzig war, sah man ihr nicht einmal an, wenn man es wusste. Ihr Haar trug sie recht modisch frisiert, und ihre himmelblaue Lesebrille ließ sie noch ein bisschen jünger wirken. Ohne gehässig sein zu wollen, musste Christine feststellen, dass ihre Tante besser aussah als Polly von gegenüber, und das, obwohl sie es im Leben auch nicht immer leicht gehabt hatte.
»Oh, wie reizend!«, rief Betty und betrachtete die Figur eines Mädchens, das in einer Hand einen geöffneten Schirm hielt, während auf der anderen Hand zwei Vögel saßen, die Zuflucht vor dem Regen gesucht haben mussten.
»Ich dachte, es könnte dir gefallen«, sagte Christine, zufrieden darüber, dass sie für ihre Tante genau das richtige Mitbringsel gefunden hatte, und kümmerte sich erst einmal um Isabelle, die in ihrer Box saß, als sei es für eine Katze das Natürlichste auf der Welt, in einem solchen tragbaren Gefängnis verharren zu müssen.
In aller Gemütsruhe verließ sie ihre Transportbox, inspizierte die bereits von einer Nachbarin im Badezimmer bereitgestellte Katzentoilette und sah sich dann ausgiebig im Wohnzimmer um.
»Das ist also die berühmte Isabelle, von der du mir geschrieben hast«, sagte Betty und fügte erstaunt an: »Ihr Fell hat ja einen ausgesprochen intensiven Orangeton. So was habe ich noch nie gesehen.«
»Ja, mein Tierarzt in London meinte sogar zuerst, jemand könnte ihr Fell gefärbt haben«, stimmte Christine ihr zu. »Aber diese roten Tigerstreifen sind echt.«
Isabelle ging zu Betty, schnupperte ausgiebig am Gips, ehe sie auf die Sessellehne sprang und sich auf ihrem Schoß niederließ, um sich kraulen zu lassen.
»Jetzt erzähl mir erst mal, wie es dir geht«, wandte sich Christine an ihre Tante. »Kann ich dir irgendwas bringen? Brauchst du etwas?«
»Ganz ruhig, mein Schatz«, beschwichtigte Betty sie, während sich Isabelle gegen ihre Hand drückte und die Streicheleinheiten sichtlich genoss. »Ich habe dir gesagt, dass ich gut zurechtkomme. Hier im Haus gibt es fast nichts, was ich nicht auch mit einem gebrochenen Bein erledigen kann, außer dass ich mich nicht in den ersten Stock traue, weil die Treppe zu schmal ist. Ansonsten brauche ich eigentlich nur Hilfe bei Besorgungen, und ab und zu muss hier Staub gesaugt oder gespült werden. Glaub mir, du hättest wirklich nicht herkommen brauchen. Meine Nachbarn ...«
»Ja, ich weiß«, unterbrach Christine sie. »Aber ich möchte mich gern um dich kümmern, okay?«
»Okay, mein Schatz.« Betty lächelte sie an. »Ich will dir nur sagen, dass es wahrscheinlich nicht so viel zu tun gibt, wie du vielleicht glaubst.«
»Aber zum Arzt fahren darf ich dich hoffentlich«, wandte Christine ein. »Oder hast du dafür schon einen Chauffeur engagiert?«
»Nein, du kannst ...« Mitten im Satz stutzte sie, da Isabelle aufgehört hatte zu schnurren und sich auf ihrem Schoß hinsetzte und einen langen Hals machte. »Was hast du denn, Kleine?«
Christine sah in die Richtung, in die Isabelle schaute, konnte jedoch nichts Ungewöhnliches erkennen. »Bestimmt hat sie im Garten einen Vogel gesehen.« Sie drehte sich zu der Katze um. »Du weißt, ich habe dir verboten, Vögel zu jagen. Wenn du Hunger hast, bekommst du von mir etwas zu essen. Ist das klar?«
Isabelle verdrehte den Hals, um an ihr vorbei aus dem Fenster zu sehen, wobei sie nach wie vor auf Bettys Schoß sitzen blieb. »Eigenartig«, murmelte die. »Wenn sie etwas gesehen hätte, wäre sie doch längst zum Fenster gelaufen.«
»Ja, aber ... vielleicht hat sie was gehört«, überlegte Christine. »Hattest du schon mal ungebetene Besucher im Garten?«
»Menschliche oder tierische?«
»Beide Arten.«
»Tierische ja, wenn die Katzen aus der Nachbarschaft sich gegenseitig jagen, aber von den Nachbarn schleicht da keiner herum. Hinter der Hecke verläuft ein verwahrloster Streifen Land, auf den gar niemand gelangen kann. Du weißt schon, das sollte mal eine Straße werden, aber gegen die haben wir uns erfolgreich zur Wehr gesetzt. Dahinter wiederum liegt das Hotelgrundstück. An sich sollte eigentlich niemand dort drüben unterwegs sein.«
Christine nickte. »Es sei denn, es ist jemand, der da nichts zu suchen hat.« Sie ging zum Fenster und warf einen Blick nach draußen. »Vielleicht hat Isabelle irgendwen bemerkt, der da hinten herumschleicht und herausfinden will, wie er unbemerkt in die Häuser einsteigen kann. Weißt du was? Ich sehe mich mal ein bisschen um. Halt Isabelle fest, während ich rausgehe. Sie kennt sich hier noch nicht aus, und ich möchte, dass sie sich erst mal mit deinem Haus vertraut macht, ehe ich sie in den Garten lasse.«
»Kein Problem, ich hatte in meinem Leben genügend Stubentiger, um zu wissen, wie man sie halten muss, damit sie einem nicht entwischen.«
Isabelle spürte nichts von dem Griff, in den Betty sie nahm, da sie unverändert auf das konzentriert war, was sie irgendwo dort draußen bemerkt hatte.
Christine öffnete die Terrassentür, die Katze saß noch immer wie erstarrt da. Doch als Christine die Tür hinter sich zuziehen wollte und die sich plötzlich verhakte, machte Isabelle einen so unerwarteten und mächtigen Satz, dass Betty nur noch erschreckt aufschreien konnte, und dann schoss das Tier auch schon quer durchs Wohnzimmer.
Christine versperrte mit einem Bein den Türspalt, der sich nicht schließen ließ, doch der auf sie einstürmenden Gewalt war sie nicht gewachsen. Mit der Schulter warf sich Isabelle gegen ihr Schienbein und brachte sie lange genug aus der Balance, um an ihrem Bein vorbei in den Garten zu huschen.
»Ach, verdammt«, rief Christine, während ihre Tante entschuldigend die Hände hob.
»Tut mir leid, Schatz, aber so ein Energiebündel habe ich noch nicht erlebt!«
»Ich weiß, Tante Betty«, gab sie über die Schulter zurück und lief in den Garten. »Damit hat sie mich auch schon überrumpelt.«
Wie ein roter Blitz schoss Isabelle durch den Garten und war durch die Hecke verschwunden, lange bevor Christine überhaupt eine Chance hatte, sie einzuholen.
»Isabelle, komm zurück!«, rief sie, obwohl sie wusste, dass sie keinen wohlerzogenen Hund vor sich hatte, der seinem Frauchen aufs Wort gehorchte. Stattdessen hatte sie es mit einer eigensinnigen Katze zu tun, die in ihr wenig mehr sah als eine Dosenöffnerin und eine Streicheleinheiten-Spenderin.
An der Hecke angekommen, versuchte sie, durch das dichte Blattwerk etwas zu erkennen. Tatsächlich konnte sie für einen Augenblick einen rötlichen Schemen ausmachen, der dann aber gleich wieder verschwunden war. Isabelle lief also weiter. Sie musste irgendetwas gehört oder gewittert haben, und Christine wollte wissen, um was es sich handelte. Vielleicht schlich tatsächlich jemand über das verwilderte Grundstück und versuchte die Häuser auszuspionieren, um herauszufinden, wo ein Einbruch die meiste Beute versprach.
Sie suchte nach einem Durchlass in der Hecke, fand aber keinen; damit blieb ihr nur der Weg, den Isabelle genommen hatte: unter der Hecke hindurch. Sie legte sich ins Gras und zwängte sich durch den recht schmalen und ziemlich flachen Freiraum, bis sie auf dem einige Meter breiten Streifen angelangt war, der hinter den Gärten der Häuser in der Road by the Sea verlief. Gräser waren hier hüfthoch gewachsen, und etliche Hecken waren wild drauflos gewuchert, sodass ein stellenweise undurchdringliches Dickicht entstanden war. Zahlreiche kleine Bäume und ausladende Büsche hatten sich über viele Jahre hinweg ausgebreitet, nachdem nach der ersten Rodung des Geländes die Bürgerinitiative den Bau einer Straße verhindert hatte.
Christine war froh, dass sie Jeans, Sweatshirt und geschlossene Schuhe trug, sonst hätte sie sich an den Ästen und Zweigen wahrscheinlich die Arme und Beine aufgekratzt. Sie sah sich um, konnte aber keinen Hinweis darauf entdecken, dass sich hier jemand aufhielt. Auch Isabelle war unauffindbar. Erst als sie die Augen schloss und intensiv lauschte, vernahm sie ein leises Rascheln, das von der Katze stammen musste. Sie konnte die Richtung einigermaßen genau bestimmen, doch half ihr das nicht dabei, einen Weg durch das Dickicht zu finden. Bei jedem Schritt musste sie nicht nur aufpassen, wohin sie trat, damit sie nicht über eine Wurzel stolperte, sondern sich darüber hinaus die Arme vors Gesicht halten. Nur so konnte sie verhindern, dass sie gegen einen Ast lief, während sie den Boden im Auge behielt.
Plötzlich fand sie sich vor einem Bretterzaun wieder und stutzte. Hatte sie sich auf der kurzen Strecke verlaufen? Wieso stand hier ein Bretterzaun mitten in der Landschaft? Sie spähte durch eine Ritze zwischen zwei Brettern und erkannte, dass sie sich genau hinter dem Hotel The Golden West befand, einem vierzehn Stockwerke hohen Gebäude, das Mitte der 70er errichtet worden war.
Der Name des Hotels war blanker Hohn, denn bei dem Bauwerk handelte es sich um einen geschmacklosen grauen Klotz, eine der typischen Bausünden aus jener Zeit, als möglichst viel Beton in möglichst klobiger Form zum Maß aller Dinge erklärt wurde, ehe die Architekten eine Kehrtwende machten – und stattdessen erst zu viel Stahl und dann zu viel Glas einsetzten, sodass den Betonklötzen stählerne und wenig später gläserne Kästen folgten.
Durch die Ritze entdeckte sie dann auch Isabelle. Die hatte ihren Erkundungsgang offenbar beendet und sich stattdessen hingesetzt, um auf irgendetwas zu warten. Was genau das war, konnte Christine nicht erkennen.
»Isabelle!«, rief sie. »Komm her.«
Tatsächlich drehte die Katze den Kopf in ihre Richtung, doch sie rührte sich nicht von der Stelle. Allem Anschein nach wartete Isabelle auf sie.
»Was soll denn das jetzt?«, murmelte sie genervt und ging am Bretterzaun entlang, um nach einer Lücke zu suchen, doch es fand sich keine, die breit genug für sie war. Isabelle musste einen Weg unter dem Zaun hindurch entdeckt haben, vermutlich war irgendwo ein Stück eines Bretts herausgebrochen.
Nein, hier gab es für sie kein Durchkommen. Sie konnte nur ins Haus zurückkehren und dann um den Block herum zum Hotel fahren. Eben drehte sie sich um, da kam ihr ein Gedanke, der sie innehalten ließ. Warum sollte sie einen solchen Umweg machen, wenn es wahrscheinlich doch viel einfacher ging? Wenn der Zaun zu der Zeit gebaut worden war, als man mit den Vorbereitungen für die Straße begonnen hatte, dann musste er inzwischen morsch geworden sein. Es gab nur eine Methode, das herauszufinden: die harte Tour.
Sie stellte sich mit dem Rücken gegen den Zaun und trat mit aller Kraft nach hinten aus. Wie erhofft bot das verwitterte Holz keinen Widerstand, und das Brett wurde beim ersten Treffer herausgerissen. Das Gleiche wiederholte sie beim nächsten Brett, womit ein ausreichend breiter Durchgang entstanden war. Es bestand zwar die Gefahr, dass die Hoteldirektion ihr Ärger machen würde wegen des angerichteten Schadens, aber das Holz hatte so leicht nachgegeben, dass sie vermutlich mit der Behauptung durchkommen könnte, sie sei über eine Wurzel gestolpert und gegen den Zaun gefallen.
Darauf bedacht, nicht mit den rostigen Nägeln in Berührung zu kommen, die aus den herausgetretenen Brettern ragten, stieg sie durch die Lücke und stellte fest, dass Isabelle noch an der gleichen Stelle saß wie zuvor. Da Christine nun freie Sicht hatte, bemerkte sie, dass das Tier am Rand des Swimmingpools saß. Ein Gitterzaun gleich hinter dem Gebäude machte deutlich, dass der Pool derzeit für die Gäste gesperrt war, wohl weil er renoviert werden musste.
Beim Näherkommen wurde jedoch erkennbar, dass das gesamte Gelände hinter dem Hotel nicht nur vorübergehend geschlossen war, sondern bereits seit einer ganzen Weile. Zwischen den Steinplatten rings um das Becken quoll das Moos, die Sträucher und Büsche waren seit Jahren nicht mehr geschnitten worden, und die Liegewiese auf der anderen Seite des Pools befand sich in einem ähnlichen Zustand wie der Streifen Land, durch den sie sich soeben gekämpft hatte.
Von den Steinplatten, die unmittelbar um den Pool verlegt waren, saßen etliche locker, einige waren im Lauf der Zeit herausgebrochen. Irgendjemand war wohl seinerzeit sehr optimistisch gewesen, was die Renovierungsdauer betraf, und hatte die Liegen in einer Ecke aufeinandergestapelt, wo ihre Metallrahmen mittlerweile komplett verrostet waren.
Von ihrer Position ein paar Meter vom Beckenrand entfernt aus konnte Christine sehen, dass die Wände und wohl auch der Boden des Pools hellblau gekachelt waren, ein simpler Trick, der das Wasser sauberer erscheinen ließ, als es in Wahrheit vermutlich gewesen war. Zahlreiche Kacheln waren mit der Zeit herausgebrochen, hier und da hatten sich Wurzeln durch den Boden vorgearbeitet und Schäden verursacht.
Das Ganze sah aus wie eine Szene aus einem Film, der in der Zeit nach einer Apokalypse spielte, die die Menschheit gezwungen hatte, sich aus der Zivilisation in die Wildnis zurückzuziehen, sodass nach und nach alles marode wurde und die Natur sich das ihr abgenommene Land zurückeroberte.
Ein Schauer lief Christine über den Rücken, und fast rechnete sie damit, dass jeden Moment hinter dem nächsten Busch ein verstrahlter Zombie hervorkam, um sich auf sie zu stürzen.
Sie schüttelte sich und hockte sich neben Isabelle hin. »Was ist los, meine Süße?«, fragte sie. »Was willst du mir hier zeigen?«
»Mau«, lautete ihre knappe Antwort, dann stand sie auf und ging zielstrebig zum Beckenrand, wo sie auf einmal zu knurren begann und einen Buckel machte.
Christine richtete sich auf und folgte ihr zum Pool. Vielleicht war eine andere Katze in das Becken gesprungen und kam ohne fremde Hilfe nicht wieder heraus.
Was sie in dem trockengelegten Schwimmbecken dann allerdings erblickte, als sie keine zwei Meter mehr entfernt war, das konnte eindeutig nicht ohne fremde Hilfe den Pool verlassen – allerdings aus einem anderen Grund.
Mitten im Becken lag ein Mann in einer großen Blutlache, die sich um seinen zerschmetterten Kopf herum ausgebreitet hatte. Er trug ein Superman-Kostüm: blauer Ganzkörperanzug, dazu Stiefel, Hose und Cape in Rot, auf seiner Brust prangte ein rotes S auf gelbem Grund.
Was die Verkleidung sollte, konnte sich Christine nicht erklären. Sie wusste nur eines:
Superman war tot.
Kapitel 2
»Und Sie haben also den Toten entdeckt?« Der Mann im dunklen Nadelstreifenanzug, der in Begleitung von zwei uniformierten Polizisten eingetroffen war, hatte im Becken die Leiche in Augenschein genommen und war eben wieder herausgekommen.
Christine nickte. »Ja, richtig. Ich hatte meine Katze gesucht und sie hier auf dem Grundstück entdeckt.«
»Sie hätten das Gelände gar nicht betreten dürfen«, raunte Billings sie an. Der Hotelmanager war wutentbrannt mit den drei Polizisten durch den Hintereingang zum Pool geeilt, nachdem Christine von dort aus per Mobiltelefon die Polizei von ihrem Fund in Kenntnis gesetzt hatte. »Das Gelände ist als Baustelle ausgewiesen, und deren Betreten ist strikt verboten.«
»Dann sollten Sie auch dafür sorgen, dass der Bretterzaun da hinten mal erneuert wird«, hielt sie ihm entgegen. »Da muss man sich von der anderen Seite nur dagegenlehnen, dann bricht er schon zusammen. Außerdem können Sie doch froh sein, dass ich hergekommen bin. Oder wäre es Ihnen lieber gewesen, einer Ihrer Gäste hätte den Toten entdeckt?«
»Es geht mir um ...«
»Halten Sie bitte beide den Mund«, knurrte der Polizist ungehalten und fuhr sich über sein kurz geschnittenes rötliches Haar, das ihn sehr irisch aussehen ließ. Er wirkte bereits gereizt, als sie ihn aus dem Hotel hatte kommen sehen – so als hätte sie ihn bei etwas so Wichtigem wie dem Mittagessen gestört. »Der Dame ist ja nichts passiert«, wandte er sich an den Hotelmanager. »Ich schlage vor, Sie ...«, er deutete auf Christine, »... nehmen Ihre Katze und gehen nach Hause, und Sie vergessen den Zwischenfall einfach, Mr Billings. Reparieren Sie den Zaun, und wenn wir den Toten weggebracht haben, rate ich Ihnen, den Pool mit einer Plane abzudecken, damit wir morgen nicht den Nächsten vom Beckenboden kratzen müssen. Das ist nämlich eine ziemliche Sauerei.«
Billings nickte stumm, dann wandte er sich ab und kehrte zurück ins Gebäude.
»Und was ist mit mir, Inspector?«, fragte Christine, als der Mann sich wegdrehte und offenbar ebenfalls den abgesperrten Bereich verlassen wollte.
»Detective Chief Inspector Hatfield, um ganz genau zu sein«, erwiderte er und sah sie über die Schulter hinweg an. »Sie können ruhig Chief Hatfield sagen, das macht hier jeder.« Er wartete, ob sie etwas darauf entgegnen würde, aber sie stand nur abwartend da. »Was soll mit Ihnen sein?«
»Na, wollen Sie denn meine Personalien nicht aufnehmen? Und benötigen Sie von mir keine Aussage?«
»Eine Aussage? Wofür das denn?«, rätselte er. »Sie haben den Toten entdeckt, uns informiert, und das war es dann. Es ist ja schließlich nicht so, als hätte ihn jemand umgebracht.«
Christine legte verwundert den Kopf schräg. »Woher wollen Sie das wissen? Wenn Sie sich nicht im Hotel umgesehen haben, können Sie doch gar nichts dazu sagen, was sich zugetragen hat.«
»Wer von uns beiden ist Polizist?«, fragte er schnaubend. Es war nicht zu übersehen, wie lästig ihm diese Diskussion war.
»Na, Sie.« Sie verkniff sich eine spöttische Bemerkung, die ihr sicherlich eine Anzeige wegen Beamtenbeleidigung eingebracht hätte. Stattdessen fügte sie hinzu: »Und deshalb ist es Ihre Pflicht, alle Möglichkeiten in Erwägung zu ziehen.«
Hatfield drehte sich zu ihr um und zwirbelte die Enden seines Schnauzers zwischen Daumen und Zeigefinger. Eine Weile musterte er sie, dann nickte er bedächtig. »Sie sind nicht von hier, richtig?«
»Ja, das stimmt. Ich bin momentan zu Besuch in Beechwood«, bestätigte sie.
»Momentan? Wann waren Sie denn das letzte Mal hier?«
»Das ist ungefähr fünfzehn bis zwanzig Jahre her«, antwortete sie ausweichend. Bei Polizisten konnte man nie wissen, welche Details sie sich einprägten, um sie später gegen einen zu verwenden.
»Aha.« Wieder nickte er. »Dann möchte ich Ihnen mal etwas erklären: Seit zehn oder elf Jahren kommen jeden März ein paar Tausend Fans von all diesen eigenartigen Zukunftsserien und so weiter nach Beechwood und veranstalten eine Convention.«
»Und so weiter?«, hakte sie nach. »Was meinen Sie damit?«
»Na, Zeug wie dieses Herr der Ringe und Star Wars und das alles.«
»Dann meinen Sie eine Science-Fiction- und Fantasy-Convention«, korrigierte Christine ihn.
»Ja, ja, sag ich doch«, fuhr er hastig fort. »Da wimmelt es in ganz Beechwood von Verrückten, die in Uniformen herumrennen, die sie in irgendwelchen Filmen gesehen haben. Die meisten sind ganz harmlose Spinner, aber erstens finde ich, sind das zu viele Spinner auf einem Haufen, und zweitens gibt es in der Zeit mehr Diebstähle und Gewaltdelikte als im ganzen übrigen Jahr. Sobald sie eine Maske vor dem Gesicht haben, glauben diese Verrückten ...«
»Nur weil diese Leute Kostüme tragen, müssen Sie sie nun wirklich nicht ständig als Verrückte bezeichnen«, fiel sie ihm ins Wort. »Das sind ganz normale Leute, die in ihrer Freizeit einem Hobby nachgehen. Die werden nicht zu Gewalttätern, nur weil sie auf einmal ein paar spitze Ohren aufsetzen oder eine Rüstung tragen.«
»Ach ja? Und wie erklären Sie sich dann den Anstieg der Straftaten, sobald diese Horde hier auftaucht?«
»Vielleicht nutzen Kriminelle die Situation aus und rauben in irgendeiner wirren Verkleidung Leute aus, weil sie wissen, dass der Verdacht automatisch auf die Convention-Besucher fällt.«
»Sie scheinen sich ja gut auszukennen. Gehören Sie etwa auch zu denen? Verkleiden Sie sich auch?«, fragte er argwöhnisch.
Sie schüttelte den Kopf. »Nein, aber ich habe viele von diesen Leuten kennengelernt, und wenn Sie es genau wissen wollen: Ich finde, es sollte mehr Menschen von deren Schlag geben, die auf eine harmlose Weise ihre Träume ausleben.«
Hatfield zuckte mit den Schultern. »Sie haben zu dem Thema Ihre Meinung, ich habe meine.« Wieder wandte er sich zum Gehen.
»Einen Augenblick bitte«, rief Christine ihm nach. »Wollen Sie wirklich keine Nachforschungen anstellen?«
»Finden Sie, das sollte ich tun?« Er blieb erneut stehen und deutete auf den Swimmingpool. »Was meinen Sie denn, wie der da hingeraten ist?«
»Ich würde sagen, es ist denkbar, dass ihn jemand in den Tod gestoßen hat.«
»Sehen Sie sich den Kerl doch mal genauer an«, forderte Hatfield sie auf und zog sie mit sich zum Beckenrand. »Ich habe für diesen Kram nun wirklich nichts übrig, aber selbst ich erkenne, dass das da ein Superman-Kostüm ist. Superman. Der Typ, der unter anderem fliegen kann. Die Hefte hab ich früher auch gelesen, als ich noch klein war. Mein bester Freund wollte immer Superman sein, wenn wir gespielt haben. Er band sich eine rote Tischdecke um den Hals und tat so, als könnte er fliegen, wie Superman. Dreimal brach er sich die Schulter, bis er endlich einsah, dass das nur eine erfundene Figur ist und in Wirklichkeit niemand fliegen kann.«
»Und Sie meinen, weil er dieses Kostüm trägt ...«, begann Christine.
»Ganz genau. Der da hat auch gedacht, er könnte fliegen. Bloß ist er nicht wie mein bester Freund von einem Baum heruntergesprungen, sondern vom Dach eines vierzehnstöckigen Gebäudes. Selbst wenn der Pool gefüllt gewesen wäre, hätte das Wasser den Sprung wohl nicht wesentlich gebremst. Aber das Wasser war abgepumpt, und als Superman merkte, dass das mit dem Fliegen nicht so richtig klappt, da schlug er auch schon mit dem Kopf voran auf dem Beckenboden auf.« Sein Schulterzucken wirkte so, als sei ihm der Tote ziemlich egal. »Dumm gelaufen«, ergänzte er dann noch.
»Dumm gelaufen?«, entrüstete sich Christine. »Haben Sie denn überhaupt kein Mitgefühl mit dem jungen Mann?«
»Wenn ich mit jedem Trottel Mitgefühl hätte, der ums Leben kommt, nur weil er vorübergehend oder auf Dauer den gesunden Menschenverstand abgeschaltet hat, dann käme ich gar nicht mehr zum Arbeiten.« Er strich sein kurzes rotes Haar nach hinten. »Mag sein, dass sich das in Ihren Ohren herzlos anhört, aber wenn Sie das schon so lange mitmachen würden wie ich, wüssten Sie, wann Mitgefühl angebracht ist. Wenn ein Kind auf dem Schulweg von einem Betrunkenen angefahren wird, wenn eine alte Frau auf dem Weg von der Bank überfallen und ausgeraubt wird, können Sie sicher sein, dass mein Mitgefühl keine Grenzen kennt. Wenn allerdings jemand vom Dach springt, weil er meint, er könnte fliegen ... sorry, da muss ich passen.«
Christine atmete seufzend aus. »Also werden Sie nicht untersuchen, ob es vielleicht doch kein Unfall war?«
»Miss ...«
»Bell, Christine Bell.«
»Miss Bell, wenn mir oder meinen Kollegen etwas eigenartig vorgekommen wäre, dann hätten wir längst die Spurensicherung angefordert. Aber das ist so eindeutig, daran gibt es nichts zu rütteln. Außerdem erwarten wir in den nächsten Tagen hohen Besuch in Beechwood, und meine Leute haben alle Hände voll zu tun, um die Sicherheit unseres Gastes zu gewährleisten.«
Mit diesen Worten wandte er sich endgültig ab und ließ sie stehen. Den beiden uniformierten Polizisten rief er im Vorbeigehen noch etwas zu, dann schob er das Absperrgitter zur Seite und kehrte ins Hotel zurück.
Christine stand da und schaute ihm ungläubig nach, doch als sie zu den beiden Polizisten sah, die wohl nur noch da waren, um auf die Ankunft des Leichenwagens zu warten, wusste sie, dass von ihnen keine Unterstützung zu erwarten war. Die wollten den ›Verrückten‹ genauso schnell loswerden wie ihr Vorgesetzter. Alles andere hätte weitaus mehr Arbeit gemacht, und das war offensichtlich nicht in ihrem Sinne.
Sie drehte sich um und suchte nach Isabelle, die eben noch neben ihr gesessen hatte, während sich Chief Hatfield zur angeblich eindeutigen Todesursache äußerte. Doch als sie sie nun auf den Arm nehmen und mit ihr querfeldein zum Haus ihrer Tante zurückkehren wollte, da war sie abermals verschwunden.
»Isabelle?«, rief sie und lauschte, aber sie erhielt keine Antwort. »Isabelle! Wo bist du?«
Plötzlich ertönte ein leises Miau, doch die Katze kam nicht zum Vorschein.
Erneut rief Christine nach ihr, erneut war ein Miauen zu hören, mehr geschah nicht. Sie folgte den verhaltenen Lauten, bis sie Isabelle hinter den verrosteten Sonnenliegen entdeckte. »Was suchst du denn hier? Jetzt komm schon, wir wollen nach Hause gehen.«
Die Katze rührte sich nicht von der Stelle, sodass Christine gezwungen war, über die Liegen zu steigen, um das Tier hochnehmen zu können. Darüber beschwerte sich Isabelle so lautstark, als hätte man ihr den ersten Futternapf nach drei Tagen Nulldiät gleich wieder weggenommen.
»Was ist denn los mit dir?«
Isabelle wand sich in ihren Armen, sprang zurück auf den Boden an die Stelle, an der sie noch vor wenigen Augenblicken gesessen hatte.
Kopfschüttelnd unternahm Christine einen weiteren Versuch, wobei ihr auffiel, dass die Katze sich auf ein Blatt Papier gesetzt hatte. Wieder hob sie Isabelle auf ihre Arme, die diesmal keinen Mucks von sich gab. Dann bückte sie sich nach dem Blatt, das mehrfach gefaltet war. Im Gegensatz zu allem anderen, was sich auf dem abgesperrten Bereich befand, war das Papier nicht über einen längeren Zeitraum Wind und Wetter ausgesetzt gewesen. Tatsächlich sah es sogar so aus, als habe es maximal ein paar Stunden dort gelegen.
Sie drehte es um und stutzte, da die Rückseite mehrere Blutspritzer aufwies, die zwar getrocknet, aber dennoch nicht alt waren. Vorsichtig faltete sie das Papier ein Stück weit auseinander und kam zu dem Schluss, dass es sich um eine Art Bauplan oder Grundriss handeln musste. Ihr Blick wanderte zum Swimmingpool, dann zum Dach des Hotels. Wenn der junge Mann mit dem Plan in der Hand vom Dach gesprungen war und ihn im Fallen losgelassen hatte, konnte es durchaus sein, dass er vom Wind bis hinter den Stapel aus Sonnenliegen geweht worden war. Der gefaltete Plan war für ihr Gefühl nicht leicht genug, um vom Wind aus dem Poolbecken herausgetragen zu werden. Aber woher sollten dann die Blutspritzer kommen? Es sei denn ...
Die beiden Polizisten unterhielten sich angeregt und nahmen keine Notiz von ihr. Sie war fast sicher, wenn sie den beiden ihren Fund zeigen würde, würden sie sich irgendeine fadenscheinige Erklärung dafür aus den Fingern saugen. Hauptsache, sie mussten keine Ermittlungen aufnehmen. Nein, sie würde erst handfeste Beweise vorlegen müssen, bevor der Chief Inspector auch nur in Erwägung zog, es könne doch etwas anderes als ein tödlicher Unfall gewesen sein.
Sie nahm den Plan an sich und verließ mit Isabelle auf dem Arm das Grundstück auf dem Weg, auf dem sie auch hergekommen war. Die Uniformierten sahen ihr nicht einmal nach.
»Vielleicht war es ja Selbstmord«, gab ihr Tante Betty zu bedenken, als sie eine halbe Stunde später bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen, das Christine von einer Autobahnraststätte mitgebracht hatte, beisammensaßen. Isabelle lag auf der Fensterbank, wo sie darüber eingeschlafen war, die Vögel im Garten zu beobachten. »So was kommt bei jungen Leuten schließlich auch vor. Leider viel zu oft, möchte ich sagen.«
Christine trank einen Schluck Kaffee, dann schüttelte sie den Kopf. »Das passt einfach nicht. Warum soll er mit diesem Plan in der Hand vom Dach springen? Das ergibt so oder so keinen Sinn, egal, ob er nun tatsächlich dachte, er könnte fliegen, oder ob er sich in den Tod stürzen wollte.«
»Und wenn ihm der Plan aus der Hand geglitten ist, und er wollte nach ihm greifen und ist dabei vom Dach gefallen?«
Sie dachte darüber nach, musste aber verneinen. »Das würde bedeuten, dass das Blut bereits auf das Papier spritzte, als er noch auf dem Dach stand. Wie soll das möglich sein?«
»Wenn ihm jemand den Schädel einschlug und ihn anschließend vom Dach warf«, sprach Betty das aus, was Christine dachte.
»Ganz genau, Tante Betty.«
»Sag nicht immer ›Tante‹ zu mir«, unterbrach Betty sie sanft. »Da komme ich mir genauso alt vor, als würde mich jemand ›Oma‹ nennen. Ich sage schließlich zu dir auch nicht ständig ›Nichte Christine‹.«
»Okay.« Christine nickte lächelnd. »Dann sage ich eben nur Betty, wenn dir das lieber ist.«
»Somit hätten wir das ja geklärt. Aber zurück zu unserem eigentlichen Thema.« Betty goss ihnen beiden noch etwas Kaffee ein. »Was ist denn das eigentlich für ein Plan, den du da gefunden hast?«
»Den Isabelle gefunden hat«, berichtigte sie ihre Tante augenzwinkernd. Als sie ihren Namen hörte, hob die Katze den Kopf, blinzelte zum Wohnzimmertisch und döste dann weiter. »Das ist so etwas wie ein Grundriss.«
Sie griff nach dem Papier und faltete es auseinander, bis es viermal so groß war wie ein normales Blatt. Darauf war ein großer Kreis eingezeichnet, der fast die ganze Fläche in Anspruch nahm.
»Mit den vielen Linien sieht das eher aus wie ein Labyrinth in der Rätselrubrik meiner Fernsehzeitung. Du weißt schon, diese Dinger, bei denen man den Weg von einer Seite zur anderen finden muss.«
»M-hm«, stimmte Christine zu. »Und wenn du genau hinsiehst, kannst du sogar erkennen, dass da ein Weg eingezeichnet worden ist. Hier.« Sie zeigte auf eine Stelle und folgte mit dem Finger der Linie, die sich durch die Gänge zog – oder was immer das darstellen sollte.
»Ist denn da gar nichts beschriftet?«, fragte Betty und griff nach ihrer Lesebrille.
»Doch, doch.« Wieder deutete sie auf verschiedene Stellen auf dem Plan. »Aber das sieht nach einer Fantasieschrift aus. Entziffern kann ich davon jedenfalls nichts.« Sie drehte den Plan hin und her. »Nicht mal, wenn ich es auf dem Kopf oder seitenverkehrt zu lesen versuche.«
»Wenn sich jemand die Mühe macht, das alles in einer Fantasieschrift zu beschriften, damit das niemand sonst entschlüsseln kann, dann muss es ja etwas streng Geheimes sein«, urteilte Betty. »Möglicherweise war der junge Mann ein Spion von Bin Laden.«
»Oder der Plan stammt von Außerirdischen.«
»Christine!«, rief Betty erschrocken. »Komm mir nicht mit sowas! Wir hatten hier in der Gegend genug merkwürdige Ereignisse!«
»Was für Ereignisse?«, fragte Christine verwundert.
Ihre Tante winkte ab. »Ach, du weißt schon. Die üblichen seltsamen Lichter am Himmel und so weiter.«
»Du meinst ... UFOs?«
»Na ja, jedenfalls behaupten das manche. Ich persönlich glaube nicht daran, aber als du jetzt gerade von Außerirdischen gesprochen hast ...«
»Nein, nein, Betty«, beschwichtigte Christine sie. »Ich dachte dabei an diese Science-Fiction-Convention, die Ende der Woche im Saal auf dem Pier stattfinden wird. In all den Serien und Filmen haben die Außerirdischen auch immer eine eigene Schrift und eine eigene Sprache, die natürlich komplett erfunden ist. Wenn das hier etwas mit einer von den Serien zu tun hat, dann sind das vermutlich ganz willkürliche Zeichenfolgen, die überhaupt nichts zu bedeuten haben.«
»Ach ja, du hast recht, hier findet jedes Jahr so etwas statt«, fiel es Betty ein. »Da wimmelt es in der Stadt von Kostümierten. Ich finde das ganz amüsant, muss ich sagen.« Sie stutzte. »Besuchst du eigentlich nicht solche Veranstaltungen? Du schreibst doch Fantasy, nicht wahr?«
Christine nickte. »Im Prinzip wäre das sicher was für mich, aber vermutlich haben sie wichtigere Leute eingeladen, und solange die nicht absagen, rücke ich auf der ellenlangen Liste nicht weiter nach oben.«
»Warum fragst du nicht einfach nach? Du bist schließlich auch wichtig, und bestimmt bist du wichtiger als einige von den anderen, die da hingehen.«
»Danke, Betty«, sagte sie lachend. »Aber du musst nicht mein Ego aufbauen. Mir macht das nichts aus, wenn ich nicht eingeladen werde. Die Veranstalter müssen beurteilen, wen sie haben wollen, und je nachdem, welchen Schwerpunkt so ein Event hat, kommen bestimmte Autoren von vornherein nicht infrage. Und man fragt da als Autor nicht nach, weil das so erbärmlich ist, als würde man sich selbst zu einer Geburtstagsparty einladen, nur weil keine Einladung in der Post war. Mein Agent weiß aber, dass er mich auf solche Conventions grundsätzlich aufmerksam machen soll, auch wenn es sich um kleinere Veranstaltungen handelt. Er hat mich nicht angerufen, also ist auch niemand an mir interessiert.«
»Aha, ich verstehe.«
»Außerdem bin ich hergekommen, um mich um dich zu kümmern«, ergänzte sie. »Da werde ich dich doch nicht gleich wieder im Stich lassen!«
»Du weißt, dass es nicht so viel gibt, was du für mich tun musst.«
»Trotzdem werde ich nicht hingehen«, beharrte Christine.
»Ich bin nicht eingeladen worden, und ich werde mich nun mal niemandem aufdrängen.«
»Aber vielleicht bringt dich das in diesem Fall weiter«, gab Betty zu bedenken. »Wenn der junge Mann auch zu diesem Treffen gehen wollte, kannst du vielleicht dort etwas mehr über ihn erfahren und dem Täter auf die Spur kommen.«
Unschlüssig saß Christine da und starrte in ihre Kaffeetasse.
»Wenn ich dich recht verstanden habe, will dieser Inspector doch auf keinen Fall Ermittlungen einleiten, nicht wahr?«
»Er ist überzeugt, dass es ein Unfall war«, bekräftigte sie.
»Na bitte. Wenn es aber kein Unfall war, dann kommt der Mörder ungestraft davon.«
»Eben, und der Gedanke gefällt mir überhaupt nicht.«
»Ich weiß«, meinte Betty leicht amüsiert. »Deine Mom hat mir erzählt, dass nach deinem Abenteuer mit diesem mörderischen Milchproduzenten bei dir ein kriminalistischer Spürsinn erwacht ist, was du wohl ganz allein deiner Katze zu verdanken hast.«
»Tja, ohne Isabelle wäre ich nie in die Sache verstrickt worden. Zu schade nur, dass ihr vorheriger Besitzer tot ist und ich nichts weiter über sie in Erfahrung bringen kann.« Eine Zeit lang saßen sie schweigend da, dann sagte Christine: »Also gut, ich werde darüber nachdenken, ob ich mich bei den anderen Besuchern der Convention ein bisschen umhöre, um etwas über den Toten herauszufinden. Aber wirklich nur, wenn du mich entbehren kannst.«
»Das hört sich besser an«, gab Betty zurück. »Wenn du mir jetzt ins Schlafzimmer hilfst, werde ich mich ein bisschen hinlegen, bis Coronation Street anfängt. Bis dahin kann ich dich entbehren.«
»Okay.« Christine überlegte kurz, bis ihr eine Idee kam. »Dann kann ich mich in der Zwischenzeit schon mal ein bisschen gründlicher umsehen.«
***
Das Golden West war ein Hotel von der Sorte, die man niemandem guten Gewissens empfehlen konnte, und doch existierte es bereits seit über dreißig Jahren, auch wenn die Eigentümer wohl fast so häufig wechselten wie die Gäste. Das Gebäude mit seinen vierzehn Stockwerken überragte jedes andere Bauwerk in Beechwood, und auch wenn es weit weg war von der Promenade mit dem Pier, störte es die Skyline des Küstenorts durchaus. Es wirkte, als hätte ein Riese ein langes Betonstück ungespitzt in den Boden gerammt und es dann einfach dort zurückgelassen. Gelindert wurde dieser Eindruck nur durch die Tatsache, dass gleich daneben in Richtung Eastbourne die Kreideklippen in den Himmel wuchsen und das Bauwerk um viele Meter überragten. Auf diesen Klippen stand auch der alte Leuchtturm von Beechwood.
Ursprünglich war geplant gewesen, ein neues, futuristisches Stadtzentrum entstehen zu lassen, um dem altehrwürdigen benachbarten Brighton Konkurrenz zu machen und eine ganz neue Zielgruppe unter den Touristen anzusprechen. Nach deren Fertigstellung hätte man das alte Beechwood abgerissen, um dort weitere Hochhäuser zu errichten, in denen sich betuchte Interessenten Ferienwohnungen kaufen sollten.
Auf dem Zeichenbrett war das Projekt weit gediehen, der Zeitplan stand bereits fest, und man hatte auch schon die ersten Bauunternehmen beauftragt, die in den Startlöchern saßen. Dann auf einmal war der Projektleiter spurlos verschwunden – und mit ihm ein zweistelliger Millionenbetrag, mit dem die erste Phase finanziert werden sollte. Da weder der Projektleiter noch das Geld je wieder auftauchte, war es nicht möglich, die Umgestaltung von Beechwood voranzutreiben. Doch es war nicht nur dieses Geld, das den Stadtvätern fehlte; es mussten Kredite in Millionenhöhe aufgenommen werden, um die Schadenersatzforderungen der Bauunternehmen zu erfüllen. Die Gelder standen ihnen vertraglich zu, daran war nichts zu rütteln. Die Stadt steckte tief in den roten Zahlen, und daran sollte sich auf Jahre hinaus nichts ändern.
Wenn man das Golden West betrachtete, dann war es für Beechwood vielleicht gar nicht so schlecht, dass es so gekommen war. Der Bau präsentierte sich als hässlicher Betonklotz, dessen Stil bereits bei Baubeginn längst nicht mehr zeitgemäß gewesen war, und auch die Einrichtung war so gestaltet, dass das Hotel bereits bei seiner Eröffnung wirkte, als sei es seit zehn Jahren nicht mehr renoviert worden. Das Mobiliar sah seinerzeit zwar neu aus, aber die gesamte Einrichtung ließ vermuten, dass sie mehrere Jahre in irgendeinem Möbellager gestanden hatte und dann zu einem Schleuderpreis verkauft worden war, um endlich Platz zu schaffen.
Offenbar war nicht nur der Projektleiter eine zwielichtige Gestalt gewesen, auch der Innenarchitekt des Hotels hatte sich vermutlich einen Teil des Budgets in die eigene Tasche gesteckt und die Möbel preisgünstig erstanden. Wären die anderen Projekte auf die gleiche Weise umgesetzt und das alte Beechwood abgerissen worden, dann hätte die Stadt wohl über kurz oder lang den Bankrott erklären müssen, weil sich kein Tourist eine solche Zumutung antun wollte.
So war zumindest das alte Beechwood erhalten geblieben, und dieser Schandfleck stand weit genug abseits, um von den meisten Einwohnern und den Touristen ignoriert zu werden.
Christine blieb in einiger Entfernung stehen und musterte das Hochhaus. Die zum Land weisende Seite befand sich in einem erbärmlichen Zustand, sämtliche Farbe war abgeblättert, alles war so verdreckt, dass der Regen den Schmutz nicht abwaschen, sondern nur in großflächigen Schlieren auf dem hellgrauen Beton verteilen konnte. Die seitliche Fassade sah fast genauso schlimm aus, lediglich die Front war vor nicht allzu langer Zeit frisch gestrichen worden, als ob niemand das Haus aus einer anderen Richtung sehen könnte.
Bei dieser Fassadenkosmetik wiederum hatte man gespart, wo man nur konnte, und offenbar war der Eigentümer dabei auch auf die Idee gekommen, auf ein Gerüst zu verzichten und die Außenwände stattdessen von den Balkonen und den Fenstern aus mit Farbrollen zu streichen. Dementsprechend unansehnlich war das Ergebnis.
Aber letztlich tat das Beechwood keinen Abbruch. Der Ort lockte genug Touristen an, und etliche von ihnen begnügten sich mit einer vergleichsweise schlichten Unterkunft, wenn sie dafür ein paar Tage am Meer verbringen konnten.
Christine riss sich vom Anblick der fleckigen Fassade los und betrat das Foyer, dessen Flair in etwa dem eines Parkhauses entsprach. Der dunkelbraune Noppenfußboden ließ deutlich erkennen, wo in den letzten Jahrzehnten die meisten Gäste gegangen waren. An den Wänden klebten Poster, die den sonnigen Süden zeigten, allerdings den in Spanien. Die Sitzgruppe in einer Ecke hatte zweifellos auch schon den Tag der Eröffnung Mitte der 70er mitgemacht, und die Empfangstheke zur Rechten war auch nicht mehr die Jüngste. Ein Mann mittleren Alters saß hinter der Theke und starrte auf einen Monitor, von Christine nahm er gar keine Notiz.
Kopfschüttelnd, aber auch erfreut begab sie sich zu den Aufzügen. Wenn sich niemand für sie interessierte, musste sie auch niemandem erklären, was sie hier wollte. Also würde man ihr auch keine Fragen stellen, und niemand käme auf die Idee, die Polizei zu verständigen.
Als die Aufzugtür sich öffnete, erschrak Christine. Die Liftkabine war innen über und über mit Graffiti beschmiert, von den vier Glühbirnen an der Decke brannte nur noch eine, und noch bevor sie den Rückzug antreten und die Treppe benutzen konnte, versetzte ihr die sich schließende Tür einen Stoß in den Rücken.
Dann ratterte der Aufzug nach oben, obwohl sie noch gar keine Taste gedrückt hatte. Vermutlich hatte irgendwer den Lift angefordert, aber bevor er halten konnte und sie erst noch mit nach unten fahren musste, drückte sie auf die 14 und kniff die Augen zu. Sie war auf alles gefasst. Insgeheim fürchtete sie, der Aufzug könnte es sich jeden Moment anders überlegen und mit ihr an Bord in die Tiefe stürzen. Nach einer endlos scheinenden Minute kam die Kabine mit einem heftigen Ruck zum Stehen, und die Tür ging auf. So schnell wie jetzt und hier hatte Christine noch nie einen Aufzug verlassen.
Der Flur im vierzehnten Stockwerk wirkte genauso schäbig wie das Foyer, aber immerhin war auch hier alles sauber. Christine ging den Korridor entlang und stieß auf das Treppenhaus; sie ging nach oben und fand die Metalltür zum Dach unverschlossen vor. Als sie sie öffnete, wurde sie ihr von einer kräftigen Böe aus der Hand gerissen. »Hoppla«, murmelte sie und spähte zunächst einmal vorsichtig um die Ecke. Der Wind blies ihr ins Gesicht, jedoch nicht so stark, dass er sie an den Dachrand oder sogar darüber hinaus hätte wehen können.
Sie betrat das Flachdach und stellte fest, dass ringsum in einem Abstand von bestimmt einem Meter zur Dachkante ein Geländer verlief, das mindestens eins zwanzig hoch sein musste. Vermutlich war das hier mal als Sonnendeck gedacht gewesen, doch der Wind hatte diesem Plan sicher den Garaus gemacht. Zwar konnten die Sonnenhungrigen nicht buchstäblich weggeweht werden, dafür aber alles, was sie mitbrachten – Handtücher, Kleidung, Sandwiches.