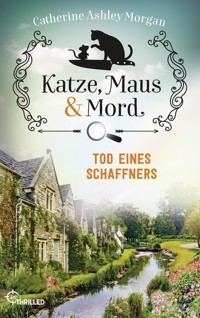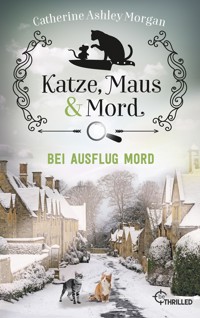
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Katzen mit der Spürnase
- Sprache: Deutsch
Catherine Ashley Morgan ist ein Pseudonym des Autors Ralph Sander, der mit seiner Katzen-Krimi-Serie "Kater Brown" viele Leserinnen und Leser begeistert
Eigentlich wollte DCI Anne Remington nur das berühmte Finlay-Finnegan-Festival im winterlichen Selford besuchen. Als jedoch auf dem Festivalgelände ein Toter gefunden wird und klar ist, dass es sich um Mord handelt, macht sich Anne natürlich an die Ermittlung. Und es bleibt nicht bei einem Toten ... Gibt es eine Verbindung zwischen den Opfern? Und was haben ganze zwölf entführte Katzen mit dem Fall zu tun? Anne muss schnell handeln, denn der Mörder hat schon sein nächstes Ziel vor Augen ...
Bei diesem Katzen-Krimi handelt es sich um eine eBook-Neuauflage von »Im Dutzend tödlicher« von Catherine Ashley Morgan um DCI Anne Remington und ihre samtpfotigen Helfer.
Alle Bände der Reihe um Christine und Isabelle bei beTHRILLED:
Katze, Maus und Mord - Ein rätselhafter Nachbar
Katze, Maus und Mord - Die verhängnisvolle Botschaft
Katze, Maus und Mord - Tod eines Schaffners
Katze, Maus und Mord - Das tödliche Drehbuch
Und hier ermittelt Anne Remington:
Katze, Maus und Mord - Die Entführung der Lady Agatha
Katze, Maus und Mord - Ein tödliches Spiel
Katze, Maus und Mord - Bei Ausflug Mord
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 534
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
Cover
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Epilog
Über die Autorin
Weitere Titel der Autorin
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
vielen Dank, dass du dich für ein Buch von beTHRILLED entschieden hast. Damit du mit jedem unserer Krimis und Thriller spannende Lesestunden genießen kannst, haben wir die Bücher in unserem Programm sorgfältig ausgewählt und lektoriert.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beTHRILLED-Community werden und dich mit uns und anderen Krimi-Fans austauschen möchtest. Du findest uns unter be-thrilled.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich auf be-thrilled.de/newsletter für unseren kostenlosen Newsletter an.
Spannende Lesestunden und viel Spaß beim Miträtseln!
Dein beTHRILLED-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
Eigentlich wollte DCI Anne Remington nur das berühmte Finlay-Finnegan-Festival im winterlichen Selford besuchen. Als jedoch auf dem Festivalgelände ein Toter gefunden wird und klar ist, dass es sich um Mord handelt, macht sich Anne natürlich an die Ermittlung. Und es bleibt nicht bei einem Toten ... Gibt es eine Verbindung zwischen den Opfern? Und was haben ganze zwölf entführte Katzen mit dem Fall zu tun? Anne muss schnell handeln, denn der Mörder hat schon sein nächstes Ziel vor Augen ...
Catherine Ashley Morgan
Katze, Maus und Mord – Anne Remington ermittelt
Bei Ausflug Mord
Prolog
»Diese Schweinehunde!«, fluchte er, als er lautes Quietschen hörte und nach links schaute, wo eine Rauchwolke von den durchdrehenden Reifen der weißen Limousine aufstieg, die mit Vollgas beschleunigte und davonfuhr.
Aus der anderen Richtung kam ein Polizeiwagen herangerast, aber der hielt nicht an dem aufgesprengten Transporter an, hinter dem er sich versteckte, sondern fuhr weiter und setzte zur Verfolgung seiner Komplizen an. Die hatten offenbar mit ihrem überstürzten Aufbruch das Interesse der Polizisten auf sich gelenkt.
Der Polizeiwagen raste hinter der Limousine her, aber die Strecke war etwas zu kurvenreich, um noch erkennen zu können, ob er das andere, deutlich PS-stärkere Fahrzeug einholte. Auf die – ohnehin sehr unwahrscheinliche – Rückkehr seiner Komplizen konnte er jedenfalls nicht warten, da zu befürchten war, dass die Polizisten längst Verstärkung angefordert hatten, die sich um diesen vermeintlichen Unfall und um mögliche Verletzte kümmern sollte. Zudem gab es noch ein anderes Problem: Der Fahrer und der Beifahrer des Transporters waren durch das schnell wirkende Betäubungsmittel nicht allzu lange außer Gefecht gesetzt.
Den anderen Wagen konnte er vergessen, der war bei der Kollision mit dem Transporter zu stark beschädigt worden, außerdem hatte er einen Platten. Also gab es nur eine Lösung. Er musste zu Fuß von hier wegkommen.
Er nahm die beiden Stoffbeutel, sah sich noch einmal um, ob auch ganz sicher niemand da war, der ihn beobachtete, dann war er mit drei ausholenden Schritten zwischen den Bäumen verschwunden.
Natürlich würden die anderen nach ihm suchen, aber es gab immer Leute, die einem helfen konnten unterzutauchen. Wenn erst einmal Ruhe eingekehrt war und die Polizei längst ganz andere Verbrechen aufklären musste, würde er wieder auftauchen, die Beute zu Geld machen und sich dann ins Ausland absetzen. Südamerika wäre schön. So wie dieser Posträuber ... Biggs, oder wie hieß er noch gleich?
Seine Gedanken schweiften ab, während er in südwestlicher Richtung durch den Wald ging. Immer wieder musste er sich dazu zwingen, nicht zu schnell zu gehen, schließlich wollte er vermeiden, dass er vor Unachtsamkeit über eine aus dem Boden ragende Wurzel stolperte, hinfiel und sich etwas brach. Die Polizei war nicht hinter ihm her, sagte er sich. Sie konnte nicht hinter ihm her sein, weil sie gar nicht wusste, dass er auch an dem Überfall beteiligt war. Falls sie seine Komplizen einholten und festnahmen, würde danach noch immer viel Zeit vergehen, ehe sie nach einem weiteren Beteiligten Ausschau hielten. Sie würden annehmen, dass die anderen die Beute während der Flucht aus dem Fenster geworfen hatten, und die gesamte Strecke danach absuchen. Sollten die anderen ahnen, dass er mit der ganzen Beute entwischen wollte, würde ihnen das auch nicht viel nützen, da sie nur sagen konnten, dass die Polizei nicht alle Verdächtigen gefasst hatte, womit sie sich natürlich selbst belasten würden.
Sein Weg führte ihn weiter durch den Wald, der zwischendurch von Wiesen und Feldern unterbrochen wurde. Die zwangen ihn hin und wieder zu Umwegen, da er nicht quer über einen Acker marschieren und von einem Bauern gesehen werden wollte, der sich über seinen Anblick sicher genug wundern würde, um anderen von dieser Beobachtung zu erzählen – oder sich sogar an die Polizei zu wenden.
Es war bereits dämmrig, als er an einem vor vielen Jahren aufgegebenen und teilweise verfallenen Bauernhof vorbeikam und gleich dahinter die letzten Ausläufer des Waldgebiets rund um Buxton erreichte, aber es war noch zu hell, um sich in das in einiger Entfernung gelegene Dorf zu begeben, von dem er von hier ein paar Häuser ausmachen konnte, in denen bereits Licht brannte. Wenn er dort auftauchte, durfte niemand gesehen haben, woher er gekommen war, sonst würde ihn noch irgendwer mit dem Überfall in Verbindung bringen, auch wenn der Tatort inzwischen etliche Meilen hinter ihm lag.
Er schlenderte eine Weile im Schutz der Bäume hin und her, bis ihm auf einmal etwas auffiel. Eine flache Felsformation erstreckte sich bis weit in den Wald hinein, und auf der Seite, auf der er stand, befand sich eine Art Höhleneingang, der groß genug schien, um dort ins Innere zu gelangen. Das brachte ihn auf eine Idee.
Er zog sein Handy aus der Tasche, schaltete die Taschenlampe ein und leuchtete in den Zugang. Tatsächlich führte der auf einer leichten Schräge in einen unterirdischen Raum, und nachdem er sich ein letztes Mal umgesehen hatte, ob ihn auch tatsächlich niemand beobachtete, begab er sich in die Tiefe.
Die Lampe reichte aus, um den Weg nach unten zu erhellen, aber sie war zu schwach, als dass er mit ihrer Hilfe in der Höhle allzu viel erkennen könnte. Es war auf jeden Fall eine große Höhle, da der Lichtschein immerhin ein paar Meter weit reichte und trotzdem von einer gegenüberliegenden Wand nichts zu sehen war.
Dann richtete er die Taschenlampe wieder auf die Felswand gleich neben sich und betrachtete sie genauer. Nach ein paar Metern stieß er auf das, wonach er gesucht hatte. Ein Spalt klaffte auf halber Höhe im Gestein, gerade breit genug, um eine gespreizte Hand hineinzuhalten und dabei beinahe beide Seiten zu berühren. Das war das ideale Versteck. Hier würde niemand nach der Beute suchen, und nach dem Boden zu urteilen, hielt sich hier auch sonst niemand auf, da es keine Hinweise auf irgendwelche menschlichen Besucher gab. Die hätten nämlich so wie überall sonst auf der Welt Abfälle aller Art hinterlassen, von Lebensmittelresten bis hin zu Bierdosen.
Er legte die beiden Stoffbeutel in den Felsspalt, wobei er darauf achtete, sie relativ weit vorn zu platzieren. Nicht, dass ihm ein Beutel wegrutschte und er ihn später nicht mehr zu fassen bekam. Dann las er ein paar größere Steine auf und legte sie so in den Felsspalt, dass sie die Beutel bedeckten, dabei aber so zufällig angeordnet dalagen, dass niemand auf sie aufmerksam werden konnte.
Zufrieden mit dem Ergebnis seiner Bemühungen nickte er und kehrte vorsichtig zurück zum Höhleneingang. Er ahnte nicht, dass jede seiner Bewegungen von einem grünen Augenpaar sehr interessiert verfolgt worden war.
Als es dunkel war, verließ er den Wald und näherte sich dem Dorf. In den Häusern brannte vereinzelt Licht, aber auf den Straßen war niemand unterwegs, wenn man von der einen oder anderen Katze absah, die Jagd auf Mäuse und anderes Getier machte. Das Dorf war nicht so klein und auch gar nicht so dörflich, wie es ihm vom Waldrand aus betrachtet noch vorgekommen war. Alle Straßen waren asphaltiert, man hatte Fußwege angelegt, Straßenlampen sorgten für ein wenig Helligkeit. Autos parkten am Straßenrand und in den Zufahrten zu den Einfamilienhäusern, die zwar nicht mehr als Neubauten durchgehen konnten, die aber auch keine halb verfallenen, aufgegebenen Bauernhöfe waren. Jetzt musste er nur noch herausfinden, wie diese Ortschaft hieß, schließlich gab es für ihn einen wichtigen Grund, bald wieder herzukommen.
An der folgenden Ecke bog er nach rechts ab. Nun lief er auf einen großzügig bemessenen Platz an einer breiten Straße zu, an dem ihm eine große Holztafel auffiel, die von einer Neonröhre beschienen wurde.
»Willkommen in Selford, der Geburtsstadt von Finlay Finnegan«, las er halblaut vor und zog die Augenbrauen zusammen. Finlay Finnegan? Den Namen hatte er schon mal irgendwo gehört. Irgendein ... Schriftsteller oder so. Mit dem Lesen hatte er es nicht so, und es konnte durchaus sein, dass er mit seiner Vermutung auf dem Holzweg war. Finnegan hätte genauso gut ein Maler sein können oder ein Bildhauer. Mit der Kunst hatte er es auch nicht so. Sicher waren nur zwei Dinge: Finnegan war kein Fußballspieler, und er hatte auch nie bei Big Brother mitgemacht. Damit kannte er sich aus.
Wichtig war aber sowieso nur, dass er wusste, er war in Selford gelandet. Wo das genau lag, konnte er so nicht sagen, da hätte er schon sein Smartphone einschalten und auf Google Maps nach diesem Ort suchen müssen. Aber das wollte er jetzt nicht anmachen, weil er nicht wusste, ob die Polizei seine Komplizen festgenommen hatte und nach seinem Handy suchte.
Er sah sich um und entdeckte auf der gegenüberliegenden Straßenseite eine Bushaltestelle. Sehr gut, überlegte er. Er würde den nächsten Bus nehmen, egal wohin der ihn brachte, und falls in der Zwischenzeit jemand vorbeikam und sich wunderte, woher dieser Fremde kam, konnte er behaupten, dass er im Bus eingeschlafen und dadurch fünf Stationen zu weit gefahren war. Jetzt wartete er auf den Bus in die entgegengesetzte Richtung, damit er nach Hause fahren konnte.
Er sah nach rechts und links, die Straße war frei, er konnte sie überqueren. Kaum war er losgegangen, fiel ihm ein, dass er besser in die andere Richtung fuhr. Immerhin war er nicht mit dem Streckenverlauf dieser Buslinien vertraut, und er wollte ganz sicher nicht in die Nähe des Tatorts zurückkehren.
Er machte kehrt, blieb aber mit der Schuhspitze an einem Kanaldeckel hängen. Das geschah so unverhofft, dass er zwar reflexartig die Arme hochriss, dabei aber so unglücklich auf dem Asphalt landete, dass er zur Seite wegrollte und mit dem Kopf auf die Bordsteinkante schlug. Das war das Letzte, was er spürte, ehe um ihn herum alles dunkel wurde.
Oh verdammt ..., war sein letzter Gedanke.
Kapitel 1
Vier Monate später
Detective Chief Inspector Anne Remington saß am fertig gedeckten Frühstückstisch und hatte rechts von sich ihren Laptop abgestellt, um nach den Mails zu sehen, die seit gestern Abend eingegangen waren. Ihre Detectives versorgten sie zweimal am Tag mit Kopien aller Vorgänge, unabhängig davon, wie dringend oder unbedeutend sie waren, und damit taten sie genau das, was Anne ihnen aufgetragen hatte. Es ging ihr nicht darum, ihren Leuten unablässig auf die Finger zu schauen oder ihnen das Gefühl zu geben, dass sie von ihr auf Schritt und Tritt überwacht wurden. Sie wollte bloß genauso in der täglichen Routine bleiben, als wäre sie im Dienst.
Immerhin hatte sie zwar Urlaub genommen, aber die letzten vierzehn Tage waren kein Urlaub gewesen. Seit ihre Tante Ada Hamilton nach der Bandscheibenoperation aus dem Krankenhaus gekommen war, hatte Anne sich um sie gekümmert, indem sie den Haushalt erledigte, für sie einkaufen ging und ihr alle Tätigkeiten abnahm, die für sie noch zu anstrengend waren. Erfreulicherweise hatte sie sich von dem Eingriff aber schnell erholt, was für Anne bedeutete, dass sie in Kürze wieder nach Hause zurückkehren konnte.
Ada war für sie immer Tante Ada gewesen, auch nachdem sie sich von ihrem Mann getrennt hatte, einem Halbbruder von Annes Vater. Genau genommen war sie sich gar nicht so sicher, ob Ada dadurch überhaupt eine richtige Tante war, und noch weniger wusste sie, ob sie nach der Scheidung und der Rückkehr zu ihrem Mädchennamen formell eigentlich weiter ihre Tante blieb oder ob sie zur Ex-Tante wurde. Es änderte aber nichts daran, dass sie gern hergekommen war, um sich um Ada zu kümmern, zumal sie von ihrer ganzen Verwandtschaft diejenige war, die den kürzesten Weg zu ihr hatte.
Und da Ada Katzen über alles liebte, war es für Anne nur logisch gewesen, ihre Rasselbande einzupacken und mitzunehmen. Sie hätte unmöglich von ihren Detectives verlangen können, zwei Wochen lang jeden Tag mindestens zweimal nach den vier kleinen Ungeheuern zu sehen und sie zu versorgen, zumal die Kartäuserzwillinge Laverne und Shirley bis vor ein paar Tagen noch mit einer Augenentzündung zu tun gehabt hatten und ihnen alle paar Stunden Augentropfen eingeträufelt werden mussten.
Aber unabhängig davon hätte sie auch kein gutes Gefühl dabei gehabt, die Katzen über einen solchen Zeitraum hinweg sich selbst zu überlassen.
Das war schon beim letzten Mal nicht gut gegangen, als sie dienstlich für ein paar Tage unterwegs gewesen war und man ihre Katzen entführt hatte. Diesmal gab es zwar keinen Schurken, der sie auf diese Weise unter Druck setzen wollte, aber vierzehn Tage, das war eindeutig zu lange.
Sie beantwortete eine der Mails mit einem Vermerk, dass ihre Detectives den Ehemann der Vermissten beschatten sollten, weil sie bei ihm ein ungutes Gefühl hatte, als auf einmal wie aus dem Nichts die Bombaykatze Phaedra auf den Tisch sprang, eine Scheibe Schinken von der Aufschnittplatte in der Tischmitte stibitzte und dann auch schon einen Satz zurück auf den Boden machte, um zur Tür zu rasen.
»Was ...?«, rief Anne verdutzt, die die Katze vor ein paar Minuten noch im Gästezimmer gesehen hatte, wo sie auf dem Bett lag und fest schlief. »Wie oft soll ich dir eigentlich noch sagen, dass du dich nicht selbst bedienen sollst?« Sie lief hinter Phaedra her, die mit ihrer Beute die Treppe hinaufeilte und sich im Gästezimmer unter das Bett zurückzog, wo sie für Anne unerreichbar war. Kopfschüttelnd kehrte sie zurück ins Erdgeschoss. Es hätte viel zu lange gedauert, erst noch den Besen zu holen, um Phaedra aus ihrem Versteck zu vertreiben, da sie den Schinken bis dahin längst runtergeschlungen hatte.
Anne ging zurück in die Küche, setzte sich an den Tisch und trank einen Schluck Tee, dann wandte sie sich wieder ihrem Laptop zu ... und stutzte. Der letzte Satz in ihrer Antwortmail, die sie unterbrochen hatte, um Phaedra hinterherzulaufen, endete mit den Worten »... und achten Sie bitte darauf, dass er geE3wfgtjmk-«.
Sie sah auf die Tastatur und überlegte, wie sie so etwas geschrieben haben sollte, unmittelbar bevor sie aufgesprungen war. Dann aber zerlegte sie das sonderbare Wort und stellte fest, dass sich, wenn sie das »ge« am Anfang wegließ, drei Buchstabengruppen ergaben, die jeweils zusammengehörten, dazu ein Bindestrich am Ende.
»Verstehe«, murmelte sie und sah vor ihrem geistigen Auge, wie eine Katze über die Tastatur spazierte. Nur dass Phaedra in ausreichendem Abstand zu ihr vom Tisch gesprungen war. Dann hatte gleich noch jemand ... sie unterbrach sich und sah auf den Teller mit dem Aufschnitt. Oder besser gesagt: auf den leeren Teller, auf dem sich vor ein paar Minuten noch drei restliche Scheiben Schinken und zwei Scheiben Cheddar befunden hatten.
Anne sah sich um, aber natürlich war im Esszimmer niemand mehr zu sehen. Die vier hatten ganze Arbeit geleistet. Phaedra hatte den Lockvogel gespielt, damit sie ihr aus dem Raum und dann nach oben folgte, damit die drei anderen Katzen sich in Ruhe über den unbewachten Tisch hermachen konnten. Zweifellos waren sie danach in alle Himmelsrichtungen verschwunden, um irgendwo unter einem Tisch oder hinter dem Sofa die wertvolle Beute zu verspeisen.
»Ein Glück, dass auf meinem Brot Marmelade ist«, murmelte sie und atmete schnaubend aus. Sie löschte die wirre Buchstabenfolge auf ihrem Laptop und schrieb die Mail zu Ende, dann schickte sie alles ab und fuhr den Computer für den Augenblick herunter.
»Guten Morgen, Schatz«, ertönte gleich darauf Adas Stimme, die längst wieder viel kräftiger klang als noch vor einer Woche. Sie hatte sich tatsächlich gut erholt.
»Morgen, Tante Ada«, sagte sie und stand auf, um ihr mit dem Stuhl zu helfen. Zwar winkte ihre Tante ab, dennoch ließ Anne sich nicht davon abhalten. Wenn sie schon dafür hergekommen war, konnte sie sich auch nützlich machen. Ada würde noch früh genug wieder alles selbst erledigen müssen. »Wie fühlst du dich?«
»Ach, jeden Tag ein bisschen mehr wie neugeboren«, antwortete sie und fuhr sich durch die grauen Locken. »Es war wirklich gut, dass ich mich zu dieser Operation durchgerungen habe, sonst würde ich jetzt immer noch bei jedem Schritt laut aufschreien.« Ihr Blick wanderte über den Tisch. »Keine Wurst und kein Käse heute?«
»Doch, doch, das war schon alles da«, erwiderte Anne. »Aber hier geht es zu wie bei einem Frühstücksbuffet in einem spanischen Hotel voll mit Engländern und Deutschen.«
Ada warf ihr einen fragenden Blick zu.
»Na ja, ich bin offenbar die eine arme Engländerin, die gegen vier Deutsche keine Chance hat und am Buffet leer ausgeht«, erklärte sie grinsend.
Ihre Tante lachte leise. »Ich weiß nur nicht, ob deine vier Katzen es mögen, wenn sie als raffgierige Deutsche hingestellt werden.«
»Das heißt ja nicht, dass ich nicht genauso raffgierig bin wie sie, ich bin nur eben zahlenmäßig unterlegen. Und taktisch offenbar auch.« Beiläufig zuckte sie mit den Schultern und holte die Wurstpackung aus dem Kühlschrank, die sie ihrer Tante hinlegte. »Auf den Teller lege ich das nicht mehr, sonst werden meine Katzen uns als Nächstes noch mit Blasrohren und Giftpfeilen außer Gefecht setzen, damit sie auch noch die Reste einkassieren können«, sagte sie. »Zu Hause passiert so was nie, weil ich alles aus dem Kühlschrank nehme und auch sofort wieder dahin zurückstelle.«
»Na, du bist ja bald wieder zu Hause.«
»Nein, nein, so war das nicht gemeint, Tante Ada«, beteuerte Anne hastig, als ihr klar wurde, wie leicht ihre Bemerkung missverstanden werden konnte. »Es ist halt für die Katzen eine Einladung, wenn man einen Teller mit Wurst und Käse auf den Tisch stellt und den nicht die ganze Zeit über bewacht. Tee?«
»Ja, bitte.« Ada hielt ihr die Tasse hin, damit Anne einschenken konnte. »Und wann kommt dieser holländische Commissioner ... was hast du gesagt, wie er heißt?«
»Commissaris Hoofdambtenaar Jeroen Gerards«, korrigierte Anne sie und setzte sich wieder hin, um noch eine Scheibe Toast zu schmieren. »Aber ich darf mir den Zungenbrecher am Anfang und die Stimmbandreizung am Ende ersparen und ihn einfach nur Jeroen nennen.« Sie schaute auf die Uhr. »Halb zehn ... in einer halben Stunde dürfte er hier sein, sofern er nicht unterwegs in den Gegenverkehr gerät oder auf der Karte Oswestry übersieht.«
»Ich wette, er benutzt ein Navigationsgerät«, meinte Ada. »Damit wird er schon herfinden.«
»Nein, tut er nicht. Er benutzt Landkarte und Stadtplan, und notfalls fragt er nach dem Weg.«
»Nicht? Ist der Mann denn schon über achtzig, dass er mit dem neumodischen Zeugs nicht mehr zurechtkommt?«
»Er ist ziemlich genau so alt wie ich, was ich dir ja auch schon gesagt habe. Er findet, gerade ein Polizist sollte in der Lage sein, den Weg von A nach B zu finden, ohne sich von einer säuselnden Stimme den Weg vorschreiben zu lassen.«
»Er kann ja auch eine andere als die säuselnde Stimme auswählen«, wandte Ada ein. »Ich habe mal gelesen, dass man andere Stimmen kaufen und auf so ein Gerät überspielen kann. Also wenn ich für so was Verwendung hätte, dann würde ich mir den Weg von Tim Curry beschreiben lassen. Du weißt schon, Frank’n’Furter aus ...«
Anne hob abwehrend die Hände. »Ich weiß, ich weiß. Aber ich war damals sieben, als du mich in die Rocky Horror Picture Show mitgenommen hast, und das hat mich für mein Leben gezeichnet.«
»Na, ganz so schlimm wird’s schon nicht gewesen sein«, hielt Ada dagegen.
»Doch, weil ich mir auf einmal vorgestellt habe, wie alle meine Lehrer in Netzstrümpfen und auf Stöckelschuhen aussehen würden, und damit meine ich nur die Lehrer, nicht die Lehrerinnen!«
»Ja, ich erinnere mich, dass du vor Lachen nicht mehr konntest.« Sie zog lächelnd eine Braue hoch. »Aber zurück zu diesem ... Commissaris. Sieht er denn wenigstens gut aus?«
»Tante Ada«, sagte sie mit gespielter Empörung. »Ich mache doch nicht das Aussehen zum Maßstab, ob ich mit jemandem befreundet sein möchte.«
»Das nicht, aber es kann hilfreich sein, wenn sich mal mehr ergeben sollte als nur eine Freundschaft.«
»Er ist verheiratet, Tante Ada«, gab Anne zurück und beendete damit die Diskussion. Hatte sie zumindest geglaubt.
»Und?« Ihre Tante hob unbeeindruckt die Schultern. »Was heißt das schon? Mein Ex-Mann war auch verheiratet, als er sich für eine andere Frau zu interessieren begann. Und das gleich zweimal. Einmal war ich die andere Frau, das zweite Mal war ich mit ihm verheiratet. Das hat ihn von nichts abgehalten.«
»Vielleicht hätte es dir mehr zu denken geben sollen«, überlegte Anne, »dass er mit dir was angefangen hat, obwohl er noch verheiratet war.«
»Ja, vielleicht«, seufzte sie. »Aber ich habe ihn wirklich geliebt, und er hat mich geliebt. Jedenfalls damals.« Sie schüttelte den Kopf. »Trotzdem waren es überwiegend schöne Zeiten. Was ich damit sagen will ...«
»Nein, Tante Ada. Zwischen Jeroen und mir ist nichts, und da wird auch nichts sein. Wir sind beide viel zu ehrgeizig, keiner von uns würde auf seinen Job verzichten, um beim anderen zu leben.«
»Und wenn dir jemand eine Stelle bei Europol anbieten würde?«, hakte Ada leise nach. »Dann würdest du nicht auf deinen Job verzichten, und ihr könntet euch jeden Tag sehen.«
»Tante Ada, ich finde Jeroen nett und sympathisch, aber er ist nicht mein Typ. Da ist keine Spur von Anziehung vorhanden. Außerdem ist er blond.«
Ada stutzte. »Was hat denn das damit zu tun?«
»Ich möchte einfach keinen blonden Freund haben.«
Ihre Tante schüttelte den Kopf. »Jetzt kann ich dir nicht mehr folgen.«
»Na, das ist das Gleiche wie bei Männern, die sich nur für rothaarige Frauen oder nur für Blondinen interessieren«, erklärte sie. »Ich habe gemerkt, dass mir die Haarfarbe bei einem Mann egal ist, solange er nicht blond ist.«
»Hm, vielleicht sollte ich ihm unter vier Augen anvertrauen, dass er sich nur die Haare dunkel färben muss, um dein Herz zu gewinnen.«
»Tante Ada, ich ...« Weiter kam sie nicht, da in diesem Moment zwei junge Kartäuserkatzen ins Zimmer gehetzt kamen und gleichzeitig auf den Stuhl und von da auf den Tisch sprangen, wo sie dann stehen blieben und sich suchend umschauten.
»Ihr habt allen Käse und die Wurst geklaut«, sagte Anne zu ihnen. »Das war schon mehr als genug. Tante Ada wird euch erst heute Nachmittag wieder was zu fressen geben.«
»Sofern mir deine pelzigen Plagegeister bis dahin nicht alles zertrümmert haben, was nicht an die Wand genagelt ist«, wandte Ada ein.
Anne verzog schuldbewusst den Mund. Laverne und Shirley hatten es sich zur Gewohnheit gemacht, zu Hause die Tische und Sideboards abzuräumen, wenn sie der Meinung waren, dass es mal wieder etwas zu essen geben sollte. Toby und Phaedra hatten sich das nach nur einem Tag von den Halbwüchsigen abgeguckt, woraufhin Anne nichts anderes übrig geblieben war, als alles in Schränke und Schubladen zu packen, was klein oder leicht genug war, um von einer jungen Katze in die Tiefe befördert zu werden. Dass sie ständig alle ihre Sachen auf dem Boden wiedergefunden hatte, war zwar lästig, aber noch hinnehmbar gewesen, das wirkliche Problem war, dass beim Aufprall auf dem Fußboden scharfe Kanten an den Gegenständen entstehen konnten, die eventuell eine ernste Gefahr für die Tiere darstellten.
»Sobald ich diese Nilpferdspardose irgendwo entdecke, werde ich sie kaufen und dir vorbeibringen«, versicherte sie ihrer Tante kleinlaut. »Wenn die Truppe bei mir zu Hause was zerlegt, ist das ja wenigstens nur meine Sache, aber ich hatte auch gedacht, dass sie sich erst mal eingewöhnen müssten und nicht sofort auf dumme Gedanken kommen würden.«
Ada winkte ab. »Halb so wild. Sie haben es ja nicht absichtlich gemacht.«
»Ganz im Gegenteil, Tante Ada. Sie haben es mit purer Absicht gemacht. So wie mich Phaedra vorhin aus dem Zimmer gelockt hat«, sagte sie und streichelte Laverne und Shirley, die es sichtlich genossen, im Mittelpunkt zu stehen. Trotzdem gingen die Augen ständig hin und her, ob sich nicht doch jemand erbarmte und ihnen noch etwas zu essen gab. Laverne schnupperte vorsichtshalber an Adas Teetasse, zog aber dann rasch den Kopf zurück und zwinkerte ein paar Mal, während Shirley die Nase ins offene Marmeladenglas steckte und zu überlegen schien, ob die durchscheinende rötliche Masse wohl schmecken würde. Die Entscheidung fiel letztlich dagegen aus.
Anne sah, dass ihre Tante durch das Esszimmerfenster jemandem auf der Straße zuwinkte, und als sie sich nach links drehte, entdeckte sie die Briefträgerin, die einen Stapel Sendungen in den Briefkasten neben dem Gartentor steckte, zurückwinkte und dann ihr Fahrrad zum nächsten Haus weiterschob.
»Ich hol die Post rein«, sagte Anne und stand auf. Die beiden Kartäusermädchen standen weiter auf dem Tisch und sahen der Briefträgerin nach, bis die hinter der Hecke zum Nachbargrundstück verschwunden war.
Sie zog das Kapuzenshirt über und lief nach draußen, wo ihr ein kalter Wind entgegenschlug, der zum bedeckten Himmel passte, durch den alles wie von einer dünnen grauen Schicht überzogen zu sein schien. Während sie den dicken Stapel Briefe aus dem Kasten zog, fiel ihr Blick auf die Armbanduhr, und ihr wurde bewusst, dass sie sich besser beeilen sollte. Zwar gab es tatsächlich keinen Anlass, sich für Commissaris Gerards schick zu machen, aber sie wollte ihn auch nicht gerade im Jogginganzug empfangen, sondern in etwas, das besser zu DCI Remington passte.
Dummerweise fiel ihr das zu spät ein, denn gerade, als sie sich zum Haus umdrehte, hörte sie einen Wagen hupen, und als sie in die Richtung sah, aus der das Geräusch kam, entdeckte sie einen blaugrauen Kombi, der vor Tante Adas Haus anhielt. Die Linkslenkung und das knallgelbe Kennzeichen mit der ungewohnten Kombination aus Ziffern und Buchstaben ließen ihr gar nicht erst genug Spielraum, um noch hoffen zu können, dass es eben nicht der angekündigte Besuch war.
Sie verdrehte die Augen und ging zurück zum Gartentor. Die Fahrertür ging auf, und Jeroen stieg aus, sah sie an und grinste breit. »Anne? Du hättest dich doch für mich nicht extra so in Schale schmeißen müssen«, spottete er in einem liebevoll gemeinten Ton.
Anne sah an sich herab. »Meine Tante hatte mich schon gewarnt, dass ich overdressed bin und du das vielleicht als ein falsches Zeichen deutest«, konterte sie im gleichen Tonfall und öffnete das Gartentor, um ihm entgegenzugehen und ihn zu umarmen.
»Wir haben uns ja eine Ewigkeit nicht mehr gesehen«, sagte er und lehnte sich zurück. »Lass dich ansehen ... nein, du hast dich überhaupt nicht verändert.«
»Jedenfalls nicht seit dem letzten Foto, das du von mir bekommen hast«, erwiderte sie. »Und das ist ja soooo alt.« Als sie vor ein paar Jahren gemerkt hatten, dass jeder mit seiner Arbeit zu beschäftigt war, um dem anderen mal einen Besuch abzustatten, waren sie auf die Idee gekommen, sich jeden Monat ein aktuelles Selbstporträt zu mailen, damit sie nicht bei einem eventuellen Wiedersehen aus allen Wolken fielen, wie sehr sie beide sich verändert hatten.
Dadurch waren die Falten in Jeroens Gesicht auch keine Überraschung für sie, ebenso wie seine extrem kurz geschnittenen Haare, die einen Hauch von Grau durchschimmern ließen, dazu der notorische Dreitagebart. Er war so leger gekleidet wie damals und wie auf all seinen Fotos, Jeans und Sweatshirt, eine dicke Jacke gegen die winterliche Kälte, die er gleich nach dem Aussteigen angezogen hatte.
»Lass uns reingehen«, sagte sie. »Ich muss mich noch umziehen, und wenn man nicht gerade joggt, ist ein Jogginganzug gar nicht so warm, wie man vielleicht meinen sollte.«
Er schloss seinen Wagen ab, dann folgte er ihr die Auffahrt hinauf. »Und gehört dir diese Familienkutsche, oder ist das rote Etwas dahinter dein Dienstwagen?« Er zeigte zuerst auf ihren neuen lindgrünen Citroën Picasso, dann auf den klapprigen, rostigen Austin Metro, der seine besten Zeiten schon vor einigen Jahrzehnten erlebt hatte, aber erstaunlicherweise fuhr er immer noch und hatte seine bisherige Existenz ohne irgendwelche Reparaturen hinter sich gebracht.
»Die Familienkutsche gehört mir«, antwortete sie.
Jeroen blieb stehen. »Augenblick mal, du müsstest ja innerhalb der letzten vier Wochen schwanger geworden sein und dann sofort Drillinge zur Welt gebracht haben, wenn du auf einmal im Auto Platz für eine ganze Familie brauchst. Du hattest doch diesen schönen alten Sportflitzer.«
»Den habe ich auch immer noch. Aber keine Angst, du hättest schon in den Nachrichten davon gehört, wenn eine Frau nach vierwöchiger Schwangerschaft Drillinge zur Welt gebracht hätte.« Nach einer kurzen Pause fügte sie dann hinzu: »Ich habe dir doch von den Katzen geschrieben ...«
Jetzt ging ihm ein Licht auf. »Ah, verstehe. Dein alter Wagen ist nicht groß genug für Transportboxen für vier Katzen.« Er nickte bedächtig. »Ja, natürlich, da brauchst du was Größeres.«
»Richtig«, bestätigte sie. »Es ist nur interessant, dass anscheinend alle Männer glauben, eine Frau hätte eine Großfamilie zu transportieren, wenn sie was in Richtung Van oder Minivan fährt.«
Jeroen zuckte mit den Schultern. »Liegt vermutlich daran, dass Frauen mit Minivan meistens eine Großfamilie durch die Gegend fahren müssen.«
»Mag sein, auf jeden Fall musste ich mir als Erstes von dem Autoverkäufer anhören, welche Vorteile so ein Wagen doch hat, wenn man Kinder vom Sport abholt und dann doch noch am Supermarkt anhalten und die Einkäufe für die ganze Familie für die nächste Woche machen kann, weil ein solcher Wagen groß genug und dabei doch so handlich ist, dass jede Mutter damit zurechtkommt.«
»Hast du ihn aufgeklärt?«
Anne schüttelte den Kopf und lachte. »Da wäre ich schön dumm gewesen. Zugegeben, ich hätte dem Kerl gern gesagt, dass ich keine Mutter bin, jedenfalls keine, die menschliche Kinder vorweisen kann, und dass ich auch niemanden vom Sport abholen oder für eine ganze Familie einkaufen muss, jedenfalls nicht für eine menschliche. Aber als er mich gefragt hat, wie zahlreich mein Nachwuchs ist, da habe ich ganz ehrlich geantwortet, dass ich vier hungrige Mäuler stopfen muss ...«
»Wenn deine Katzen so gefräßig sind wie unsere Hunde, dann ist das wirklich nicht gelogen«, warf der Commissaris ein.
»Eben, und daraufhin hat er mir einen so großen Nachlass gegeben und noch so viele Extras draufgelegt, dass ich es einfach nicht übers Herz gebracht habe, ihm zu sagen, zu welcher Spezies diese vier Mäuler gehören.«
Jeroen lachte. »Das hast du gut gemacht. Da ist der Verkäufer seinen eigenen Vorurteilen zum Opfer gefallen. Geschieht ihm recht.«
»Tja, in dem Fall ist die Konkurrenz verschont geblieben«, sagte sie und ging weiter.
»Wie meinst du das?«
»Ich war zuerst bei einem Toyota-Händler, der doch tatsächlich zu mir gesagt hat, dass ich für die Probefahrt und den Vertragsabschluss meinen Ehemann mitbringen soll, weil so was keine Frauensache ist.« Sie schloss die Haustür auf und ging vor Jeroen nach drinnen. »Ihm hab ich daraufhin meine Dienstmarke gezeigt und ihm gesagt, dass er froh sein kann, wenn ich ihn nicht wegen Diskriminierung anzeige.«
Er atmete schnaubend aus. »So was ist ja schon wirklich eine Frechheit. Da hatte ich mehr Glück.«
»Das heißt?«
»Du hast doch Fotos von meiner Frau gesehen.«
»Du meinst die Frau, die bei jeder Misswahl den ersten Preis abräumen müsste?«, fragte sie.
Es war ihr noch immer ein Rätsel, wie es Jeroen gelungen war, als eigentlich völlig durchschnittlicher Mann mit einem ganz normalen und nicht allzu gut bezahlten Job eine Frau abzubekommen, die als Model ein Vermögen hätte machen müssen, wenn sie an einer solchen Karriere interessiert gewesen wäre.
»Ja, genau die«, antwortete er und grinste breit. Er wusste selbst nur zu gut, was für ein Glückspilz er in diesem einen Fall gewesen war. »Ich habe sie unseren Volvo kaufen lassen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sich die Verkäufer darum gerissen haben, sie zu bedienen. Sie ist dann hingegangen und hat nach dem ersten Beratungsgespräch einfach den Kollegen am nächsten Schreibtisch angesprochen und ihm erzählt, welche Konditionen man ihr soeben angeboten hatte. Der Kollege hat prompt unterboten, und dann hat sie die beiden einfach gegeneinander ausgespielt.«
»Ich nehme an, sie hat an dem Tag viel Bein und viel Busen gezeigt?«, fragte Anne amüsiert.
»Auf jeden Fall genug, um die Männerwelt den Verstand verlieren zu lassen. So günstig hatte ich bis dahin noch nie ein Auto kaufen können. Und du hättest die Gesichter der beiden sehen sollen, als sie das schriftliche und damit verbindliche Angebot in der Hand hielt und ich dazukam, um den Vertrag abzuschließen.«
Kopfschüttelnd machte sie die Tür hinter ihm zu. »Komm, ich stelle dich meiner Tante vor, dann ziehe ich mich um, damit wir losfahren können.«
Als Anne zwanzig Minuten später fertig angezogen nach unten kam, fand sie Jeroen und ihre Tante noch immer im Esszimmer vor. Alle vier Katzen hatten sich auf dem inzwischen freigeräumten Tisch niedergelassen und wetteiferten darum, möglichst ausgiebig von dem Besucher gekrault zu werden. Dieses Wetteifern wurde unter anderem von gegenseitigem Drängeln und Wegschubsen begleitet, gefolgt von Knurren und Fauchen und auch schon mal einer drohend erhobenen Pfote, was die Kartäuserzwillinge längst so gut beherrschten wie die beiden älteren Katzen.
Anne nahm erfreut zur Kenntnis, dass Jeroen in diesen Augenblicken das einzig Richtige tat, ohne dass sie es ihm erst noch hatte sagen müssen: Er stellte das Kraulen augenblicklich ein, um der Bande zu demonstrieren, dass keiner von ihnen etwas davon hatte, sich gegenseitig den Platz an der kraulenden Hand streitig zu machen, weil es dann für niemanden mehr Streicheleinheiten gab. Die Taktik funktionierte bei ihm genauso wie bei ihr, denn im nächsten Moment kehrte Ruhe ein, und alle sahen gebannt auf Jeroen, wann er denn nun endlich weitermachen würde.
»Anne, sei so gut und stell du die Rasselbande deinem Bekannten vor«, bat Ada sie, als Anne sich dem Tisch näherte. »Ich kann mir immer nur merken, dass Toby Toby heißt, aber den Namen der Bombay vergesse ich dauernd, weil er so eigenartig ist, und die beiden Kleinen kann ich nicht voneinander unterscheiden.«
»Kein Problem«, sagte Anne und zeigte der Reihe nach auf ihre Katzen. »Die Bombay heißt Phaedra, der Siamkater von altem Schlag ist Toby, aber eigentlich heißt er Tobias Eugene Rustlebourne VIII., nur dass er auf diesen Namen noch nie gehört hat. Und die Kartäusermädchen sind von links nach rechts Laverne und Shirley, beide unehelich geboren.«
Jeroen stutzte. »Unehelich geboren?«
»Na ja, eigentlich soll das heißen, dass die zwei keinen Stammbaum haben, weil ihre adlige Mutter sich mit einem nicht standesgemäßen Kater eingelassen hat. Aber das will ich nicht jedem erzählen, ich will schließlich nicht, dass die beiden schief angesehen werden«, fügte sie mit einem Zwinkern hinzu.
»Das ist schon interessant«, warf Tante Ada ein. »Bei Katzen und Hunden herrschen immer noch Verhältnisse wie bei den Menschen im 18. und 19. Jahrhundert in unseren Breitengraden. Da hat dieses Standesdenken seine Bedeutung verloren, außer natürlich bei den hartgesottenen Erzkonservativen, die eigentlich alles längst verschlafen haben, aber auf Katzenausstellungen prahlt man mit dem Stammbaum, obwohl die Linien auch alle mal mit ganz normalen Katzen angefangen haben.«
»Vermutlich haben die Menschen das in Erinnerung an die ›gute alte Zeit‹ beibehalten«, meinte Jeroen, »in der man wenigstens noch die besseren Herrschaften vom Pöbel trennen konnte. Heute ist das nicht mehr so einfach, vor allem wenn der Pöbel dickere Autos fährt und in größeren Häusern wohnt als die Herrschaften.«
»Kann ich dich wirklich mit diesen vier Monstern allein lassen?«, fragte Anne ihre Tante, gleichzeitig gab sie Jeroen ein Zeichen, damit er aufstand.
»Du bist heute Abend wieder hier, Anne«, erwiderte sie und hob abwehrend die Hände. »Einen ganzen Tag werde ich schon überleben. Es ist ja nicht so, als wären sie bewaffnet und könnten mir die Pistole auf die Brust setzen, damit sie was zu fressen bekommen. Wohin fahrt ihr eigentlich?«
»Nur rüber nach Selford.«
Ada nickte. »Ah, dann weiß ich ja, was du vorhast. Viel Spaß wünsche ich euch.«
»Danke, ich bringe dir auch was mit«, versprach Anne ihr.
»Das musst du nicht«, wehrte ihre Tante ab.
»Ach, ich finde bestimmt etwas, das dir gefallen wird. Notfalls was Essbares. Vielleicht ein paar von den berühmten Fleischklopsen. Bis heute Abend.«
Jeroen verabschiedete sich ebenfalls von Annes Tante, dann verließen sie das Haus und gingen zur Straße. Anne zog den Reißverschluss ihrer Jacke zu, da es ihr trotz Sweatshirt zu kalt war, was vor allem am eisigen Wind lag, der ihnen entgegenwehte.
»Wir können doch meinen Wagen nehmen«, sagte er, als sie ihren Minivan aufschloss. »Ich blockiere doch sowieso schon die Einfahrt.«
Anne schüttelte den Kopf. »Sorry, aber ich bin keine gute Beifahrerin, und ich glaube, dir wird es nicht gefallen, wenn ich ständig bremse und dir sage, dass du auf einen Fußgänger achten sollst, obwohl du den längst gesehen hast.«
»Hm, dann wüsste ich aber endlich mal, wie sich meine Frau fühlt, wenn ich ihr Beifahrer bin«, meinte er grinsend.
»Ich würde dir ja gern den Gefallen tun, aber mit deiner Linkslenkung machst du alles nur noch schlimmer. Dann sitze ich nämlich auf meiner Fahrerseite und habe kein Lenkrad mehr vor mir.«
Schulterzuckend ging Jeroen weiter, dann blieb er stehen und rief: »Ach, Anne, funktioniert der Geldautomat da drüben?« Er deutete auf die Tankstelle, die Ada zufolge schon vor drei oder vier Jahren geschlossen worden war und seitdem leer stand. An der linken Seite des ehemaligen Shops hatte ein Unternehmen einen Geldautomaten installiert, das offenbar zu keiner Bank gehörte und damit jedem Kunden einen horrenden Betrag fürs Geldabheben in Rechnung stellte. Der Platz war geschickt gewählt, zumindest war er das mal gewesen, als die Tankstelle noch betrieben wurde. Wer hier getankt und dabei bemerkt hatte, dass er noch Bargeld benötigte, war zu diesem Automaten gegangen, um dort ein paar Scheine zu ziehen. Wer wollte sich schon die Mühe machen, erst noch nach der nächsten Bank mit Geldautomat zu suchen, wenn so ein Gerät genau vor einem stand?
»Ja, der gehört nicht zur Tankstelle«, antwortete sie. »Der wird regelmäßig aufgefüllt.«
Sie stieg in ihren Wagen ein und wartete, bis Jeroen das Einfahrtstor geöffnet und seinen Wagen weggefahren hatte, dann setzte sie zurück, stieg aus und machte das Tor wieder zu. Auf der anderen Straßenseite ging Jeroen zum Geldautomaten, Anne fuhr auf das Gelände der stillgelegten Tankstelle und hielt auf Höhe ihres Polizeikollegen an. Ein paar Minuten später stieg er zu ihr in den Wagen.
»Glück gehabt«, merkte er an, während er den Gurt anlegte.
»Wieso?«
»Na, der Automat dürfte so gut wie leer sein. Ich habe nur Fünfer rausbekommen, und statt dreihundert Pfund gab es nur zweihundertachtzig. Dann hieß es, das Fach ist leer.«
»Wir können noch zur Bank fahren, wenn du willst«, schlug sie vor. »Das ist nur ein Stück da entlang.« Sie zeigte nach hinten.
Jeroen winkte ab. »Das reicht, ich habe sowieso etwas mehr abgehoben. Für alle Fälle.«
Anne nickte und fuhr los.
Nach einigen Meilen setzte leichter Schneefall ein, was Anne mit einem leisen Stöhnen kommentierte.
»Was ist?«, fragte Jeroen.
»Der Schnee«, sagte sie und deutete nach draußen.
»Das ist doch kein Schnee«, meinte er unbesorgt. »Die paar Flocken bleiben schon nicht liegen, und falls doch, müssen wir uns eben durch millimeterhohe Schneewehen kämpfen. Das werden wir schon schaffen.« Er zwinkerte ihr zu, Anne musste lachen.
»Täusch dich da mal nicht, was die ›paar Flocken‹ angeht. Das Schneechaos im letzten Jahr fing genauso harmlos an.«
»Sollen wir besser umkehren?«
Anne schüttelte den Kopf. »Nein, wir sind ja keine Ewigkeit unterwegs.«
»Wohin fahren wir eigentlich genau?«, wollte er wissen.
»Lass dich überraschen«, sagte sie ausweichend. »Ich glaube, das wird dir gefallen.«
Als sie knapp eineinhalb Stunden später die Ortschaft Leek hinter sich ließen und auf den Straßenschildern Selford in greifbare Nähe rückte, fielen immer größere Schneeflocken immer dichter und überzogen die wenig befahrene Landstraße mit einer noch nicht allzu dicken, aber gleichmäßigen weißen Schicht.
»Sollen wir besser umkehren?«, wollte Jeroen wieder wissen.
Erneut schüttelte Anne den Kopf. »Wir sind fast da, und so kurz vor dem Ziel gebe ich auch nicht mehr auf. Ich fürchte nur, wir werden den Ausflug ein wenig abkürzen müssen, damit wir bei dem Wetter nicht noch allzu spät unterwegs sind.« Sie hielt den Blick auf die Fahrbahn gerichtet und atmete innerlich erleichtert auf, dass sie sich nicht dazu hatte überreden lassen, bei Jeroen mitzufahren. Sie wusste zwar nicht, wie gut er auf Eis und Schnee unterwegs war, aber sie war sich ihrer eigenen Fähigkeiten bewusst und hätte bei diesem Wetter nicht einem anderen ausgeliefert sein wollen – schon gar nicht in einem Linkslenker.
Sie passierten das Ortseingangsschild und folgten dem Verlauf der Landstraße, auf der die Autofahrer durch versetzte Parkstreifen dazu gezwungen werden sollten, nicht durch den Ort zu rasen. Vermutlich gehörten dazu auch noch entsprechende Fahrbahnmarkierungen, aber die waren längst unter der Schneedecke verschwunden. Als sie rechts von sich den kleinen Dorfplatz mit der Hinweistafel auf die Heimat von Finlay Finnegan entdeckte, wusste sie, dass sie dort abbiegen musste, um zu einem der Parkplätze für die Festivalbesucher zu gelangen. Sie nahm die Square Street, aber am Ende der Straße angekommen, war der Weg nach links abgesperrt.
»Ach, Mist, eine Straße zu früh abgebogen«, sagte sie entschuldigend zu Jeroen und begann zu wenden, da fiel ihr auf der anderen Seite der Absperrung ein Polizeiwagen auf, eine Polizistin in dicker Winterkleidung und mit hochgeschlagener Kapuze wollte soeben einsteigen.
Anne drückte auf die Hupe und winkte der Frau, die daraufhin die Wagentür zuwarf und über die verschneite Straße zu ihnen kam.
»Ja, bitte?«, fragte die Frau und kniff die Augen zusammen, da ihr der Wind Schneeflocken ins Gesicht trieb, die durch das offene Fenster auch in Annes Wagen geweht wurden.
»Guten Tag, Constable ... O’Morley«, begrüßte Anne sie nach einem Blick auf das Namensschild am Anorak. »Ich bin DCI Anne Remington, wir sind sozusa...«
»Das ging aber schnell, DCI Remington«, erwiderte O’Morley erstaunt. »Warten Sie, ich räume nur schnell die Straßensperre zur Seite, dann können Sie bis oben durchfahren.«
»Ähm ...« Anne überlegte noch, was das zu bedeuten hatte, aber dann sah sie, wie die Frau weggehen wollte. »Constable, warten Sie«, rief sie laut genug, um trotz der Kapuze gehört zu werden.
Die Frau kam zurück zu ihrem Wagen. »Ja?«
»Wieso haben Sie gerade gesagt, dass das aber schnell gegangen ist?«, fragte Anne. »Ich ... wir ...«
»Na ja, ich habe den Toten vor einer halben Stunde gemeldet, und da hieß es, dass mir bei dem Wetter niemand sagen kann, wie schnell jemand herkommen wird. Um ehrlich zu sein«, sie zuckte mit den Schultern, »hatte ich nicht damit gerechnet, dass heute noch jemand hier auftauchen wird.«
»Ein Toter?«, wiederholte Anne und zog eine Augenbraue hoch, während sie Jeroen ansah.
Der grinste breit. »Und ich dachte die ganze Zeit über, du wolltest mich überraschen.«
Kapitel 2
Wenigstens ließ der Schneefall ein wenig nach, als Anne dem Streifenwagen auf einen der drei großen Parkplätze folgte, die für die Besucher des Finlay-Finnegan-Festivals eingerichtet worden waren.
Constable O’Morley stellte ihren Wagen auf dem ersten Platz links ab, Anne parkte gleich daneben, dann stiegen sie und Jeroen aus. »Ich bin wirklich froh, dass Sie so schnell noch herkommen konnten«, sagte die Polizistin zu ihr. »Das Festival ist zwar offiziell noch nicht eröffnet, aber heute Nachmittag findet der Pressetermin statt, und es wäre eine denkbar schlechte Werbung für das Festival, wenn sich ab heute Nachmittag im Internet verbreitet, dass jemand ermordet worden ist.«
»Ermordet?«, hakte Jeroen nach. »Sie sprachen doch nur von einem Toten. Woher wissen Sie, dass das Opfer ermordet wurde?«
O’Morley stutzte, wohl, weil sie seinen leichten Akzent bemerkt hatte. »Na ja, ich gehe davon aus, dass er ermordet wurde. Es dürfte ziemlich schwierig sein, sich in den Kopf zu schießen, sich dann in ein Grab zu legen, sich komplett mit Erde zu bedecken und dann auch noch die Schaufel verschwinden zu lassen.«
Jeroen lächelte amüsiert, während Anne ein wenig verdutzt über O’Morleys Tonfall eine Braue hochzog. »Ich wollte nicht Ihre Befähigung anzweifeln, ein Mordopfer als solches zu erkennen«, entgegnete er freundlich. »Ich war lediglich daran interessiert, wie Sie zu der Erkenntnis gelangt sind.«
»Ich ... ähm, entschuldigen Sie, Sir«, sagte die Polizistin ein wenig kleinlaut. »Das war unangemessen von mir.«
Er winkte ab. »Mir ist das egal, Constable, ich lege sowieso keinen Wert auf diesen formalen Kram. Wenn ich schon diesen Begriff ›political correctness‹ höre! Demnächst klagt noch eine Legehenne, weil sie nicht als ›Federvieh‹ bezeichnet werden möchte, da der Begriff ›Vieh‹ sie in einen Topf mit Kühen, Ziegen und so weiter wirft.«
»Gefiedertes landwirtschaftliches Nutztier«, sagte O’Morley.
»Wie?« Anne sah sie verdutzt an.
»Nun, das wäre doch die politisch korrekte Bezeichnung«, meinte sie grinsend.
Jeroen begann zu lachen, Anne musste unwillkürlich mit einstimmen. Dann aber räusperte sie sich. »Constable, damit es hier nicht zu Missverständnissen kommt – wir sind nicht hier, weil Sie jemanden angefordert haben.«
»Nicht? Aber Sie haben sich doch als DCI vorgestellt.«
»Ja, aber nur, weil ich Sie unter Kollegen bitten wollte, uns hinten an der Absperrung passieren zu lassen«, erklärte Anne.
Constance O’Morley schüttelte ratlos den Kopf. »Aber wieso sind Sie dann hergekommen?«
»Eigentlich aus einem rein privaten Anlass. Das hier ist ein befreundeter Kollege aus den Niederlanden, Commissaris Hoofdambtenaar Jeroen Gerards.« Sie deutete auf ihn, dann fuhr sie fort: »Er ist dienstlich in England und hat die Gelegenheit genutzt, mir einen Besuch abzustatten. Ich wollte ihm das Finlay-Finnegan-Festival zeigen, und zwar heute, bevor der ganz große Trubel beginnt.«
»Dann wussten Sie also gar nichts von meinem Anruf?«
»Nein. Welche Wache ist denn überhaupt zuständig?«
»Buxton, Ma’am«, antwortete sie. »Das ist ein Stück weiter in diese Richtung.« Sie machte eine vage Handbewegung.
»Ah, wir kommen gerade aus Oswestry«, sagte Anne.
»Das ist ja genau entgegengesetzt«, stellte die Polizisten fest. »Tja, dann sind Sie ja hier gar nicht zuständig.« Sie verzog den Mund. »Und ich hatte gehofft, ich könnte das hinter mich bringen, bevor die Presse hier auftaucht. Vielleicht können Sie ja mit Ihrem Vorgesetzten in Oswestry reden, ob Sie hier einspringen können. Sie wissen schon, von wegen Gefahr im Verzug und so ...« Dann hielt sie sich erschrocken die Hand vor den Mund. »Um Gottes willen, was rede ich denn da? Sie sind doch gar nicht im Dienst!«
»Genau genommen bin ich nicht mal in Oswestry zuständig«, ließ Anne sie wissen. »Meine Zuständigkeit beschränkt sich eigentlich auf die Grafschaft Northgate.«
»Northgate?« O’Morley überlegte kurz. »Das ist ja ganz woanders.« Anne konnte ihr ansehen, wie sich ein Räderwerk in ihrem Kopf in Bewegung setzte.
»Und bevor Sie mich fragen, ob ich nicht dort meinen Vorgesetzten fragen kann, obwohl ich nach wie vor offiziell nicht dienstlich unterwegs bin – da muss ich niemanden fragen, da bin ich sozusagen mein eigener Chef. Na ja, jedenfalls in der Form, dass ich auf unserer Wache niemanden mehr über mir habe. Natürlich gibt es da noch den Superintendent, dem ich Rede und Antwort stehen muss, aber der sitzt nicht im Büro nebenan, sondern viele Meilen weit von mir entfernt.«
»Verstehe.« Die Polizistin sah sich unschlüssig um. »Tja, wenn das so ist, dann ... dann muss ich Ihnen leider sagen, dass Sie Finnegan Village bis auf Weiteres nicht betreten dürfen, weil wir den Tatort sichern müssen. Ich fürchte, Sie haben die Fahrt vergebens unternommen.«
Anne atmete leise schnaubend durch, während sie versuchte, Constance O’Morley zu durchschauen. War für sie das Thema damit tatsächlich abgehakt, oder spekulierte sie darauf, dass Anne ihrem Freund und Kollegen unbedingt Finnegan Village zeigen wollte und sie sich einverstanden erklärte, zumindest einen Blick auf den Toten zu werfen?
»Wie schön, dass ich gar nichts zur Sache beitragen kann«, meinte Jeroen grinsend. »Wäre das hier bei mir daheim passiert, hätte ich schon längst von meinem Vorgesetzten zu hören bekommen, ich solle doch gefälligst einspringen, wenn die zuständigen Kollegen verhindert sind.«
Sie war sich sicher, dass es von ihm als eine völlig arglose Äußerung gedacht war, aber ihr entging nicht das Funkeln in O’Morleys Augen, als die diese Worte hörte. Jeroen hatte sie auf eine Idee gebracht. Zweifellos überlegte sie in diesem Moment, ob sie nicht auf der Wache in Buxton anrufen sollte, um Jeroens Überlegungen dem dortigen Chief vorzuschlagen. Innerlich stöhnte Anne auf, weil sie einfach nur einen Ausflug mit einem guten Freund unternehmen wollte und ein Toter hier in Selford sie nichts anging, ob er nun ermordet worden war oder nicht. Doch wenn sie darauf beharrte, dass sie hier nicht zuständig war, würde diese Constable O’Morley sich an ihren Vorgesetzten wenden, und wenn Anne dann Pech hatte – wovon auszugehen war –, dann würde sie zur Mithilfe verdonnert werden, ob ihr das passte oder nicht. Diese Genugtuung würde sie O’Morley nicht gönnen. Wenn schon, dann sollte es so aussehen, als hätte sie sich aus freien Stücken entschieden, die ersten Ermittlungen einzuleiten.
»Du bringst mich da auf eine gute Idee, Jeroen«, sagte sie und lächelte ihn scheinbar freundlich an, damit O’Morley ihr nichts anmerkte, doch der Blick, den sie ihm dabei zuwarf, veranlasste ihn dazu, den Mund für einen Moment zu verziehen. An ihn und Constable O’Morley gerichtet redete sie dann weiter: »Ich werde das mal schnell mit dem Superintendent klären, damit wir rechtlich auf der sicheren Seite sind und der Täter nicht am Ende ungeschoren davonkommt, nur weil ich hier eigentlich keine Weisungsbefugnis habe.«
O’Morleys Miene verriet nichts, doch das war in Annes Augen die wirklich verräterische Geste. Die junge Frau mit dem blonden Lockenschopf, der ohne den Schutz der Kapuze vom Wind zerzaust wurde, hätte unter normalen Umständen eigentlich mit Erstaunen auf Annes Entschluss reagieren müssen, vielleicht sogar mit Freude, weil sie unerwartete Hilfe bekam und ihr damit auch das Dilemma erspart blieb, wie sie mit der Presse umgehen sollte. Aber sie war allem Anschein nach vollkommen darauf konzentriert, sich ihre Genugtuung nicht anmerken zu lassen.
»Ist das dein Ernst?«, fragte Jeroen verhalten. Ihm war wohl auch bewusst, was er mit seiner unüberlegten Äußerung heraufbeschworen hatte.
»Natürlich ist das mein Ernst«, erwiderte sie und grinste ihn an. »Ich schwinge mich hier zum Sheriff auf, und du wirst mein Deputy. Schön, nicht wahr?«
Er hob abwehrend die Hände. »Na, komm mir lieber nicht mit so was. Als Polizist habe ich hier keine Befugnisse, und außerdem habe ich die falsche Staatsangehörigkeit.«
»Das hättest du dir überlegen sollen, bevor du Anekdoten zum Besten gibst, die ungeahnte Folgen nach sich ziehen«, raunte sie ihm zu, dann fügte sie lauter hinzu: »Das werde ich auch mit dem Superintendent besprechen. Es gibt bestimmt irgendein Schlupfloch in den Vorschriften, damit du einer guten Freundin helfen kannst, möglichst bald wieder nach Hause zurückkehren zu dürfen.«
Nicht ganz eine Viertelstunde später hatte Anne das Okay ihres Superintendent – mündlich und in Form einer SMS –, und auch ihre beiden Detectives Franklin und Hennessy waren instruiert worden, die Angelegenheit so zu behandeln, als würde sie in die Zuständigkeit des Northgate Police Department fallen.
Anne nickte zufrieden, was sie in gewisser Weise auch war, da sie der Polizistin zuvorgekommen war. »Okay, Constable O’Morley und ... Deputy Gerards«, sagte sie gut gelaunt, da sie nun den Spieß umdrehen würde. »Der Superintendent ist einverstanden, dass ich die Ermittlungen kommissarisch leite, bis die Kollegen aus Buxton eintreffen und übernehmen. Das heißt, ich bin jetzt hier weisungsbefugt und bin bis auf Weiteres Ihre Vorgesetzte, Constable O’Morley.«
Die Polizistin lächelte sie strahlend an, doch es wirkte irgendwie aufgesetzt. Offensichtlich hatte sie erkannt, dass Anne ihre Absicht durchschaut hatte und ihr zuvorgekommen war.
»Dann bringen Sie uns jetzt erst mal zu dem Toten«, forderte sie sie auf, und gemeinsam mit Jeroen folgte sie der jungen Polizistin vom Parkplatz auf einen verschneiten Feldweg, der zu einem Höhleneingang führte. Zu beiden Seiten des Weges standen Buden, bei einigen waren die Sperrholzplatten abgenommen worden, sodass man sehen konnte, was dort alles angeboten wurde. Händler rührten irgendwelche Teige an oder putzten die Glasscheiben ihrer Stände, andere waren noch damit beschäftigt, die Preise ihrer Angebote nach oben zu korrigieren, immerhin hatten sie sie seit dem letzten Jahr nicht erhöht.
Jeroen sah nach links und rechts und fragte schließlich: »Tut mir leid, ich dachte immer, ich verfüge über überdurchschnittlich gute Englischkenntnisse, aber ich habe keine Ahnung, was ›frische Quastenkuchen‹ sein sollen. Oder ... ›Eckleberry vom Fass‹. Oder ›flambierte Fruizide‹.«
»Sie müssen nicht an Ihren Englischkenntnissen zweifeln, Sir«, kam O’Morley Anne mit einer Antwort zuvor. »Es handelt sich um Speisen und Getränke aus den Geschichten von Finlay Finnegan. Man muss mit seinen Arbeiten vertraut sein, um den Wiedererkennungswert richtig schätzen zu können.«
»Ich schätze, ich müsste überhaupt erst mal mit diesem Fi... Fer...«
»... Finlay Finnegan«, warf die Polizistin ein.
»Ja, richtig. Mit ihm müsste ich erst mal vertraut sein, um überhaupt zu wissen, was hier los ist.«
»Nun, Finlay Fi...«
»Nicht nötig, Constable«, unterbrach Anne sie. »Den Part der Fremdenführerin werde ich später noch übernehmen. Mr Gerards wird von mir schon noch in die Geheimnisse von Finnegans Welt eingeführt.«
»Jawohl, Chief«, sagte O’Morley nur knapp und ging schweigend weiter.
»Erst mal will ich den Toten sehen, danach erfährst du mehr«, wandte sie sich ihrem Freund zu, während sie sich dem Höhleneingang näherten. Der Eingangsbereich war durch Drängelgitter so verengt worden, dass man zwangsläufig am Kassenhäuschen vorbeigehen musste, um ins Innere der Höhle eingelassen zu werden.
»Hallo, Hank«, rief die Polizistin einem übergewichtigen Mann mit bis auf die Brust reichendem Vollbart und einer wallenden Mähne zu, die das letzte Mal zur Hippiezeit in Mode gewesen sein musste.
Das Kassenhäuschen wackelte hin und her, als der Mann nach vorn kam und die Glasscheibe zur Seite schob. »Hallo, Constance. Wie sieht’s aus? Darf ich den Laden zumachen und Konkurs anmelden, weil da ein Toter in meiner Höhle liegt?«
»Das hier ist DCI Remington«, sagte sie und deutete auf ihre Begleiter, »und neben ihr Commissaris ... Gerards.« Mit einer Kopfbewegung zeigte sie auf den Vollbärtigen. »Und er ist Hank Hancock.«
»Ich organisiere das Festival«, warf der Mann ein und gab den beiden die Hand. »Aber vielleicht sollte ich besser sagen, dass ich früher mal das Festival organisiert habe. Wenn mir die Leiche da hinten einen Strich durch die Rechnung macht, dann kann ich nämlich einpacken.«
Jeroen nickte und lächelte O’Morley milde an. Immerhin hatte sie sich Mühe gegeben, seinen Namen einigermaßen richtig auszusprechen.
Hancock sah Jeroen an. »Wie war Ihr Name noch mal?«
»Gerards.«
Der Bärtige zog die buschigen Brauen zusammen und kratzte sich an der Stirn.
»Ich bin niederländischer Polizist und nur zu Besuch hier«, erklärte Jeroen.
»Ah, darum hab ich nichts verstanden. Hat sich etwa schon Interpol eingeschaltet?«, knurrte er. »Wird die ganze Höhle konfisziert und eingepackt, um sie irgendwo in einem Labor auf Haare zu untersuchen, die der Mörder verloren haben könnte?«
»Nein, ich bin von Europol«, erklärte Jeroen dem Mann, was den nicht fröhlicher stimmen konnte. »Und ich bin nicht von Europol hergeschickt worden, weil hier ein Toter gefunden wurde«, fügte er hinzu, »sondern nur zu Besuch.«
»Können Sie das mal aufschreiben, wie Sie heißen?«
»Oh, wenn ich es Ihnen aufschreibe, werden Sie es erst recht nicht aussprechen können. Nennen Sie mich einfach Jeroen.« Als er sah, wie der andere Mann zum Reden ansetzte, ergänzte er: »Versuchen wir es mit Lautmalerei.« Er überlegte kurz und notierte dann »Yay-roon«.
»Hm«, meinte Hank, als er auf den Zettel sah. »Das klingt nach der Nummer 23 auf der Speisekarte vom Koreaner. Yay-roon. Na, das werde ich schon irgendwie hinkriegen.«
Constable O’Morley gab Anne ein Zeichen. »Wollen Sie jetzt den Toten sehen?«
»Ja, je eher wir das hinter uns bringen, umso besser«, erwiderte sie und zog Jeroen mit sich.
Hinter dem Kassenhäuschen bogen sie gleich nach rechts ab und gingen um einen schweren schwarzen Vorhang herum, der zum einen die Kälte daran hinderte, in die Höhle vorzudringen, zum anderen dafür sorgte, dass die Besucher von Finnegan Village von draußen nicht sehen konnten, was sie im Inneren erwartete.
»Das ist ja ...«, murmelte Jeroen.
»Atemberaubend, nicht wahr?«, gab Anne leise zurück.
Die weitläufige Höhle war in ein schillerndes Farbenspiel getaucht, das mal den Eindruck erweckte, man gehe durch einen Wald, während es einem ein paar Meter weiter so vorkam, als befände man sich tief unter Wasser. Ein gut ausgeleuchteter Weg führte an Schaukästen vorbei, die so groß waren wie Hütten, in ihrem Inneren hatte man auf ein paar Quadratmetern mit der Hilfe optischer Täuschungen scheinbar ganze Welten erschaffen, die von skurrilen Wesen bevölkert waren. Hier und da waren eindeutig Menschen am Werk und legten noch letzte Hand an die Dekorationen, andere ließen sich von Maskenbildnern dabei helfen, sich in fremdartige Wesen zu verwandeln, die mal so aussahen, als würde Baumrinde den ganzen Körper bedecken, während andere an Fische erinnerten, denen Lungen anstelle von Kiemen gewachsen waren, ohne dass sich an ihrem übrigen Aussehen viel verändert hätte.
In anderen Hütten entdeckten sie im Vorbeigehen fast normal aussehende Menschen, die »nur« einen lang gestreckten, birnenförmigen Kopf aufwiesen oder eine extrem spitz zulaufende und sich dann verästelnde Nase oder aber Finger, die an ihren Enden in die Tentakel eines Tintenfischs übergingen.
»Und?«, fragte Anne, nachdem sie die ersten sechs oder sieben Hütten hinter sich hatten. »Was sagst du dazu?«
»Faszinierend, aber ... zum Teil auch ein bisschen so wie aus einem Albtraum«, gestand Jeroen ihr.
»Ja, richtig. Und damit passt das hier ganz genau zu den Geschichten von Finlay Finnegan.«
»Wirst du mir mehr über ihn erzählen?«, wollte er wissen. »Ich sehe hier nämlich nirgendwo Tafeln, auf denen erklärt wird, was man da eigentlich gezeigt bekommt.«
Sie legte beruhigend eine Hand auf seinen Unterarm. »Das werde ich dir alles noch erklären, aber erst, wenn wir diesen Toten gesehen haben und ich weiß, was wir mit ihm machen sollen. An der Kasse gibt es übrigens auch ein Programmheft, das spendiere ich dir nachher noch.«
»Okay, dann bin ich ja mal gespannt, was es mit dem Toten auf sich hat«, meinte er.
»Nicht nur du, Jeroen«, stimmte sie ihm zu. »Nicht nur du.«
Constable O’Morley dirigierte sie im vorderen Teil der Höhle in die äußerste rechte Ecke, dann blieb sie vor einem abgezäunten Bereich stehen, der aus zwei Grabreihen mit je drei Gräbern bestand. Das mittlere Grab in der vorderen Reihe war ausgehoben und mit einem Tuch abgedeckt worden.
»Ein Friedhof?«, fragte Jeroen verwundert. »Ist der nur Dekoration oder gehört das auch zu einer Geschichte?«
»Das sind die ›sprechenden Gräber von Quentin Village‹«, sagte Anne. »Der Titel sagt eigentlich schon alles aus.«
»Soll ich?«, fragte O’Morley und zeigte auf einen roten Knopf an einem kleinen Kasten, der rechts am Zaun montiert war.
Anne nickte lächelnd. »Ja, bitte. Das ist besser als jede Beschreibung.«
Die Polizistin drückte auf den Knopf, woraufhin die Hintergrundbeleuchtung etwas dunkler wurde, während der linke Grabstein von innen heraus zu leuchten begann.
«Ach, wenn ich doch nur aus meinem Leben erzählen könnte«, ertönte eine wehklagende Stimme aus dem Grab davor.
«Aber das tust du doch gerade«, meldete sich das Grab hinten rechts.
«Das schon, aber es hört mir niemand zu«, sagte das erste Grab.
«Es hört dir niemand zu?«, kam eine keifende Stimme aus dem Grab dahinter. «Bin ich etwa niemand?«
Etwas Unverständliches drang aus dem Grab, das ausgehoben und zugedeckt worden war, während der Grabstein leuchtete.
«Hab ich doch gleich gesagt«, kommentierte das erste Grab daraufhin, dann begannen die anderen dumpf zu lachen.
O’Morley drückte wieder auf den Knopf, um die Vorführung abzuschalten.
»Na? Hab ich dir zu viel versprochen?«, fragte Anne grinsend.
Jeroen schüttelte den Kopf. »Wirklich originell. Ich glaube nur, dass ich nicht mitbekommen habe, was dieses Grab hier vorn gesagt hat.«
»Ist mir auch aufgefallen«, stimmte Anne ihm zu.
»Genau deshalb ist man auch nur auf den Toten aufmerksam geworden«, warf die Polizistin ein. »Als heute Vormittag die Anlage getestet wurde, fiel auf, dass das mittlere Grab nicht zu hören ist. Die Techniker haben überall nach dem Fehler gesucht, und schließlich haben sie angefangen zu graben, um sich den Lautsprecher vorzunehmen, weil der die Fehlerquelle sein musste. Tja, und dabei sind sie auf den Toten gestoßen. Er hat durch sein Gewicht wahrscheinlich die Lautsprechermembran eingedrückt, daher die unverständlichen Töne.«
»Wahrscheinlich?«, hakte Anne nach.
»Ja, die beiden haben die Leiche wenigstens freigeschaufelt, aber erstens konnte ich von ihnen nicht erwarten, dass sie den Toten auch noch da rausholen, zweitens wollte ich ja keine Spuren verwischen.«
»Wann genau hat man ihn gefunden?«
»Vor ...« Sie sah auf die Uhr. »... eineinviertel Stunden, also um Viertel nach zwölf.«
»Und da herrschte hier schon Hochbetrieb?«
»Ja, hier waren unter anderem zwei Leute, die die Beleuchtung überprüft haben, ein Maler, der eine Stelle am Zaun nachgebessert hat.« Constable O’Morley hob die Schultern. »Keine Ahnung, wer hier noch alles war. Vielleicht hat auch jemand die Erde auf den Gräbern zusammengefegt.«