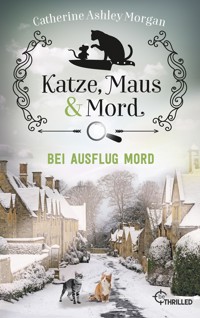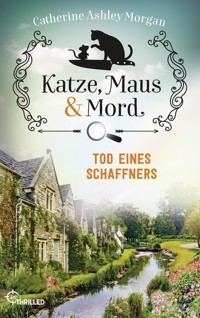4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Katzen mit der Spürnase
- Sprache: Deutsch
Catherine Ashley Morgan ist ein Pseudonym des Autors Ralph Sander, der mit seiner Katzen-Krimi-Serie "Kater Brown" viele Leserinnen und Leser begeistert
Der erste Fall der klugen Katze Isabelle
Die Autorin Christine Bell sucht in der Idylle des ländlichen Englands die nötige Ruhe und Inspiration für ihr neues Buch. Doch als ihr eines nachts eine rotgetigerte Katze zuläuft und Christine sie bei sich aufnimmt, ist es mit der Ruhe plötzlich vorbei. Kurz darauf kommt ihr streitsüchtiger Nachbar unter mysteriösen Umständen ums Leben - und er soll nicht das einzige Opfer bleiben. Außerdem fühlt Christine sich verfolgt. Hat ihre neue Mitbewohnerin - Katze Isabelle - mit alldem etwas zu tun? Denn irgendwie scheint sie stets die falschen Menschen anzuziehen ... Oder hat die Katze in Wirklichkeit ein Pfötchen für Mordfälle?
Alle Bände der Reihe um Christine und Isabelle bei beTHRILLED:
Katze, Maus und Mord - Ein rätselhafter Nachbar
Katze, Maus und Mord - Die verhängnisvolle Botschaft
Katze, Maus und Mord - Tod eines Schaffners
Katze, Maus und Mord - Das tödliche Drehbuch
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 498
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Cover
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
Widmung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Über die Autorin
Weitere Titel der Autorin
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
vielen Dank, dass du dich für ein Buch von beTHRILLED entschieden hast. Damit du mit jedem unserer Krimis und Thriller spannende Lesestunden genießen kannst, haben wir die Bücher in unserem Programm sorgfältig ausgewählt und lektoriert.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beTHRILLED-Community werden und dich mit uns und anderen Krimi-Fans austauschen möchtest. Du findest uns unter be-thrilled.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich auf be-thrilled.de/newsletter für unseren kostenlosen Newsletter an.
Spannende Lesestunden und viel Spaß beim Miträtseln!
Dein beTHRILLED-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
Die Autorin Christine Bell hofft im englischen Dorf Wrightford-on-Stratton die nötige Ruhe und Inspiration für ihr neues Buch zu finden. Mit der Dorfidylle ist es allerdings nicht weit her, denn sie gerät mehrfach mit ihrem streitsüchtigen Nachbarn wegen dessen Katze Isabelle aneinander. Seltsamerweise kommt dieser kurz darauf auf mysteriöse Art ums Leben. Der Vorfall wird schnell als tragischer Unfall abgetan – schließlich passieren in dem idyllischen Dörfchen keine Verbrechen. Christine hat jedoch einen Verdacht und ermittelt auf eigene Faust – schon allein, weil ihr die Katze des Nachbarn kurz vor dessen Tod zugelaufen ist und sie dadurch selbst überaus verdächtig wirkt. Doch bald gibt es weitere Opfer! Hängen diese Todesfälle etwa mit der Katze Isabelle zusammen? Denn die scheint die Aufmerksamkeit der falschen Menschen auf sich zu ziehen – und Christine gleich mit ...
Der erste Band um die kluge Katze Isabelle und die Autorin Christine Bell!
Catherine Ashley Morgan
Katze, Maus und Mord – Isabelle und Christine ermitteln
Ein rätselhafter Nachbar
Für Mucki, Tana, Mucky, Penny und Paulchen
Kapitel 1
Ein Geräusch weckte sie auf.
Kein lautes Poltern, das einen abrupt aus dem Schlaf riss, sondern ein leises Scheppern, das man nur unterbewusst wahrnahm. Christine Bell saß sofort kerzengerade im Bett und starrte in die Dunkelheit. Ihr Herz schlug schneller, während sie gebannt den Atem anhielt und über ihren dröhnend lauten Pulsschlag hinweg auf weitere Geräusche lauschte.
Hatte sie es sich nur eingebildet? Oder geträumt?
Seit sie vor fünf Tagen nach Wrightford-on-Stratton gekommen war und in diesem Haus wohnte, hatte sie noch keine Nacht durchgeschlafen. Der Gedanke ihres Verlegers, sie solle sich hier für ein paar Monate einquartieren, damit sie ganz in Ruhe an ihrem neuen Buch arbeiten konnte, war grundsätzlich nicht verkehrt, denn zu Hause in London wollten ständig alle möglichen Leute etwas von ihr. Natürlich brauchte sie Ruhe, um die Geschichte zu entwickeln, aber bislang hatte sie sich nicht an diese absolute Ruhe gewöhnen können, die hier in Wrightford-on-Stratton am Rande des Dartmoors herrschte.
Tagsüber war in diesem Dörfchen schon recht wenig los, aber nachts kam es ihr manchmal so vor, als sei sie taub geworden, und mehr als einmal hatte sie den Radiowecker auf ihrem Nachttisch eingeschaltet und so leise laufen lassen, dass sie so eben noch wahrnehmen konnte, welcher Song im Nachtprogramm lief.
Und dann die Dunkelheit! Christine hatte nie Angst vor der Dunkelheit gehabt, auch nicht als kleines Mädchen. Aber sie war ein Großstadtkind und mit Straßenlampen, Schaufensterbeleuchtung und Neonreklame aufgewachsen, die den Himmel über London so sehr erhellten, dass es nie wirklich dunkel war. Hier auf dem Land dagegen herrschte eine erdrückende Schwärze, die ihr zeitweilig die Luft zum Atmen nahm. Wrightford-on-Stratton lag an einer wenig befahrenen Landstraße, die halbwegs parallel zur A30 verlief und eine kurvenreiche Verbindung zwischen Henfort und Okehampton darstellte, auf der aber niemand unterwegs war, der nicht in Wrightford-on-Stratton etwas zu erledigen hatte. Von den ohnehin dünn gesäten Straßenlampen wurden ab Mitternacht gut zwei Drittel abgeschaltet, sodass man in der Dunkelheit kaum die Hand vor Augen sehen konnte.
Seit ihrer ersten Nacht in diesem Haus ließ Christine daher im Erdgeschoss das Licht im Flur an und die Schlafzimmertür geöffnet, damit ein wenig Helligkeit ins Zimmer fiel, die sie an London erinnerte und besser schlafen ließ – sofern sie nicht vom Ächzen und Knarren des Hauses selbst aufgeweckt wurde, das nachts lebendig zu werden schien. In der ersten Nacht war es ganz schlimm gewesen, weil sie bei jedem Laut glaubte, jemand schleiche durch das Haus oder komme die Treppe herauf. Inzwischen hatte sie sich ein wenig daran gewöhnt, aber morgens fühlte sie sich immer noch gerädert.
Zum Glück wirkte sich das nicht auf ihre Arbeit aus, denn dass dieselbe Ruhe auch am Tag herrschte, ließ sie gut mit ihrem Projekt vorankommen. Sie war ihrem Verleger David Miller dankbar, dass er ihr dieses Haus zur Verfügung stellte, das einer auf Weltreise befindlichen Tante seiner zweiten Ehefrau gehörte. Ein Fantasyzyklus für junge Leser ließ sich nun mal nicht schreiben, wenn man immer wieder aus der Arbeit gerissen wurde, weil jemand an der Tür klingelte, um aus Anlass der Neueröffnung des zigsten indischen Restaurants die Speisekarte in die Briefkästen zu werfen, weil der Paketbote, der UPS-Fahrer, der FedEx-Fahrer oder diverse andere Kuriere ein Päckchen für die Nachbarn abgeben wollten, und weil es trotz Geheimnummer immer noch irgendeinem Callcenter gelang, bei ihr anzurufen (zum Teufel mit diesen Wählcomputern!), um ihr einen günstigen Stromtarif, den Wechsel zu einem neuen Telefonanbieter oder die Teilnahme an einem Gewinnspiel schmackhaft zu machen.
Tagsüber war die ungewohnte Ruhe also wirklich hilfreich, aber nachts ... nachts wäre sie manchmal am liebsten zur nächsten Autobahn gefahren, um in einem Motel oder notfalls gleich im Wagen zu übernachten – Hauptsache, die Stille und Dunkelheit nähmen ein Ende.
In diesem Moment wünscht sie sich ganz besonders, dass sie das getan hätte. Nicht, weil sie dann dem Gefühl entronnen wäre, als würde sie sich irgendwo tief unter einem Bergmassiv befinden. Sondern weil ihr dann der Eindringling egal gewesen wäre, der im Erdgeschoss sein Unwesen trieb.
Es war nur undeutlich zu hören, doch es gab keinen Zweifel daran, dass sich außer ihr noch jemand hier aufhielt. Womöglich ging der Unbekannte davon aus, dass das Haus unbewohnt war; immerhin wusste jeder im Dorf, dass Margaret Berethwaite – die Tante von Millers zweiter Ehefrau – an einer Kreuzfahrt teilnahm. Da wäre es kein Wunder, wenn irgendwer auf die Idee käme, ihre Abwesenheit zu nutzen, um sich ein wenig nach Wertgegenständen umzusehen.
»Verdammt«, flüsterte Christine und schlug die Bettdecke zur Seite, stand auf, zog sich den Morgenmantel über und schlüpfte in ihre Hausschuhe. Sie konnte nicht einfach daliegen und abwarten, was geschah. Früher oder später würde der Einbrecher die Räume im Parterre durchsucht haben und in den ersten Stock hinaufkommen. Was er tun würde, wenn er sie im Bett liegend entdeckte, wollte sie sich lieber erst gar nicht ausmalen.
Ihr blieb keine andere Wahl, sie musste versuchen, den Eindringling in die Flucht zu schlagen oder vielleicht sogar zu überwältigen, falls er ihr nicht körperlich überlegen war. Gelingen konnte ihr das durchaus, immerhin hatte sie das Überraschungsmoment auf ihrer Seite, da er das Haus für verlassen hielt.
Sie knipste die Nachttischlampe an und sah sich im Zimmer nach etwas um, was sie als Waffe benutzen konnte. Dabei fiel ihr Blick auf die ramponierte Wasserwaage, die wohl ein Handwerker hier vergessen hatte, als das neue Fenster eingesetzt worden war. Ja, diese Waage hatte die richtigen Maße, um sie als Schlagwaffe zu benutzen.
Als sie auf den Nachttisch sah, fiel ihr auf, dass sie ihr Mobiltelefon am Abend zuvor im Wohnzimmer hatte liegen lassen. Da sich der Festnetzanschluss ebenfalls dort befand, blieb ihr ohnehin keine andere Wahl, als den Einbrecher zu stellen. Die Polizei konnte sie so schließlich nicht rufen, doch sie zweifelte auch daran, dass es viel gebracht hätte. In Wrightford-on-Stratton gab es keine Polizeiwache, und Christine hatte nicht die geringste Ahnung, wo die nächste war. Ihr Anruf würde in einer Zentrale am anderen Ende der Welt angenommen werden, und bis dann ein Streifenwagen zu ihrem Haus in diesem abgelegenen Landstrich geschickt wurde, könnte ihr alles nur Erdenkliche zustoßen. Ganz zu schweigen davon, ob man ihre Vermutung, dass sich offenbar jemand in ihrem Haus aufhielt, überhaupt ernst nehmen würde.
Christine nahm die Wasserwaage in die Hand, dann schlich sie vorsichtig in die Diele. Jetzt zahlte es sich aus, dass sie die Schlafzimmertür wegen des Lichts aus dem Erdgeschoss offen gelassen hatte. Die Türangeln quietschten nämlich bei jeder Bewegung so laut, dass der Eindringling das auf jeden Fall bemerkt hätte.
So waren es nur der Holzfußboden und die Treppenstufen, die unter ihren Schritten leise knarrten, während sie nach unten ging. Die Geräusche aus dem Parterre waren nach wie undefinierbar, ein Rumoren und Scharren, das keinen Rückschluss darauf zuließ, wo der Einbrecher am Werk war.
Nach ein paar Stufen stutzte sie. Wie konnte der Eindringling annehmen, dass niemand im Haus war, wenn im Flur das Licht brannte? Wer war so dumm, in ein Haus einzusteigen, wenn davon auszugehen war, dass sich nicht nur jemand darin aufhielt, sondern dass derjenige auch noch wach war?
Handelte es sich womöglich um einen von diesen lästigen Journalisten, die versuchten, an eine Textdatei ihres neuen Buchs zu gelangen, um die Sensationsgier jener Leser zu stillen, denen sie in ihren Boulevardblättern diese Gier überhaupt erst eingeredet hatten? Es war denkbar, dass irgendein findiger Reporter sie aufgespürt hatte, weil zum Beispiel der Postmitarbeiter nicht den Mund halten konnte, der ihren Nachsendeantrag bearbeitete.
Den Bewohnern von Wrightford-on-Stratton wollte sie nicht unterstellen, dass sie ihr die Presse auf den Hals gehetzt hatten, denn hier schien sie wirklich kein Mensch zu kennen. Offiziell arbeitete sie als Beraterin für verschiedene Unternehmen und pflegte ihre Kundenkontakte via Internet, weshalb sie sich in dieses gottverlassene Dorf zurückziehen und die Ruhe genießen konnte.
Da man sie als Autorin vor allem unter ihrem Pseudonym P. S. Lowell kannte, war nicht davon auszugehen, dass hier irgendjemand auch nur ahnte, wer sie wirklich war.
Plötzlich ertönte ein so lautes Scheppern, dass Christine vor Schreck fast die Wasserwaage aus der Hand gefallen wäre. Was für ein Lärm! Das hatte sich nach einem Kochtopf angehört, der mitsamt Deckel vom Herd gefallen und auf den Steinfußboden in der Küche aufgeschlagen war. Der Deckel klapperte noch einen Moment lang, dann kam er zur Ruhe.
Christine wartete eine Weile, aber nichts geschah. Dieser Einbrecher musste ein völliger Trottel sein, wenn er das Licht im Flur ignorierte und dann mit Kochtöpfen um sich warf, ohne sich danach zu vergewissern, dass er nicht im nächsten Augenblick in den Lauf einer Schrotflinte blickte – oder von einer Heugabel aufgespießt wurde.
Immerhin sind wir hier auf dem Land, dachte sie. Da ist eine Heugabel keine so ungewöhnliche Waffe. Ganz im Gegensatz zu einer Wasserwaage.
Und was suchte der Typ überhaupt in der Küche? Hatte er beim Stöbern Hunger bekommen? Sollte sie ihm vielleicht noch einen Tee anbieten?
Langsam ging sie eine Stufe nach der anderen die Treppe hinunter, bis sie durch die offene Küchentür einen schwachen Lichtschein ausmachen konnte. Das sah nach der Kühlschrankbeleuchtung aus! Christine schüttelte ungläubig den Kopf. Da machte sich doch tatsächlich jemand über das Essen her, das sie aus dem Supermarkt in der Nähe von Hatherleigh mitgebracht hatte!
Nur ... wer sollte das sein? Wrightford-on-Stratton war klein und überschaubar, hier gab es keine Obdachlosen, die nachts in Häuser einstiegen, um sich den Bauch vollzuschlagen. Hier gab es keine Trinker oder Drogensüchtigen, zumindest sah man sie nicht auf der Straße herumlungern.
Was sich hinter geschlossenen Türen abspielte, war ein ganz anderes Thema, doch das hatte ja nichts mit ihrem Kühlschrank zu tun.
Christine sah zur Wohnzimmertür und erkannte, dass der Gedanke, die Polizei zu rufen, ohnehin sinnlos gewesen war. Um an eines der Telefone zu gelangen, hätte sie im hell erleuchteten Flur an der Küchentür vorbeigehen müssen, und das wäre nun wirklich zu auffällig gewesen. Aus dem Haus laufen konnte sie auch nicht, da sie abgeschlossen hatte, der Schlüssel im Schloss steckte und die Tür zudem durch eine Kette gesichert war. Es hätte viel zu lange gedauert, die Haustür zu öffnen und nach draußen zu stürmen.
Es half alles nichts, sie musste den Einbrecher stellen und irgendwie mit ihm fertig werden. Zögerlich näherte sie sich der Küche, blieb gleich neben dem Türrahmen stehen und spähte um die Ecke. Der Raum war in den fahlen Schein der Kühlschrankbeleuchtung getaucht, aber zu sehen war niemand. Es war zwar ein mannshoher Kühlschrank, sodass jemand hinter seiner geöffneten Tür hätte kauern können – nur hätte derjenige dann auch das Licht aus dem Kühlschrank verschattet.
Es waren aber immer noch Geräusche zu hören, also hielt sich jemand hier auf. Aber wo? Unter dem Tisch kauerte niemand, und da die Tür nach außen aufging (eine Konstruktion, über die sich Christine immer wieder aufs Neue wunderte), konnte sich dahinter auch niemand versteckt halten.
Sie lauschte angestrengt, bis sie bemerkte, dass es sich bei dem Geräusch um ein leises Schmatzen handelte. Kurz entschlossen stieß sie einen markerschütternden Kampfschrei aus, stürmte in die Küche, machte das Licht an und ...
... und schaute in ein grünes Paar Augen, deren Pupillen sich im hellen Licht abrupt zu schmalen Schlitzen verengten.
Vor dem Kühlschrank saß eine Katze.
Eine rotgetigerte Katze.
Kapitel 2
Wo kommst du denn her?«, fragte Christine, als könnte die Katze ihr eine Antwort geben.
Die musterte sie nur kurz, dann widmete sie sich wieder ihrer eigentlichen Beschäftigung und leerte den Kochtopf, in dem sich das restliche Chili con Carne vom Vorabend befand. Dabei schien sie keinen Unterschied zwischen Fleisch und Bohnen zu machen, und erst recht störte sie sich nicht daran, wie stark Christine das Gericht gewürzt hatte, das für sie nicht scharf genug sein konnte.
»Ich glaube, das ist nichts, was Katzen essen sollten«, sagte sie, hob den Deckel auf und wollte nach dem Kochtopf greifen – bis sie auf einmal ein tiefes Knurren hörte und spürte, wie sich eine Pfote auf ihre Hand legte. Die Krallen waren noch eingezogen, aber der Blick der roten Katze ließ keinen Zweifel daran, dass sich das schnell ändern würde, wenn Christine die Hand nicht zurücknahm.
Also zog sie langsam die Hand weg, das Knurren verstummte, und die Katze steckte den Kopf wieder in den Kochtopf, um das kalte Chili con Carne zu genießen.
»Na gut«, meinte Christine skeptisch und blieb neben dem Tier hocken. »Du verdirbst dir damit den Magen ... und ich habe morgen kein Mittagessen.«
Eine Weile sah sie dem Tier zu; als es offenbar genug hatte, sprang es auf den Küchentisch und legte sich der Länge nach hin, um sich ausgiebig zu putzen. Christine musterte den Rest Chili, legte den Deckel auf den Topf und stellte ihn ins Spülbecken. »Das kann ich wohl wegwerfen«, murmelte sie und sah die Katze an, die sie daraufhin mit einem vorwurfsvoll wirkenden Blick bedachte. »War nicht persönlich gemeint«, verteidigte sich Christine. »Ich habe nichts gegen dich, aber mit dem Rest kann ich nichts mehr anfangen.«
Eine Unterhaltung mit einer Katze – das grenzt schon ans Absurde, überlegte sie und gab etwas Wasser in einen Unterteller, den sie auf den Tisch stellte. »Ich schätze, die Mahlzeit hat dich durstig gemacht.«
Die Katze putzte sich weiter, und erst nach ein paar Minuten nahm sie von dem Unterteller Notiz und trank ein wenig von dem Wasser, um sich dann auf dem Tisch zusammenzurollen.
»Auch wenn du dich hier wie zu Hause fühlst«, sagte Christine zu ihr, »geht es auf keinen Fall, dass du hier Stammgast wirst. Ich weiß nämlich, dass Mrs Berethwaite gegen Tierhaare allergisch ist und es mit dir keine fünf Minuten aushalten würde.« Zumindest hatte sie das von ihrem Verleger erfahren, als der ihr auflistete, worauf sie zu achten habe, wenn sie sich in diesem Haus einquartierte. Dass ihr nicht auch noch Herrenbesuche nach 22 Uhr verboten waren, kam schon einem kleinen Wunder gleich.
Aber vielleicht stimmte das mit der Allergie ja gar nicht, und Mrs Berethwaite benutzte es nur als Vorwand, weil ein Haustier für sie mit zu viel Arbeit verbunden war. Denn die Selbstverständlichkeit, mit der sich die Katze auf den Tisch gelegt hatte, sprach dafür, dass sie das öfter machte. Oder die zeitweilige Hausherrin war ihr sympathisch, und sie wollte deshalb nicht wieder gehen. Wobei ›sympathisch‹ in diesem Zusammenhang vielleicht auch nur bedeutete, dass sie sich von einem Knurren und einer erhobenen Pfote wunderbar leicht einschüchtern ließ. Womöglich war Mrs Berethwaite auch viel resoluter und jagte sie gleich wieder aus dem Haus.
Falls die Allergie doch kein Vorwand war, würde die gute Mrs Berethwaite nach ihrer Rückkehr wohl eine Zeit lang mit Niesattacken und tränenden Augen zu kämpfen haben.
Christine streckte vorsichtig eine Hand aus und näherte sich der Katze, die diesmal nur interessiert zuschaute und zuließ, dass sie gestreichelt wurde. »Na, du bist ja doch eine ganz Brave«, lobte Christine sie. »Du wirst wohl nur kratzbürstig, wenn man dir an dein Essen will.«
Es dauerte nicht lang, da schnurrte die Katze laut, kniff die Augen fest zusammen und ließ sich im Nacken kraulen, bis Christine einen lahmen Arm bekam. Sie lehnte sich zurück, und prompt handelte sie sich einen vorwurfsvollen Blick ein. Wie konnte sie es nur wagen, das Streicheln ohne Erlaubnis ihrer rotgetigerten Majestät einfach einzustellen?
»Ich bin hundemüde«, rechtfertigte sich Christine und kam sich abermals ein klein bisschen albern vor, dass sie überhaupt etwas zu ihrer Verteidigung sagte. Sie verzog den Mund und ergänzte: »Tut mir leid, wenn ich ›hundemüde‹ gesagt habe, aber so heißt das nun mal.«
Sie stand auf und sah sich in der Küche um, dabei entdeckte sie überall Spuren, die ihr Eindringling hinterlassen hatte. Dort war die Flasche mit Spülmittel umgefallen, da lag die Packung Teebeutel auf dem Boden. Pfotenabdrücke zierten einen Teil des Weges, den die Katze durch die Küche zurückgelegt hatte. Wie es ihr gelungen war, den Kühlschrank zu öffnen, blieb rätselhaft, vor allem da es sich um ein Modell mit einer recht schweren Tür handelte. Als Christine dann aber den Kühlschrank gründlicher betrachtete, bemerkte sie, dass im unteren Bereich der Lack bis auf das nackte Blech abgekratzt worden war – genau in der Höhe, in der eine Katze versuchen würde, die Tür zu öffnen.
»Ich muss wohl davon ausgehen, dass du schon öfter hier warst«, wandte sie sich an die Katze, die – ein Eingeständnis ihrer Schuld? – schnell in eine andere Richtung sah. Oder aber sie war nur der Fährte anderer Katzen gefolgt, die von Mrs Berethwaite unbemerkt den Kühlschrank plünderten.
Plötzlich wurde ein Flügel des Küchenfensters von einer Windböe aufgedrückt, womit für Christine klar war, wie der Gast im roten Fell ins Haus gelangt war. Ein kalter Luftzug wehte ins Zimmer und ließ sie schaudern.
Die Katze rollte sich daraufhin auf dem Tisch wieder zusammen, als wolle sie damit sagen, dass sie den Rest der Nacht auf keinen Fall da draußen verbringen würde.
»Dummerweise heißt es nur, dass man bei dem Wetter keinen Hund vor die Tür jagt. Von Katzen ist da keine Rede«, räsonierte Christine laut. Als wüsste es genau, um was es ging, rollte sich das Tier noch fester zusammen, bis nur noch ein Fellknäuel ohne Anfang und ohne Ende auszumachen war.
»Ja, ja, schon verstanden.« Sie durchquerte die Küche, beugte sich über die Spüle und drückte das Fenster zu. Kaum hatte sie sich umgedreht, war der Katzenkopf wieder zum Vorschein gekommen, und die beiden grünen Augen blickten sie dankbar an. »Mir wär’s da draußen nachts auch zu kalt.«
Wieder streichelte sie die Katze, die den Kopf gegen ihre Hand drückte, als ihr auffiel, was für ein abscheuliches Halsband das arme Tier trug: ein gut drei Zentimeter breites Band aus billigem und steinhartem Leder, besetzt mit mehreren Strasssteinen und einem ovalen, rund fünf Zentimeter langen ›Edelstein‹ aus durchsichtigem Plastik, der eher zu einem Zirkuspferd als zu einer Katze gepasst hätte.
Warum nur gab es so viele Tierhalter, die unter derartiger Geschmacksverirrung litten? Dieses Band sah beim besten Willen weder edel noch schön aus, ganz zu schweigen davon, dass es für dieses schmale Tier viel zu klobig war und am Hals scheuern musste.
Kopfschüttelnd schaute sie sich um, ob ansonsten alles in Ordnung war, dann ging sie zur Tür und wollte das Licht ausmachen, als ihr plötzlich etwas einfiel. »Augenblick mal«, sagte sie leise. »Ich kenne dich doch, du bist Heddingfields Katze.« Ja, genau, das war das Tier ihres Nachbarn zur Linken.
Heddingfield war ein komischer Kauz, gut einen halben Kopf größer als sie selbst, schmales Gesicht, die grauen Haare zum Pferdeschwanz gebunden, Kinnbart, Hornbrille. Nicht besonders freundlich, aber vielleicht hatte sie ihn auch nur auf dem falschen Fuß erwischt. Gleich am ersten Tag war bei ihr ein Päckchen abgegeben worden, während sie noch damit beschäftigt war, ihre Taschen auszupacken und sich häuslich einzurichten. Gegen halb sechs kam Heddingfield nach Hause, und nur ein paar Minuten darauf ging Christine durch den Garten, schob sich durch eine Lücke in der zerzausten Hecke zwischen den beiden Grundstücken und klopfte an der Tür zum Wintergarten.
Sie hörte Heddingfield im Haus rumoren, aber da er nicht auf ihr Klopfen reagierte, zog sie die Tür auf und trat ein.
»Hallo?«, rief sie, während die Tür hinter ihr zufiel. »Mr Heddingfield? Wo sind Sie?«
Im nächsten Augenblick kam er aus dem Nebenzimmer in den Wintergarten gestürmt. »Wer sind Sie, wo kommen Sie her, und was haben Sie hier zu suchen?«, fauchte er sie an.
»Jetzt mal langsam, Mr Heddingfield«, erwiderte sie. »Ich bin Ihre neue Nachbarin, Christine Bell. Der Paketbote gab das hier« – sie hielt das Päckchen hoch – »bei mir ab, und ich wollte es Ihnen nur bringen.«
Seine Miene wurde daraufhin nicht sanfter, wie das bei anderen Leuten vielleicht der Fall gewesen wäre, die sich darüber freuten, wenn ein Nachbar ein Paket annahm und ihnen der Weg zum Postamt erspart blieb. »Das muss ein Neuer sein«, brummte er. »Die anderen wissen alle, dass sie nichts woanders abgeben sollen.« Er sah vom Adressaufkleber zu Christine. »Merken Sie sich das: Wenn dieser Bote wieder was bei Ihnen abgeben will, dann sagen Sie ihm, dass er das nicht tun soll.«
Christine verstand die Welt nicht mehr. Hatte sie das gerade eben richtig verstanden? »Ich dachte, ich tue Ihnen damit einen Gefallen. Ich wusste nicht ...«
Weiter kam sie nicht. »Da irren Sie sich. Sie tun mir einen Gefallen, wenn Sie nichts für mich annehmen und der Bote mir stattdessen eine Benachrichtigung dalässt.«
»Wieso ...?«, begann sie, beschloss aber dann, die Sache auf sich beruhen zu lassen. Wenn Heddingfield das so wollte, dann würde sie sich bestimmt nicht aufdrängen. Ihr war es nur darum gegangen, sich als freundliche und umsichtige Nachbarin einzuführen, doch wenn das in diesem Fall nicht erwünscht war, dann eben nicht. Vorsichtshalber würde sie sich in den nächsten Tagen dezent bei den anderen Anwohnern erkundigen, wie sie das hier untereinander handhabten, damit sie nicht in noch mehr Fettnäpfchen trat.
»Sonst noch was?«, holte Heddingfield sie aus ihren Überlegungen.
»Ich ... ähm ... nein, nein, ich bin schon wieder weg.«
Da sie sich nicht sofort von der Stelle rührte, machte er eine ungeduldige Geste und schnaubte aufgebracht. Kurz bevor sie die Hintertür erreicht hatte, wurde sie von einer roten Katze überholt. »Ja, Kleine, ich mache dir die Tür auf, damit du in den Garten kannst«, sagte sie, als das Tier zu ihr zurückkam und sich an ihre Beine schmiegte.
»Nein!«, brüllte Heddingfield sie an, schob sie aus dem Weg und baute sich vor der Hintertür auf. »Kommen Sie ja nicht auf die Idee, Isabelle rauszulassen.«
Jetzt war es an Christine zu schnauben. »Entschuldigung, aber kann man Ihnen eigentlich irgendetwas recht machen? Was war denn jetzt schon wieder verkehrt? Wrightford-on-Stratton ist keine Großstadt mit Hauptverkehrsstraßen, die für eine Katze zu gefährlich wären. Hier im Garten kann ihr nichts passieren.«
»Sie kann aus diesem Garten entwischen«, stellte Heddingfield klar. »Wenn Sie durch den Garten zwischen den Grundstück wechseln können, dann stellt es für Isabelle erst recht kein Problem dar, Ihrem schlechten Beispiel zu folgen.«
»Es würde mir auch nichts ausmachen, wenn Isabelle zu mir rüberko...«
»Nein, sie wird nicht zu Ihnen kommen!«, unterbrach er sie schroff. »Und sie wird auch nicht in diesen Garten hinausgehen!« Sekundenlang stand er nur da und starrte sie an, schließlich schnaubte er wieder entrüstet. »Es geht Sie zwar nichts an, Miss Ball ...«
»Bell.«
»Meinetwegen, dann eben Miss Bell. Wie gesagt, es geht Sie eigentlich nichts an, aber meine Katze ist herzkrank und muss einmal am Tag eine Tablette nehmen. Wenn sie da rausgeht und drei oder vier Tage lang ihre Medikamente nicht bekommt, dann können Sie sich vielleicht vorstellen, wie groß die Chancen sind, dass sie zu mir zurückkommt.«
»Oh«, machte sie nur.
»Ja, ›oh‹«, äffte er sie nach. »Warum muss man den Leuten eigentlich ständig Dinge erklären, die sie gar nichts angehen, nur damit sie einen in Ruhe lassen? Warum genügt es Ihnen nicht, wenn ich sage, dass es eben so ist? Warum wollen Menschen wie Sie immer noch mehr wissen?«
»Weil ich gern verstehe, warum jemand so handelt, wie er handelt«, antwortete Christine leicht verärgert.
»Dann sollten Sie schleunigst begreifen, dass Sie das von manchen Leuten nicht erfahren werden. Nicht jeder hat ein Interesse daran, Ihnen alle Details seines Privatlebens auf die Nase zu binden.«
Sie wusste nicht, wie er das geschafft hatte, aber mit einem Mal kam sie sich vor, als wäre sie im Unrecht. Zugegeben, Heddingfield musste sich natürlich nicht vor ihr rechtfertigen. Aber in einem Kuhkaff wie Wrightford-on-Stratton hätte sie erwartet, die Nachbarn würden eng zusammenhalten.
In ihrem Apartment in London war das etwas anderes. Da kümmerte es im ersten Stock niemanden, wer im dritten Stock lebte, und wenn man sich im Aufzug oder im Treppenhaus begegnete, dann grüßte man freundlich, aber distanziert, ob es sich nun um einen Nachbarn, einen Zeugen Jehovas oder einen Auftragskiller handelte. Wer der andere war, kümmerte einen nicht, jedenfalls solange man selbst in Ruhe gelassen wurde. Im Grunde genommen war der Hausmeister der Einzige, mit dem alle Bewohner ein freundliches Wort wechselten. Und das, obwohl sie ihn von ihrer Umlage mitbezahlten.
»Schon gut«, sagte sie und schlug ihrerseits einen gereizten Tonfall an, um ihre Verlegenheit zu überspielen. »Sie brauchen keine Angst zu haben, ich werde Sie garantiert nicht fragen, ob Sie mir drei Eier für ein Omelett borgen.«
»Ich esse sowieso keine Eier«, gab Heddingfield zurück, nahm die Katze auf den Arm und ging um Christine herum, damit sie das Haus verlassen konnte.
Seit dieser unerfreulich verlaufenen ersten Begegnung hatte sie ihn nicht mehr gesehen, und darüber war sie auch ganz froh, weil sie davon überzeugt war, dass er einer von den Leuten war, denen man es nie recht machen konnte.
Aber jetzt lag seine Katze Isabelle auf ihrem Küchentisch und wartete darauf, dass sie das Licht ausmachte, damit sie mit ihrem Bauch voller Chili con Carne ein Schläfchen machen konnte.
Wieso hatte Heddingfield das Tier rausgelassen, wenn es doch einmal am Tag eine Herztablette brauchte?
Christine sah aus dem Fenster, aber nebenan war alles dunkel. Ein Blick auf die Uhr sagte ihr, dass es kurz vor halb drei war. Sie würde ihm einfach am Morgen einen Besuch abstatten und sich von ihm erklären lassen, was seine Katze nachts in anderer Leute Küche zu suchen hatte.
Kapitel 3
Christine ließ sich Zeit, bevor sie am nächsten Morgen zu Heddingfield ging, um ihm seine Katze zurückzubringen. Die Nacht hatten sie beide gut überstanden, Christine in ihrem Bett, Isabelle vor dem Kamin im Wohnzimmer, dessen Glut für eine angenehme Restwärme gesorgt hatte.
Als die Sonne zum Fenster des Schlafzimmers hereinschien, nahm sie, wie an jedem Morgen, die extrem niedrigen Decken in diesem Haus besonders deutlich wahr. Den Tag über verlor sich dieser Eindruck, einerseits, weil sie sich an das Raumgefühl gewöhnte und andererseits, weil sie die meiste Zeit über ohnehin an dem alten Sekretär im Wohnzimmer saß und konzentriert an ihrem Laptop arbeitete. Und in der Nacht empfand sie die Dunkelheit und die Stille als so erdrückend, dass sie gar nicht weiter auf die niedrigen, dunklen Decken achtete.
Sie war mit einsfünfundsechzig nicht allzu groß, aber sie konnte sich nicht vorstellen, wie hier jemand leben sollte, der einen Kopf größer war als sie. Auf die Dauer hätte ein hochgewachsener Mensch zweifellos Probleme mit dem Rücken bekommen, da er sich nur in gebückter Haltung durch das Haus bewegen konnte.
Isabelle kam zu ihr, als sie am Küchentisch saß und frühstückte. Christine hielt ihr eine Fingerspitze Marmelade hin, aber die Katze schnupperte nur kurz und begann dann blitzschnell, die Butter vom Toast zu lecken.
»Hey, das wollte ich noch essen!«, rief Christine, doch Isabelle hatte schon fast den ganzen Aufstrich verschlungen, bevor sie das Brot in Sicherheit bringen konnte.
Betrübt betrachtete sie den blanken Toast auf ihrem Teller, stand auf und toastete zwei weitere Scheiben Brot. »Ausnahmsweise werden sich die Vögel über deine Existenz freuen«, sagte sie, während sie mit dem Rücken zum Tisch vor dem Toaster stand und wartete. »Die andere Scheibe werde ich zerbröseln und im Garten an sie verfüttern.«
Mit dem fertigen Toast auf dem Teller drehte sie sich um und kehrte an den Tisch zurück, wobei sie sich darüber wunderte, dass sich Isabelle immer noch putze und sich dabei der rechten Vorderpfote mit besonderer Sorgfalt widmete.
»Du hast doch die Butter direkt vom Brot geleckt«, sagte Christine, natürlich ohne eine Antwort zu erwarten. Doch als sie nach dem Eierbecher griff, musste sie feststellen, dass von dem geköpften weich gekochten Ei nur noch das Eiweiß übrig war.
Sie sah aus dem Augenwinkel zu Isabelle und hätte schwören können, dass die Katze eine Unschuldsmiene aufsetzte, als sie den Blick erwiderte.
Fast wie in einem Garfield-Cartoon. Unwillkürlich musste Christine grinsen. »Du kleine Diebin, du«, sagte sie und strich ihr über den Rücken, was Isabelle mit einem wohligen Schnurren beantwortete.
Nach dem Frühstück holte Christine die Zeitung aus dem Briefkasten, setzte sich im Wohnzimmer in den bequemen Ledersessel vor dem Kamin und begann zu lesen. Weit kam sie nicht, da Isabelle ihr aus der Küche folgte, auf ihren Schoß sprang und sich so auf die Zeitung legte, dass Christine unmöglich umblättern konnte.
»Du hättest dir wenigstens eine interessantere Seite als die Börsenkurse aussuchen können«, beschwerte sie sich. Natürlich ohne Erfolg.
Während Isabelle bei ihr lag und fest einschlief, begann sie sich darüber zu wundern, dass diese Katze ihr Herrchen gar nicht zu vermissen schien. Und nicht nur das, offenbar fühlte sie sich bei ihr auch noch ... nun ja ... pudelwohl, überlegte Christine. Womöglich kümmerte sich Heddingfield nicht allzu intensiv um seine Katze, auch wenn er ihr ihre tägliche Herztablette gab. Oder aber Isabelle war nicht auf eine bestimmte Person fixiert und nahm, wen sie kriegen konnte, um sich ihre Schmuseeinheiten zu holen.
Als sie eine halbe Stunde später mit Isabelle auf dem Arm nach draußen ging und sich dem Haus ihres Nachbarn diesmal nicht vom Garten, sondern von der Straße her näherte, fiel ihr auf, dass sich ihre Atemluft in der Kälte zu Wölkchen formte.
»Gut, dass ich dich heute Nacht nicht rausgeworfen habe«, sagte sie zur Katze, die ihren Kopf an Christines Wange drückte. »Das wäre viel zu kalt für dich gewesen.«
In diesem Jahr fiel der September ungewöhnlich kühl aus, was sie aber nicht störte, da sie alles andere als eine Hitzefanatikerin war – auch wenn der Rest des Landes im Hinblick auf das Wetter anderer Meinung zu sein schien. Aber vermutlich war das auf dem Kontinent nicht anders.
»Wenn der Klimawandel nicht für eine Erderwärmung sorgen würde, sondern für Dauerregen und Kälte«, hatte sie erst vor Kurzem noch zu ihrer Freundin Joanne gesagt, nachdem im Fernsehen eine der vielen Dokumentationen zu dem Thema gelaufen war, »dann hätten neunzig Prozent der Menschen ihr Auto bereits verschrottet, und niemand würde mehr ein Flugzeug benutzen wollen.«
Solange die Klimakatastrophe bedeutete, dass es nördlich des Äquators wärmer und trockener wurde, war für die meisten in diesem Teil der Welt alles in Ordnung. Was das für den Rest der Erdenbewohner bedeutete, war ihnen offenbar gleichgültig.
Der Gedanke blieb ihr noch einen Moment länger im Gedächtnis, als sie den Jaguar sah, der ein Stück weiter am Straßenrand abgestellt worden war. Sie kannte dieses Modell noch aus der Spielzeugsammlung ihres großen Bruders und wusste, das Baujahr bewegte sich irgendwo zwischen Ende der Siebziger und Anfang der Achtziger, also eine gute alte Dreckschleuder, die sich auch noch das Etikett Oldtimer ans Revers heften durfte.
»Wer hat denn hier so hohen Besuch?«, rätselte Christine und bog in Heddingfields Vorgarten ein.
Als sie eben im Begriff war, anzuklopfen, hörte sie von drinnen laute Stimmen, die aber durch die Tür so gedämpft waren, dass sie nichts verstehen konnte. Der Tonfall ließ allerdings keinen Zweifel, dass sich mindestens zwei Männer lautstark stritten. Heddingfield und ... wer? Der Fahrer des Jaguars?
Sollte sie zurück nach Hause gehen und warten, bis der unbekannte Besucher gegangen war?
Andererseits kümmerte es sie nicht, mit wem sich ihr Nachbar stritt. Vielleicht hatte er ja den Postminister zu sich bestellt, um sich darüber zu beschweren, dass wieder eines seiner Pakete irgendwo abgegeben worden war.
»Egal«, sagte sie sich und klopfte an. Beim ersten Anlauf geschah nichts, die Stimmen sprachen genauso laut weiter. Sie versuchte es noch einmal, dann wurde es ruhig im Haus.
Heddingfield öffnete die Tür und sah Christine an. »Was?« Er klang nicht aufgebracht, so wie beim letzten Mal, stattdessen machte er einen etwas nervösen Eindruck auf sie.
»Guten Morgen, Mr Heddingfield«, erwiderte sie mit besonderer Betonung, um ihn auf seine schroffe Begrüßung aufmerksam zu machen, doch ihr Nachbar war immun gegen solche Bemühungen. »Was?«, fragte er nur wieder, diesmal noch eine Spur nervöser. Fast kam es ihr so vor, als fürchte er, von ihr könne eine Bedrohung ausgehen. Oder besser gesagt: von ihr könne auch eine Bedrohung ausgehen. Es war ein eigenartiges Gefühl, das Christine nicht in Worte fassen konnte, aber Heddingfield machte auf sie den Eindruck eines Mannes, der sich von zwei Seiten in die Enge getrieben fühlte.
Dass von ihr keine Gefahr für ihn ausging, wusste Christine, aber sie fragte sich, wer der Mann war, mit dem er sich eben noch gestritten hatte und vor dem er – möglicherweise aus gutem Grund? – Angst hatte.
»Ich bringe Ihnen Ihre Katze zurück«, sagte sie und hielt ihm Isabelle hin.
»Das ist nicht meine Katze«, erwiderte Heddingfield. Christine stand sekundenlang da, Isabelle in ihren ausgestreckten Armen, ehe zu ihr durchgedrungen war, was ihr Nachbar soeben von sich gegeben hatte.
»Das ist Ihre Katze«, beharrte sie.
»Nein, meine Katze ist schwarz«, behauptete er.
»Kann ich Ihre Katze mal sehen? Ihre schwarze Katze?«
Heddingfield schüttelte den Kopf. »Die treibt sich irgendwo in der Nachbarschaft herum. Sie wissen ja, wie Freigänger so sind.«
»Aber ...«, begann sie.
»Aber wo ich Sie gerade sehe«, fiel er ihr ins Wort. »Ich wollte Ihnen gestern schon dieses Wurmkurpräparat zurückgeben, das Sie mir geliehen hatten. Winston hat es ohne Probleme geschluckt.«
»Wurmkurpräparat?«, wiederholte sie, doch die Tür war bereits zugefallen. »Winston?«
Knapp zwei Minuten lang stand Christine mit Isabelle auf dem Arm da und rätselte, was hier vor sich ging. Die plausibelste Erklärung war noch die, dass sie mit versteckter Kamera gefilmt wurde und sich nächste Woche im Fernsehen wiedersehen würde. Möglich war auch, dass Heddingfield einfach den Verstand verloren hatte und nicht wusste, was er redete. Immerhin hätte das erklärt, warum er seine Katze aus dem Haus gelassen hatte.
Das Problem bei allen diesen Erklärungsversuchen war jedoch die auffällige Nervosität des Mannes, die so gar nicht zu ihm passte. Bevor sie länger darüber nachgrübeln konnte, ging die Tür erneut auf, und Heddingfield stand wieder vor Christine.
»Hier«, sagte er und drückte ihr eine Arzneimittelpackung in die Hand. »Und nochmals danke.«
Ehe sie sichs versah, fiel die Tür ein weiteres Mal ins Schloss.
Christine stand da, die Katze auf dem Arm, und überlegte,
ob sie vielleicht jeden Moment aufwachen würde. Aber dann streckte sich Isabelle und drückte ihr die Krallen einer Pfote herzhaft in die Schulter. Der stechende Schmerz machte ihr klar, dass sie nicht träumte.
Wie benommen ging sie zurück ins Haus, setzte die Katze ab und machte sich einen Kaffee. Isabelle strich um ihre Beine, um sich eine Leckerei zu erbetteln, aber da Christine nicht auf Besuch dieser Art eingestellt war, musste sie das gierige Tier mit einer Scheibe Schinken ruhigstellen.
»Ich möchte wetten, im Handbuch ›Wie schaffe ich mir eine Katze an‹ ist nicht die Möglichkeit erwähnt, sich einfach eine vom Nachbarn in die Hand drücken zu lassen«, sagte sie zu Isabelle, die den Schinken verschlang und sofort wieder hochsah, um sich zu versichern, ob noch Nachschub folgen würde.
Grübelnd holte Christine den Laptop aus dem Wohnzimmer, setzte sich an den Küchentisch und ging ins Internet, um nach Informationen zu suchen, welche Grundausstattung für eine Katze im Haus nötig war. Sie wurde schnell fündig und druckte eine Liste der wichtigsten Dinge aus, damit Isabelle fürs Erste versorgt war. Vorläufig sollten eine Katzentoilette, Streu und Futter genügen, denn es war immerhin denkbar, dass Heddingfield sich im Lauf des Tages eines Besseren besann und seine Katze zurückholte, doch bis das der Fall war, wollte sie sich wenigstens vernünftig um das Tier kümmern.
Das Ganze war nach wie vor ein Rätsel. Warum behauptete Heddingfield, seine Katze sei schwarz und heiße Winston? Und warum drückte er ihr eine Packung Wurmkurtabletten in die Hand, die sie ihm angeblich geliehen hatte?
Mit der Liste in der Hand ging sie in den Flur und entdeckte dort die Medikamentenpackung, die sie beim Hereinkommen zur Seite gelegt hatte. Enacard stand darauf geschrieben, in einer Ecke war die Silhouette einer Katze zu sehen, darin ein stilisiertes Herz.
Ein Herz?
Ein Herz?
Christine öffnete die Verpackung und holte den Beipackzettel heraus. Sie musste nur die ersten Zeilen lesen, dann wurde ihr klar, dass Heddingfield seine Katze nicht zurücknehmen würde. Weder heute noch in nächster Zukunft.
Warum, war ihr nicht klar. Sie wusste nur, dass es so war.
Bei dem »Wurmkurpräparat« handelte es sich in Wahrheit um Isabelles Herztabletten.
Eine Viertelstunde später saß Christine in ihrem noch fast neuen Mini Cooper Kombi und fuhr vom Grundstück, auf dem neben dem Haus Platz genug war für einen ausgewachsenen Pkw. Normalerweise konnte sie die notwendigen Besorgungen zu Fuß erledigen, weil die wenigen Geschäfte in Wrightford-on-Stratton alle um den einen zentralen Platz herum angeordnet waren, auf dem auch jeden Freitag der Wochenmarkt stattfand. Ringsum waren im Erdgeschoss der gemütlichen kleinen Häuser ein Metzger, ein Bäcker, ein Lebensmittelgeschäft, ein Haushaltswarenladen, eine kleine Buchhandlung, die ihre Kunden auch mit Illustrierten und Tageszeitungen versorgte, außerdem mit Tabakwaren und der Möglichkeit, sein Geld beim Lotto zu verspielen. Zwischen Metzger und Bäcker eingezwängt, fand sich ein winziges Postamt. Das Einzige, wovon es in Wrightford-on-Stratton mehr als eines gab, war der Pub. Genau genommen konnte man sogar zwischen drei Pubs wählen.
Wenn man mit dem vorhandenen Angebot zufrieden war (zum Beispiel, weil man gern noch so lebte wie in den Dreißigerjahren, wie ihr Verleger zynisch angemerkt hatte), musste man das Dorf nie verlassen und kam gut ohne Auto aus. Wer dagegen lieber mal Italienisch oder Indisch aß, wer zwischen mehr als zwei Sorten Tiefkühlpizza (Salami oder Schinken) wählen wollte oder gelegentlich Lust auf eine andere Sorte Eis als Vanille hatte, der hatte das Nachsehen und musste gut zwanzig Meilen bis nach Hatherleigh fahren, wo der nächste wirklich große Supermarkt zu finden war.
Dass dieser Supermarkt genauso wie jeder andere, noch weiter entfernte eine ernsthafte Konkurrenz für die Geschäftsleute in Wrightford-on-Stratton darstellte, zeigte sich allein schon daran, dass man bei der Einrichtung der Ladenlokale Anfang der Sechzigerjahre stehen geblieben war. Es fehlten nur noch Autos aus dieser Zeit, und die Illusion wäre perfekt gewesen.
Christine fuhr heute allein aus dem Grund mit dem Wagen ins – sie musste sich ein Schmunzeln verkneifen – Stadtzentrum, um die Katzenstreu und das Katzenfutter zu besorgen. Beides würde zu schwer sein, um es von dort bis nach Hause zu tragen, und sie wollte auch nicht, dass Mr Flurby ihre Einkäufe nach Hause lieferte. Mr Flurby sah aus, als entstamme er einer Liaison zwischen Marty Feldman – von dem er die Glupschaugen hatte – und Robert Morley – dem er den immensen Bauchumfang verdankte.
Einerseits wusste sie bei ihm nie, auf welches Auge sie sich konzentrieren sollte, andererseits wurde sie bei ihm das Gefühl nicht los, dass er sie unverhohlen anstarrte, wenn er mit ihr allein war, und das gefiel ihr bei keinem Mann, wobei es bei ihm einfach nur unheimlich war. Im Supermarkt war das noch erträglich, weil sie diejenige war, die gehen konnte, wenn sie ihre Einkäufe erledigt hatte. Doch wenn er zu ihr kam, dann konnte sie ihm nicht entkommen, sondern sie würde warten müssen, bis er sich wieder auf den Weg machte.
Sie musste unbedingt mal mit ein paar von den anderen Frauen im Dorf ins Gespräch kommen und herausfinden, ob es ihnen auch so erging oder ob sie Mr Flurby lediglich etwas unterstellte.
Als sie vom Grundstück aus in die Straße einbog, bemerkte sie im Rückspiegel eine Bewegung. Sie sah einen Mann in einem dunkelblauen Anzug aus dem Garten von Heddingfields Haus kommen, er bog nach rechts ab und stieg in den Jaguar ein. Das war also sein Besucher gewesen, mit dem er sich so heftig gestritten hatte. Und der ihn so nervös gemacht hatte.
Er wendete auf der schmalen Straße, indem er eine Einfahrt auf der gegenüberliegenden Seite benutzte, dann gab er Gas und fuhr mit hoher Geschwindigkeit an Christines Mini vorbei. Der Mann hatte dunkles, glattes Haar, das er zu einem Seitenscheitel gekämmt hatte, und sein Kiefer war recht ausgeprägt, was ihm einen entschlossenen Ausdruck verlieh. Das Kennzeichen war so knapp und markant, dass Christine es sich nicht notieren musste: M1LK. Auf den ersten Blick hätte man es für ›MILK‹ halten können, aber die ›1‹ war ihr bereits aufgefallen, als sie den Wagen am Straßenrand hatte parken sehen.
»Wer bist du, dass Heddingfield deinetwegen seine Katze nicht zurückhaben will?«, murmelte sie und fuhr ebenfalls los, verlor den Jaguar aber bereits nach der ersten Kurve aus den Augen, da der Fahrer in einem halsbrecherischen Tempo davonjagte, mit dem sie weder mithalten konnte noch wollte. Offenbar befürchtete er keine Radarfalle, obwohl diese nicht selten in kleinen Ortschaften wie dieser aufgestellt wurden, um unaufmerksame Autofahrer um etliche Pfund zu erleichtern, die der Gemeinde zugutekamen.
Nachdem der Jaguar verschwunden war, überlegte Christine, ob sie umkehren und einen zweiten Anlauf unternehmen sollte, Isabelle zurückzugeben. Sie entschied sich aber dagegen. Wenn er sein Tier haben wollte, dann musste er sich schon bequemen, zu ihr nach Hause zu kommen. Und nur wenn seine Erklärung für sein Verhalten Christine überzeugen konnte, würde sie Isabelle herausrücken. Sollte der leiseste Zweifel an der Stichhaltigkeit seiner Begründung zurückbleiben, dann würde sie ihn vor die Wahl stellen, dass sie die Katze entweder behielt und er sich damit abfand, oder aber dass sie sie ins Tierheim brachte und Anzeige gegen ihn erstattete.
Kapitel 4
Wie erwartet, konnte sich Christine auf dem Dorfplatz aussuchen, wo sie parken wollte. Von den gut fünfzehn Stellplätzen in der Platzmitte rings um den kleinen »Park« mit seinen drei Bäumen und fünf Büschen waren gerade mal zwei Plätze besetzt. Als Erstes ging sie zur Post, die im Wesentlichen aus einem Schalter mit Panzerglas und einer größeren Durchreiche für Pakete bestand. Hinter dem Schalter saß eine schmächtige Gestalt mit Bürstenhaarschnitt, spärlichem Oberlippenbart und Brille mit kreisrunden Gläsern: Mr Anderson. Das dunkelblaue Hemd saß tadellos und schien erst am Körper gebügelt worden zu sein.
An dem kleinen Tisch links vor dem Schalter saß die alte Mrs O’Malley und sah ihr übliches Dutzend Rubbellose aus dem Lottoladen an der Ecke durch. Christine hatte sie seit ihrer Ankunft in Wrightford-on-Stratton jeden Morgen im Postamt sitzen sehen. »Guten Morgen, Mrs O’Malley«, begrüßte sie die grauhaarige Frau.
»Oh, guten Morgen, Miss Bell«, erwiderte sie und lächelte Christine an.
Die stellte sich an den Schalter und betete im Stillen, nicht wieder die gleiche Prozedur über sich ergehen lassen zu müssen wie am Tag zuvor. Doch als sie sah, wie Mr Anderson stur auf ein Rundschreiben an alle Postangestellten starrte, das vor ihm lag, wusste sie, dass sie vergebens hoffte.
Mr Anderson war in seine Lektüre vertieft und würde sich seiner Kundschaft erst annehmen, wenn er das Rundschreiben gelesen hatte; schließlich musste er sich versichern, ob es neue Instruktionen für den Umgang mit den Postkunden gab. Zumindest war das seine Erklärung gewesen, als er sie am zweiten Tag ihres Aufenthaltes fast zehn Minuten lang hatte warten lassen, obwohl sich außer ihnen dreien niemand in der Filiale aufhielt. Insgeheim war sie der Meinung, dass er entweder einfach nur ein Sadist war, oder aber er lebte auf diese Weise seinen Frust darüber aus, dass man ihn in dieses Postamt versetzt hatte, in dem so gut wie nichts los war. Dennoch hatte sie nur genickt, da sie wusste, hinter dem Panzerglas saß er am längeren Hebel. Und sie traute ihm glatt zu, dass er sich weigern könnte, ihr ihre Post auszuhändigen, wenn sie sich nicht kooperativ zeigte.
Diesmal dauerte es nur drei Minuten, dann hatte er seine Dienstanweisung gelesen. Er griff zu einem Textmarker und kennzeichnete verschiedene Passagen. Dann endlich blickte er auf.
»Was kann ich für Sie tun?«
»Guten Morgen, Mr Anderson.«
»Guten Morgen«, gab er wie automatisch zurück. »Was kann ich für Sie tun?«
»Ich hätte gern gewusst, ob heute wieder Post für mich nachgeschickt worden ist.«
»Auf welchen Namen?«
Christine seufzte. »Das gleiche Spielchen wie gestern?«
»Auf welchen Namen?«, wiederholte er ungerührt und sah sie an, als hätte er sie noch nie gesehen.
»Bell«, antwortete sie gedehnt. »Christine Bell.«
Wortlos drehte sich Mr Anderson zu einem Regal um, an dem ein Messingschild mit der Beschriftung »Nachsendungen« klebte. Von den zwanzig Fächern war genau eins belegt, trotzdem nahm er sich die Zeit, seinen Blick über das ganze Regal schweifen zu lassen. Dann erst zog er einen dünnen Stapel von fünf oder sechs Briefen heraus, vermutlich Rechnungen oder Werbung.
»Lassen sich viele Leute ihre Post nach Wrightford-on-Stratton nachsenden?«, fragte sie spitz, woraufhin Mrs O’Malley zu kichern begann.
»Nein, nur Sie«, antwortete er, ohne auf ihren Tonfall einzugehen.
Einmal mehr fragte sich Christine, in welcher Mottenkiste sie einen solchen Mitarbeiter gefunden hatten. Dem Gesicht nach zu urteilen, war er höchstens Ende zwanzig, aber im Verhalten glich er einem sturen Beamten kurz vor der Pensionierung, der in seinem ganzen Leben noch nie ein Auge zugedrückt und Verständnis für die Kunden an seinem Schalter gezeigt hatte. Ein Beamter der ganz alten Schule. Vermutlich hatte es ihn aus König Edwards Zeit ins 21. Jahrhundert verschlagen, und er war einfach nicht in der Lage, sich an die neuen Gegebenheiten anzupassen.
»Na, dann lassen Sie mal sehen«, sagte Christine und hielt erwartungsvoll die Hand an das Fach unter der Panzerglasscheibe.
Mr Anderson zog verdutzt die Augenbrauen hoch. »Sie müssen sich erst ausweisen.«
»Wie bitte?«
»Sie müssen sich ausweisen«, wiederholte er.
»Aber Sie kennen mich doch.«
»Das hat damit nichts zu tun. Ich muss vermerken, dass ich Ihnen diese Briefe ausgehändigt habe, und dazu benötige ich nun einmal ein Dokument, anhand dessen ich Sie identifizieren kann.«
»Ich habe Ihnen doch gestern schon meinen Führerschein gezeigt, Mr Anderson.«
»Ja, für die Briefe, die Sie gestern abgeholt haben.«
»Was sollte sich von gestern auf heute an meinem Führerschein geändert haben?«
Mr Anderson zuckte mit den Schultern. »Sie könnten zu schnell gefahren sein, und die Polizei hat Ihren Führerschein eingezogen. Wie stehe ich dann da, wenn ich mit dem heutigen Datum eintrage, ich hätte Ihre Fahrerlaubnis gesehen, wenn sie Ihnen gestern abgenommen wurde?«
»Mir wurde mein Führerschein nicht abgenommen«, beharrte Christine.
»Dessen kann ich mir erst sicher sein, wenn ich ihn mit eigenen Augen gesehen habe.«
»Himmel noch mal!«, mischte sich auf einmal Mrs O’Malley ein. »Lewis, Sie sind ein elender Pedant! Ich sitze jeden Morgen hier, wenn Miss Bell herkommt, um ihre Post abzuholen, und jeden Morgen verlangen Sie von ihr, dass sie sich ausweist. Haben Sie Alzheimer, oder was?«
»Ich habe nun einmal meine Vorschriften.«
Mrs O’Malley stand auf und stellte sich neben Christine. »Sie haben Glück, dass ich eine Lady bin, sonst würde ich Ihnen erzählen, was Sie mit Ihren Vorschriften machen können!«
»Vorschriften gibt es nicht ohne Grund«, konterte er stur.
»Am liebsten würde ich Mr Heather ausgraben, Gott hab ihn selig, damit er wieder den Schalter übernimmt. Zu seiner Zeit wurde man wenigstens mit einem Lächeln bedient, aber Lächeln gehört ja leider nicht zu den Vorschriften.«
Mr Anderson zog die Augenbrauen zusammen und warf der alten Dame einen vernichtenden Blick zu.
»Wir wissen doch alle«, fuhr sie unbeeindruckt fort, »warum Sie hier gelandet sind. Ich sage Ihnen, wenn Sie so weitermachen, werden wir Ihrem Vorgesetzten eine Unterschriftenliste vorlegen, damit Sie von hier verschwinden. Neulich lief ein Bericht im Fernsehen, dass man bei einer Forschungsstation am Südpol ein Postamt aufmachen will. Vielleicht haben Sie Chancen.«
Grimmig hielt er das Formular von innen an die Trennscheibe. »Sehen Sie doch selbst! Hier steht: ›Empfänger hat sich ausgewiesen durch: ............‹ Was soll ich denn bitte da hinschreiben?«
»Schreiben Sie ›durch Mrs O’Malley‹«, antwortete sie.
»Aber ...«, setzte Mr Anderson an.
»Unterschriftenliste«, unterbrach sie ihn sofort. »Südpol.«
Zähneknirschend trug er ihren Namen ein und schob die Briefe durch den Schlitz unter der Trennscheibe.
»Und am Montag ...?«, begann Christine zögerlich.
»Am Montag werde ich ›persönlich bekannt‹ eintragen«, kam seine kleinlaute Antwort.
Christine verließ das Postamt zusammen mit Mrs O’Malley und überflog die Absender ihrer Briefe. »Wie erwartet«, murmelte sie. »Werbung und Rechnungen.«
»Das sind die einzigen Sendungen, die wirklich immer ankommen«, stimmte Mrs O’Malley ihr zu. »Aber wenigstens wird Mr Anderson Sie jetzt nicht mehr piesacken, wenn Sie Ihre Post abholen.«
»Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Vielleicht kann er sich am Montag nicht mehr daran erinnern, dass ich heute da war. Gibt es denn wirklich einen bestimmten Grund dafür, dass er hierher versetzt wurde? Hat er sich etwas zuschulden kommen lassen?«
»Haben Sie mal vom Swansea-Skandal gehört?«, fragte Mrs O’Malley.
Christine schüttelte den Kopf. »Nicht, dass ich wüsste.«
»Na ja, war wohl auch mehr eine interne Sache, wie man mir sagte. Auf jeden Fall hat unser guter Mr Anderson ...«
»Huhuu«, meldete sich von links eine Frauenstimme.
Mrs O’Malley hörte auf zu reden und drehte sich um. »Oh, guten Morgen, Dorothy«, rief sie einer Frau mittleren Alters zu, die ihr aufgeregt winkte. An Christine gewandt sagte sie: »Kennen Sie Dorothy schon? Dorothy Green vom Zeitschriftenladen?« Christine nickte. »Ja, ich war vor ein paar Tagen bei ihr, um ein Magazin zu kaufen.«
»Ach, da fällt mir ein, ich muss sowieso noch zu ihr, meine Rubbellose einlösen. Stellen Sie sich vor, ich habe mit einem davon zwanzig Pfund gewonnen, und dazu noch ein bisschen Kleinkram bei den anderen. Sie wissen schon, die üblichen fünfzig Pence, damit der Lospreis nicht ganz so sehr schmerzt.«
»Zwanzig Pfund? Meinen Glückwunsch.«
»Danke, hören Sie, die Sache mit Mr Anderson erzähle ich Ihnen bei Gelegenheit, einverstanden? Das ist eine längere Geschichte.«
»Gern, Mrs O’Malley. Ich wollte sowieso noch ein paar Dinge erledigen und dann wieder nach Hause.«
Während Mrs O’Malley sich nach links wandte, betrat Christine die Metzgerei gleich neben dem Postamt. An der Theke wartete bereits ein Kunde, aber es war niemand, den sie hier schon gesehen hatte. Der Mann war Anfang sechzig, und dem wettergegerbten Gesicht, den schwieligen Händen und der robusten Kleidung nach zu urteilen, war er vermutlich Landwirt. Abgesehen davon stand draußen auf dem Parkplatz ein Traktor.
»Komme gleich!«, rief der Metzger aus einem rückwärtigen Raum, als das Glockenspiel erklang, das beim Öffnen der Ladentür ausgelöst worden war. Es erinnerte vage an die Melodie von Big Ben, leierte aber wie eine von diesen Glückwunschkarten, bei denen die Batterie allmählich den Geist aufgab.
Christine betrachtete die spärliche Auslage, die aus ein paar Stücken Fleisch und einer Handvoll Aufschnitt sowie ein paar salamiähnlichen Würstchen bestand. Es tat gut, einmal einen Metzger zu sehen, der sich an der Nachfrage zu orientieren schien, anstatt ratlos vor den zwanzig Meter langen, mit Fleisch vollgepackten Regalreihen der großen Supermärkte zu stehen. Sie mochte den Gedanken nicht, dass das meiste davon ein paar Tage später weggeworfen werden musste. Außerdem war sie ohnehin nicht der Typ, dem beim Gedanken an ein Stück Braten das Wasser im Mund zusammenlief.
Der Mann, der vor ihr an der Reihe war, sah das wohl anders, denn als der Metzger schließlich nach vorn ins Geschäft kam, trug er auf einem großen Metalltablett mindestens dreißig Koteletts. »Ist’s so recht?«, fragte er den Kunden.
Der sah über die Thekenkante auf das Tablett und nickte zufrieden. »Das sollte reichen.«
Während er die Koteletts in mehrere Plastiktüten verpackte, sah der Metzger zu Christine. Er entsprach so gar nicht dem Klischee von einem Metzger. Er war kein dicker Mann mit Schweinsgesicht und Wurstfingern, sondern schmal und groß und wirkte fast schon ein wenig unterernährt. Die Wangen waren leicht eingefallen, was ihn älter erscheinen ließ, obwohl Christine ihn auf Mitte dreißig schätzte. Er trug eine weiße Kappe, dazu eine mit frischen Blutspritzern und Flecken übersäte weiße Schürze, die keinen Zweifel daran ließen, womit er in den letzten Minuten beschäftigt gewesen war. Aber darüber wollte sie lieber nicht nachdenken.
»Ach, Sie sind die Neue, stimmt’s?«, sagte er.
Christine nickte. »Christine Bell.«
»Angenehm, Stuart Beavisham.« Er lächelte sie freundlich an. »Und was darf ’s sein? Ein schöner Sonntagsbraten?«
»Nein, ich wollte nur ...«
»Dann bestimmt ein Steak, das Sie nur kurz anbraten, damit es innen noch so richtig schön blutig ist?«, warf der andere Kunde ein.
»Nein, ganz bestimmt nicht.« Sie wurde langsam ungeduldig. »Mag ja sein, dass Ihnen das schmeckt, aber für mich ist das nichts.«
»Brian, lass meine Kundschaft in Ruhe«, brummte der Metzger. »Ich hab dir schon hundertmal gesagt, dass die Leute deine Vorschläge nicht hören wollen.«
Der Mann namens Brian reagierte verschnupft. »Pah. Ich hab schon genug deiner Kunden auf Ideen gebracht, auf die sie von selbst nicht gekommen wären.«
»Und du hast mir noch mehr Kunden vergrault, weil du ihnen unbedingt haarklein schildern musstest, wie man ein Schwein schlachtet!«
»Ach, Blödsinn. Das sind doch alles Weicheier. Ein Schwein schlachtet man ganz einfach, indem ...«
Plötzlich schlug der Metzger mit solcher Wucht auf die Theke, dass Christine einen Moment lang glaubte, die Glasplatte würde zerspringen. »Okay, Brian. Wenn du vor meinen Kunden noch ein Wort zu dem Thema sagst, dann werde ich ab Montag auf Gregorys Angebot eingehen und die Schweine bei ihm kaufen.«
»Gregory verlangt sieben Pfund mehr als ich.« – »Mag sein«, konterte der Metzger. »Aber wenn du mir die Kunden verscheuchst, entgeht mir ein Umsatz von mehreren Hundert Pfund, und ich glaube, du kannst dir selbst ausrechnen, wie schnell es sich für mich lohnt, Gregory den höheren Preis zu zahlen.«
Brian schnaubte und murmelte etwas Unverständliches, hielt aber immerhin den Mund.
Wieder wandte sich Stuart Beavisham an Christine. »Also, was darf es sein?«
»Ich hätte gern hundert Gramm Tartar.«
»Am besten noch nach Hause geliefert«, brummte der Mann neben ihr.
»Brian!«
«Schon gut, schon gut.«
»Möchten Sie das Fleisch gleich zum Burger gepresst haben?« Christine stutzte, da sie eine solche Frage noch nie gehört hatte. «Äh, nein. Es ist für meine Katze.«
Brian begann lauthals zu lachen. »O Mann, zu meiner Zeit haben sich Katzen noch mit einer Schale Milch und den Essensresten zufriedengegeben, wenn sie nicht gerade auf Mäusejagd waren.«
»Ja, ja, Brian«, gab der Metzger zurück. »Zu deiner Zeit haben die Leute auch noch geglaubt, die Erde sei eine Scheibe.« Dann legte er mehrere Plastikbeutel mit Koteletts auf die Theke, kassierte bei Brian und wandte sich gleich wieder an Christine. »Darf ’s für Sie selbst denn auch noch was sein?«
»Nein, nein, danke. Ich esse selten Fleisch, und ich hatte erst gestern Chili con Carne, das reicht für die nächsten zwei Wochen.« Sie zuckte entschuldigend mit den Schultern. »Tut mir leid, aber ich werde wohl kein so guter Kunde wie der freundliche Herr vor mir.«
»Elende Grasfresser«, zischte der im Rausgehen.
Christine sah ihm kopfschüttelnd nach, wie er mit seinen
Tüten voller Koteletts zu seinem Traktor ging.
»Machen Sie sich nichts draus«, sagte der Metzger zu ihr und drehte ein Stück Rinderfilet durch den Fleischwolf. »Soll ich Ihnen ein Geheimnis verraten? Seit ich den Job hier mache, bin ich strikter Vegetarier geworden. Ich kriege keinen Bissen Fleisch mehr runter.«
Sie lächelte ihn an. »Sie sind der erste Metzger, der mir richtig sympathisch ist. Aber wenn Ihre Kunden auch so denken würden, dann hätten Sie nichts mehr zu tun.«
»Dann würde ich eben vegetarische Würstchen verkaufen«, meinte er mit einem Schulterzucken. »Aber ich sag Ihnen was: Die meisten wären Vegetarier, wenn sie das Schwein für ihren Sonntagsbraten selbst schlachten müssten.«
»Ja, da dürften Sie recht haben.« Sie bezahlte, wünschte dem Mann ein schönes Wochenende und ging zum Supermarkt.
Eine halbe Stunde später hatte Christine alle Besorgungen gemacht und fuhr zurück zu ihrem Haus. Zum Glück war sie im Supermarkt und im Haushaltswarengeschäft gleich nebenan nicht noch mehr schrägen Typen wie Mr Anderson und diesem Brian begegnet, sonst hätte sie sich wirklich langsam Gedanken gemacht, ob hier irgendetwas im Trinkwasser war. Mr Flurby war nicht im Supermarkt, stattdessen saß eine jüngere Frau an der Kasse, vielleicht Mrs Flurby, vielleicht auch eine Tochter, womöglich sogar eine Aushilfe aus einem benachbarten Dörfchen. Auf jeden Fall sprach sie Christine nicht auf den Sack Katzenstreu und die zwei Kartons mit Katzenfutter an, was ihr sehr recht war und angenehme Erinnerungen an London weckte. Sie war erst ein paar Tage von zu Hause weg, aber schon vermisste sie so gut wie alles – ausgenommen den Lärm und die vielen Störungen, die es ihr unmöglich machten, konzentriert an ihrem Buch zu arbeiten. Was ihr besonders fehlte, war, selbst darüber zu bestimmen, wie anonym sie leben wollte. Wenn ihr in der Großstadt der Service in dem einen Geschäft nicht zusagte, konnte sie einfach kommentarlos zur Konkurrenz gehen. Hier in Wrightford-on-Stratton dagegen hatte sie das Gefühl, sie würde sich bei der Dorfgemeinschaft sehr schnell unbeliebt machen, wenn sie nicht Rechenschaft über ihre persönlichen Angelegenheiten ablegte.
So war es ihr zum Beispiel gegangen, als sie im Haushaltswarenladen eine Katzentoilette kaufte.
»Ich wusste gar nicht, dass Sie eine Katze haben«, sagte die Inhaberin, Mrs Catherall, nachdem Christine ihren Wunsch geäußert hatte.
Christine musste sich verkneifen, Mrs Catherall darauf hinzuweisen, dass es noch viel mehr gab, was die nicht über sie wusste. »Tja, da sehen Sie mal«, gab sie stattdessen lächelnd zurück und legte zwei Zehner auf die Theke.
Mrs Catherall stand einige Sekunden lang da und sah sie an, da sie offensichtlich auf eine ausführliche Erklärung wartete, was es mit dieser Katze auf sich hatte. Dann erst begriff sie, dass Christine nichts weiter zu dem Thema sagen würde, tippte den Betrag ein und gab das Wechselgeld heraus.
»Ich glaube, beim nächsten Buch quartiere ich mich in einem Luxushotel ein«, sagte Christine zu sich selbst, als sie den Wagen auf dem Grundstück abstellte. »Da werde ich wirklich von allen in Ruhe gelassen.«
Sie warf einen Blick in den Briefkasten, aber es gab keinen Hinweis darauf, dass Heddingfield versucht hatte, in der Zwischenzeit mit ihr Kontakt aufzunehmen. Vielleicht war er dagewesen, aber einen Zettel hatte er nicht hinterlassen. Sie ging ins Haus und wurde von Isabelle freudig begrüßt. Sie machte noch einen etwas verschlafenen Eindruck, schmiegte sich aber sofort an Christines Beine.
»Wenigstens stellst du keine neugierigen Fragen«, lobte sie die Katze. »Leider gibst du im Gegenzug auch keine Antworten.«
Kapitel 5
Am Sonntagmorgen wurde Christine nicht von einer hungrigen Katze geweckt, wie sie es eigentlich erwartet hätte, sondern von Stimmengewirr ganz aus der Nähe. Sie blinzelte in das Licht, das zum Fenster hereinfiel, und versuchte, die Digitalanzeige auf dem Radiowecker zu entziffern. Erst als sie ihre Hand danebenhielt, um die Sonnenstrahlen abzuschirmen, sah sie, dass es halb neun war.